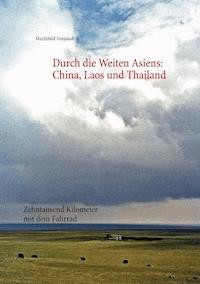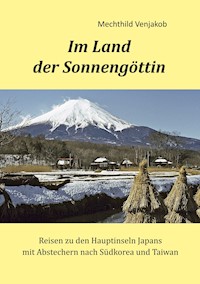
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Von Tokio aus machte sich Mechthild Venjakob auf die Suche nach dem alten Japan. Sie entdeckte Tempel, Schreine, Burgen, Paläste und historische Orte und hinter der glitzernden Fassade der Moderne alte Traditionen, die heute noch lebendig sind. Ein Abstecher führte sie nach Südkorea und Taiwan. Sie beschreibt die Kultur- und Naturschätze der Länder und sie erzählt von der Gastfreundschaft der Menschen, die in Japan besonders ausgeprägt war.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 295
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Autorin
Mechthild Venjakob, 1943 in Paderborn geboren, war fünfzehn Jahre als Lehrerin im Schuldienst tätig. Als Auslandsschullehrerin verbrachte sie zwei Jahre in Quito, der Hauptstadt Ecuadors. Dort düste sie in den Ferien mit ihrem VW-Käfer durch die Anden Südamerikas, durch Peru, Bolivien, Chile, Argentinien und Kolumbien. Sie kehrte nach Deutschland zurück, unterrichtete noch fünf Jahre im Ruhrgebiet, kündigte den Schuldienst 1981 und löste ihre Wohnung auf, um sich die nächsten zwanzig Jahre dem Reisen zu widmen.
Sie nahm Züge und Busse, wanderte im Himalaja und in den Rockies und machte große Fahrradtouren durch Indien, Laos, Pakistan, Japan, China, durch Europa und durch die USA. Hilfsarbeiten in Australien, Neuseeland, Alaska, Colorado und England halfen ihr in den ersten zehn Jahren ihres Reiselebens über die Runden. Dann unterrichtete sie Deutsch als Fremdsprache an Instituten in Bremen, Hongkong und in Südkorea.
Im Jahr 2000 kehrte sie über Land von Laos nach Deutschland zurück, davon 12700 Kilometer mit dem Fahrrad. Sie ließ sich in ihrem Geburtsort Paderborn nieder, um über ihr Leben nachzudenken, das fantastischer war als ein Traum, den manch einer träumt.
Inhaltsverzeichnis
J
APAN
Vorwort
Auf Honshu, der größten Insel Japans
Tokio, die Metropole
Kamakura, die Stadt der Schreine und Tempel am Meer
Im Hakone-Nationalpark und am Fuji-san
Nagoya und der Ise-Shima-Nationalpark
Im Süden der Halbinsel Kii und in der alten Kaiserstadt Nara
Kyoto – Regierungssitz für mehr als tausend Jahre
In West-Honshu:
Matsue, Hagi, Hiroshima und die Schreininsel Miyajima
Fahrradfahren auf den Inseln Kyushu und Shikoku
Auf Kyushu: Nagasaki und Kumamoto
Beginn der Radtour:
Über Kagoshima im Süden nach Beppu an der Ostküste
Auf der Insel Shikoku:
Über Kochi im Süden nach Takamatsu im Norden
Fahrradfahren auf Honshu:Von der Inlandsee zum Japanischen Meer und in den Norden
Von Kurashiki über Okayama und Himeji nach Kyoto
Über Hikone und Eiheiji zur Halbinsel Noto
Abstecher in die Berge nach Takayama
Der heilige Berg Haguro-san, Kraterseen und Hirosaki
Mit dem Fahrrad auf Hokkaido
Vom Shikotsu-Toya-Nationalpark über Sapporo in den Norden
Die Halbinsel Shiretoko, im Aksan-Nationalpark, am Kap Erino
Zurück auf Honshu: Mit dem Fahrrad bis Nagano
Zum Bandai-Asahi-Nationalpark
Im Nikko-Nationalpark
Über Nagano ins Kiso-Tal, das Ende einer großen Radtour
ABSTECHER NACH SÜDKOREA
In Gyeongju, Hauptstadt der Silla-Könige
Zum Seoraksan-Nationalpark und nach Seoul
Von Gongju, Regierungssitz des Baekche-Reichs, zum Kapsa- und zum Beopjusa-Tempel
Die Insel Jeju
ABSTECHER NACH TAIWAN
Mit der Fähre von Kyushu über Okinawa nach Taiwan
Taipeh, die Hauptstadt
In der Taroko-Schlucht und in den Bergen
Nachwort
ANHANG
Die Fahrradtour durch Japan im Überblick
Literaturhinweise
Dank
Weitere Bücher
Vorwort
Ein riesiges Feuerwerk erhellte am 13. Februar 1983 den Nachthimmel über Hongkong. Die Chinesen feierten ihr Neujahrsfest. Das Jahr des Schweins war angebrochen. Von drei Booten im dunklen Hafen schossen Feuerwerkskörper zum Firmament auf, zischten, pfiffen, knatterten und zerplatzten zu Tausenden von Sternchen, die in alle Richtungen zerstoben, sich zu riesigen Bällen aufplusterten und, einem Goldregen gleich, ins Hafenbecken rieselten. Fontänen, Springbrunnen und Wasserfälle aus Licht, bunte Pfeile, Kometen und Rosetten blitzten für Momente auf, um lautlos zu erlöschen. Die Ah- und Oh-Rufe der circa fünf Millionen Zuschauer brausten auf und verebbten wieder. Und ich dazwischen! Ich erlebte das prächtigste Feuerwerk meines Lebens. Ich war entzückt und staunte wie ein kleines Kind.
Vor fast genau zwei Jahren war ich von Deutschland nach Indien geflogen und über Land immer weiter nach Osten gereist. Jetzt hatte ich den östlichsten Punkt meiner Tour und eines der teuersten Länder der Welt erreicht. Das Neujahrsfest war der Auftakt für meinen Japanbesuch. Drei Tage später flog ich nach Tokio. Ich wollte das alte Japan erkunden, Nippon, das Ursprungsland der Sonne.
JAPAN
Die Hauptinseln Japans: die große Insel Honshu, Kyushu im Südwesten, Shikoku im Süden und Hokkaido im Norden.
JAPAN
Auf Honshu, der größten Insel Japans
Tokio, die Metropole
Die Maschine schwebt über Honshu. Der schneebedeckte Fuji-san kommt in Sicht. Mit seiner gleichmäßigen Kegelform ragt er in makelloser Schönheit aus der Ebene auf. Abgesteckte Felder in Braun- und Grüntönen fügen sich zu einem Karree-Muster, aufgelockert durch Siedlungen und Waldstücke. Eine flache Insel erstreckt sich im graublauen Meer.
Das Flugzeug landet auf dem Narita Airport, sechzig Kilometer von Tokio entfernt. Ich rufe zwei Jugendherbergen an, um nach einem Platz für die Nacht zu fragen, beide sind belegt. An einem Informationsstand auf dem Flughafen empfiehlt mir eine Angestellte das „Yoshida House". Sie überreicht mir eine genaue Beschreibung des Weges. Mit dem Bus fahre ich nach Narita, von dort aus mit dem Zug nach Tokio. An der Nippori-Station steige ich um. Mit dem Yamanote-Zug fahre ich nach Ikebukuro und weiter mit der U-Bahn zur Oizuma-Gakuen-Station, die in der Nähe des Yoshida-Hostels liegt. Eine Viertelstunde laufe ich und bin nach insgesamt dreieinhalb Stunden seit meiner Ankunft endlich am Ziel.
Der Stadtteil, in dem ich wohne, wirkt mit seinen schmalen Straßen, engen Gassen und niedrigen, schmucken Gebäuden kleinstädtisch. Einladende Shops und Restaurants liegen zwischen den Privathäuschen. Mein Hostel ist ein typisches japanisches Holzhaus mit Schiebetüren, Schiebefenstern und lichtdurchlässigen Papierwänden. Die Straßenschuhe zieht man aus und schlüpft in Puschen, die in Paaren eine lange Reihe vor dem Eingang bilden. Für Toilette und Küche stehen extra Schlappen bereit.
Die Zimmer sind mit ein Meter achtzig mal neunzig Zentimeter großen Tatami, Rollmatten aus Reisstroh, ausgelegt, dem traditionellen Bodenbelag in Japan. Die Größe eines Raums richtet sich nach ihrer Anzahl. So ist mein Zimmer sechs Tatami groß. Zum Schlafen breite ich eine Matratze auf dem Boden aus, die tagsüber zusammengerollt im Wandschrank verstaut wird. – Traditionelle Häuser sind sparsam eingerichtet, Schiebetüren und Fenster asymmetrisch angelegt. Es entstehen Räume großer Harmonie, die auf einer rhythmischen Linienführung beruht. Die mit dunklem Band eingefassten Strohmatten leuchten hell und durch die mit Papier bespannten Fenster dringt gedämpftes Licht. Oft gibt es in den kahlen Räumen eine Nische mit Blumen in einer Vase, einer Keramik oder einem Rollbild an der Wand. Ansonsten sind die Zimmer leer bis auf ein Tischchen mit Sitzkissen auf dem Boden. Die Japaner sind Meister in der Kunst der Beschränkung. Das Augenmerk des Betrachters wird auf das Wesentliche gelenkt. Die Schlichtheit der Ausstattung ist ansprechend und schön. Beim Betreten des Hostels fühle ich mich sofort wohl.
Dieses gemütliche Haus hat einen Nachteil: Hier drängen sich zu viele Gäste. In der winzigen Küche möchte sich jeder sein Mahl selbst zubereiten, weil das Essen im Restaurant sehr teuer ist. Ich habe im Supermarkt um die Ecke Vorräte eingekauft und warte, dass eine Kochplatte frei wird. Im kleinen Fernsehraum sitzen wir auf Tatami oder auf Sitzkissen.
Einige Gäste, die länger im Yoshida-Haus wohnen, unterrichten Englisch in Schulen und an Fremdspracheninstituten. Viele der jungen Ausländerinnen aus Amerika, Kanada und Deutschland, ebenfalls Gäste des Hauses, arbeiten als Hostess in einer Bar oder in einer Kneipe. Sie tauschen untereinander Klamotten aus, schminken sich, lackieren ihre Fingernägel, putzen sich heraus und stöckeln los, um japanische Geschäftsleute zu unterhalten, die sich vom Stress eines arbeitsreichen Tages erholen und ihren Drink in weiblicher Gesellschaft nehmen wollen. Es bestehe keine Pflicht, sich zu prostituieren, versichert mir Elke, eine Deutsche, die sich gerade zurechtmacht: „Wir unterhalten uns auf Englisch. Auf Dauer sind diese Abende sterbenslangweilig. Immer dasselbe! Die gleichen geschniegelten Typen und fade Gespräche!" Nur bei gegenseitiger Sympathie verlängere manche Hostess die Nacht und gehe mit dem Mann ins Bett.
Am Morgen wage ich kaum, meine Nase aus dem Bett in die Kälte zu stecken. Der Fernsehraum und die Küche des Hauses sind beheizt, die Schlafzimmer nicht. Unter der Platte des niedrigen Tischchens in meinem Zimmer befindet sich eine Heizspirale. Rund um den Tisch hängt eine dicke Decke, damit die Wärme darunter bleibt und nicht in den Raum aufsteigt. Meine kalten Füße kann ich aufwärmen, mehr nicht.
Zum ersten Mal in diesem Jahr hat es in Tokio geschneit. Schnee ist ungewöhnlich in diesen Breiten. Wir freuen uns alle und gucken aus dem Fenster auf die herabtorkelnden Schneeflocken, die auf den Pflanzen und Bäumchen im Vorgarten des Yoshida-Hauses, auf Dächern, Gehsteigen und Straßen liegen bleiben.
Nach einem ausgedehnten Frühstück mache mich auf den Weg in den Stadtteil Shinjuku, Zentrum der Wolkenkratzer. Das 1974 errichtete, zweihundertzehn Meter hohe Sumitomo-Gebäude dort besteht aus zweiundfünfzig Stockwerken. Mit dem zurzeit schnellsten Aufzug der Welt fahre ich in den 51. Stock. Fünfhundertvierzig Meter legt der Lift pro Minute zurück, zweiunddreißig Kilometer und vierhundert Meter in der Stunde. In weniger als einer halben Minute bin ich oben. Ich steige aus und gucke durch die Panoramascheiben in wabernde Wolkenschwaden, die den Turm einhüllen. Bei klarem Wetter sind der Fuji und die Meeresbucht von Tokio zu sehen. Heute nicht! Ich laufe an exklusiven Restaurants und Läden vorbei. Bei schönem Wetter würde ich mir eine Tasse Kaffee gönnen und die Aussicht über die Stadt genießen. Heute lohnt es sich nicht. Ich gehe zurück zum Aufzug und rase ins Erdgeschoss zurück.
In der Nähe des Bahnhofs zieht sich die Reeperbahn Tokios hin. Pachinko-Spielhöllen, Karaoke- und Nachtbars, Restaurants und Love-Hotels säumen die Straßen. Hier wird die Nacht zum Tag. Auch tagsüber sitzen die Spieler vor den sich aneinanderreihenden Pachinko-Automaten und das Klicken der in die Schächte fallenden Metallkugeln erfüllt die Hallen. Die zumeist jugendlichen Besucher drücken hektisch Hebel und Knöpfe. Die Automaten glitzern und blinken. Quietschen, Jaulen, Rauschen und schrille Popmusik vereinigen sich zu einer undefinierbaren, gewaltigen Geräuschkulisse. Wie hypnotisiert sitzen die Spielratten in einer Hölle greller Farben und ohrenbetäubenden Lärms.
Der Himmel ist grau, der in Regen übergegangene Schnee tropft von den Zweigen der Bäume. Schuhe und Socken sind nass geworden, ich fahre zurück zum Yoshida-Haus.
Strahlender Sonnenschein durchflutet am nächsten Morgen die Straßen der Stadt, ein guter Tag, um dem Kaiserpalast einen Besuch abzustatten. Auf gemauertem Sockel erhebt sich die weiß getünchte Burg von Edo mit mehreren geschwungenen Dächern hinter einem Wassergraben. Hier wohnt die kaiserliche Familie. Zweimal im Jahr zeigt sie sich dem Volk, am 2. Januar und am Geburtstag des Kaisers. Brücken, Mauern und Pinien spiegeln sich im Wasser. Viele Japaner posieren vor dem Wallgraben und fotografieren sich gegenseitig mit Leidenschaft, die Burg im Hintergrund. – Von 1603 bis 1868 regierten die Shogune, die Befehlshaber der Samurai, das Land. Sie waren mächtiger als der Kaiser geworden und hatten ihren Sitz in Edo, dem heutigen Tokio. Edo entwickelte sich zu einer der größten Städte der Welt. 1868 entmachtete der Meiji-Tenno den damals herrschenden Shogun. Der Hof zog von Kyoto, der alten Kaiserstadt, nach Tokio. Die Meiji-Zeit dauerte von 1868 bis 1912.
Ich komme mit John, einem Engländer, ins Gespräch. Gemeinsam schlendern wir zu den östlichen Gärten. Wir durchschreiten ein steinernes Tor, passieren ein Wachhaus und wandern durch den Park zum Ginza-Bezirk, einem vornehmen Geschäftsviertel. Große Warenhäuser, elegante Boutiquen, Juweliergeschäfte, Kunsthandwerksläden und teure Restaurants reihen sich aneinander. Dazwischen hat sich McDonald's angesiedelt. Trotz des frostigen Wetters stehen Tische und Stühle auf dem Gehsteig. Hungrig geworden, holen wir uns einen Hamburger und essen ihn draußen in der Kälte. Wir gehen ins Mitsukoshi-Warenhaus um die Ecke, um uns aufzuwärmen. Die Auslagen des Konsumpalastes glänzen. In einem der zwölf Geschosse befindet sich eine Kimonoabteilung neben der Abteilung für Damen- und Herrenmode. Schuhe, Taschen, Porzellan, Lackschalen und Lackkästchen, Kunstdrucke, Kalligrafie, Haushaltsgeräte, fast alles, was das Herz begehrt, ist hier erhältlich.
Im unteren Geschoss folgt ein Delikatessenstand auf den anderen. Alle Käsesorten, die man sich vorstellen kann, werden angeboten, Käse aus Holland, Frankreich und der Schweiz. Es gibt Pasteten, Schinken und Salami. In den Auslagen der kleinen Restaurants sind Plastikmodelle jeder Speise, versehen mit Preisschildern, ausgestellt, Suppen, Sushi, Reis- und Nudelgerichte, gegrillte Hähnchenspieße, Tofu in Sojasoße, Pilze als Beilage, Konfekt. Die Gerichte sehen lecker aus. Uns läuft das Wasser im Mund zusammen. Es fällt uns schwer, all den Versuchungen zu widerstehen. In der Getränkeabteilung gibt es Sake, den traditionellen Reiswein, französische, italienische, australische und deutsche Weine. Neben dem japanischen Suntory Whisky stehen schottische, irische und amerikanische Whiskys und verschiedene Cognac- und Rumsorten.
Zum Zeitpunkt meines Besuchs hat Tokio zwölf Millionen Einwohner, doppelt so viele wie Hongkong. Trotzdem kommen mir die Straßen nicht so überfüllt vor wie die in Hongkong. Die Hälfte der Bevölkerung befindet sich vielleicht immer gerade im verzweigten Eisenbahn- und U-Bahnnetz. Die nächtliche Beleuchtung ist dezenter als die in Hongkong, aber trotzdem effektvoll.
Tokio bei Nacht, Zentralhonshu, Japan
In der Nähe des Harajuku-Bahnhofs liegt das Stadion, das für die Olympischen Spiele 1964 gebaut wurde, ein Betonklotz mit riesigem, geschwungenem Metalldach. Die Straße davor ist heute, am Sonntag, voll mit Jugendlichen. Sie haben ihre Rekorder und Lautsprecher aufgebaut, drehen die Musik auf und tanzen dazu. Sie stecken in glänzenden, schwarzen Jacken, haben sich als Mangafiguren und Punkmusiker verkleidet und wirken sanft und friedfertig. Die Mädchen tragen gleich Blumenkindern Schleifen im Haar und bunte Gewänder. Mit vielen Einheimischen und Ausländern gucke ich dem Spektakel zu. Die Geschäfte und Boutiquen des Harajuku-Bezirks sind auf die Bedürfnisse der Teenager eingestellt. Hier kaufen die jungen Leute ein, hier treffen sie sich in Cafés, Restaurants, Spielhallen und Karaoke-Bars. Die Fassaden der Hochhäuser sind bedeckt mit Neonreklame und riesigen Bildschirmen.
Ich entdecke John unter den Zuschauern und gehe zu ihm hinüber. Wir kommen mit einem Engländer ins Gespräch, der zurzeit als Model in Tokio arbeitet und uns in sein Appartement zu einer Tasse Kaffee einlädt. Seine Wohnung ist vierzig Quadratmeter groß und kostet vierhundertfünfzig Euro Miete im Monat, damals ein horrender Preis.
Über einen von Zedern gesäumten Kiesweg erreichen wir den Meiji-Schrein. Ein rot lackiertes Torii aus Holz grenzt den profanen von dem heiligen Bereich ab. Toriis, große, frei stehende, mit zwei Querbalken versehene Tore aus Holz, Stein oder Beton, sind die Kennzeichen eines Shinto-Schreins. Der obere, leicht geschwungene Balken ragt über die Pfosten hinaus und bildet das Dach. Am unteren Balken befinden sich oft Schriftzeichen.
Der Meiji-Schrein brannte während des Krieges 1945 ab, er wurde 1958 wieder aufgebaut. Der schlichte, ebenmäßige Bau aus edlem Holz trägt ein geschwungenes Kupferdach. Er ist Kaiser Meiji (1852 – 1912) und seiner Frau, Kaiserin Shoken (1849 – 1914), geweiht. Kaiser Meiji modernisierte Japan. Er empfing europäische Gesandte, führte öffentliche Schulen ein und schaffte das Feudalsystem ab. Seine Frau, die „Mutter der Nation", setzte sich für die Ausbildung von Frauen ein. Sie engagierte sich auf sozialem Gebiet und rief eine Stiftung für das Internationale Rote Kreuz ins Leben. Wohlstand und Frieden herrschten während der Regierungszeit dieses Kaiserpaars. Millionen Japaner besuchen über Neujahr den Meiji-Schrein, um ihre Seelen anzubeten und Glück und Heil für das zukünftige Jahr zu erbitten.
Der Ueno-Park zieht sich mit Grünanlagen, Museen, Shinto-Schreinen, einem riesigen See und einem zoologischen Garten durch den Norden Tokios. Hier fand im 19. Jahrhundert die letzte große Schlacht zwischen den kaiserlichen Truppen und den Samurai statt. Nach seinem Sieg ließ Kaiser Meiji den Park anlegen. Während seiner Regierung entstanden das Nationalmuseum und der Zoo. Andere Museen kamen im Laufe der Zeit dazu. Der Ueno-Park bietet Natur und Kultur gleichermaßen. Jedes Jahr, wenn die Kirschbäume blühen, strömen Tausende von Besuchern in den Park, um zu picknicken und das Kirschblütenfest zu feiern.
Ich schlendere zum Toshugu-Schrein im Park. Er ist dem Gründer des Tokugawa-Shogunats, Tokugawa Ieyasu (1543 – 1616), gewidmet. Tokugawa Ieyasu hatte alle anderen Generäle besiegt und ließ sich in Edo nieder. 1603 wurde er vom Kaiser zum Shogun ernannt. Der mit vergoldeten Türen versehene Schrein überstand den Zweiten Weltkrieg, ein rares Überbleibsel aus der Edo-Zeit. Mehrere Reihen hoher Bronzelaternen auf verzierten Sockeln säumen den Weg, der zu ihm hinführt.
Durch Gassen, von denen es in Tokio viele gibt, laufe ich weiter zum Stadtteil Asakusa, um den buddhistischen Senso-ji-Tempel zu besuchen. Eine überdachte, von Souvenirshops gesäumte Straße mit dem Namen Nakamise führt zum Eingangstor. Angeboten werden Kimonos mit passenden Schärpen, geschnitzte Haarkämme aus Teakholz, mit Blumendekor verzierte Haarnadeln, bemalte Fächer, Puppen, Lackteller, Lackschalen, Essstäbchen, Silberschmuck und viele andere erlesene Dinge. Das Kunsthandwerk hat in Japan Tradition. Sogar die Souvenirs sind geschmackvoll gestaltet. Ich sehe selten Kitsch.
Ein riesiger, roter Papierlampion hängt im Eingangstor des Senso-ji-Tempels. Der schwarze Schriftzug, der sich über die Laterne zieht, bedeutet „Donnertor". Links und rechts des Durchgangs bewachen mannshohe, sitzende Figuren, der Donner- und der Windgott, das Tempelgelände. Dahinter liegt die Haupthalle. In einem überdachten Rauchbecken davor stecken brennende Räucherstäbchen. Eine Duftwolke durchzieht die Luft. Die japanischen Besucher fächeln sich den Qualm zu, denn er soll gesund sein und beruhigend wirken.
Ich gehe weiter zum Haupttempel. Er ist Kannon, der japanischen Gottheit der Barmherzigkeit und Gnade geweiht. Der Legende nach fanden zwei Fischer im Jahr 628 eine goldene Kannon-Statue in ihrem Netz. Zur Erinnerung daran erbaute der Priester Shokai 645 die Gebäude. Der Senso-ji-Tempel ist einer der ältesten und heiligsten Tempel in Japan. Er wurde mehrere Male wiederaufgebaut.
Am nächsten Tag besuche ich das Freilichtmuseum Nihon Minka-en in Kawasaki. Im Gelände stehen traditionelle Bauernhäuser aus der Edo-Zeit, solide, mit Schilfrohr gedeckte Holzhäuser. Die Besucher dürfen hineingehen, um sich umzugucken. Ich ziehe mir die Schuhe aus, betrete durch Schiebetüren die Häuser und laufe durch die Räume. Einige sind mit Lehmböden ausgestattet, andere mit Tatami oder glänzenden Holzplanken ausgelegt. In einem ist eine viereckige Feuerstelle in der Mitte des Raums im Holzboden versenkt. Kessel und Töpfe hängen an Haken darüber. An einer Mühle im Park dreht sich ein Wasserrad. Viele der Häuser sind als Kulturgut Japans gekennzeichnet. – Die meiste Zeit des Tages sitze ich im Zug oder in der U-Bahn, vor allen Dingen deshalb, weil ich auf dem Hinweg nach Kawasaki nicht die kürzeste Strecke herausgefunden habe.
Seit Jahrzehnten gehört die Elektronik- und Unterhaltungsindustrie Japans zur Weltspitze. Exportiert werden Kameras, Computer, Videospiele, Spielkonsolen, Fernsehgeräte, Stereoanlagen, Telefone, Videoprojektoren, Roboter und vieles mehr. Autos, Motorräder und Fahrzeugteile werden in alle Welt verkauft.
Die Holzfassaden der Häuser gehören vergangenen Zeiten an, erst recht die aus Schilfrohr gefertigten Dächer. Nur selten sehe ich Frauen im Kimono. Die technisierte Welt überlagert das Brauchtum, das unter der glitzernden Oberfläche der Moderne verborgen liegt. Hinter Plastikfassaden und unter Wellblechdächern sitzt und schläft das japanische Volk weiter auf Tatami. Nur wenige Japaner haben Wohneinrichtungen aus dem Westen, Betten, Stühle, Sessel und Sofas, übernommen. Ich setze mich in den Zug und verlasse Tokio, um mich in kleinen Orten und auf dem Land umzugucken. Mittags bin ich in Kamakura, der Stadt der Schreine und Tempel. In der Jugendherberge am Pazifik finde ich Unterkunft.
Bronzelaternen vor dem Toshugu-Schrein, Tokio, Zentralhonshu, Japan
Votivtafeln im Hashiman-gu-Schrein in Kamakura, Zentralhonshu, Japan
Daibutsu, der Große Buddha, Kamakura, Zentralhonshu, Japan
Kamakura, die Stadt der Schreine und Tempel am Meer
Die Zeit von 1185 – 1333 ist als Kamakura-Epoche in die Geschichte Nippons eingegangen. Zwölf Jahre hatte Krieg zwischen dem Taira- und dem Minamoto-Clan geherrscht, bis Letzterer siegte. Er errichtete seinen Regierungssitz in Kamakura. Kyoto, die alte Kaiserresidenz, blieb offiziell weiterhin Hauptstadt. Der Hofadel dort verarmte, während die Shogune ihren Reichtum vermehrten.
In diese Zeit fallen die Feldzüge der Mongolen, die unter Dschingis Khan begannen und von seinen Söhnen und Enkeln fortgesetzt wurden. Kubilay Khan, ein Enkel Dschingis Khans, von 1271 – 1291 Kaiser von China, herrschte zum Zeitpunkt seines Todes über das größte Territorium, das es jemals in der Weltgeschichte gegeben hatte. Japan zu bezwingen, gelang ihm nicht. Zweimal versuchte er es und beide Male scheiterte er, denn Stürme kamen auf und zwangen ihn zur Umkehr. Die Götter hatten die Winde geschickt, um Nippon zu schützen. Das glauben die Japaner.
Kamakura ist ein Mekka der Kultur. In der Schriftsteller- und Künstlerstadt gibt es neunzehn Shinto-Schreine und fünfundsechzig buddhistische Tempel. Das Kunstgewerbe blüht. In den Läden werden Holzschnitzereien, lackierte Gefäße, Boxen und Teller, Keramik, Wandschirme, Fächer, bemalte Seidenstoffe und Vieles mehr angeboten. Alle Arbeiten sind von hoher Qualität.
Von der Jugendherberge aus laufe ich am Strand entlang, dann durch Straßen, Gassen und Grünanlagen und erreiche bald das Wahrzeichen Kamakuras, den Großen Buddha aus dem 13. Jahrhundert, Daibutsu genannt. Die Bronzefigur stand einmal in einer Halle, deren Wände 1495 von einem Tsunami weggerissen wurden. Seitdem trotzt die über dreizehn Meter hohe Kolossalstatue im Freien allen Stürmen der Zeit. Sie verkörpert Amida, den Buddha des unendlichen Lichts. Er residiert im sogenannten Reinen Land, einem Paradies. Seine wichtigsten Attribute sind Mitgefühl und Weisheit.
In stoischer Ruhe sitzt der Große Buddha von Kamakura versunken in tiefer Meditation. Ich blicke zu ihm auf und bewundere seine ebenmäßigen Gesichtszüge. Eine in Bronze gegossene Lotosblüte erhebt sich auf hohem Sockel vor der Statue. Sie symbolisiert das Makellose im Buddhismus, den reinen, erleuchteten Geist, der sich von Illusionen nicht täuschen lässt. Im Großen Buddha hat der Zustand der höchsten Erkenntnis seinen Ausdruck gefunden. Er ist eine der schönsten Statuen, die ich jemals gesehen habe.
Kamakura ist von grünen Hügeln umgeben. Der Hase-dera-Tempel zieht sich über zwei Stufen einen Berghang hinauf. Hinter dem Holztor, das mit einem riesigen Lampion geschmückt ist, breitet sich ein Garten mit einem Teich voller dicker Karpfen aus. Eine Halle und mehrere Grotten sind Benten, auch Benzaiten, einer schintoistischen Glücksgöttin geweiht. Sie verkörpert Schönheit und Reichtum. Die Höhlen wirken geheimnisvoll. Von flackerndem Kerzenlicht spärlich beleuchtet tauchen die Götterstatuen, die aus den Felswänden gemeißelt sind, nur schemenhaft auf. An einigen Stellen ist es so dunkel, dass ich mich vorsichtig vorwärts tasten muss. In einer der Grotten überragt die Göttin Benten unzählige kleine Götterfiguren. Als Schützerin der Kunst und Musik spielt sie oft Mandoline.
Ins Tageslicht zurückgekehrt, erklimme ich die Stufen und komme an Tausenden von kniehohen, lächelnden Jizo-Steinfiguren vorbei. Jizo ist der Beschützer kleiner Kinder und werdender Mütter. Er hilft auch Seeleuten und Reisenden und er geleitet die Seelen von Fehlgeburten, verstorbenen und abgetriebenen Kindern ins Totenreich. Mütter und Väter haben vielen der Statuetten Mützchen aufgesetzt, rote Kinderlätzchen umgebunden, einen Schal um den Hals gewickelt und den Figuren Gewänder angezogen. Dicht gedrängt stehen sie auf den verschiedenen Terrassen. Sie sehen aus wie freundliche Mönche, die fröhlich und wohlgenährt durchs Leben gehen. Der Jizo-Kult soll den Eltern helfen, über den Verlust ihres Kindes besser hinwegzukommen.
Auf der oberen Terrasse angelangt, ziehe ich mir die Schuhe aus und betrete den Haupttempel von Hase-dera. Eine neun Meter hohe, vergoldete Buddhafigur aus dem 8. Jahrhundert beherrscht den Raum. Sie ist aus einem einzigen Stück Kampferholz geschnitzt. Mit elf Gesichtern, tausend Armen und Händen stellt sie Kannon dar, die Gottheit der Barmherzigkeit, die dem Amida-Buddha entspricht. Kannon wird sowohl in männlicher als auch weiblicher Form dargestellt.
Von der Terrasse blicke ich hinunter auf Kamakura, die Bucht und das Meer. Dann steige ich die Treppen hinab in die Tiefe und wandere weiter zum Hashiman-gu-Schrein, der dem Kriegsgott Hashiman geweiht ist. Er liegt in der Nähe des Bahnhofs vor grünen Hügeln. Eine von Geschäften und Restaurants gesäumte Kirschbaumallee teilt den Boulevard, der auf
Jizo-Figuren am Hase-dera-Tempel, Kamakura, Zentralhonshu, Japan
Gläubige am Hashiman-gu-Schrein in Kamakura, Zentralhonshu, Japan
ihn zuführt. Eine lange, schmale, steile Treppe führt zum Schutzschrein des Minamoto-Clans hinauf. Zu beiden Seiten des Aufgangs stehen Holz- und Steinlaternen zwischen kugelig geschnittenem Buchsbaum. Ein hohes Torii aus Granit überspannt die oberen Stufen und bildet die Trennlinie zwischen dem profanen und dem heiligen Bereich. Das geflochtene Seil aus Reisstroh, das vom Sturzbalken hängt, symbolisiert die Anwesenheit der Götter. Wasser fließt in einem dünnen Strahl von einer Felswand in ein Becken. Die Gläubigen nehmen zylinderförmige Holzkellen mit langem Stiel in die Hand und fangen es auf, um sich die Hände zu reinigen und den Mund auszuspülen.
Auf der oberen Ebene stehen die rostfarbenen Bauwerke des Schreins aus dem Jahr 1828. Nur Hohepriester dürfen die heiligen Hallen betreten. Die Gläubigen treten vor den Schrein, ziehen an einem Seil und bringen eine Glocke zum Klingen, damit die Götter erwachen. Sie werfen ein paar Yen in eine Holzkiste, klatschen zweimal in die Hände, um nochmals auf sich aufmerksam zu machen, falten ihre Hände, beten und verbeugen sich zum Abschied. Viele Tempel in Japan sind Hashiman geweiht. Besonders die Samurai und die Bauern verehren ihn.
Nicht weit entfernt vom Hashiman-gu-Schrein liegt der Kenchoji-Tempel im Grünen. 1253 gegründet, gehört er zu den fünf großen Zen-Tempeln Japans. Er ist der älteste, in dem der Zen-Buddhismus praktiziert wird. Beeindruckt stehe ich vor dem wuchtigen Sanmon-Tor, dem Eingangstor zum Tempelgelände, einem Holzbau aus dem Jahr 1754. Über den vier Durchgängen zieht sich ein der Öffentlichkeit nicht zugänglicher Raum hin, der von einer Holzveranda umgeben ist. Er ist Buddha Amida geweiht, der von fünfhundert kleinen Figuren, buddhistischen Heiligen, umgeben sein soll. Grüne, geschwungene Dächer heben sich vom dunklen Holz ab.
Neben dem Sanmon-Tor steht ein Glockenturm unter hohen, duftenden Wacholderbäumen und zwischen Bambusgewächsen, ein strohgedeckter, kleiner Pavillon, in dem die mit Grünspan überzogene Glocke aus dem Jahr 1255 hängt.
Ein von Wacholdern gesäumter Weg führt zur Tempelhalle aus dem Jahr 1647. Sie ist Jizo geweiht, dem Beschützer der Kinderseelen. Er sitzt auf einem Altar hinter hohen, brennenden Kerzen. Ich schlendere weiter zur riesigen Lehrhalle aus dem Jahr 1814. Hier wird die tausendarmige Göttin Kannon verehrt. Unter der Decke hängt ein holzgeschnitzter Drache, im Buddhismus das Symbol des Lernens. Im Tempelgarten laufe ich um einen Teich herum und verlasse das Gelände, um einen kleinen Tempel in der Nähe zu besuchen. Unauffällig liegt er in einer Gartenanlage. Es ist ruhig hier, Besucher sind kaum unterwegs. Ein Friedhof zieht sich den Berghang hinauf und die Pflaumenbäume blühen schon.
Nachdem ich stundenlang gelaufen bin, kehre ich zur Jugendherberge am Meer zurück. Viele Kunstgewerbegeschäfte liegen auf meinem Weg. Kamakura ist das Zentrum der Holzschnitzkunst. Besonders gut gefallen mir die rostbraunen und fein lackierten Holzteller.
In der Jugendherberge gibt es ein japanisches Bad. Nachdem ich mich abgeschrubbt habe, steige ich ganz, ganz langsam in das über alle Maßen heiße Wasser. Endlich habe ich es geschafft. Ich sitze und ruhe. Die Temperaturen ähneln denen in einer Sauna. Ich vermeine im Wasser zu schwitzen. Die Hitze dringt bis ins Innerste und wärmt den Körper durch und durch. Für mindestens zwei Stunden ist sie in den Knochen gespeichert und die Winterkälte kann mir in dieser Zeit nichts anhaben.
Bei strahlendem Sonntagswetter wache ich auf. Nach meinem selbst zubereiteten Frühstück in der Jugendherberge, Kaffee, Toast, Eier und Käse, laufe ich los. Niedrige Häuser säumen die schmalen Straßen, rundum schimmert das Grün der Hügel. Nach einer halben Stunde Fußmarsch durch die Außenbezirke Kamakuras stehe ich vor dem Gelände des beliebten Zeni-Arai-Benten-Schreins. Er ist Benten, der Glücksgöttin und Beschützerin der Musik geweiht. Die Grotten der Andacht befinden sich in einer hohen Felswand. Eine heilige Quelle entspringt in einer Nische und speist einen Teich. Ugafuko, ein Gott mit menschlichem Gesicht und einem Schlangenleib, erschien dem Shogun Minamoto Yoritomo im Traum, um ihm von dieser wundersamen Quelle zu erzählen: „Geh dorthin! Wenn du in dieser Quelle eine Münze wäschst, wird sie sich vielfach vermehren!" Der Shogun tat es, wusch seine Münzen, die sich vermehrten, und weihte die Grotten den Göttern. So entstand der Zeni-Arai-Benten-Schrein.
Durch einen dunklen Tunnel und mehrere Toriis, die dicht hintereinanderstehen, gelange ich in das Innere der Anlage, die von hohen Felswänden und überhängenden Bäumen umgeben ist. In den Mauervertiefungen wachsen Farne. Holzschreine stehen ringsum im Hof und in den düsteren Grotten. In einem Weihrauchfass entzünden die Gläubigen Räucherstäbchen, deren weißer Rauch zum Himmel steigt. Bunte Stricke, die
Räucherfass und Toriis im Zeni-Arai-Benten-Schrein, Kamakura, Zentralhonshu, Japan
Grotte im Zeni-Arai-Benten-Schrein, Kamakura, Zentralhonshu, Japan
Götterseile, Zickzackpapier aus Reisstroh, die die Heiligkeit des Ortes symbolisieren, hängen über Altären und an den Fassaden der Schreine. Hunderte von kleinen, hölzernen Toriis, auf denen die Wünsche, Gebete und Danksagungen der Spender geschrieben stehen, stapeln sich in einer Grotte auf einem Tisch. In einer anderen halbdunklen Höhle zieht sich ein langes, von Steinen eingefasstes Becken mit dem heiligen Wasser hin. Einige Gläubige legen Münzen oder Scheine in einen Bambuskorb, nehmen eine Kelle und übergießen ihr vermutlich hart verdientes Geld mit dem heiligen Wasser. Inbrünstig streichen sie darüber und hoffen, dass es sich verdoppelt und verdreifacht. Vielleicht bekommen sie ja demnächst eine Lohnerhöhung oder gewinnen im Lotto.
Tage könnte ich in Kamakura verbringen, aber fürs Erste habe ich genug gesehen. Ich bin neugierig auf andere Orte, auf den Fuji, den höchsten Berg des Landes, auf Nara und Kyoto. Ich kehre zurück zur Jugendherberge, hole meinen Rucksack und stelle mich als Anhalter an die schmale, stark befahrene Straße, um meine Reise fortzusetzen.
Trampen ist eine Reiseart, die es im Zeitalter der Mitfahrzentralen und billigen Flüge leider kaum noch gibt. Dabei erspart es nicht nur die Fahrtkosten, sondern ist überaus aufregend. Der Anhalter weiß nie, auf welche Leute er trifft, auf freundliche, die gefällig sind und sich unterhalten wollen, auf durchgeknallte oder wahnsinnige oder auf böse Buben. Der Fahrer geht ebenfalls ein Risiko ein, denn auch unter den Anhaltern könnte es Ganoven geben.
Als junger Mensch war ich viel getrampt, innerhalb Deutschlands, aber auch ins Ausland nach Kopenhagen, Paris und Venedig. Nie wusste ich, wie lange ich am Straßenrand warten musste. Manchmal lief alles wie geschmiert, manchmal kam ich nur langsam voran. Zumeist hatte es schöne Unterhaltungen gegeben, ab und zu Einladungen, manchmal auch unliebsame Annäherungsversuche. Dann stieg ich aus, sobald der Wagen hielt, und suchte das Weite. Nie hatte ich mich in Lebensgefahr befunden, nie hatte man mich ausgeraubt. Trampen war für mich immer mit einem Gefühl der Freiheit verbunden, eine abenteuerliche Reiseform, um die Welt zu sehen. Japan galt als sicheres Land. Es kam mir gar nicht in den Sinn, dass etwas passieren könnte. Ich war neugierig auf die Menschen, die ich treffen würde.
Der 3776 Meter hohe Fuji hinter dem Ashi-See, Hakone-Nationalpark, Honshu, Japan
Schreine im Hakone-Nationalpark, Zentralhonshu, Japan
Im Hakone-Nationalpark und am Fuji-san
Schon bald hält ein kleiner Wagen, der mit Gepäck beladen ist. Ich zwänge mich mit meinem dazu. Bis Odawara führe er, sagt der Fahrer, ein Grundschullehrer, der mehr schlecht als recht Englisch spricht. Statt mich in Odawara abzusetzen, fährt er weiter in die Hakone-Region hinein. An einer Mautstelle zahlt er fünfhundert Yen Straßengebühren und das Auto ächzt in die Gebirgswelt des Nationalparks zur Stadt Hakone hinauf. Der Ashi-See inmitten bewaldeter Hügel taucht auf und spiegelt den blauen Himmel. Der schneebedeckte Fuji-san ragt in der Ferne über bläulich dunklen Höhenzügen auf. Von einem Panoramateilstück der Straße blicke ich auf den See, die Stadt Hakone und den Vulkan.
Zur Jugendherberge mögen es weitere zehn Kilometer sein. Unvermittelt hält der Fahrer an einer Tankstelle und bedeutet mir, auszusteigen. Er will ein Taxi bestellen. „Nein, um Himmels willen", sage ich, „ich halte den nächsten Wagen an!" Ob er sich mit den Regeln des Trampens nicht auskennt? Vielleicht wollte er mir einen Gefallen tun und beabsichtigte noch nicht einmal, nach Odawara zu fahren. In Zukunft muss ich aufpassen, dass man meinetwegen keine großen Umwege fährt.
Der nächste Wagen hält und ich steige ein. Der Fahrer fährt los und setzt mich an der Abzweigung nach Sounzan ab. Sounzan-onsen, ein Kurbad mit heißen Quellen und einer Jugendherberge, liegt auf den Überresten eines erloschenen Vulkans. In der Nähe der Kreuzung strömt heißes Wasser einen Felsen hinab und dampft in der Kälte, ein Naturschauspiel, das ich zum ersten Mal in meinem Leben beobachte. Weit und breit sehe ich nur große Hotels, die ihren Gästen das Baden in heißen, mineral- und schwefelhaltigen Quellen anbieten, den Onsen. Ich stiefele eine Straße steil bergauf und suche im oberen Teil des Ortes vergeblich einen Supermarkt. Schließlich entdecke ich einen kleinen Laden, kaufe ein und suche die Jugendherberge in der Nähe auf. Dort ist es kalt, nur der Aufenthaltsraum ist geheizt. Zwei Mädchen aus Hongkong sind eingetroffen. Wir kommen sofort miteinander ins Gespräch, weil ich bereits mehrere Male in Hongkong war. Nach dem Abendessen laden uns die Herbergseltern zu einem Tässchen Kaffee in ihre Privatwohnung ein. Wir hocken auf Tatami, strecken die Füße unter den Heiztisch, schlürfen den Kaffee und unterhalten uns.
Am nächsten Morgen starte ich wieder per Anhalter zu einem Tagesausflug an den Ashi-See. Der Fahrer setzt mich an einem zugefrorenen Teich in der Nähe eines steingeschnitzten Buddhas aus dem 13. Jahrhundert ab. Gegenüber steht eine größere Statue des Schutzpatrons Jizo neben vier kleineren Figuren, die halb im Schnee versunken sind. Sie sind kahlköpfig und tragen rote Lätzchen. Wahrscheinlich haben die Eltern verstorbener Kinder ihnen karierte Wolldecken umgehängt, damit sie in der Kälte nicht frieren. Die große Figur trägt über dem Lätzchen einen Schal.
Auf dem Weg nach Moto-Hakone blicke ich über den See. Die Spitze des Fujis schwebt in der Ferne über den Wolken. Im Städtchen angekommen, stromere ich durch die Straßen und sehe dem Treiben der Leute zu. An Marktständen auf dem Gehsteig verkaufen und kaufen sie Schirme aus Bambus und Papier, kleine Glückskatzen, niedliche Holzpuppen und einfarbiges und gemustertes Origami-Papier. Durch die damaligen Palastgärten Moto-Hakones verläuft eine Zypressenallee. Säulenförmig und schlank wachsen die fast vierhundert Jahre alten Bäume in den Himmel. Sie bieten immerwährenden Schutz vor Wind und Sonne.
Ich verlasse den Ort und wandere zum berühmten Torii des Hakone-Schreins. Das rostrote Tor, ein beliebtes Fotomotiv, steht im Wasser und spiegelt sich im tiefblauen Ashi-See. Unter hohen Zedern folge ich dem Weg den Berghang hinauf zum 757 gegründeten Hakone-Schrein. Seine heutigen Gebäude stammen aus dem Jahr 1667. Je höher ich steige, umso höher türmt sich der Schnee. Er liegt auf den Zweigen der Bäume, auf den Dächern der Hallen, auf Steinlaternen und Heiligenfiguren, die draußen stehen und aus der Schneedecke gucken. Die bunt angestrichenen Fassaden des Schreins und die lackierten Säulen heben sich intensiv von der weißen Umgebung ab.
Zurückgekehrt zum Ufer, folge ich dem alten Tokaido-Weg, der Edo (Tokio) mit Kyoto verband. Er führte durch Hakone-machi. Wie ein Vogelnest liegt das Städtchen am Berghang. Die restaurierte Seki-Sho-Schranke, der damalige Kontrollpunkt am Ortsrand, besteht aus einem dunklen, überdachten Holztor, Holzzäunen und alten Häusern für die Beamten, die die Durchreisenden nach Waffen durchsuchten. In einem kleinen Museum sind Gebrauchsgegenstände, Fässer, Wasserbehälter, Geschirr, Strohhüte, Schöpfkellen, geflochtene Körbe und Kleidungsstücke zu besichtigen. In graue Gewänder gekleidete Kunstfiguren aus
Markt in Moto-Hakone am Ashi-See, Zentralhonshu, Japan
Yosegi-Zaiku-Holzarbeiten im Hakone-Nationalpark, Zentralhonshu, Japan
Gips knien rund um eine viereckige Feuerstelle bei einer Teezeremonie. Umwerfend finde ich den Blick hinunter auf den Ashi-See mit seiner indigoblauen Wasseroberfläche zwischen den mit Schnee bestäubten Hügelketten.
In Hakone-machi reihen sich Spezialläden aneinander. Die Geschäftsleute verkaufen Leckereien, aber vor allen Dingen kleine Schränke, Kisten, Boxen und Spielzeug aus Holz, deren kunstvolle Muster aus unterschiedlich getönten Holzarten zusammengesetzt sind. Seit dem 9. Jahrhundert werden die Yosegi-Zaiku-Holzarbeiten hergestellt und verkauft. Die Preise sind erschwinglich: Für zweitausend Yen, etwa zehn Euro, bekommt man fein gefertigte Sachen.
In einem Laden kaufe ich Proviant ein, folge ein Stück der schmalen Seestraße und trampe dann zum Owaku-dani-Tal, zum „Tal des großen Dampfes". Ich steige in die Seilbahn, die zu einem Aussichtspunkt führt, und blicke in den Krater des Hakone-Vulkans. Schwefeldämpfe steigen zwischen Schneefeldern auf. Es riecht nach faulen Eiern. Über der Bergwelt ringsum erhebt sich im Norden der 3776 Meter hohe Fuji mit seinem markanten Vulkankegel. Im Westen erblicke ich ein Stück vom Ashi-See und in der Ferne das Meer.
In gut einer Stunde laufe ich zurück zur Jugendherberge. Die Hongkonger sind noch da. Abends laden uns die Herbergseltern wieder zu einer Tasse Kaffee ein, ein netter Brauch, und wir spielen Mau-Mau.