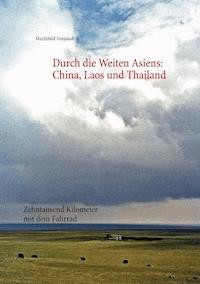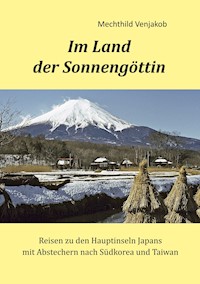Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Welches Unterfangen! Aus eigener Kraft und im Alleingang reist die Autorin mit dem Fahrrad von der Küste des Südchinesischen Meeres auf das Qinghai-Tibet-Plateau, das höchste der Erde. Sie startet in Kanton am Perlfluss und durchfährt das ländliche China der Provinz Guangdong, die Kautschuk-, Bananen- und Kokosnussplantagen auf der Insel Hainan und eine märchenhaft anmutende Karstlandschaft, Zuckerrohr- und Reisfelder in der Provinz Guangxi. In Yunnan besucht sie die Volksgruppe der Bai in Dali am Erhai-See und die der Naxi in Lijiang. Sie heilt die Verletzungen eines Sturzes aus, bevor sie sich Meter für Meter der Schwerkraft entgegenstemmt, um 5000 Meter hohe Pässe zu erobern. Unzählige Herausforderungen meistert sie: mehr als eineinhalbtausend Kilometer auf Schotterstraßen, die einseitige Kost, die aus unzähligen Nudelsuppen besteht, die dünne Luft, das Zelten im Schnee und die Kälte des hereinbrechenden Winters. Die Autorin schildert die landschaftlichen Besonderheiten dieser Extremtour und erzählt von den Begegnungen mit Menschen, die ihr in Notsituationen zur Seite standen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 285
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Autorin
Mechthild Venjakob, am 29. April 1943 in Paderborn geboren, war fünfzehn Jahre als Lehrerin im Schuldienst tätig. Zwei Jahre unterrichtete sie an der Deutschen Schule in Quito, der Hauptstadt Ecuadors. Ende 1980 kündigte sie den Schuldienst und löste ihre Wohnung auf, um sich die nächsten zwanzig Jahre dem Reisen zu widmen. Sie hielt sich überwiegend in asiatischen Ländern auf, aber auch in Australien, Neuseeland, den Vereinigten Staaten, Mittelamerika und Europa. Doch Asien mit seinen alten Kulturen und östlichen Weisheiten erkundete sie am intensivsten. Dort verbrachte sie insgesamt zehn Jahre.
Hilfsarbeiten in Australien, Neuseeland, Alaska, Colorado und England halfen ihr in den ersten zehn Jahren ihres Reiselebens über die Runden. Dann unterrichtete sie Deutsch als Fremdsprache an Instituten in Bremen und Hongkong und 1997 an der Chung-Ang-Universität in Ansong in Südkorea.
Seit 1989 reiste sie mit dem Fahrrad und machte mehrmonatige Radtouren in den USA, Südeuropa und in Asien: Sie radelte durch Indien, Thailand, Laos, Pakistan, Japan und immer wieder trieb es sie durch China. Drei Touren führten über das Qinghai-Tibet-Plateau. Im Jahr 2000 kehrte sie über Land nach Deutschland zurück. In neun Monaten legte sie 12700 Kilometer mit dem Fahrrad zurück und durchquerte dabei die Wüste Gobi in der Mongolei. Ein großartiges „Nomadendasein“ ging zu Ende. Sie ließ sich in ihrem Geburtsort Paderborn nieder, um ihre Reiseberichte zu schreiben und über ihr Leben nachzudenken, das fantastischer war als ein Traum, den manch einer träumt.
INHALT
Vorwort
Ein Jahr in Hongkong – im Vorhof der Hölle
Guangdong – eine Region im Aufbruch
Hainan – die große Insel im Süden
Haikou, die Hauptstadt
Auf der Westroute nach Sanya
Durch die Berge zurück nach Haikou
Guangxi – Zuckerrohr und Felsentürme
Yunnan –Heimat vieler Minoritäten
Durch den Steinwald nach Kunming
Kunming, die Stadt des ewigen Frühlings
Fahrradtour um den Dianchi-See bei Kunming
Dali am Erhai-See – Heimat der Bai
Lijiang, die Stadt der Naxi
Wanderung durch die Tigersprungschlucht
Der Sturz
Durch Kham und Amdo – das alte Tibet
Der Aufstieg auf das Qinghai-Tibet-Plateau
Regenzeit – von Zhongdian nach Litang
Berg- und Talfahrt: von Litang nach Kangding
Stufen zum Himmel: von Kangding nach Maniganggo
Dzogchen und Serxu, zwei Klöster zwischen hohen Pässen
Wintereinbruch: durch Qinghai nach Xining
Die Routen im Überblick
Dank
Im Hafen von Hongkong
Die Star Ferry zwischen Kowloon und Hongkong Central
VORWORT
Langzeitreisende leben gewöhnlich spartanisch. Je sparsamer sie sind, umso länger können sie frei und ungebunden unterwegs sein. Das hat seinen Preis! Mein Freund David und ich verzichteten freiwillig auf Luxus und oftmals auf Komfort, denn wer das eine will, muss auf das andere verzichten. Jeder Mensch sollte bei Entscheidungen Prioritäten setzen: Möchte ich lieber dies oder das? Was ist mir am wichtigsten? Uns war die Zeit des freien Umherziehens wichtig, angetrieben von der Neugier auf fremde Länder und Kulturen und der Sehnsucht nach Ferne und Abenteuer. Wenn wir ein Jahr gearbeitet hatten, konnten wir gewöhnlich ein Jahr lang reisen. Wir besaßen kein Haus, keine Wohnung, keine Möbel und keinen Fernseher, keinen Garten und kein Auto, aber wir hatten reichlich Zeit für unsere Fahrradtouren, ein wunderbares Gefühl, wenn man ein riesiges Land wie China erkunden möchte. Zeit zu haben war für mich ein Reichtum, der den materillen tausendfach übertraf, ich verschaffte mir Zeit, um intensiv zu reisen.
Anfang 1994 starteten David und ich unsere Reise durch Indien, Pakistan und China. Wir radelten durch die Wüste Thar in Rajasthan, bezwangen einige Strecken im Himalaja, eroberten den gut 4700 Meter hohen Khunjerab-Pass, der Pakistan und China trennt, und folgten der Seidenstraße für Tausende Kilometer bis Xian, die Stadt mit der berühmten Terrakottaarmee. Im Januar 1995 kamen wir in Hongkong an. Ein Reisejahr war um. Es wurde Zeit, das Reisebudget wieder aufzubessern. Eine Phase des Geldverdienens stand jetzt an. Wir planten, in Hongkong ein Jahr lang zu arbeiten, um dann weiterzuziehen. Die Mieten in Hongkong waren hoch. Um Geld zu sparen, lebten wir in einer Absteige und stießen an die Grenze des Erträglichen. Der Verzicht auf eine gemütliche Wohnung wurde fast zu groß.
Bis 1997 verwalteten die Briten Hongkong als ihre Kronkolonie. In den Opiumkriegen des 19. Jahrhunderts hatten sie gesiegt und sie pachteten das Land für 99 Jahre: die Insel Hongkong Central, die Schwesterstadt Kowloon, die sich auf dem Festland an der Mündung des Perlflusses in das Chinesische Meer ausbreitet, und das Hinterland Kowloons, das an das Riesenreich China grenzt. Hochhäuser und Wolkenkratzer verdrängten im Laufe der Zeit die Fischerhütten. Es entstand ein führendes Handels- und Finanzzentrum in Asien und ein Shoppingparadies für Touristen aus aller Welt.
Hongkong
EIN JAHR IN HONGKONG – IM VORHOF DER HÖLLE
Die belebten Straßen erglänzen im Lichterschein der Nacht. Riesige, an den Hausfassaden befestigte Reklametafeln ragen weit über die Nathan Road, die Hauptverkehrsader Kowloons. Von der Fähre, die zwischen Kowloon und Hongkong Central im Zehnminutentakt verkehrt, der Star Ferry, blicke ich über den Hafen auf die erleuchteten Wolkenkratzer und die Uferstraße auf der anderen Seite. Ich flaniere über die auf Säulen ruhende Hafenpromenade, die sich vor dem futuristisch anmutenden, 1989 erbauten Kulturzentrum am alten Uhrturm hinzieht, und genieße die markante Skyline von Hongkong. Der 367 Meter hohe, gläserne Dreiecksbau der Bank of China hebt sich mit seiner eigenwilligen Architektur von den anderen Wolkenkratzern ab. Zwei Antennen auf dem spitzwinkligen Dach verlängern den Turm und durchstechen den Himmel, ein Zeichen von Stärke und Macht.
Im Herzen Kowloons, in der Nathan Road, liegt das Chungking Mansions, ein siebzehnstöckiges, fünf Blöcke umfassendes Hochhaus aus dem Jahr 1961. Es besteht aus einer Ansammlung von Gästehäusern, Herbergen, Shops, Restaurants und Bistros, kleinen Fabriken, Wechselstuben und Privatwohnungen. Hier leben viertausend Menschen. Seit Jahrzehnten zieht es Rucksackreisende, legale und illegale Immigranten, Händler aus der Dritten Welt, dubiose Geschäftsleute, Ratten und Kakerlaken an. Der Reiseführer „Lonely Planet“ bezeichnet das Leben in diesem Mikrokosmos als die „Vision einer Hölle“, obwohl es viele kleine, saubere Gästehäuser auf den verschiedenen Etagen gibt und auch ordentliche Leute ihre winzigen Appartements hier haben.
Die Sechsmillionenstadt Hongkong kann sich nicht ausbreiten, es fehlt an Platz. So wird in die Vertikale gebaut. Auch in den hügeligen Territorien, dem Hinterland Hongkongs, erheben sich die Wohnsilos in den Himmel, Legebatterien vergleichbar. Sie überragen um ein Vielfaches die älteren ein- und zweistöckigen Häuser, die besser auf die Bedürfnisse des Menschen zugeschnitten sind. Die Mieten sind hoch, viele Menschen leben auf engstem Raum. Etwa einhunderttausend Hongkong-Chinesen wohnen sogar in übereinandergestapelten, zwei Kubikmeter großen Mietkäfigen. Für Hühner treten Tierschützer ein, für Menschen gibt es keinen Schützer. — David und ich wohnen im sechzehnten Stock des Travellers Hostels. Die meisten Reisenden leben in Vier- oder Sechsbettzimmern, die mit zweistöckigen Eisenbetten ausgestattet sind. Außerdem gibt es noch drei Doppelzimmer. Wir haben das größte erwischt. Jeder, der reinkommt, staunt, dass es so etwas Großes im Chunking Mansions überhaupt gibt. Gewöhnlich ist ein Doppelzimmer mit einem Bett ausgefüllt, in das der Bewohner sich setzen muss, ehe er die Tür schließen kann. Wir haben eine Winzigkeit mehr an Platz. Ohne Verrenkung können wir stehen und zweieinhalb Schritte tun. Im Vergleich zu den Mietkäfigen der ärmsten Chinesen leben wir wie in einem Palastzimmer.
Unser Zimmer ist keine zehn Quadratmeter groß. In einer Ecke steht ein Eisenschrank mit imitierter Holzmaserung, unsere Bücher stehen in aus Pappkartons zusammengesetzten Bücherregalen neben einem ausgedienten Computer, den David aufgetrieben hat. Der Tisch ist etwa acht Din-A4-Seiten klein. Ein wackeliger Bürostuhl ergänzt das Mobiliar. Wir haben sogar eine leicht lädierte Stehlampe auftreiben können. Der cremefarbene Lampenschirm taucht das Zimmer in weiches Licht und ersetzt die kalte Neonbeleuchtung. Die weiß gekachelten Wände – wir kommen uns vor wie in einer Metzgerei – haben wir mit Landkarten zugepflastert: Ein großer Teil der weiten Welt hängt im Zimmer: China, Hongkong und die „New Territories“. Davids Fahrrad liegt unter dem Bett, mein „Flöhchen“ steht an der Wand und dient als Ablage. Zwei Besucher finden spielend Platz, notfalls drei, dann wird es eng.
In diesem Zimmerchen standen einmal drei doppelstöckige Betten. Sechs Rucksackreisende mussten sich mit ihrem Gepäck einrichten. Vor elf Jahren hatte ich eine vergleichbare Unterkunft ein paar Straßen entfernt. Zehn Personen hausten dort auf engstem Raum. Ich wusste nicht, wohin ich den Rucksack stellen sollte. Das Travellers Hostel existierte damals auch schon. In der großen, quadratischen Eingangshalle herrschte ein großes Durcheinander. Eine Matratze lag neben der anderen, um die Gäste aufzunehmen, die in den umliegenden Herbergen keinen Platz mehr gefunden hatten. Heute ist der große Eingangsraum des Travellers Hostels frei. Gegenüber der Rezeption hängt die Pinnwand, Bänke stehen an den Wänden und laden die Gäste zum Hinsetzen und Plauschen ein. Ein Getränkeautomat und ein Bügelbrett stehen um die Ecke. Die Wände sind weiß gekachelt, die Herberge ist sauber, denn die Polizei und das Gesundheitsamt sorgten vor zwei Jahren dafür, dass die schlimmsten Missstände beseitigt wurden. Ein Gästehaus nach dem anderen musste schließen, es sei denn, die Besitzer fingen an, diese zu renovieren und zu putzen. Viele taten es und erhöhten die Preise. In einigen Schlafräumen ist es immer noch eng. Aber da ein bisschen mehr auf die Hygiene geachtet werden muss, geht es etwas menschenwürdiger zu.
Die Küche im Travellers Hostel ist ein schmaler Schlauch, die Wände sind, wie üblich, gekachelt. Auf der Steinanrichte steht ein zweiflammiger Gasherd, an der Stirnseite befindet sich die ewig verstopfte Spüle, unter der Anrichte stapeln sich Töpfe und Pfannen auf Regalbrettern. Teller und Besteck muss jeder mitbringen, wäscht sie nach der Mahlzeit ab und nimmt sie mit ins Zimmer. Schmutzige Töpfe und Pfannen dagegen lässt manch einer frech stehen.
Der Kühlschrank ist vollgestopft mit Plastiktüten voll Lebensmitteln der Kochlustigen. Anfangs gab es zwei Kühlschränke, einer war defekt: Die Tür sprang andauernd auf. Eine Ratte kam des Öfteren zu Besuch, huschte durchs Fenster und an den Wänden entlang und einmal sprang sie aus dem Kühlschrank heraus. Mae von den Philippinen, die Managerin, entsorgte ihn. Sie versucht ihr Bestes, die Küche und den kleinen Vorraum sauber zu halten. Der quadratische Tisch in dem Vorraum ist längst nicht groß genug für die drei Dutzend Leute, die sich ihre Mahlzeiten selbst zubereiten und dort essen wollen.
Vor Kurzem waren Gisela, Chemielehrerin an einer Berufsschule, und Christa, Englischlehrerin an einem Gymnasium, hier. Sie verbrachten ihre Osterferien in Hongkong und Südchina. „Hier bleiben wir nicht!“, hatte Christa gesagt, gewöhnt an Sauberkeit, Ordnung und gehobenen Komfort – ihre erste Reaktion auf diese Budget-Unterkunft. Sie blieben doch, denn das Travellers Hostel im Chungking Mansions ist die preiswerteste Bleibe im teuren Hongkong. Es besticht durch die ideale Lage im Zentrum der Stadt. Gisela und Christa fingen an, die Treffen und Gespräche mit den anderen Gästen der Herberge zu genießen, sie setzten sich zu uns und erkundigten sich wissbegierig nach unseren Erlebnissen. Vor allen Dingen Gisela war fasziniert von unserem Lebenstil. Sie selbst hatte abenteuerliche Reisen über das Touristikunternehmen Rotel-Tours gemacht und war im „rollenden Hotel“, den speziell ausgestatteten Allradbussen von Rotel Tours, durch Tunesien gerollt.
Die meisten Rucksackreisenden bleiben nur ein paar Tage in Hongkong, fahren dann nach China oder fliegen nach Bangkok, Manila, Taipeh oder nach Hause zurück. Einige Gäste des Hostels sind länger unterwegs, Aussteiger wie wir, deren Zukunft nicht vorprogrammiert ist, die das Karriere- und Sicherheitsdenken aufgegeben haben und die immer wieder neu entscheiden müssen, wo sie ihre Brötchen verdienen, damit die Reise weitergehen kann.Viele Engländer bleiben länger in der Stadt. Anstandslos bekommen sie für den Aufenthalt in der britischen Kronkolonie ein Visum für ein ganzes Jahr. Sie dürfen hier arbeiten und suchen sich einen Job. David ist mit seinem britischen Pass aus dem Schneider. Schnell bekommt er die ersten Englischkurse über eine Agentur vermittelt und unterrichtet morgens Kinder in Schulen und abends Erwachsene in den Räumen der Agentur.
Ich stecke in der Klemme. Deutsche bekommen ein Visum für nur vier Wochen. Alle Naselang muss ich nach Shenzen ausreisen, um mir an der Grenze ein neues Visum zu besorgen. Wie lange würde das gutgehen?
An Bremer Instituten unterrichtete ich Anfang der Neunzigerjahre als Dozentin Deutsch als Fremdsprache. Jetzt suche ich nach einer Dozentenstelle in Hongkong. Ich kontaktiere das Goetheinstitut mit einem abschlägigen Bescheid, erkunde die Lage an einer Schweizer Schule und finde schließlich eine Anstellung an einem Fremdspracheninstitut in Hongkong Central. William, der junge Manager gibt mir schnell den ersten Kurs, obwohl er um meine Situation weiß: „Alle vier Wochen läuft mein Visum ab. Ich muss nach Shenzen fahren und mir ein neues besorgen!“ „Macht nichts“, sagt er, „ich helfe dir, wenn die Beamten Schwierigkeiten machen!“ Aber er unternimmt nichts! Unternehmer müssen eine empfindliche Strafe zahlen, wenn sie ausländische Arbeitskräfte ohne Arbeitsvisum einstellen. Wenn er bloß nicht auffliegt!.
Nach drei Monaten macht der Zoll Ärger. Was ich in Hongkong wolle, wie lange ich bliebe, wollen die Beamten wissen. „Beim nächsten Mal lassen wir Sie nicht mehr einreisen!“ Sie drücken den Stempel in meinen Pass und für vier Wochen habe ich wieder Luft. Wenn sie wüssten, dass ich bereits illegal arbeite und mittlerweile drei Kurse. betreue!
David und ich gehen zum Ausländeramt, um eine längere Aufenthaltsgenehmigung für mich zu beantragen. Die Einreise- und Ausreisestempel in Pässen, Briefe von Freunden und Fotos beweisen, dass wir schon einige Jahre zusammenleben, und siehe da: Der Beamte bewilligt mir eine Aufenthaltsgenehmigung bis zum Ende des Jahres 1995. Eine Sorge weniger! Die Arbeit aber bleibt weiterhin illegal. Davids wegen bleibe ich in Hongkong, sonst wäre ich schon längst über alle Berge. Auf die Idee, dass ich eventuell in Deutschland bessere Arbeitschancen hätte, komme ich gar nicht.— Die Lage ist alles andere als rosig. Die Miete ist ein Killer. Alle zwei Wochen blättern wir 2000 Hongkong-Dollar auf den Tisch des Hostels, nach damaligem Umrechnungskurs 400 DM (200 Euro). An Sparen ist in den ersten Monaten unseres Lebens in Hongkong nicht zu denken. Kaum halten wir unseren Verdienst in den Händen, ist er für Miete und Lebensmittel verbraucht. Ich habe das Gefühl, auf der Stelle zu treten und bin irritiert. Meinen gut bezahlten Lehrerberuf hatte ich nicht aufgegeben, um für den Rest meines Lebens am Limit herumzukrebsen und in ärmlichen Verhältnissen zu leben. Doch ganz, ganz langsam wendet sich das Blatt, als weitere Deutschkurse anstehen und sich einige besser bezahlte Privatstunden ergeben. Auf einmal sammelt sich das Geld an und vermehrt sich. Vielleicht zieht Geld Geld an, wie Glück das Glück und wie ein Unglück das nächste anzieht. Solchen Gedankengängen bin ich nicht abgeneigt. Nach fünf Monaten endlich ist es mir möglich, Rücklagen für die Weiterreise zu bilden.
Ab und zu agieren wir als Statisten in Filmen, die im Fernsehstudio Hongkongs gedreht werden. Der denkbar schlecht bezahlte Job, drei Euro die Stunde, spielt sich meistens nachts ab. Der Agent, ein Engländer namens Ken, holt uns ab, eine Handvoll Leute aus dem Travellers Hostel. Gemeinsam fahren wir mit der Metro zum Studio und warten in einem unansehnlichen Raum hinter den Kulissen mit vielen chinesischen Statisten. Oft sind die Auftritte nur kurz, die langweiligen und ermüdenden Wartezeiten umso länger. Darum ist die Bezahlung so schlecht. „Ihr tut ja nichts!“, sagt Ken. So verdienen wir unser Geld im Schlaf!
In einer Nacht sitzen wir im „Gerichtshof“ des Fernsehstudios, die Männer in Frack und Zylinder, die Frauen in langen Biedermeierkleidern und großen Hüten auf den Köpfen. Lachend haben wir uns in die Kostüme gezwängt, einigen Statisten sind sie zu groß, anderen zu klein. So genau kommt es nicht darauf an. In einer anderen Nacht begibt sich die Crew auf Hongkongs Straßen. Wir Statisten schlendern vor belebten Bars und Nachtklubs auf und ab und sitzen zum Schluss in einer Kneipe, essen Nüsse und trinken Bier. Der Regisseur zerstückelt die Filmszenen in kleinste Sequenzen und wiederholt sie meistens mehrere Male. In acht Arbeitsstunden werden, wenn es hochkommt, fünf Minuten des Filmgeschehens gedreht.
Eines Tages sind wir schon am Nachmittag um fünfzehn Uhr dreißig ins Studio bestellt. Wir, Ken, der Agent, Nicola, David und ich, sitzen in der lärmenden Kantine und überraschend schnell ruft der Regisseur uns auf den Set. Die Männer stecken in Anzügen, Nicola und ich in Kostümchen. Der Rock ist uns zu eng, der Rockschlitz ohnehin schon offen bis zum Gesäß. Amüsiert stolzieren wir ins kühle Studio und die Dreharbeiten fangen an. Ein Restaurant mit einer Bar dient als Kulisse. Wir sitzen gemütlich am Tresen. Jede Sequenz wird fünf- bis achtmal wiederholt. Die Hauptdarsteller sind noch dabei, ihren Text zu lernen. „Cut!“ – „Stand by!“ – „Cut!“ – „Stand by!“ Um einundzwanzig Uhr ist Pause und wir gehen in die Kantine. Uns wird klar, dass uns vermutlich eine lange Nacht bevorsteht. Wir sitzen herum. Um zwölf Uhr dreißig sind neun Arbeitsstunden um, ab jetzt werden zwei Euro fünfzig pro Stunde mehr gezahlt. In der letzten Szene treten wir wieder als Statisten an der Bar im Restaurant auf, um zwei Uhr vierzig sind wir erlöst. Der Fahrer des TV-Busses fährt wie der Henker durch die dunklen und leeren Straßen der Stadt nach Kowloon und setzt uns im Stadtteil Mongkok ab. Wir nehmen ein Taxi zum Chungking Mansions und sind um vier im Bett. David muss um acht unterrichten und schleppt sich mit bleiernen Gliedern zur Schule.
Eines Sonntags treffen sich die Statisten – vier Männer, vier Frauen und drei fünfjährige Kinder – um vier Uhr fünfzehn am frühen Morgen vor dem Sheraton, zwei Gebäude vom Chungking Mansions entfernt. Wir sitzen auf den Stufen des Hotels und warten – wie üblich. Gegen fünf Uhr kommt ein Minibus mit den Kostümen und die Filmcrew steckt uns in Winterkleidung, passend zum Filmthema „Winter in Hongkong“. Der Titel ist unerhört und himmelschreiend. Ein europäischer Winter ist in diesen Breitengraden mit seinem subtropischen Klima undenkbar. Im Film soll er nachgeahmt werden. Mit blühender Fantasie hat der Drehbuchautor ihn erdichtet. Ich ziehe einen schweren, warmen Mantel mit Pelzkragen an und setze mir einen Hut auf. Wir sind gut vorbereitet für die Winterszene in Hongkong bei Temperaturen von dreißig Grad Celsius. Es ist schwül, ein Mann der Crew stellt eine Schneemannattrappe vor die U-Bahn-Station Tsim Sha Tsui und streut weiße Plastikkugeln auf dem Boden aus, die Schnee vortäuschen sollen. Das Filmteam taucht auf. Mittlerweile ist es sechs Uhr dreißig. Nach einer gefühlten Ewigkeit beginnen die Dreharbeiten.
Einer der Jungen steckt in Knickerbockerhosen. Er trägt eine Schlägermütze und einen dicken Schal um den Hals. Die Szene beginnt mit einer Großaufnahme des Kindes. „Action! Snow in Hongkong!“ soll es rufen, freudig mit der Zeitung wedeln und dabei um den Schneemann rennen. Das Blatt verkündet diese unglaubliche Neuigkeit: Schnee in Hongkong! Das gibt es nicht! Das Dilemma ist, dass der kleine Junge müde und keineswegs freudig erregt ist. Zigmal wird die Szene wiederholt, während wir schwitzend durch den „Schnee“ auf und ab wandern. Der Junge fängt an zu weinen und sein kleiner Bruder übernimmt die Rolle. Er hat gute Laune, er macht seine Sache gut. Mittlerweile ist Hongkong erwacht, die ersten Passanten laufen durch die Szene und vermasseln sie immer wieder, bis auch dieser Junge bockt. „Action! Snow in Hongkong!“ – diesen Satz will er nicht mehr sagen, er hat ihn oft genug wiederholt. Er schüttelt seinen Kopf, ist kurz vorm Weinen. Das kleine Mädchen übernimmt den Part, fröhlich lachend und voller Energie. Trotz der Wiederholungen bleibt es gut gelaunt, obwohl es zwischendurch befremdet guckt, weil es diesen Zirkus nicht versteht.
Inzwischen sind die Bürgersteige bevölkert, wie Mückenschwärme drängen die Menschen aus der U-Bahn-Station. Immer öfter und länger müssen wir auf die Fortsetzung der Dreharbeiten warten. Um halb eins kommt die Polizei und verjagt uns alle, den Regisseur, die Schauspieler, den Kameramann, die Statisten. Jeder von uns kassiert 400 Hongkong-Dollar (etwa 50 Euro) und wir gehen zurück ins Travellers Hostel. Mittlerweile hat es angefangen zu regnen, warm und stark platscht der Regen auf den nicht schmelzenden Schneemann und den falschen Schnee. So ist das in Hongkong: Die Stadt besteht aus glänzenden Fassaden, Attrappen, Glitter, Flitter und Spiegelungen. Was ist Realität?
Der Lärm, die Enge, das Leben zu zweit in einem winzigen Zimmer – irgendwann bin ich genervt. Die Zustände in diesem „Vorhof zur Hölle“ sind kaum auszuhalten. Dennoch entbehrt dieses extreme Leben im Chungking Mansions nicht der Faszination. Alle möglichen Typen aus der ganzen Welt kreuzen auf. Vor den zu kleinen Aufzügen bilden sich oft Menschenschlangen, Europäer, Pakistaner, Inder, Nepalesen, Afrikaner und Hongkong-Chinesen stellen sich an. Der Aufzug knarrt, wenn er zu voll ist. Spätestens, nachdem sich sieben Personen hineingezwängt haben, ertönt das Warngeräusch: Einer muss zurück in die Schlange. Meistens passen nicht mehr als sechs Personen in den Aufzug. Schwarze haben wahrscheinlich einen schweren Knochenbau; auch die schlanken verursachen schnell den knarzenden Ton. Und einige Frauen aus Afrika wiegen so viel wie drei Personen auf einmal. Farbenprächtige Gewänder verhüllen ihren Leibesumfang.
Das Chungking House hat einen schlechten Ruf. Im vierten Stock wurde vor Kurzem eine indische Frau ermordet, im siebzehnten hat es eine Messerstecherei gegeben. Wahrscheinlich werden auch Drogen umgeschlagen. Wer nach Arbeit sucht, sollte diese Adresse bei seinem Arbeitgeber besser nicht angeben. Manchmal gibt es Razzien und Polizisten durchkämmen alle Blöcke auf der Suche nach illegalen Immigranten..
Eines Morgens klopft es um fünf Uhr an unsere Zimmertür: Ein junger Polizist betritt das Zimmer, streckt seine Brust heraus und bellt in rüdem Ton nach den Pässen. Er blättert in unseren Dokumenten und hat Mühe, die Hongkong-Einreise-Stempel zwischen den vielen anderen zu finden. Wie wir später hören, wurden alle Ausgänge blockiert und bewacht, niemand konnte fliehen. Alex, ein junger Deutscher auf der Durchreise, wurde in Handschellen abgeführt, denn unglücklicherweise lag sein Pass gerade im Reisebüro, weil er ein Visum für China beantragt hatte. Den Beleg akzeptierte der Polizist nicht. Mit etwa fünfzig anderen, Pakistanern, Indern und Afrikanern, luden die Ordnungshüter ihn auf einen Lkw und fuhren zur Polizeistation. Dort saßen alle, die Hände auf dem Rücken gebunden, weitere zwei, drei Stunden, bis der Fall jedes Einzelnen geklärt war. Alex ist noch immer wütend, als er uns davon erzählt. Er wird dem deutschen Konsulat einen Bericht über die Vorkommnisse schicken und sich beschweren.
Sonja, eine Österreicherin, besucht uns oft im Zimmer. Sie ist Buddhistin. Die letzten vier Jahre habe sie wiederholt und mutterseelenallein in einem abgelegenen tibetischen Kloster verbracht, um zu meditieren, erzählt sie. Das Kloster liegt in der Nähe des Dorfs Maniganggo auf dem Qinghai-Tibet-Plateau in über 4500 Meter Höhe. Die Kommunikation zwischen ihr und dem Lama, ihrem Lehrer, habe sich durch Telepathie abgespielt, denn der Lama spräche kein Englisch. „Aber der Lama weiß, was du denkst, denn in seinem meditativen Leben hat er bereits eine höhere Bewusstseinsstufe erreicht“, erklärt Sonja. Wie bitte? Der Lama weiß, was ich denke? Wie soll das denn funktionieren? Sonja spricht von dem, was ihr der Lama ohne Worte übermittelt hat: „Beobachte deine Gefühle und Gedanken und reagiere nicht darauf, dann hört das Leiden auf!“ Es klingt plausibel. Bei vierzig Grad Celsius unter dem Gefrierpunkt säße der Lama in den Wintermonaten im Zimmer, reguliere seine Körpertemperatur und meditiere. „Ich selbst hatte manchmal Angst, nicht wieder aufzuwachen!“, erzählt sie.
Sonja ist keineswegs überkandidelt. Dem Weltlichen hat sie nicht entsagt. Nach den Jahren in der Einsamkeit hat sie sich Markenjeans und schöne Kleider gekauft. Ihre Fußnägel hat sie rot lackiert. Buddhisten sollen Wünsche und Begehren, das „Anhaften“, wie sie es nennen, die Ursache des Leidens, überwinden. Sonja raucht und ist sich bewusst, dass sie abhängig ist. Sie steckt sich erst einmal eine Zigarette an und gibt der Sucht nach, ehe sich der Geist zu sehr beunruhigt. — John, „the book“, wohnt schon lange im Travellers Hostel. Er kommt aus England, ist von hagerer Statur und fahler Gesichtsfarbe, hinkt leicht und lebt von seiner Rente. Er ist der belesenste Mann weit und breit und kennt alle Klassiker der Weltliteratur. Er macht mich mit dem Gilgamesch-Epos vertraut, der ältesten Dichtung auf Erden, die im alten Babylon entstand. Bei ihm kann jeder gebrauchte Bücher ausleihen oder kaufen. Außerdem betreibt er einen kleinen Handel mit benutzter Kleidung. Jeden Tag studiert er die Hongkonger Zeitungen, verfolgt das Weltgeschehen und sammelt alle ihm wichtig erscheinenden Artikel. Sein Eisenbett im klitzekleinen Schlafsaal hat er mit Decken zugehängt, um sich, so gut es geht, in seine Privatsphäre zurückziehen zu können. Sein Krempel liegt unter dem Bett und stapelt sich in einer winzigen Nische daneben. Eigentlich lebt er nicht besser als ein Hongkong-Chinese in einem Mietkäfig. Warum nur? Warum macht er es sich nicht in England gemütlich? Wir unterhalten uns oft, doch persönliche Fragen wären aufdringlich und unangebracht.
Ernesto, ein schlanker Kanadier mit grau melierten Schläfen, tritt nur in gebügeltem Hemd und mit Krawatte auf. Er ist immer höflich und freundlich, ein Gentleman vom Scheitel bis zur Sohle, aber über sein Privatleben verrät er ebenfalls nichts.
Estella, vielleicht um die vierzig, kommt aus Venezuela. Wo sie geht und steht, trägt sie eine in Leder eingebundene Bibel unter dem Arm. Jeden, der ihr über den Weg läuft, versucht sie zu bekehren. Überall eckt sie an und die Bewohner unserer Herberge machen sich über sie lustig. Bei all den Gottlosen ringsum hat sie keine Chance, man verhöhnt und beleidigt sie und fährt sie an: „Verschwinde! Hau ab!“ Estella lässt sich nicht beirren, gleichbleibend freundlich verfolgt sie ihren Missionsgedanken und predigt mit hoher Fistelstimme von Jesus und der Liebe.
Serafino aus England verliebt sich in Malou, eine junge Frau von den Philippinen. Sie ist älter als er. Viele Filipinas kommen nach Hongkong, um zu arbeiten. Sie sind die Putzfrauen der Stadt. Sie träumen von einem Leben mit einem Ausländer aus dem Westen und versprechen sich davon den Himmel auf Erden, egal, ob der Zukünftige etabliert ist oder nicht. Malou hat es geschafft. Alle aus dem Travellers Hostel sind zur Trauung und zum Hochzeitsmahl geladen. Serafino ist glücklich über seine Malou und Malou ist froh, dass sie versorgt ist. (Ist sie das?) Die beiden ziehen in eine fensterlose Mansardenwohnung im Chunking Mansions. Ein Jahr später haben sie einen Sohn.
Kurz vor Weihnachten verlasse ich Hongkong. Es ist geschafft! Ich habe genug Geld für die Weiterreise gespart. Es müsste für das kommende Jahr reichen. Neue Abenteuer winken. Das chinesische Jahr des Schweins neigt sich dem Ende zu, eine Höllenzeit, die mit Glück nicht viel zu tun hatte. Das Jahr der Feuer-Ratte beginnt. Die Feuer-Ratte liebt ihre Selbständigkeit, reist gern und ist rege und energiegeladen.
Das Chunking Mansions in der Nathan Road, Kowloon, Hongkong
David will seine Englischkurse nicht aufgeben und weiter unterrichten. Er bleibt in der Enge, dem Gedränge und dem Lärm Hongkongs. Ich möchte die große Insel Hainan in Südchina besuchen und von dort aus durch die Provinzen Guangxi und Yunnan radeln, um dann das höchste Plateau der Erde zu erklimmen, das Quinghai-Tibet-Plateau.
Das Kulturzentrum am Hafen in Kowloon, Hongkong
Reisfelder in Guangdong
Dschunken in Chuncheng, Guangdong
GUANGDONG – EINE REGION IM AUFBRUCH
21.12.1995 – 01.01.1996: 710 Kilometer
David bringt mich und „Flöhchen“, mein Fahrrad, am Mittwochabend zur Fähre. Sie legt im Ocean Terminal ab und wird am nächsten Morgen Kanton erreichen. Das Boot ist alt und dunkel. Ich suche meine Koje, stelle das Gepäck ab und gehe an Deck. Das Sternzeichen Orion steht im Zenit, Weihnachtsgrüße erleuchten die Fassaden einiger Wolkenkratzer: Merry Christmas! Die Fähre tuckert Richtung Westen und biegt dann nach Norden in das Delta des Perlflusses ab. Sie fährt unter der noch nicht fertiggestellten, riesigen Brücke durch, die einmal die Insel Lantau mit dem Festland verbinden soll. Ich bin der einzige Passagier an Deck. Der Wind weht kalt und todmüde suche ich schließlich meine Koje auf.
Als ich am nächsten Morgen aufwache, liegen wir schon im Hafen von Kanton. Am bequemsten wäre es, die Fähre zur Insel Hainan zu nehmen, doch die fährt nur jeden zweiten Tag. Ich habe keine Lust, bis morgen zu warten und bepacke voller Energie mein Fahrrad. Mithilfe meines kleinen chinesischen Straßenatlasses gelange ich leicht aus der quirligen Großstadt Kanton hinaus. Eine Fußgänger- und Radfahrerfähre bringt mich über den Perl-Fluss. Weil ich kein Kleingeld parat habe, darf ich umsonst mitfahren und stehe glücklich zwischen Chinesen, die mit ihren uralten, verrosteten Rädern auf Deck gedrängt sind. Einige sind mit Körben, Taschen und Brettern schwer beladen.
Auf der anderen Seite des Flusses erreiche ich ein dörflich anmutendes Viertel mit niedrigen Häusern, Gassen und Märkten. In einem Straßenrestaurant vertilge ich eine gute und reichhaltige Nudelsuppe. Ein etwa Zwanzigjähriger, den ich nach dem Weg frage, schwingt sich auf sein Damenfahrrad und lotst mich durch das Verkehrsgetümmel in den Gassen zur großen Straße nach Foshan. Kilometer um Kilometer fährt er voraus, um mich an Ort und Stelle zu bringen. Ich mache ihm begreiflich, dass ich bis zur Insel Hainan radele, was ihm zu weit ist. Wir verabschieden uns. Einige Male muss ich noch nach dem Weg fragen, bis ich endlich die Route 325 gefunden habe. Die stark befahrene Straße ist breit, als Radfahrerin habe ich genug Platz und fühle mich sicher. Aber der Lärm! Das Hupen nimmt kein Ende, ein Lkw nach dem anderen rauscht an mir vorbei. Hunderte von Möbellagern reihen sich aneinander. In den offenen, riesigen Hallen stapeln sich Betten, Stühle und Tische. Irgendwo halte ich an und die Kellnerin in einem Restaurant serviert mir ein exzellentes Essen mit Tofu, Gemüse und Reis. Alle Bediensteten nehmen Anteil an meiner Tour. Sie umringen mich und platzen fast vor Neugier. „Woher kommst du?“, wollen sie wissen. „Wohin fährst du?“ Endlich erreiche ich die große Brücke über den Xi-Jiang und bald darauf – nach insgesamt achtzig Tageskilometern – die Stadt Heqing. Direkt an der Route 325 finde ich ein einfaches Hotel. Ich zahle dreißig Yuan (etwa vier Euro) für einen kleinen Raum, der höchstens die Hälfte wert ist. Eine kalte Dusche befindet sich über einem Stehklo. Todmüde falle ich ins Bett und weiß nur eines: Ich muss von der Route 325 weg.
Am nächsten Morgen biege ich nach Westen ab und fahre auf die Stadt Xinxing zu. Die vierspurige Straße der Zukunft wird von Seitenstreifen eingefasst. Sie ist für den Verkehr noch nicht freigegeben. Kaum ein Auto stört die Stille. Die Strecke führt durch das Grün einer Hügellandschaft. Einige Hänge sind mit Kiefern aufgeforstet. Reisfelder breiten sich in den flachen Tälern aus und dahinter liegen die niedrigen Häuser kleiner Dörfer. Der Anblick ist lieblich. Weit und breit gibt es um die Mittagszeit herum kein Straßenrestaurant. An einem klaren Fluss koche ich mir Haferbrei, um den Hunger zu stillen. Später tauchen mittelgroße Orte mit fünf- und sechsstöckigen Neubauten auf. An einer Stelle blasen Fabrikschlote Dreck in die Luft. Kleine Siedlungen liegen an Fischteichen.
Die Sonne steht schon tief. In einem Ort frage ich nach einem Restaurant, verzichte aber auf eine Mahlzeit, als ich die schmierige Küche sehe. Kurz darauf entdecke ich ein Plätzchen zum Zelten und koche Kartoffelbrei mit Thunfisch. Der Schein einer Taschenlampe flackert in der Dunkelheit auf, ein junger Mann hat mich entdeckt und rennt weg, als er mich sieht. „Nihau!“ – guten Tag – rufe ich in meinem besten Chinesisch hinterher, aber er ist auf der Flucht. Orion und die Plejaden leuchten über mir. Nach einem Jahr in der Enge Hongkongs schlafe ich wieder unter den Sternen und genieße die Ruhe, den Himmel, die frische Luft. Ich schlafe wie tot.
Am nächsten Morgen hat sich Nebel über die Landschaft gesenkt. Das Zelt ist nass und die Luft kühl. Ich packe langsam. Der junge Mann, der gestern vor mir weglief, winkt mir freundlich zu, als ich mich in Bewegung setze. Er wohnt in einem Häuschen am Anfang des Seitenwegs. Mittags im Restaurant sagt die Kellnerin: „You are welcome in our village!“.
Eine fünfundzwanzig Kilometer lange Nebenstrecke liegt vor mir. Sie besteht aus Schotter und führt ohne Steigungen an Feldern, Dörfchen und Fischteichen vorbei durch eine Hügellandschaft, durch das ländliche China. In einem Ort erstehe ich einen neuen Kochtopf und Milchpulver. Während meines Einkaufs hält ein Mann den Umstehenden einen Vortrag über die Funktionen der Gangschaltung an meinem Fahrrad, er zeigt auf die Hebel am Lenker und die Verbindungskabel zum Ritzel am Hinterrad. Er redet immer noch, als ich aus dem Laden trete. Überall blicke ich in freundliche und wohlwollende Gesichter.
Schnell erreiche ich Xinxing, eine mittelgroße Stadt. Ich lasse sie hinter mir, fahre ein paar Kilometer und gelange über einen Pfad hinunter auf eine sumpfige Wiese, auf der im Sommer die Büffel grasen mögen. Das Zelt setze ich auf ein Sandplateau in die Nähe eines plätschernden Bachs. Ich glaube mich allein im Tal, als plötzlich hohes Gekreisch vom gegenüberliegenden Berghang die Luft durchschneidet. Eine alte Frau keift mich aus der Ferne an. Ich winke ihr zu und möchte Kontakt aufnehmen, sie dreht sich um. Laut vor sich hin schimpfend kämpft sie sich von mir weg, einen Pfad entlang, und zieht zwei junge Eukalyptusbäume hinter sich her. Die Hänge sind mit frisch gepflanzten Kiefern und Eukalyptusbäumen überzogen. Ob sie die Bäume wohl abgehackt hat? Vielleicht zetert sie, weil ich sie beim Diebstahl entdeckt habe? Ich wasche mich und einige Sachen, koche eine Nudelsuppe, gucke in den Sternenhimmel und höre dem Plätschern des Baches zu. Ungestört schlafe ich bis zum nächsten Morgen.
Zelt und Wäsche sind vom Nebel nass geworden. Bis zum Mittag lasse ich mir Zeit und setze dann meine Reise fort. Ich erreiche die Bahntrasse. Die Straße verläuft südwärts durch ein ruhiges Flusstal, das sich später weitet. Soweit das Auge reicht, dehnen sich Gemüse-, Zuckerrohr- und Reisfelder aus. Sie werden mit der Hand bestellt, die Bauern arbeiten mit Geräten, die ihre Vorfahren bereits benutzt haben. Die Reisfelder sind schon abgeerntet, die Zuckerrohrernte ist voll im Gange. Jede einzelne Staude schlagen die Leute mit der Machete ab. Lasten tragen sie an zwei Meter langen Schulterstäben, an denen Eimer oder schaufelähnliche Körbe hängen, die mit Gemüse von dem Nachbarfeld gefüllt sind.