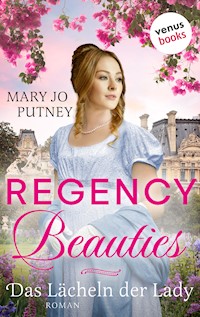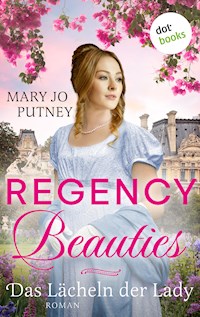4,99 €
0,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
0,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Samt und Seide
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Wenn zwei verletzte Seelen einander finden: Der opulente historische Roman »Im Land der wilden Orchideen« von Mary Jo Putney als eBook bei dotbooks. Obwohl die junge Laura Stephenson ihre neue Heimat Indien liebt, dieses prachtvolle Land voller Düfte und Farben, ist ein dunkler Schatten auf sie gefallen: Seit dem Tod ihres Stiefvaters fühlt sie sich ganz allein auf der Welt – und muss noch dazu sein schweres Erbe antreten. Aber kann einer englischen Rose wirklich zugemutet werden, in den Weiten des Dschungels auf die Jagd nach einem Tiger zu gehen, der die Menschen dort in Angst und Schrecken versetzt? Hilfe naht von unerwarteter Seite: Major Ian Cameron, ein alter Freund ihrer Familie, ist bereit, sie auf der Expedition zu begleiten. Obwohl Laura dies nie für möglich gehalten hätte, spürt sie bald, wie sich zwischen ihnen ein zartes Band entspinnt – doch so wie sie hütet auch er Geheimnisse, die eine Liebe zwischen ihnen unmöglich zu machen scheinen … Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der facettenreiche historische Roman »Im Land der wilden Orchideen« von Bestsellerautorin Mary Jo Putney. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 719
Ähnliche
Über dieses Buch:
Obwohl die junge Laura Stephenson ihre neue Heimat Indien liebt, dieses prachtvolle Land voller Düfte und Farben, ist ein dunkler Schatten auf sie gefallen: Seit dem Tod ihres Stiefvaters fühlt sie sich ganz allein auf der Welt – und muss noch dazu sein schweres Erbe antreten. Aber kann einer englischen Rose wirklich zugemutet werden, in den Weiten des Dschungels auf die Jagd nach einem Tiger zu gehen, der die Menschen dort in Angst und Schrecken versetzt? Hilfe naht von unerwarteter Seite: Major Ian Cameron, ein alter Freund ihrer Familie, ist bereit, sie auf der Expedition zu begleiten. Obwohl Laura dies nie für möglich gehalten hätte, spürt sie bald, wie sich zwischen ihnen ein zartes Band entspinnt – doch so wie sie hütet auch er Geheimnisse, die eine Liebe zwischen ihnen unmöglich zu machen scheinen …
Über die Autorin:
Mary Jo Putney wurde in New York geboren und schloss an der Syracuse University die Studiengänge English Literature und Industrial Design ab. Nach ihrem Studium übernahm sie Designarbeiten in Kalifornien und England, bis es sie schließlich nach Baltimore zog, und sie mit dem Schreiben begann. Mit ihren Büchern gelang es ihr, alle Bestsellerlisten in den USA zu erklimmen, unter anderem die der New York Times, des Wall Street Journals, der USAToday, und der Publishers Weekly.
Die Website der Autorin: maryjoputney.com/
Von Mary Jo Putney erscheinen bei dotbooks folgende Romane:
»Der Duft von wilden Granatäpfeln«
»Regency Beauties – Die Küsse des Lords«
»Regency Beauties – Das Lächeln der Lady«
***
eBook-Neuausgabe August 2022
Die amerikanische Originalausgabe erschien erstmals 1992 unter dem Originaltitel »Veils of Silk« bei Onyx. Die deutsche Erstausgabe erschien 1995 unter dem Titel »Indische Nächte« bei Lübbe
Copyright © der amerikanischen Originalausgabe Mary Jo Putney 1992
Copyright © der deutschen Erstausgabe 1995 by Gustav Lübbe Verlag GmbH, Bergisch Gladbach
Copyright © der Neuausgabe 2022 dotbooks GmbH, München
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover.
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Covergestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © shutterstock
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (mm)
ISBN 978-3-98690-309-1
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Im Land der wilden Orchideen« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Mary Jo Putney
Im Land der wilden Orchideen
Roman: Samt und Seide 2
Aus dem Amerikanischen von Kerstin Winter
dotbooks.
Für Mary Shea, der ich für ihre einzigartigen Beiträge zu meiner Schriftstellerkarriere danke. Und natürlich auch dafür, daß sie meine Freundin ist.
Über Indien
Indien besitzt eine der komplexesten und ältesten Gesellschaftsstrukturen der Welt, und allein der Gedanke an die Recherchen, die für den Hintergrund meiner Geschichte notwendig sein würden, schreckte mich zunächst ab. Aber da mein Held, Ian Cameron, nun einmal ein Offizier in der indischen Armee sein sollte, riß ich mich zusammen und sprang ins kalte Wasser.
Die meisten Amerikaner neigen dazu, sich das koloniale Indien so vorzustellen, wie es in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts gewesen ist. Doch dies ist nur ein kleiner Teil der Geschichte, da die langandauernde Einmischung Britanniens auf dem Subkontinent viele Phasen durchlaufen hat. Es begann in der Neujahrsnacht 1600, als Königin Elizabeth I. eine Charta unterzeichnete, die der East India Company, der Ostindischen Kompanie, exklusive Handelsrechte mit Indien versprach.
Die Company war aus rein kommerziellen Interessen gegründet worden, doch in den folgenden zweihundertfünfzig Jahren entwickelte sie sich zur mächtigsten Körperschaft, die es je gab. Nicht nur, daß »John Company« seine eigene Armee und Marine besaß; die Gesellschaft war auch für fast ein Fünftel der Weltbevölkerung verantwortlich.
Nach 1833 kümmerte die Company sich nicht mehr um Handel. Statt dessen wurde sie zu einer Korporation, die im Namen Großbritanniens Indien verwaltete. Die Company und die Regierung Ihrer Majestät waren so ineinander verwoben, daß die königlichen Truppen Seite an Seite mit den Einheiten der weit größeren indischen Armee dienten. Übrigens wurde zu der Zeit die britische Obrigkeit noch mit »Sirkar« betitelt; der Begriff »Raj« kam erst sehr viel später in Gebrauch.
Ausgedehnte Gebiete des Subkontinents unterstanden niemals direkter britischer Kontrolle. Über fünfhundert Staaten, von winzig bis riesig, wurden von einheimischen Fürsten regiert – eine Situation, die bis 1947, als das Land die Unabhängigkeit erlangte, anhielt. Die Fürstenstaaten hatten unterschiedliche Unabhängigkeitsgrade, und im Jahr 1841 war der mächtigste unter ihnen für die britische Herrschaft eine echte Bedrohung.
Der Sirkar mußte aber nicht nur mit Argusaugen über die mächtigen Fürsten und die plündernden Grenzstämme, sondern auch auf Rußland aufpassen, denn die Zaren hätten Indien nur zu gerne ihrem expandierenden russischen Reich einverleibt. Der verschleierte Konflikt zwischen russischen und englischen Agenten in Zentralasien ging als das »Great Game«, das »Große Spiel«, in die Geschichte ein, und es legte bereits das Muster für den kalten Krieg im 20. Jahrhundert fest.
Bis etwa zum Ende des ersten Viertels des 19. Jahrhunderts hatten Regierende und Soldaten enge Bindungen zu den Einheimischen, und nur wenig von dem abscheulichen Rassismus war zu merken, der die spätere Kolonialperiode kennzeichnete. Die Company ermutigte sogar ihre Angestellten, sich einheimische Frauen oder Geliebte zu nehmen, da es so wenig europäische Frauen in Indien gab. Gemischtes Blut war kein gewaltiges Stigma, und viele distinguierte Männer wie Premierminister Lord Liverpool oder Feldmarschall Lord Roberts hatten indische Vorfahren.
Ein Paradigma für die Rassensituation war die Eliteeinheit der indischen Kavallerie, die als »Skinner’s Horse« bekannt war. Sie wurde von James Skinner gegründet, dem Sohn eines britischen Offiziers und einem Rajputen-Mädchen. Ende des 19. Jahrhunderts hätte Skinners gemischtes Blut dafür gesorgt, daß er in seinem eigenen Regiment nicht hätte dienen dürfen.
Als das Reisen einfacher wurde, kamen mehr Europäer nach Indien, und der Einfluß von Frauen, Missionaren und Moralisten veränderte die Atmosphäre. Britische Offiziere verbrachten weniger Zeit mit ihren Männern, die sozialen Grenzen verhärteten sich und trugen zum berüchtigten Sepoy-Aufstand im Jahre 1857 bei. Der Aufstand läutete das Ende von John Company ein, da das Parlament danach beschloß, Indien wäre zu wichtig, um es der Obhut einer privaten Gesellschaft zu überlassen. Die britische Regierung übernahm also die direkte Kontrolle, die Company-Institutionen wie die höchst geschätzte Zivilverwaltung und die indische Armee eingeschlossen.
Eine Bemerkung zur Sprache. Die meisten pakistanischen und nordindischen Sprachen sind sich sehr ähnlich und stammen vom Persischen früherer Invasoren ab. Eine Form des Urdu war die Verkehrssprache der Armee, Persisch wurde von der Elite gesprochen. Heute sind Hindi und Urdu mehr oder weniger die gleiche Sprache, werden aber in verschiedenen Schriften geschrieben und gemeinhin als Hindustani bezeichnet.
Einheimische Fürsten, der erste afghanische Krieg und Ereignisse, die bereits die Rebellion sechzehn Jahre später erahnen ließen: Für einen Autor ist das Material fast schon allzu reichlich. Obwohl die Beziehung zwischen Ian und Laura der Kern der Geschichte ist, habe ich dennoch versucht, den faszinierenden geschichtlichen Fakten als Hintergrund gerecht zu werden. Ich hoffe, Sie werden Ihre imaginäre Reise nach Indien genauso genießen, wie ich es beim Schreiben getan habe.
Alles hat seine Zeit,
Ein jegliches hat seine Zeit, und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde:
geboren werden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit;
pflanzen hat seine Zeit, ausreißen, was gepflanzt ist, hat seine Zeit;
töten hat seine Zeit, heilen hat seine Zeit;
abbrechen hat seine Zeit, bauen hat seine Zeit;
weinen hat seine Zeit, lachen hat seine Zeit;
klagen hat seine Zeit, tanzen hat seine Zeit;
Steine wegwerfen hat seine Zeit, Steine sammeln hat seine Zeit;
herzen hat seine Zeit; aufhören zu herzen hat seine Zeit;
suchen hat seine Zeit, verlieren hat seine Zeit;
behalten hat seine Zeit, wegwerfen hat seine Zeit;
zerreißen hat seine Zeit, zunähen hat seine Zeit;
schweigen hat seine Zeit, reden hat seine Zeit;
lieben hat seine Zeit, hassen hat seine Zeit;
Streit hat seine Zeit, Friede hat seine Zeit.
Der Prediger Salomo, 3.1 – 3.8
Prolog
Bombay, HafenSeptember 1841
Ian Cameron hätte sein einziges Auge nicht gebraucht, um Bombay wiederzuerkennen; allein der Geruch hätte ausgereicht, Indien zu identifizieren. Als der Schoner langsam in den Hafen glitt, wurde seine Nase von den Aromen der Gewürze, Blumen und dem schwachen, doch immer darunter lauernden Gestank des Verfalls attackiert. Die lebhaften Farben waren nicht minder intensiv. Die leuchtenden Rot- und Goldtöne waren nach den sanften Schattierungen der See fast ein Schock für das Auge.
Das Schiff krängte in ein Wellental, und Ian packte die Reling mit seiner linken Hand. Die lauten Geräusche und das lebendige Treiben auf den Docks weckten in ihm die Sehnsucht nach der Stille der zentralasiatischen Wüste, die er durchquert hatte, nachdem er aus Buchara hatte entkommen können. Er hatte sich so auf das nackte Überleben konzentrieren müssen, daß er die subtilen Laute der Wüste nicht hatte schätzen können, die ihn sanft auf seine Rückkehr ins Land der Lebenden hatten vorbereiten wollen.
In den nachfolgenden Wochen mit seiner Schwester Juliet und deren Ehemann Ross hatte es ihn immense Kraft gekostet, seine Beherrschung nicht zu verlieren, sich Scherze abzuringen und vorzugeben, er litte unter nichts, was sich nicht mit ein wenig Zeit und ein paar anständige Mahlzeiten kurieren ließe. Doch trotz all der Mühe hatte er starke Zweifel, daß er überzeugend gewesen war. Und er hatte sich fast unverschämt erleichtert gefühlt, als die Zeit kam, endlich allein nach Indien zu seinem Regiment zurückzukehren.
In Gedanken versunken rieb Ian sich die schwarze Klappe, die sein rechtes Auge verdeckte, dann fuhr er sich mit der Hand durch sein kastanienbraunes Haar. Sein Kopf schmerzte, aber nicht so stark wie sonst. Vielleicht lag es daran, daß er endlich wieder in dem Land war, das für ihn die meiste Zeit seines Erwachsenenlebens Zuhause bedeutet hatte. Die letzten zwei Jahre in der Hölle, hatte er sich nichts mehr gewünscht, als nach Indien und zu seiner Verlobten zurückkehren zu dürfen.
Georgina. Goldhaarige, anmutige Georgina, das begehrteste englische Mädchen in Nordindien. Ian bemerkte, daß sich sein Herzschlag beschleunigte, sowohl aus freudiger Erwartung als auch aus ängstlicher Spannung. Er zwang sich, tief und ruhig zu atmen, bis die Furcht abebbte. Mehr als Indien, mehr als seine Freunde brauchte er nun den Anblick Georginas, brauchte er sie in seinen Armen. Dann würde er wirklich gesund werden.
Seine Fingerknöchel wurden weiß, als seine Hand die Reling fester umklammerte. Mit Gottes Hilfe würde er es schaffen.
Kapitel 1
Baipur, Stationnördliches Zentralindien
Wieder Alpträume. Mit einem unterdrückten Aufschrei fuhr Laura in ihrem Bett hoch. Eine Hand schlug noch nach dem Moskitonetz, das sie umgab. Zitternd vergrub sie das Gesicht in ihren Händen.
Als die Furcht langsam nachließ, machte sie sich in bitterer Ironie selbst Vorwürfe, daß sie sich von den Alpträumen derart aus der Fassung bringen ließ, obwohl sie doch alle alte Freunde waren. Sie hatten begonnen, als sie sechs Jahre alt war und sie zum ersten Mal die schreckliche, zerstörerische Wildheit miterleben mußte, die es zwischen Mann und Frau geben konnte.
Mit der Zeit waren die Alpträume durch neue Szenen ergänzt worden. Die schlimmste handelte von der Katastrophe, die ihre Kindheit vernichtet hatte, obwohl die Bilder sich nicht auf ihre Jahre als Larissa Alexandrowna Karelian beschränkten. Nein, eigentlich hatte das demütigendste Ereignis stattgefunden, als sie bereits Laura Stephenson geworden war.
Seit einiger Zeit kamen die Alpträume seltener und gewöhnlich dann, wenn Veränderungen bevorstanden. Doch unglücklicherweise hatten die Bilder nichts von ihrer Intensität verloren. Angst, Abscheu und Scham. Leidenschaft, Katastrophe, Tod.
Erschöpft strich sich Laura das helle Haar aus der feuchten Stirn. Meistens war sie eine vernunftbegabte, fast schon zu ruhige und beherrschte junge Frau von vierundzwanzig Jahren. In ihren Träumen aber war sie stets ein verschrecktes, vor Angst halb wahnsinniges Kind, und kein Heranreifen und Erwachsenwerden hatten das zu ändern vermocht. Wahrscheinlich sollte sie dankbar sein, daß die entsetzlichen nächtlichen Bilder höchstens zwei- bis dreimal im Jahr kamen.
Zudem kam es ihr absurd vor, von Alpträumen heimgesucht zu werden, obwohl die nahende Veränderung ihr willkommen war. Morgen würden sie und ihr Stiefvater zu einer Rundreise durch den Distrikt aufbrechen, einem der angenehmsten Teile ihrer jährlichen Routine. Nichtsdestoweniger hatte die Aussicht darauf ihre schlafenden Dämonen zu einer ihrer regelmäßigen Attacken geweckt.
Die Luft hatte sich auf eine angenehme Temperatur abgekühlt, und auf der Veranda klingelten die Glöckchen leise in einer lauen Brise. Laura hob das Moskitonetz und schwang ihre Beine aus dem Bett. Barfüßig tappte sie zum Fenster hinüber, ohne auf mögliche Skorpione zu achten, und entdeckte das erste Licht des frühen Tages am östlichen Horizont. Um so besser – so mußte sie wenigstens nicht mehr ins Bett zurück.
Wie so viele Briten in Indien hatten sie und ihr Stiefvater die Angewohnheit, frühmorgens auszureiten, bevor die Hitze des Tages sich über das Land legte. Bald würde auch er aufstehen, und sie würden zusammen Tee und Toast zu sich nehmen. Nach dem Ausritt würde er sich seinen Pflichten als Inkassobeamter des Distrikts widmen, während sie sich um die tausend Einzelheiten kümmern würde, die nötig waren, um das Haus zu schließen und die morgige Abreise vorzubereiten. Es würde ein geschäftiger, vorhersehbarer Tag werden.
Laura blieb noch eine Weile am Fenster stehen, lauschte den zarten Klängen der Glöckchen und nahm die Geräusche und den schweren Duft der Nacht in sich auf. Die warme Brise liebkoste ihr Gesicht, und die wollüstige, samtige Finsternis schien sie zu rufen. Indiens innerstes Wesen war Leidenschaft, und manchmal – fast zu oft – sehnte sie sich danach, sich ihr zu unterwerfen. Ohne sich dessen bewußt zu sein, ließ sie eine Hand über ihren Körper gleiten, strich sich über Brüste und Hüften, als sie das warme Pulsieren unter dem dünnen Musselinhemd wahrnahm.
Dann bemerkte sie, was sie tat, spürte die Röte in ihre Wange steigen und wandte sich ab von der sinnlichen Gefahr der Nacht.
Laura suchte gerade Proviant im Küchenhaus zusammen, als der Bursche ihres Vaters hereinkam, um zu melden, daß der Schlichtungsbeamte einen Besuch abstatten wollte. Sie zog ihre Nase kraus, denn Gäste konnte sie im Augenblick gar nicht gebrauchen. »Danke, Padam. Sag Mr. Walford, daß ich sofort komme.«
Sie nahm den überdachten Weg vom Küchenhaus zum Bungalow und ging zuerst in ihr Zimmer, um ihr Aussehen zu überprüfen. Wie nach Stunden herumwirtschaften zu erwarten war, sah sie aus, als hätte man sie durch ein Dickicht geschleift: Aus dem Knoten an ihrem Hinterkopf hatten sich zahlreiche Strähnchen gelöst, die nun wild um ihren Kopf standen. Das kümmerte sie nicht besonders, ihr verschwitztes, am Körper klebendes Kleid jedoch sehr wohl, denn das letzte, was sie wollte, war, Emery Walford zu provozieren. Sie rief ihr Mädchen und zog ein formloses, weißes Musselinkleid an. Dann ging sie, um ihren Gast zu begrüßen.
Die Veranda, über die sich blühende Ranken spannten, war der schönste Teil des flachen Gebäudes. Als Laura erschien, erhob sich der Beamte, ein großer, schüchterner junger Mann, augenblicklich. »Guten Morgen, Laura«, sagte er. »Ich weiß, daß Sie viel zu tun haben müssen, aber ich wollte Ihnen noch auf Wiedersehen sagen, bevor Sie abreisen.« Er schluckte und setzte dann einfallslos hinzu: »Es ist ziemlich heiß heute.«
»Doch bald wird das kühle Wetter für sechs wundervolle Monate Einzug halten.« Laura bedeutete ihm, sich hinzusetzen, und suchte sich einen Korbsessel, der in sicherer Entfernung von dem seinen stand. Dennoch war sie sich sehr deutlich seines Verlangens bewußt. Seit sie vierzehn war, warfen Männer ihr lüsterne Blicke zu, und selbst mit geschlossenen Augen konnte sie das heiße, wortlose Drängen der männlichen Gier spüren.
Gott allein mochte wissen, warum so viele Männer sie begehrten, denn sie war keine Schönheit und tat ganz gewiß nichts, was Verehrer ermutigen könnte. Trotzdem war die verlangende Bewunderung stets vorhanden, bei den meisten Männern allerdings durch die Erziehung gezügelt und daher kein Problem. Emerys unverhohlenes Verlangen jedoch brachte sie immer wieder in Verlegenheit. Und das war schade, denn sie mochte seine Intelligenz und seine freundliche Ernsthaftigkeit. Sie hätten bessere Freunde sein können, wenn er nicht so offensichtlich hinter ihr her gewesen wäre.
Als Tee und Jelabi-Kuchen serviert waren, sagte der junge Beamte: »Wäre es denn nicht günstiger, auf kühleres Wetter zu warten, bevor Sie die Reise antreten? Die Hitze ist so ermüdend!«
»Aber das Lagern im Freien ist sehr anregend«, antwortete sie mit einem Lächeln. »Wir freuen uns schon seit Wochen darauf. Vater meint, die Reise durch seinen Distrikt ist das Wichtigste überhaupt an seinem Amt.«
Mit niedergeschlagenen Lidern rührte Emery in seinem Tee. »Ich ... wir werden Sie und Ihren Vater auf der Station vermissen.«
»Wir sind zurück, bevor Sie es bemerken«, sagte sie.
»Erst kurz vor Weihnachten.« Er zögerte, als müßte er sich sammeln, um etwas Wichtiges zu sagen.
»Die Wildschweinsaison kommt, und Sie werden sehr viel zu tun haben«, warf Laura ein und wechselte damit geschickt das Thema. »Vater sagt, Sie haben ein herrliches neues Pferd von einem afghanischen Händler erstanden?«
Emerys Miene hellte sich auf, und er begann sein Pferd zu beschreiben, was sie sicher durch den Nachmittagstee lavierte. Laura nickte an den richtigen Stellen, nippte an ihrem Tee, konnte aber das unangenehme Wissen einfach nicht verdrängen, daß sie Emery nicht dauernd auf Abstand halten konnte. Früher oder später würde er um ihre Hand anhalten. Dieser Antrag war noch nicht einmal besonders schmeichelhaft, denn mindestens die Hälfte aller britischen Junggesellen, die sie in Indien kennengelernt hatte, hatten dies getan. Europäische Mädchen waren so knapp gesät, daß selbst pferdegesichtige und spitzzüngige Damen haufenweise Anträge erhielten.
Dennoch – obwohl die Frage unvermeidlich kommen würde, wollte sie das Thema so lange wie möglich hinausschieben, denn ihre Ablehnung würde nur eine unbehagliche Atmosphäre schaffen. Die wenigen Briten in Baipur lebten auf sehr engem Raum miteinander, und alles, was Spannung erzeugte, war zu vermeiden.
Was wäre so falsch daran, sie ließe sich dazu verleiten, anzunehmen, denn Emery war liebenswert und sehr attraktiv. Mehr als einmal hatte sie sich bei dem Gedanken ertappt, daß er ganz und gar anders als Edward war, so daß eine Ehe mit ihm ihr Sicherheit bieten konnte. Es wäre sicher ein Vergnügen, seine starken Arme um sich zu spüren, seine Lippen auf ihren, seine Hände...
Immer wenn ihre Gedanken diesen Punkt erreicht hatten, wurden die Tagträume in einer Woge von Panik ertränkt. Das Problem war nicht Emery, sondern sie, und eine Ehe stand außer Frage.
Sie trank ihren Tee, stand auf und streckte ihm ihre Hand entgegen. »Ich möchte nicht unhöflich sein, Emery, aber ich muß zu meiner Arbeit zurück. Ansonsten stellen wir demnächst tief im Landesinnern fest, daß uns Tee, Chinin oder sonst etwas Essentielles fehlt.«
»Wenn Sie etwas benötigen, dann lassen Sie mir eine Nachricht zukommen. Ich sorge dafür, daß es Ihnen augenblicklich geschickt wird.« Der junge Mann mochte ihre Hand nicht loslassen. »Laura... ich muß Ihnen noch etwas sagen.«
Bevor es jedoch dazu kam, nahte die Rettung in Gestalt von Lauras Stiefvater. Als Kenneth Stephenson die Treppe zur Veranda emporstieg, erfaßte er auf einen Blick die Situation, und in seinen hellblauen Augen erschien ein amüsiertes Funkeln. »Guten Tag, Emery. Sie wollten gerade gehen?«
Emery wurde rot und ließ Lauras Hand los. »Ja. Ich... ich bin nur vorbeigekommen, um Ihnen und Laura eine gute Reise zu wünschen.« Sein sehnsuchtsvoller Blick berührte Laura einen kurzen Augenblick, dann wandte er sich ab. »Ich freue mich auf Ihre Rückkehr.«
Als der junge Mann sich auf sein Pferd geschwungen und weggeritten war, bestellte Laura noch ein Tablett mit Erfrischungen. »Du bist im allerletzten Moment gekommen, Vater. Ich glaube, Emery wollte gerade zu einem Antrag ansetzen.«
Mit ernster Stimme antwortete Kenneth Stephenson: »Du könntest schlechter wählen. Er ist vielleicht ein wenig grün, aber für manche Mädchen bestimmt ein ganz ausgezeichneter Ehemann. Er stammt aus guter Familie, ist umgänglich und macht seine Arbeit sehr gut. Er wird es weit bringen.«
»Ich gönne es ihm«, sagte Laura leichthin. »Ich bleibe lieber bei dir – du bist eine weit bessere Gesellschaft.«
Ihr Stiefvater lächelte ein wenig traurig. »Du solltest wirklich eine eigene Familie gründen, Laura.«
Diese Diskussion war nicht neu. »Du bist meine Familie«, erwiderte sie. »Du brauchst mich. Jemand muß nach dir sehen und aufpassen, daß du vernünftig ißt!«
Er spielte mit einem knusprigen Jelabi. »Ich werde nicht immer bei dir sein, Liebes.«
Betroffen von seinem Tonfall, musterte Laura sein Gesicht. Es war leicht, die subtilen Anzeichen des Alters bei jemanden zu übersehen, mit dem man täglich zusammen war. Nun stellte sie plötzlich schockiert fest, wie dünn er geworden war, wie viele Falten seine sonnengebräunte Haut durchzogen und wie grau sein Haar schon war. Er war älter als die meisten Distrikt-Offiziere, und das Leben in Indien war auch für junge, kräftige Menschen mühselig. »Du arbeitest zuviel. Vielleicht solltest du langsam in den Ruhestand treten, damit wir nach England zurückkehren können.«
»Was denkst du eigentlich wirklich über Indien?« fragte er. »Ich wäre zufrieden, den Rest meines Lebens hier zu verbringen, aber für eine junge Frau ist das Leben nicht leicht. Manchmal überlege ich, ob du nicht einfach vorgibst, glücklich zu sein, nur damit ich kein schlechtes Gewissen haben muß, dich hierhergeschleppt zu haben.«
»Du hast mich nicht ›geschleppt‹ – ich habe darauf bestanden, mitzukommen, weißt du noch?« Laura blickte abwesend auf die saftig-grüne Landschaft, während sie überlegte, was sie sagen sollte. »Es tut mir nicht leid, hier zu leben. Das Land und die Leute sind faszinierend, und ich verstehe, warum du sie so liebst. Doch selbst nach fünf Jahren empfinde ich das Land noch als fremd. Ich werde es niemals begreifen.«
»Man braucht nicht zu begreifen, um zu lieben«, sagte er voller Zuneigung. »Du hast einen starken russischen Anteil in dir, den ich nie verstehen werde, aber deswegen liebe ich dich kein bißchen weniger.«
»Ich bin keine Russin – ich bin eine zivilisierte Engländerin.« Um es zu beweisen, schenkte sie sich Tee nach und fügte eine große Menge Milch hinzu. »Ich bin nur zufällig in Rußland geboren.«
»Und hast da gelebt, bis du neun warst. Das können die Jahre in England auch nicht ändern.« Kenneth lächelte. »Wenn du mich mit deinen funkelnden, goldenen Augen so ansiehst, bist du ganz und gar das Abbild deiner Mutter, und keiner war russischer als Tatjana.«
»Aber ich bin ihr nur äußerlich ähnlich«, sagte Laura mit Unbehagen. »Sonst nicht!«
Er schüttelte den Kopf, verfolgte das Thema aber nicht weiter, sondern suchte ihren Blick und hielt ihn fest. »Wenn mir etwas zustößt, dann versprich mir, Liebes, daß du nicht zu lange trauerst und ernsthaft über die Ehe nachdenken wirst.«
Alarmiert stellte Laura ihre Tasse ab und starrte ihren Stiefvater an. »Das ist aber ein merkwürdiges Gespräch. Gibt es etwas, das du mir verschweigst? Geht es dir nicht gut?«
»Nein, nein, nichts dergleichen.« Er zuckte die Schultern. »Es ist nur die Sache mit dem Brahmanen, der einmal mein Horoskop erstellt hat. Er sagte, ich würde kurz nach meinem sechzigsten Geburtstag sterben.«
Und sein Geburtstag war eine Woche zuvor gewesen. Laura hatte das Gefühl, als streifte ein eisiger Windhauch ihren Nacken. »Das ist doch Unsinn, Vater! Wie kann ein abergläubischer Heide wissen, wann du stirbst?« rief sie.
»Vielleicht hat sich der Priester ja geirrt. Aber er könnte schließlich auch recht gehabt haben. Ich habe in Indien schon viele Dinge gesehen, die nach westlichen Maßstäben unerklärlich sind.« Kenneth sprach mit ruhiger Stimme. »Wahrscheinlich habe ich mir ein bißchen vom östlichen Fatalismus angeeignet, denn der Gedanke an den Tod schreckt mich nicht besonders. Ich habe eine Bestandsaufnahme meines Lebens gemacht und bin recht zufrieden mit dem, was ich erreicht habe.« Er seufzte. »Aber ich mache mir Sorgen, was mit dir geschehen wird. Ich hätte mich mehr um meine Geldangelegenheiten kümmern sollen, denn ich habe nicht viel, was ich dir hinterlassen kann.«
»Du hast mir alles gegeben, was man sich wünschen kann«, gab sie in behutsamem Tonfall zurück. »Du brauchst dir keine Gedanken zu machen. Ich kann sehr gut für mich selbst sorgen.«
»Das weiß ich, aber das Leben besteht aus mehr als nur aus Überleben«, sagte er weich. »Es bedeutet auch Kameradschaft, Freundschaft, Liebe. Ich habe Angst, daß du dich dafür entscheidest, den Rest deines Lebens allein zu verbringen, und dadurch viele schöne Dinge verpaßt.«
Laura biß sich auf die Lippe. Unglücklich erkannte sie, daß ihr Vater ihre generelle Abneigung gegen die Ehe erkannt hatte. Sie würde das Thema nicht näher besprechen, nicht einmal mit ihrem Stiefvater, da ohnehin nichts ihre Meinung ändern konnte. Aber wenn eine Unwahrheit seinen Seelenfrieden erhalten würde, dann wollte sie gerne ein bißchen lügen. »Das Leben ist ungewiß, besonders hier in Indien – du könntest glatte zwanzig Jahre länger leben als ich.« Sie schauderte übertrieben zusammen. »Aber ich verspreche dir, wenn dir etwas passiert, halte ich nach einem Ehemann Ausschau. Eine Frau braucht einen Mann, wenn auch nur, um das richtig fette Ungeziefer zu erschlagen. Du weißt, wie sehr ich Tausendfüßler hasse.«
Kenneth lachte in sich hinein, und seine Miene wurde weicher. »Wenn du heiraten solltest, dann findest du bestimmt noch eine andere Verwendung für deinen Mann. Wenn du mich nicht mehr bemuttern mußt, wirst du feststellen, wie nett die Gesellschaft junger Männer sein kann.«
Vielleicht würde sie das ja tatsächlich, aber Heiraten käme trotzdem nicht in Frage. Niemals.
Kapitel 2
Cambay StationNordindien
In seinem Bestreben, endlich zu seinem Regiment zurückzukehren, verbrachte Ian Cameron nur zwei Tage in Bombay. Nachdem er seine Bank und einen Schneider aufgesucht hatte, kaufte er das beste Pferd, das er finden konnte, Gewehr und Revolver, und begab sich auf den langen Weg nach Cambay. Er machte sich nicht erst die Mühe, eine Nachricht vorauszuschicken – er würde genauso schnell ankommen wie der Brief.
Er ritt in nordöstliche Richtung durch die weiten, grünen Ebenen, die sich vom Arabischen Meer bis zum Golf von Bengalen erstreckten, doch er fand wenig Freude an den vertrauten Bildern von fröhlichen Menschen, farbenprächtigen Tempeln und geduldigen Wasserbüffeln. In den endlosen Monaten im Schwarzen Brunnen von Buchara war er sicher gewesen: wenn er jemals freikam, wenn er wieder im Sonnenlicht stehen konnte, dann würde sein Leben wieder normal werden.
Statt dessen schien die Finsternis des Kerkers in seine Seele gedrungen zu sein. Tag und Nacht – besonders des Nachts – plagte ihn die Angst, daß das Dunkel ihn ganz einhüllen könnte. Nur Georgina konnte die Schatten vertreiben, und der Wunsch, sie zu sehen, brachte ihn dazu, sein Pferd bis zum äußersten zu strapazieren. Er dachte kaum daran, zu rasten oder zu essen. Zudem zog er es vor, den Schlaf zu meiden, denn er fürchtete die entsetzlichen Träume. Gewöhnlich handelten sie vom Schwarzen Brunnen, und er wachte jedesmal mit dem Gefühl quälender Einsamkeit auf und meinte, ersticken zu müssen.
Manchmal jedoch hatte er einen geheimnisvollen, unerklärlichen Traum von einem Feuer – ein wütendes Inferno, das über das Land tobte. Daraus erwachte er stets vor Furcht zitternd und in dem Wissen, daß er etwas tun mußte, um den Brand aufzuhalten. Aber was, daran konnte er sich nie erinnern.
Im großen und ganzen war es also besser, gar nicht erst zu schlafen.
Die Straße zum Quartier des 46. Eingeborenen-Infanterieregiments führte über eine Brücke. Oben angelangt, hielt er an und starrte auf die Ebene vor sich. Nichts schien sich in den zwei Jahren, die er fortgewesen war, verändert zu haben. In der Ferne wurden Truppen auf dem Maidan, dem Paradeplatz, gedrillt, und die forschen Schritte und Kehrtwendungen wirbelten Staubwolken auf, die der Wind davonwehte. Etwas näher befanden sich die Baracken, die Vorratslager und Bungalows in militärischer Präzision an einem verzweigten, ausgedehnten Straßennetz.
Endlich erlaubte er sich, zu Colonel Whitmans geräumigem Bungalow hinüberzublicken. Es war später Nachmittag, also müßte Georgina zu Hause sein und sich zum Dinner ankleiden. Wenn nicht – nun, sie würde nicht weit fort sein. Innerhalb der nächsten zwei Stunden würde er sie in die Arme schließen können, und dann hätten seine Alpträume endlich ein Ende.
Ungeduldig trieb er sein Pferd hinunter in die geschäftigen Straßen, wo Soldaten und Zivilisten ihren üblichen Aufgaben nachgingen. Ungläubige Blicke folgten ihm, als er vorbeiritt, und ein- oder zweimal glaubte er, seinen Namen flüstern zu hören, aber er hielt nicht an. Später würde er noch genug Zeit zum Reden haben.
Als er sein Ziel erreicht hatte, stieg er ab und hastete, immer zwei Stufen auf einmal nehmend, die Treppe zum Bungalow hinauf. Wahrscheinlich wäre es klüger gewesen, sich zuerst eine Bleibe zu suchen, damit er sich waschen und umziehen und eine Nachricht an Georgina schicken konnte, die sie über seine Rückkehr informierte. Aber wie seine Mutter immer sagte, war noch niemand an guten Nachrichten gestorben, und er wollte nicht eine Minute länger auf das Wiedersehen mit seiner Verlobten warten.
Auf Ians Klopfen öffnete der Bursche des Colonels, der gleichzeitig die Funktion des Butlers innehatte. Unbeeindruckt von der verstaubten Erscheinung des Besuchers fragte er höflich: »Kann ich Ihnen helfen, Sahib?«
»Erkennst du mich nicht, Ahmed?« fragte Ian und nahm seinen Topi, den breitrandigen Tropenhelm ab, den alle Europäer trugen, um sich vor der gleißenden indischen Sonne zu schützen.
Die Kinnlade des Mannes fiel herab. »Major Cameron?«
»Höchstpersönlich. Ein wenig älter, wahrscheinlich nicht weiser, aber grundsätzlich gesund. Ist Miss Georgina da?«
»Sie ist im Gartenzimmer, Sahib, aber...«
Ian schnitt dem Burschen das Wort ab. »Melde mich nicht an – ich will sie überraschen!« Und schon eilte er durch den Hauptraum des Bungalows, und sein Herz hämmerte in dem Wissen, daß die Rettung nur noch ein paar Schritte entfernt war.
Das Gartenzimmer war ein hübscher, schattiger Teil der Veranda, der zu Mrs. Whitmans spektakulären Blumenbeeten hinausführte. Und dort – wie die Schale mit Gold am Ende eines Regenbogens – saß Georgina. Sie hatte Ians Schritte nicht gehört, und so blieb er in der Tür stehen, um ihren Anblick zu genießen, wie sie auf dem Korbsofa mit ihrer Stickerei beschäftigt war.
Die Monate der Gefangenschaft hatten ihr Bild in seiner Erinnerung verschwimmen lassen, doch nun fragte er sich, wie er je ihre zarten Gesichtszüge, die goldschimmernden Kringellöckchen und ihren wunderbar edlen Hals hatte vergessen können. In ihrem fließenden rosafarbenen Kleid wirkte sie so süß, so frisch und so ausgesprochen weiblich ... all die Eigenschaften, nach denen er sich im Kerker so gesehnt hatte!
Sein Heilmittel war in greifbarer Nähe. Leise rief er: »Georgina!«
Sie schaute auf, dann stockte ihr der Atem, und sie ließ ihre Stickerei fallen. Ihre Miene zeigte mehr als Überraschung; es war Entsetzen!
Ihre Reaktion machte Ian schmerzlich bewußt, welchen Anblick er bieten mußte: Klapperdürr, verstaubt, in einer zu weiten Uniform, eine schwarze Klappe über einem Auge. Was für ein Narr war er gewesen, gleich hierher zu kommen; möglich, daß sie ihn gar nicht erkannte. Bemüht, heiter zu wirken, sagte er: »Ich gebe zu, daß ich etwas nach Bandit aussehe, bis zur Unkenntlichkeit habe ich mich aber doch nicht verändert.«
»Ian!« Sie versuchte sich zu erheben, sank dann jedoch ohnmächtig aufs Sofa zurück.
Ian verfluchte sich heftig, während er zum Sofa ging und ihre zusammengesunkene Gestalt so platzierte, daß ihre Füße etwas höher als der Kopf gelagert waren. Sie duftete nach Parfüm und war weich und rund, wie eine Frau es sein sollte.
Dann flatterten ihre blaßgoldenen Wimpern auf, und sie starrte den Mann an, der neben ihr kniete. »Ian.« Sie legte ihm unsicher eine Hand auf die Wange. »Gütiger Himmel, du bist es wirklich.«
Er wollte etwas antworten, dann hielt er inne. Es war, als ob man ihm eine Faust in den Magen gerammt hatte. Die Hand, die Georgina erhoben hatte, war ihre linke, und am Ringfinger trug sie einen goldenen Reifen.
Er packte ihre Hand und starrte den Ring an. Es war ein Ehering, daran gab es keinen Zweifel, und sie trug ihn zusammen mit einem Diamantring, der nicht derselbe war, den er ihr zur Verlobung gegeben hatte.
Sein Blick verschleierte sich. Er ließ ihre Hand fallen und stand auf, ohne es recht glauben zu wollen. Dann entdeckte er den Grund für Georginas Rundlichkeit: Sie mußte im vierten oder fünften Monat schwanger sein. Mit heiserer Stimme, die er kaum als seine identifizieren konnte, sagte er: »Ich hatte gehofft, daß meine Abwesenheit die Gefühle vertiefen würde, aber offenbar bedeutet für dich: Aus den Augen, aus dem Sinn. Ist der Glückliche jemand, den ich kenne?«
»Gerry Phelps«, antwortete sie schwach und preßte sich eine Hand an die Kehle.
Natürlich. Der ehrenhafte Gerry Phelps, Ians Freund und Rivale, seit sie zusammen als Kadetten auf der Militärakademie von Addiscombe gewesen waren – und zudem hartnäckigster Verehrer Georginas neben ihm selbst. Ians Gesicht verzog sich. »Ich hätte es mir denken können. Gerry wollte dich schon immer haben. Warum hast du ihn nicht sofort genommen, statt erst so zu tun, als würdest du mich lieben?«
Ihre helle Stimme brach. »Ich habe nicht so getan, als ob, Ian, aber alle haben mir gesagt, du seist tot! Ich habe eine Woche geweint, als die Nachricht eintraf.«
»Und dann die Tränen getrocknet und Gerry geheiratet«, beendete Ian bitter den Satz. Er warf einen Blick auf ihre Mitte. »Du hast ja nicht viel Zeit mit Trauer verschwendet!«
Georgina begann zu weinen. Tränen taten ihrer Schönheit keinen Abbruch, denn sie hatte immer schon die Gabe gehabt, sehr hübsch zu schluchzen.
Während Ian auf seine ehemalige Verlobte starrte, spürte er, wie etwas in seinem Inneren zerriß und die Maske der Normalität mitnahm, die er seit seiner Rettung aus dem Kerker so mühselig aufrechterhalten hatte. Aus Furcht, er könnte vielleicht handgreiflich werden, machte er auf dem Absatz kehrt und ging steif hinaus. Sie flüsterte schluchzend seinen Namen, aber er blickte sich nicht um. Nachdem er sich von Ahmed seinen Helm hatte reichen lassen, riß er die Tür mit solcher Kraft auf, daß die Wände des Bungalows bebten, und sah sich Gerald Phelps gegenüber.
Gerry erstarrte mitten in der Bewegung, in seiner Miene eine Mischung aus Freude und Schuldbewußtsein. »Mein Gott, Ian. Du lebst ja wirklich! Jemand hat mir erzählt, daß du gerade gesichtet worden bist, aber ich konnte es nicht glauben. Es ist verdammt lange her.« Er hob die Hand, um sie ihm entgegenzustrecken, ließ sie dann jedoch wieder fallen. »Wir dachten alle, du wärest tot.«
»Das habe ich bereits festgestellt.« Ian überlegte, ob er seine Faust gegen Gerrys gutgeformtes Kinn rammen sollte; es hätte ihn in seinem hilflosen Zorn vielleicht ein wenig erleichtert. Aber wenn er seinem Drang nach Gewalt in seiner jetzigen Verfassung nachgeben würde, wäre er zu einem Mord fähig, und Gerry war im Kampf nie ein wirklicher Gegner gewesen. »Meine Glückwünsche zu deiner Hochzeit«, sagte er mit einem bösartigen Unterton. »Ich weiß nicht, ob der Beste gesiegt hat, aber Hauptsache ist doch der Sieg, nicht wahr?«
Ohne auf eine Antwort zu warten, schob er den anderen zur Seite und schwang sich auf sein Pferd. Dann stob er in der schnellsten Gangart davon, die er dem erschöpften Tier zumuten konnte.
Gerry Phelps sah ihm nach, ging schließlich hinein und fand seine Frau an den Türrahmen zum Gartenzimmer gelehnt. Ihr Gesicht war leichenblaß, ihre Hände waren krampfhaft ineinander verschränkt. Gerry wollte zu ihr gehen und sie trösten, und noch mehr wollte er sie sagen hören, wie froh sie war, ihn geheiratet zu haben, doch ihre verwirrte Miene ließ ihn innehalten.
Mann und Frau starrten sich an und spürten die Distanz zwischen sich, die nichts mit Metern zu tun hatte. Zwischen ihnen stand der Geist eines Mannes, der nicht tot war.
Ian war bereits eine Viertelmeile über die Straße galoppiert, als er begriff, daß er keine Ahnung hatte, wo er hinsollte. Nachdem er sein Pferd zum Stehen gebracht hatte, brach er über dessen Hals zusammen, weil er sich nicht länger aufrecht halten konnte. Die körperliche Erschöpfung, die er so lange einfach ignoriert hatte, überfiel ihn nun mit aller Macht, und sein Atem kam stoßweise und keuchend. Doch noch viel schlimmer als seine physische Qual war der Schmerz in seiner Seele und ein bitteres Stück Wahrheit, das er weder annehmen noch leugnen konnte.
Seit er gerettet worden war, hatte er sich an dem Gedanken festgeklammert, daß Georgina seine Erlösung bedeutete, doch statt dessen hatte er nur Asche vorgefunden. Die Dunkelheit in seiner Seele war nun endgültig hervorgebrochen, und nicht einmal die gleißende asiatische Sonne war stark genug, die schwarzen Nebel zu schlucken, die in Wellen erstickender Furcht in seinem Inneren aufwallten.
Ian konnte gerade noch erkennen, daß er zerfiel, und er hatte nicht die leiseste Ahnung, wie zum Teufel er diesen Vorgang aufhalten sollte. Wie ein verwundetes Tier wünschte er sich sehnlichst eine Höhle, in der er allein leiden konnte, aber der Club war zu öffentlich, Hotels gab es nicht, und er würde niemals das Haus eines Freundes finden, bevor er zusammenbrach.
Rascher Hufschlag erklang hinter ihm, und eine Stimme rief seinen Namen. Ian erstarrte und fragte sich, ob Gerry Phelps blöd genug war, ihm zu folgen. Das andere Pferd galoppierte an seine Seite und wurde heftig gezügelt. Dann berührte eine Männerhand Ians rechtes Handgelenk.
Die Tatsache, daß man sich seiner blinden Seite genähert hatte, ließ den letzten Faden von Ians Selbstbeherrschung zerreißen. Er drehte sich im Sattel um, holte mit seiner linken Faust aus und wollte nur noch schlagen, wehtun, sich wehren, wen immer er auch treffen würde.
Der Störenfried war nicht Gerald Phelps. Als seine Faust auf die Brust des anderen krachte, erkannte Ian, daß er seinen jüngeren Bruder David attackierte.
David, in der Uniform eines Captains des 46. Eingeborenen-Infanterieregiments, schaffte es nur knapp, nicht aus dem Sattel zu fallen. Einen endlosen Augenblick starrten die beiden Männer sich an. Dann verzog ein schiefes Lächeln Davids sonnengebräuntes Gesicht. »Ich habe nicht vergessen, daß ich dir zehn Pfund schulde, Ian, aber du mußt das Geld nicht aus mir rausprügeln. Ich hätte es dir längst zurückgezahlt, wenn du nicht nach Turkestan gegangen wärst, um dich umbringen zu lassen.«
Hilflos erwiderte Ian: »Himmel, David, was tust du hier? Als ich Indien verließ, warst du bei den Bengalischen Pionieren!«
»Kalkutta war so langweilig, so daß ich drei Monate, nachdem du fort warst, zum 46. gewechselt bin. Ich dachte, das Leben im Norden würde aufregender sein.« Voller Gefühl, das seine lockeren Worte Lügen strafte, griff er nach Ians Hand. Als dritter der vier Cameron-Sprößlinge besaß David die ausgeglichenste Natur und den gesündesten Menschenverstand. Und er war einer der wenigen Menschen, deren Gesellschaft Ian im Augenblick ertragen konnte.
Dann ließ er Ians Hand wieder los und sagte: »Was zum Teufel ist mit dir in Buchara geschehen?«
Ian schüttelte nur den Kopf. Er konnte nicht antworten.
David runzelte die Stirn, als er das Gesicht seines älteren Bruders intensiv musterte. »Wo bist du untergekommen?«
»Nirgendwo. Ich bin einfach nur zurückgekehrt.« Ians Stimme brach, doch er faßte sich wieder. »Ich bin direkt zu Colonel Whitmans Haus geritten.«
Schweigen legte sich über sie, dann sagte David schlicht: »Ich verstehe. Komm mit mir. Mein Bungalow liegt in der Nähe. Der Mann, mit dem ich das Haus teile, ist für ein paar Monate fort, also habe ich genug Platz.«
Stumm wendete Ian sein Pferd und ritt hinter seinem Bruder her. Nur noch ein paar Minuten. Das konnte er schaffen. Nur noch ein paar Minuten.
Kapitel 3
Verwirrt rollte sich Ian herum und blinzelte benommen, als er erwachte. Dann erinnerte er sich. Cambay. Das katastrophale Wiedersehen mit Georgina. Schließlich, Gott sei’s gedankt, David. Als sie beim Bungalow angekommen waren, hatte sein Bruder vorgeschlagen, daß er sich ausruhen sollte, und ihn zu einem der Schlafzimmer gebracht. Ian hatte sich nicht einmal ausgezogen, bevor er sich, mit dem Gesicht nach unten, ausgestreckt aufs Bett fallen ließ. Innerhalb von Sekunden war er in einen todesähnlichen Schlaf gesunken.
Die rötlichen Strahlen der Nachmittagssonne drangen durch die Fensterläden, aber was für ein Tag war heute nun? Vielleicht hatte er volle vierundzwanzig Stunden geschlafen, so wie damals, als er nach der mörderischen Flucht durch die Karakum in der Festung bei Juliet angelangt war. Und auch damals war sein Schlaf eher ein Koma gewesen.
Er fühlte sich noch immer müde und zerschlagen, glaubte aber nicht, daß er noch würde weiterschlafen können, denn die schwarzen Nebel quälten ihn noch immer. Ernsthaft dachte er über seine bildhaften Gedanken nach. Der Begriff Nebel war noch zu sanft; die Schatten waren mehr wie knurrende schwarze Hunde, die ihn umkreisten, seinen Geist verdüsterten, nach ihm schnappten und geiferten, während sie darauf warteten, ihn zu töten. Wie Wölfe vielleicht.
Vielleicht wäre es klüger gewesen, bei den Nebeln zu bleiben, überlegte er, als er zittrig auf die Füße kam und zum Waschständer ging. Der Spiegel über dem Becken zeigte ein dreckiges, bärtiges Gesicht, das allein schon jeden erschrecken konnte. Georgina hatte es auf jeden Fall erschreckt. Mit zusammengepreßten Lippen wandte er sich ab und öffnete die Tür zum Hauptraum des Bungalows. David saß an einem Schreibtisch und schrieb einen Brief.
»Wie lange habe ich geschlafen?« fragte Ian.
Sein Bruder blickte auf. »Weniger als zwei Stunden. Ich hatte nicht erwartet, dich vor morgen früh zu sehen.«
Kein Wunder, daß er sich nicht ausgeruht fühlte.
David fuhr fort: »Wie wär’s mit einem Bad? Danach können wir essen, und du kannst mir erzählen, was in den letzten zwei Jahren geschehen ist.«
Der Vorschlag war verdammt gut, denn nach einer Rasur und einem Bad und in frischen Kleidern fühlte Ian sich fast wieder wie ein Mensch. Im stummen Einverständnis stellte keiner der Brüder Fragen, bis sie mit dem Essen fertig waren. Oder besser, bis David mit dem Essen fertig war, denn Ian aß nur wenige Bissen und schob dann den Rest nur noch mit der Gabel über seinen Teller.
Als David fertig war, gab er ein Zeichen, den Tisch abzuräumen. »Hast du Lust auf einen Brandy?« fragte er.
Ian betrachtete die Karaffe. »Ich glaube schon, obwohl es wahrscheinlich ein Fehler ist ... Nach zwei Jahren in islamischen Ländern, wo es keinen Alkohol gibt, haut mich ein Drink womöglich aus den Schuhen!«
David füllte zwei Gläser und schob eins über den Tisch. »Abgesehen von dem Wechsel zum 46., ist bei mir in den letzten zwei Jahren nicht viel passiert. Aber wie bist du aus Buchara entkommen? Es hieß, du wärest kurz nach deiner Ankunft in der Stadt eingekerkert und ein Jahr später exekutiert worden!«
Ian zuckte die Schultern. »Der Bericht stimmt nur zur Hälfte. Ich wurde gefangengenommen, aber nicht exekutiert – jedenfalls nicht richtig. Nach eineinhalb Jahren in dem dreckigsten, abstoßendsten Loch, das man sich vorstellen kann, tauchten Juliet und ihr verlorengeglaubter Mann auf, wir flohen nach Persien, und hier bin ich nun.«
Davids Brandyglas kam auf halber Strecke zum Mund zum Stillstand. Ungläubig starrte er seinen Bruder an. »Unsere Schwester Juliet? Und Ross Carlisle?«
Nachdem Ian in groben Zügen die Einzelheiten berichtet hatte, stieß David einen leisen Pfiff der Verwunderung aus. »Du hattest verdammtes Glück.«
»Allerdings.« Ian nahm eine Mango und begann, die Frucht mit dem rasiermesserscharfen persischen Dolch, den seine Schwester ihm gegeben hatte, in Scheiben zu schneiden. »Ich sage mir das auch immer wieder.«
»Also sind Juliet und Ross wieder vereint«, meinte David nachdenklich. »Warum zum Teufel ist sie denn überhaupt damals davongelaufen? Ich habe das nie begriffen. Ich weiß, daß Juliet mehr als den normalen Anteil der Cameronschen Impulsivität abbekommen hat, aber Ross nach weniger als sechs Monaten Ehe zu verlassen, ist mir immer wie Irrsinn erschienen.«
»Ich weiß nicht, warum sie es damals tat – sie hat sich mir nicht anvertraut. Aber Ross ist wohl mit ihrer Erklärung zufrieden, und das ist alles, was zählt.« Ian zögerte einen Moment, als er sich an die intensive Nähe erinnerte, die er zwischen seiner Schwester und ihrem Mann gespürt hatte. Er freute sich für sie, aber der Gedanke daran ließ seine eigene Situation nur noch trostloser erscheinen. Angewidert von seinem Selbstmitleid fuhr er fort: »Sie müßten bald wieder in England eintreffen. Juliet hat sich nicht nur in eine liebende und mehr oder weniger pflichtbewußte Ehefrau verwandelt, sie trägt auch bereits einen Stammhalter mit sich herum.«
David grinste. »Typisch Juliet. Nur keine Zeit verlieren!«
»Georgina denkt wohl auch so.«
Die Miene seines Bruders wurde ernst. »Urteile nicht zu hart, Ian. Als die Nachricht kam, daß du exekutiert worden wärest – und der Bericht war überzeugend, nicht nur eine vage Vermutung –, war Georgina am Boden zerstört. Sie kam oft zu mir, und wir redeten stundenlang über dich.«
»Und dann hat sie kurzerhand den nächsten auf der Warteliste genommen.«
»Sie ist die Art von Frau, die einen Mann braucht.«
Ian nahm seinen ersten Schluck Brandy. Wie erwartet, traf ihn die Wirkung des Alkohols wie ein Schlag. Aber er war froh über den Effekt – mit etwas Glück würde er in kürzester Zeit bewußtlos werden. »Sehr ritterlich, daß du sie verteidigst, aber bei allem gebotenen Respekt bin ich im Moment nicht in der Stimmung, besonders fair zu sein.«
Davids Stirn zog sich in Falten. Er mochte Georgina, und er machte ihr keinen Vorwurf daraus, daß sie geglaubt hatte, ihr Verlobter wäre tot. Aber sie hatte tatsächlich ziemlich rasch geheiratet, und ihre Eile hatte nun üble Konsequenzen für Ian. »Wenn es dich irgendwie tröstet«, sagte er schließlich, »du bist ausgiebig von ganz Cambay betrauert worden. Von Colonel Whitman bis zum niedrigsten Arbeiter.«
»Nein, es tröstet mich nicht besonders«, antwortete Ian trocken und schnitt weiter an der Mango herum.
David musterte sein Gegenüber mit Unbehagen. Er hatte seinen Bruder schon als Kind bewundert und war stets überzeugt gewesen, daß Ians Kraft und sein fester Charakter alles bewältigen konnten. Es war Ian gewesen, der ihm beigebracht hatte, auf Beduinenart zu reiten, sich gegen größere Jungen zu verteidigen und wie man nachts aus dem Haus schlich, wenn man eigentlich schlafen sollte.
Aber der Mann, der aus Buchara gekommen war, wirkte wie ein Fremder. Sein schmales Gesicht war ausgezehrt und eingefallen, und er sah weit älter aus als zweiunddreißig. Er hatte noch nicht einmal gelacht, und das seltene Lächeln war lediglich ein bedeutungsloses Verziehen der Lippen. Unsicher fragte David: »Wirst du das Regiment wechseln? Ich denke mir, Georgina und Gerry ständig zusammenzusehen, könnte sich als... schwierig herausstellen.«
»Das ist eine Untertreibung.« Ian spießte mit der Messerspitze ein Stück Mango auf und starrte das saftige Fruchtfleisch an, während er nachdachte. Plötzlich ließ er das Messer wieder sinken. »Ich werde meinen Dienst quittieren. Ich weiß zwar nicht, was ich statt dessen tun soll, aber ich habe genug davon, die Inder zu verteidigen und das große Spiel gegen die Russen zu spielen. Zur Hölle damit. Das verdammte Königreich Ihrer Majestät wird ohne mich auskommen müssen.«
Die Bitterkeit der Worte ließ David eine Weile schweigen. Plötzlich fiel ihm ein, daß es aus der Familie Neuigkeiten gab, die wichtig für Ians Zukunft waren. »Gut, daß du die Armee verlassen willst. Du wirst nämlich zu Hause in Schottland gebraucht.«
»Wozu in aller Welt?« fragte Ian unbeeindruckt. Er schob den Teller mit den Mangostücken fort und trank von dem Brandy.
»Du bist nun Laird of Falkirk.«
Ians Gesichtszüge erstarrten. »Wie kann das sein?«
David seufzte. »Es hat etwa vor einem Jahr einen Unfall gegeben. Onkel Andrew und seine beiden Söhne sind im Loch ertrunken. Sie waren angeln, als eins der berüchtigten Unwetter aufkam.«
Ian stieß sich heftig vom Tisch ab. »Verflucht! Alle drei auf einmal umgekommen? Das kann doch nicht wahr sein!«
Während er durch den Raum schritt, spürte er zuerst nur Schock und Bedauern, und es dauerte eine Weile, bis er begriff, wie sich diese Sache für ihn persönlich auswirkte. Falkirk war der Familiensitz der Camerons, aber Ians Vater war Andrews jüngerer Bruder gewesen, und Ian hätte sich nicht im Traum vorgestellt, daß er das Anwesen und den Titel einmal erben könnte. Er war erzogen worden, sich seinen Platz in der Welt selbst zu suchen, und nun war er auf einmal Lord Falkirk.
Dann fiel ihm etwas anderes ein, und er blieb abrupt stehen und blickte seinen Bruder scharf an. »Mit der Meldung meines Todes warst du der nächste in der Reihe der Erben.«
»Ja und nein.« David lehnte sich in seinem Stuhl zurück. »Natürlich haben mich die Anwälte benannt, aber mit der gleichen Post kam ein Brief von Mutter, die mir befahl, ja nicht zu glauben, ich sei der neue Lord, da du nämlich am Leben seiest!«
Einen Augenblick lang wurde Ians Ausdruck weicher. »Habe ich schon erwähnt, daß es Mutter war, die Ross Carlisle in Konstantinopel aufstöberte und ihn förmlich dazu zwang, nach mir zu suchen?«
»Das überrascht mich ganz und gar nicht. Sie war wild entschlossen, die Anwälte die vollen sieben Jahre warten zu lassen, bevor sie deinen Tod für amtlich erklärten.« David grinste. »Sie ist in den letzten Jahren viel stärker geworden. Der Witwenstatus scheint ihr gut zu bekommen.«
Ian rieb sich seine schmerzende Schläfe. »Wie sehr trifft es dich, nicht Falkirk zu erben? Trotz Mutter mußt du es doch langsam als dein Eigentum betrachtet haben.«
»Oh, es hätte mir nichts ausgemacht, ein zugiges Schloß mit all dem Drumherum zu bekommen«, gab David ein wenig reuig zu. »Aber es gefällt mir besser, dich unter den Lebenden zu sehen. Im übrigen bin ich noch nicht bereit, Indien zu verlassen. Ich werde schon mein eigenes Stück Schottland abbekommen, wenn die Zeit dazu da ist.«
Also haßte sein Bruder ihn zumindest nicht dafür, daß er am Leben war. Ian nahm wieder seine Wanderung auf, blieb aber schließlich vor dem Fenster stehen. Während er in die samtige Dunkelheit der Nacht hinausblickte, erwog er den Gedanken, in das Land seiner Geburt zurückzukehren. Als Diplomat hatte Ians Vater den größten Teil seines Lebens im Ausland verbracht, und so war Falkirk sein britisches Kindheitszuhause gewesen. Ian hatte dort als kleiner Junge gelebt, in seinen Schulferien die wilden Hügel erforscht und war in der wunderschönen, tückischen Bucht geschwommen.
Schottland, das Land seiner Väter, kühl und grün, so vertraut wie seine Westentasche. In seinem momentanen Zustand schimmerte der Gedanke an Falkirk wie ein fernes Leuchtfeuer in einer stürmischen Nacht. Der Verlust Georginas hatte ein riesiges Loch in seine Seele gerissen, aber Falkirk würde ein wenig die Leere ausfüllen können. Er hätte zumindest ein Ziel, eine Art Heim, und einen Grund sich aufzuraffen.
Er drehte sich um und lehnte sich an den Fensterrahmen, die Arme vor der Brust verschränkt. »Ich denke, ich sollte nach Schottland zurückgehen.«
»Ich hoffe, du bleibst aber noch ein paar Tage«, sagte David. »Gott weiß, wann ich dich wiedersehe. Es wird mindestens noch Jahre dauern, bis ich Schottland einen Besuch abstatten kann.«
Da er den Entschluß gefaßt hatte, Indien zu verlassen, hätte Ian nichts lieber getan, als sofort abzureisen. Aber das war unmöglich. »Bevor ich gehe, muß ich noch etwas in Baipur erledigen. Wenn ich fertig bin, komme ich auf dem Rückweg nach Bombay noch einmal bei dir vorbei.«
»Was hast du denn zu erledigen?«
Ian dachte an Finsternis und Kälte und Verzweiflung und an den Mann, der eigentlich ein Feind gewesen war, ihm jedoch so nah wie sein eigener Schatten. »Ein Jahr lang teilte ich meine Zelle mit einem russischen Colonel, bis er exekutiert wurde. Er hat in einer kleinen Bibel ein Tagebuch geführt, und ich habe versprochen, sie seinem nächsten Verwandten zu überbringen, wenn ich überleben sollte. Er sagte mir, daß seine Nichte vor drei oder vier Jahren in Beipur gelebt hat. Da ich schon in der Nähe bin, bringe ich das Tagebuch lieber persönlich hin, als es über offizielle Kanäle zu schicken.«
David zog eine Augenbraue hoch. »Was zum Teufel hat ein russisches Mädchen in einer indischen Distriktstation zu tun?«
Ian forschte in seiner Erinnerung nach dem, was Pjotr gesagt hatte. In den langen, eintönigen Monaten hatten sie sehr viel voneinander erfahren und preisgegeben. »Die Mutter des Kindes war Tatjana, die jüngere Schwester des Colonels, und ihr Vater ein russischer Kavallerie-Offizier. Als Tatjanas erster Mann starb, besuchte sie ein Schweizer Kurbad, um ihren Kummer zu vergessen. Dort traf sie einen Verwaltungsbeamten der Company mit Namen Kenneth Stephenson, der auf dem Nachhauseweg war, um an einem College der Company in Haileybury zu lehren. Sie heirateten und lebten in Haileybury, bis Tatjana vor fünf oder sechs Jahren starb.«
»Die Company muß ja entzückt gewesen sein, eine Russin in ihren Mauern zu haben«, bemerkte David amüsiert.
»Laut Pjotr hatte seine Schwester nicht das geringste Interesse an Politik, konnte dafür aber jeden Mann auf Erden bezaubern. Nun, jedenfalls bat man Stephenson nach ihrem Tod, wieder nach Indien zu gehen. Er wurde zum Inkassobeamten des Distrikts in Baipur ernannt, und seine Stieftochter ging mit ihm. Pjotr hatte seit langer Zeit keinen Kontakt mehr zu seiner Nichte gehabt, aber die Chancen stehen gut, daß sie sich noch in Baipur aufhält.«
»Der Agent in Cambay weiß sicher darüber Bescheid«, meinte David. »Wie heißt sie und wie alt ist sie?«
»Larissa Alexandrowna Karelian, aber Pjotr nannte sie immer nur seine ›kleine Lara‹«, antwortete Ian und rollte dabei das R auf der Zunge. »Er meinte, sie wäre zu früh geboren, und Larissa erschien ihm zu mächtig für ein so winziges Würmchen, also wurde sie zu Lara. Da Pjotr selbst keine Kinder hatte, hing er sehr an seiner Nichte.« Ian dachte einen Moment nach. »Ich weiß nicht, wie alt das Mädchen ist, aber so, wie Pjotr immer von ihr gesprochen hat, muß sie dreizehn oder vierzehn sein. Alt genug jedenfalls, um das Tagebuch in die Hände zu bekommen und zu erfahren, wie ihr Onkel gestorben ist.«
Dabei wäre es soviel einfacher, wenn das Mädchen nicht mehr in der Nähe war. Dann könnte er die Bibel einfach mit einem kurzen Erklärungsschreiben an eine russische Botschaft schicken. Aber er verdankte Pjotr zuviel, um den Weg des geringsten Widerstands zu nehmen. Er würde diese Nichte also persönlich aufsuchen.
Zögernd fragte David: »Hast du Kopfschmerzen? Du reibst dir schon die ganze Zeit die Stirn.«
Ian ließ die Hand sinken. »Ich habe Kopfschmerzen, seit ich mein Auge verloren habe, aber sie sind längst nicht mehr so stark. Vielleicht hören sie eines Tages ganz auf.« Plötzlich war Davids unausgesprochenes Mitgefühl mehr, als er ertragen konnte. »Wenn es dir nichts ausmacht – ich könnte jetzt ins Bett gehen!«
Er trat an den Tisch, trank den Brandy aus und zog sich dann schneller als höflich war in sein Zimmer zurück. Dort zog er seine Kleider bis auf die leichte Unterhose aus und legte sich aufs Bett. Doch trotz Brandy und Erschöpfung wollte der Schlaf nicht kommen.
Er hatte immer gedacht, er würde sein ganzes Leben in der Armee verbringen, und niemals in Erwägung gezogen, den Dienst zu quittieren, bis er sich diese Worte hatte sagen hören. Aber im gleichen Moment hatte er erkannt, daß ihm keine Wahl blieb. Einst war das Leben beim Militär sein Element gewesen, doch nun nicht mehr.
Über seinem Kopf bewegte sich träge ein gewaltiger Fächer, den man Punkah nannte, und kühlte seinen glühenden Körper wenigstens etwas. Draußen auf der Veranda zog ein Diener, der Punkah Wallah, das Seil, mit dem der Fächer bewegt wurde. Schließlich entschied der Diener, daß es Zeit war, schlafen zu gehen, und die langen, mit Stoff bezogenen Blätter kamen quietschend zum Stehen. Über den Bungalow senkte sich Schweigen.
Da die Luft nicht mehr bewegt wurde, wurde die gelbe Flamme der Öllampe größer. Ian starrte wie gebannt auf das Licht. Er hatte die Lampe absichtlich nicht gelöscht, denn in Buchara hatte er eine Abneigung gegen die Dunkelheit entwickelt.
Seine Lippen preßten sich zu einem blutleeren Strich aufeinander. Es war an der Zeit, es war längst an der Zeit, ehrlich zu sein. Was er für die Dunkelheit empfand, war ganz sicher nicht mit einem Wort wie ›Abneigung‹ auszudrücken. Er fühlte überwältigendes, irrationales Entsetzen.
Und dies war auch nicht die einzige Angst, die er in seinem Gefängnis entwickelt hatte. Während seine Brust sich in aufkommender Panik heftig hob und senkte, zwang er sich, den häßlichen Tatsachen ins Auge zu sehen, die er seit seiner Rettung versucht hatte zu verleugnen.
Er fürchtete sich vor dem Alleinsein, hatte aber immense Schwierigkeiten, die Gesellschaft anderer zu ertragen.
Er hatte Angst vor dem Einschlafen, denn er fürchtete seine Träume.
Er war ein Feigling, ein Mann, der sich einem Ehrenkodex verschrieben und sich selbst viel gründlicher betrogen hatte, als jeder andere ihn hätte betrügen können.
Er war nicht mehr der Mann, der damals nach Buchara gereist war, sondern eine ausgetrocknete, gebrochene Hülle, die ihm nie wieder ähnlich sein konnte.
Er fürchtete den Tod. Und, unendlich viel schlimmer: Er fürchtete das Leben.
Punkt für Punkt hakte er im Geiste seine neuen Schwächen ab und erwog jede gründlich, bis sie sich in seiner Seele eingenistet hatte und sich vertraut anfühlte. Aber so bitter diese Wahrheiten auch schmeckten, so waren sie doch nicht so qualvoll wie der letzte, brutale Fakt, den zu akzeptieren er sich verzweifelt sträubte. Selbst in der Intimität seiner eigenen Gedanken war es ihm fast unmöglich, die Worte für sich selbst zu formulieren, doch endlich tat er es.
Er war impotent.
Ians Nägel gruben tiefe Rillen in seine Handflächen, als er die Worte im Geiste wieder und wieder aussprach. Impotent. Ein Eunuch. Kein Mann mehr. Niemals mehr würde er das menschliche Grundbedürfnis von Leidenschaft und körperlicher Nähe erfahren, niemals mehr eine Frau oder gar Kinder haben.
Das Wissen schnitt in seine Seele wie eine glühende Klinge. Es mochte Männer geben, die mit einer mönchischen Natur ausgestattet waren und den Verlust ihrer Sexualität gar nicht bemerkt hätten, aber er gehörte gewiß nicht zu ihnen.
Wenn er zurückblickte, wußte er genau, zu welchem Zeitpunkt der Schaden entstanden war. Einmal, als die Gefängniswärter sich einmal mehr den Spaß gemacht hatten, ihn zusammenzuschlagen, hatten sie ihn wiederholt und heftig in die Genitalien getreten. Nach diesem Tag hatte er niemals wieder irgend etwas wie Verlangen gespürt.
Zuerst hatte er es kaum bemerkt, denn Hunger und Verzweiflung hatten die Lust längst ausgelöscht. Die Frage, ob er seine Männlichkeit verloren hatte, war einfach müßig gewesen, da Frauen nur noch eine ferne Erinnerung waren und er ohnehin sicher gewesen war, in Buchara zu sterben.
Aber er hatte überlebt, und die Frage wurde wieder relevant. Nachdem die Freiheit und geregelte Mahlzeiten nichts bewirken konnten, hatte er sich geweigert, daran zu denken, daß er möglicherweise einen dauerhaften Schaden erlitten hatte. Statt dessen hatte er sich immer wieder eingeredet, daß das Wiedersehen mit seiner Verlobten ihn wieder zu einem vollständigen Mann machen würde. Georgina würde ihn schon erregen, denn ihre reifen Rundungen hatten sein Verlangen schon an dem Tag, an dem sie sich kennengelernt hatten, entfacht.
Als sie seinen Antrag angenommen hatte, war er begierig darauf gewesen, ihr die Vergnügungen der körperlichen Liebe beizubringen, denn in ihren heimlichen Augenblicken des Alleinseins hatte sie sich bereits als gelehrige Schülerin erwiesen. Aber da sie erst neunzehn gewesen war, hatten ihre Eltern auf einer langen Verlobungszeit bestanden. Das war ein Grund gewesen, warum er zugestimmt hatte, nach Buchara zu gehen, denn die Wartezeit war ihn hart angekommen.
Während der Jahre in Zentralasien hatte seine Verlobte seine Gedanken beherrscht, selbst nachdem seine Lust nur noch ein schwaches gedankliches Abbild echten Verlangens war. Sie war zu einem Symbol geworden für alles, was er je geliebt und für verloren gehalten hatte.
Nach seiner Rettung war er auf der Suche nach Heilung zu Georgina zurückgekehrt. Doch bei ihrem Anblick hatte er nicht ein winziges Aufflackern von Begierde verspürt – selbst als er von ihrer Ehe noch nichts gewußt hatte. Obwohl sie attraktiv war wie eh und je, hätte er in sexueller Hinsicht ebensogut tot sein können.
Für einen verzweifelten Moment erwog er, das schöne indische Mädchen zu besuchen, das seine Geliebte gewesen war, bevor er sich in Georgina verliebt hatte. Leela war nicht behütet aufgewachsen wie die jungen englischen Mädchen, sie war eine erfahrene Kurtisane, und ihre Beziehung war leidenschaftlich und für beide befriedigend gewesen. Doch wenn er nun an sie dachte, reagierte sein Körper überhaupt nicht. Kein Ziehen, kein Erzittern, und es half auch nicht, sich detailliert in Erinnerung zu rufen, was sie miteinander gemacht hatten.
Eine kurze, entsetzliche Vision schoß ihm durch den Kopf: Er würde zu Leela gehen und kläglich versagen. Sie war eine gutherzige Frau und würde ihn nicht auslachen; sie würde ihn bemitleiden, und dies war weitaus schlimmer.