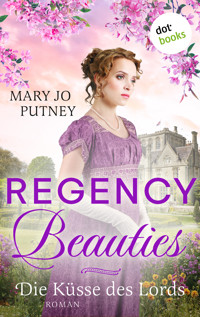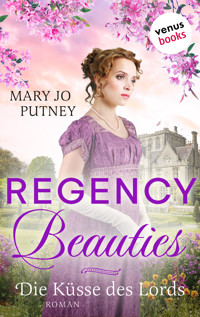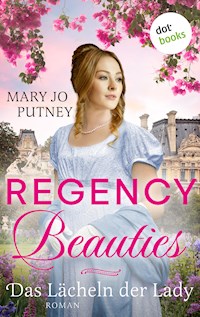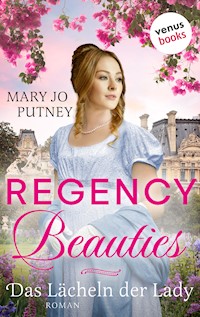
0,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: venusbooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Regency Beauties
- Sprache: Deutsch
Vom Schicksal vereint? Das historische Romantik-Highlight »Regency Beauties – Das Lächeln der Lady« von Mary Jo Putney jetzt als eBook bei venusbooks. Jeder, der sie sieht, würde die schöne Margot Ashton für eine zerbrechliche englische Rose halten … und niemand ahnt, welches Geheimnis sie so geschickt verbirgt: Sie ist eine der besten Spioninnen Englands! Doch nun führt ein neuer Auftrag sie nach Frankreich – wo sie zu ihrer Überraschung dem einen Mann begegnet, den sie niemals wiedersehen wollte: Rafael Whitbourne, den Duke of Candover. Vor vielen Jahren hat er ihr ewige Liebe geschworen und sie dann vor der Hochzeit eiskalt im Stich gelassen. Doch so sehr Margot ihn auch zu hassen glaubt, ihr bleibt keine andere Wahl, als mit ihm zusammenzuarbeiten, wenn sie die gefährlichen Intrigen am Hofe überstehen will … und merkt zu ihrem eigenen Entsetzen, dass Rafaels Nähe Gefühle in ihr weckt, die sie lang vergessen glaubte! »›Regency Beauties – Das Lächeln der Lady‹ rührt das Herz und bewegt den Geist. Ein Roman vom Feinsten.« Romantic Times Magazine Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der historische Liebesroman »Regency Beauties – Das Lächeln der Lady« der international erfolgreichen New-York-Times-Bestsellerautorin Mary Jo Putney. Lesen ist sexy: venusbooks – der erotische eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 621
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Über dieses Buch:
Jeder, der sie sieht, würde die schöne Margot Ashton für eine zerbrechliche englische Rose halten … und niemand ahnt, welches Geheimnis sie so geschickt verbirgt: Sie ist eine der besten Spioninnen Englands! Doch nun führt ein neuer Auftrag sie nach Frankreich – wo sie zu ihrer Überraschung dem einen Mann begegnet, den sie niemals wiedersehen wollte: Rafael Whitbourne, den Duke of Candover. Vor vielen Jahren hat er ihr ewige Liebe geschworen und sie dann vor der Hochzeit eiskalt im Stich gelassen. Doch so sehr Margot ihn auch zu hassen glaubt, ihr bleibt keine andere Wahl, als mit ihm zusammenzuarbeiten, wenn sie die gefährlichen Intrigen am Hofe überstehen will … und merkt zu ihrem eigenen Entsetzen, dass Rafaels Nähe Gefühle in ihr weckt, die sie lang vergessen glaubte!
»›Regency Beauties – Das Lächeln der Lady‹ rührt das Herz und bewegt den Geist. Ein Roman vom Feinsten.« Romantic Times Magazine
Über die Autorin:
Mary Jo Putney wurde in New York geboren und schloss an der Syracuse University die Studiengänge English Literature und Industrial Design ab. Nach ihrem Studium übernahm sie Designarbeiten in Kalifornien und England, bis es sie schließlich nach Baltimore zog, und sie mit dem Schreiben begann. Mit ihren Büchern gelang es ihr, alle Bestsellerlisten in den USA zu erklimmen, unter anderem die der New York Times, des Wall Street Journals, der USA Today, und der Publishers Weekly.
Die Website der Autorin: maryjoputney.com
Mary Jo Putney veröffentlichte bei venusbooks außerdem den folgenden Roman: »Regency Beauties – Die Küsse des Lords«
***
eBook-Neuausgabe August 2022
Ein eBook des venusbooks Verlags. venusbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, München.
Die amerikanische Originalausgabe erschien erstmals 1989 unter dem Originaltitel »Petals in the Storm« bei Signet Books, New York. Die deutsche Erstausgabe erschien 1995 unter dem Titel »Wie ein Blütenblatt im Sturm« bei Lübbe.
Copyright © der amerikanischen Originalausgabe Mary Jo Putney, 1989, 1993
Copyright © der deutschen Erstausgabe 1995 by Gustav Lübbe Verlag GmbH, Bergisch Gladbach
Copyright © der Neuausgabe 2022 venusbooks Verlag. venusbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, München.
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover.
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © shutterstock
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (mm)
ISBN 978-3-96898-197-0
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des venusbooks-Verlags
***
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Sie werden in diesem Roman möglicherweise Begrifflichkeiten, Weltanschauungen und Verhaltensweisen begegnen, die wir heute als unzeitgemäß und diskriminierend empfinden, unter anderem dem Begriff »Zigeuner«.
»Zigeuner« ist die direkte Übersetzung des im englischen Originaltext verwendeten Begriffs »Gypsy«, und es ist nicht möglich, dieses Wort in Titel und Text durch die heute gebräuchlichen Eigenbezeichnungen »Sinti und/oder Roma« zu ersetzen, weil sie inhaltlich nicht passen würden. Zur Handlungszeit im frühen 19. Jahrhundert war »Zigeuner« die gängige Fremdbezeichnung für die Sinti und Roma, wobei dieser Begriff seit dem 18. Jahrhundert vielerorts mit einem zunehmenden stigmatisierenden Rassismus verbunden war. Die Sinti und Roma lehnen die Bezeichnung »Zigeuner« daher heute zu Recht ab.
Bei diesem Roman handelt es sich um ein rein fiktives Werk, das vor dem Hintergrund einer bestimmten Zeit spielt und von uns ohne nachträgliche Eingriffe neu veröffentlicht wird. Mary Jo Putney hat keinen Roman im Sinne der völkisch rassifizierten Nazi-Nomenklatur geschrieben, sondern verwendet Begrifflichkeiten so, wie sie aus ihrer Sicht zu der Zeit, in der ihr Roman spielt, verwendet wurden; Klischees werden hier bewusst als Stilmittel verwendet. Keinesfalls geht es in diesem fiktionalen Text aber um rassistische Zuschreibungen oder die Verdichtung eines aggressiven Feindbildes.
***
Wenn Ihnen dieses eBook gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Regency Beauties – Das Lächeln der Lady« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.venusbooks.de
www.facebook.com/venusbooks
www.instagram.com/venusbooks
Mary Jo Putney
Regency Beauties – Das Lächeln der Lady
Roman
Aus dem Amerikanischen von Kerstin Winter
venusbooks
Von den zahlreichen Büchern, die für den Hintergrund dieser Geschichte konsultiert worden sind, möchte die Autorin drei
besonders hervorheben:
»Wellington: Pillar of State« von Elizabeth Longford, »The Foreign Policy of Castlereagh, 1812-1815« von Sir Charles Webster und »The Reminiscences and Recollections of Captain Gronow« (Viking Press edition, 1994)
Kapitel 1
»Was zum Teufel geht hier vor?«
Der Schlachtruf eines wütenden Ehemannes; Rafe hätte ihn überall erkannt. Er seufzte. Offenbar würde es nun eine häßliche emotionale Szene von der Art geben, die er am meisten verabscheute. Er ließ die attraktive Frau in seinen Armen los und wandte sich dem Mann zu, der soeben in den Salon gestürzt war.
Der Eindringling hatte etwa Rafes Größe und dasselbe Alter, Mitte Dreißig. Mochte er auch unter anderen Umständen ein angenehmer Mensch sein – im Augenblick sah er so aus, als könnte er durchaus einen Mord begehen.
»David!« rief Lady Jocelyn Kendal und ging freudig auf ihn zu, blieb jedoch bei der Miene ihres Gatten wie angewurzelt stehen. Die pulsierende Spannung zwischen ihnen war fast greifbar.
Der Neuankömmling brach das Schweigen mit leiser, zorniger Stimme. »Es ist offensichtlich, daß meine Ankunft unerwartet und wenig willkommen ist. Ich nehme an, dies ist der Duke of Candover. Oder verschenkst du deine Gunst auch an andere?«
Als Lady Jocelyn unter der geballten Wut seiner Worte zu schwanken begann, sagte Rafe kühl: »Ich bin Candover. Ich fürchte, wir sind einander noch nicht vorgestellt worden, Sir.«
Der andere Mann kämpfte sichtlich mit dem Bedürfnis, den Gast seiner Frau hinauszuwerfen, zwang sich aber zu einer Antwort. »Ich bin Presteyne, Gatte dieser Lady hier, wenn auch nicht mehr lange.« Sein Blick kehrte zu Lady Jocelyn zurück. »Verzeih mir, daß ich deine Vergnügungen gestört habe. Ich packe meine Habe zusammen und belästige dich nie wieder.«
Dann verschwand Presteyne durch die Tür, die er mit solcher Kraft zuwarf, daß die Wände zitterten. Rafe war froh, als er fort war. Obwohl er in allen sportlichen Ertüchtigungen eines Gentlemans ein Experte war, gehörten Auseinandersetzungen mit einem wütenden Ehemann mit militärischem Habitus nicht zu seinen Lieblingsbeschäftigungen.
Dummerweise war die Szene noch nicht zu Ende, denn Lady Jocelyn brach auf einen Stuhl zusammen und begann zu weinen. Rafe betrachtete sie mit wachsender Ungeduld. Er zog es vor, seine Affären komplikationsfrei und mit gegenseitigem Vergnügen ohne Reue und Schwierigkeiten zu handhaben. Er hätte Lady Jocelyn niemals berührt, wenn sie ihm nicht versichert hätte, daß ihre Ehe nur dem Namen nach bestand. Die Dame hatte offenbar gelogen. »Dein Mann scheint deine Ansicht nicht zu teilen, daß es sich bei euch nur um eine Zweckehe handelt«, bemerkte er.
Sie hob den Kopf und blickte ihn tränenblind an, als hätte sie vergessen, daß er da war.
Verärgert fragte er: »Was für eine Art Spiel spielst du eigentlich? Dein Mann scheint nicht der Typ zu sein, der sich von Eifersucht manipulieren läßt. Vielleicht verläßt er dich, vielleicht dreht er dir auch den Hals um, aber ganz sicher wird er nicht die Rolle des leidenden Gehörnten übernehmen.«
»Es war kein Spiel«, sagte sie mit bebender Stimme. »Ich habe versucht zu ergründen, was ich in meinem Herzen fühlte. Jetzt, wo es zu spät ist, weiß ich, was ich für David empfinde.«
Rafes Ärger schwand, als er sich ihre Jugend und Verletzlichkeit in Erinnerung rief. Er war schließlich auch mal so jung und verwirrt gewesen, und der Anblick ihres Elends erinnerte ihn lebhaft daran, wie vernichtend sich Liebe auswirken konnte. »Ich habe langsam den Verdacht, daß sich hinter deiner glatten, strahlenden Fassade ein romantisches Herz verbirgt«, sagte er trocken. »Wenn es so ist, dann lauf deinem Mann hinterher und wirf ihm dein bezauberndes Wesen zu Füßen. Bitte ihn um Verzeihung. Du wirst es bestimmt schaffen. Ein Mann vergibt der Frau, die er liebt, sehr, sehr viel. Laß dich nur nicht ein zweites Mal in den Armen eines anderen erwischen. Ich glaube kaum, daß er dir noch einmal verzeiht.«
Ihre Augen weiteten sich. Als sie sprach, klang ihre Stimme, als wäre sie hysterischem Gelächter nah. »Deine Kaltblütigkeit ist legendär, aber die Berichte werden dir nicht einmal gerecht. Wenn der Teufel selbst hereinkäme, würdest du ihn wahrscheinlich fragen, ob er eine Partie Whist mit dir spielt.«
»Spiel niemals mit dem Teufel Whist, meine Liebe. Er schummelt.« Rafe nahm ihre eiskalte Hand und küßte sie leicht zum Abschied. »Sollte dein Mann deinem Flehen widerstehen, laß mich wissen, ob du dich mit einer unkomplizierten, netten Affäre trösten möchtest.« Er ließ die Hand los. »Du weißt, daß du von mir niemals mehr bekommen wirst. Vor vielen Jahren verschenkte ich mein Herz an jemanden, der es zerbrochen hat. Nun habe ich keines mehr übrig.«
Das war ein guter Abgang, doch als er in das liebliche Gesicht des Mädchens blickte, hörte er sich sagen: »Du erinnerst mich an eine Frau, die ich einmal kannte. Aber du ähnelst ihr nicht stark genug. Niemals.«
Dann drehte er sich um und ging fort, aus dem Haus hinaus und die Stufen auf die Upper Brook Street hinunter. Seine Kutsche wartete, also schwang er sich auf den Bock und nahm die Zügel.
Ein Teil von ihm amüsierte sich über seine eigene Eitelkeit. Wie gut hatte der »Duke« die Szene doch wieder bewältigt, dachte er spöttisch. »Duke« war der Spitzname, den Rafe sich selbst für seine Rolle in der Gesellschaft gegeben hatte. An diesem öffentlichen Bild hatte er jahrelang gefeilt und poliert. Als Duke war er der perfekte, unerschütterliche englische Gentleman, und niemand konnte diese Rolle besser als Rafe spielen.
Jeder Mensch brauchte einen Zeitvertreib.
Doch als er in die Park Lane einbog, war er sich unangenehm bewußt, daß er mehr von sich preisgegeben hatte, als es gut war. Zum Glück war Jocelyn nicht der Typ, der solche Dinge ausplauderte, und Rafe würde es ganz sicher nicht tun.
Während ihm durch den Kopf ging, daß er sich eine neue Geliebte würde suchen müssen, hielt er die Kutsche vor seinem Haus am Berkeley Square an. In den Wochen, die dem Ende seiner letzten Affäre gefolgt waren, hatte er keine Frau finden können, die ihn wirklich ansprach. Er hatte sogar schon überlegt, ob er die willfährigen Damen seines Standes aufgeben und sich eine Kurtisane mieten sollte. Es wäre einfacher, sich eine professionelle Geliebte zu halten, aber solche Frauen waren meistens geldgierig und ungebildet und nicht selten krank. Diese Aussicht reizte ihn wenig.
Aus diesem Grund war er erfreut gewesen, als die entzückende Jocelyn Kendal ihn diskret wissen ließ, sie sei eine Zweckehe eingegangen und würde nun Zerstreuung suchen. Er hatte sie schon vor ihrer Heirat bewundert, hatte aber Abstand gehalten, weil es strikt gegen seinen Ehrenkodex ging, mit unschuldigen Mädchen etwas anzufangen. In den Wochen, in denen er auf dem Land gewesen war, hatte er mit mäßiger Erwartung an sie gedacht und sie besucht, sobald er zurück war. Leider hatte die Lady offenbar seit ihrer Einladung ein wenig nachgedacht, und Rafe mußte sich woanders umsehen.
Um sich zu trösten, gratulierte er sich lieber dazu, daß er etwas vermieden hatte, was sich zu einer recht unangenehmen Sache hätte auswachsen können. Er hätte es besser wissen müssen, als sich mit einem so romantischen Mäuschen einzulassen. Tatsächlich hatte er es besser gewußt, aber sie war wirklich die erfrischendste, anziehendste Frau, die ihm seit Jahren über den Weg gelaufen war. Sie war wirklich wie ...
Er schnitt den Gedanken scharf ab. Der Hauptgrund seiner frühen Rückkehr nach London war nicht die Suche nach Zeitvertreib gewesen, sondern eine Nachricht seines Freundes Lucien, der eine geschäftliche Sache mit ihm besprechen wollte. Die Tatsache, daß die Geschäfte des Earl of Strathmore sich um Spionage drehten, bedeutete, daß seine Projekte meist recht interessant waren.
Sein Rang verschaffte Rafe Zutritt zu den obersten Gesellschaftsschichten, wo immer er auch war, und im Laufe der Jahre war er durch diesen Vorteil zu einem nützlichen Glied des weitgespannten Spionagenetzes seines Freundes geworden. Rafes Spezialität war es, als Kurier zu fungieren, wo das Risiko, daß über die offiziellen Kanäle etwas durchsickern könnte, zu groß war. Aber er hatte auch bereits einige diskrete Ermittlungen bei den Reichen und Mächtigen durchgeführt.
Als Rafe seinen Wagen auf den Hof lenkte, hoffte er, daß Lucien für ihn diesmal etwas hatte, das ihn verflucht gründlich ablenkte.
***
Lucien Fairchild beobachtete amüsiert, wie der Duke of Candover sich durch den vollen Salon arbeitete. Groß, dunkel und mit seiner Aura von Macht paßte Rafe so gut in die Rolle des Aristokraten, daß er eher als Schauspieler denn als Original durchgehen konnte.
Da er auch noch unglaublich attraktiv war, erstaunte es nicht weiter, daß ihm jede anwesende Frau hinterhersah. Lucien überlegte, welche von ihnen die nächste in der langen Reihe der strahlenden Damen werden würde, die Rafes Bett geteilt hatten. Selbst Lucien, dessen Geschäft Informationsbeschaffung war, hatte Mühe, auf dem laufenden zu bleiben.
Während Lucien seine Überlegungen anstellte, hatte Rafe auf seinem Weg durch den Salon seinen berühmten eiskalten Blick dazu benutzt, drei unbedeutende Gestalten einzuschüchtern, die hier nichts zu suchen hatten. Doch als er endlich seinen Freund erreichte, erwärmte sich sein kühles Gesellschaftslächeln. »Es tut gut, dich zu sehen, Luce. Es hat mir leid getan, daß du diesen Sommer nicht nach Bourne Castle kommen konntest.«
»Auch mir tat es leid, aber Whitehall ist ein echtes Irrenhaus gewesen.« Lucien blickte durch den Raum und gab einem anderen Mann ein unauffälliges Zeichen, dann sprach er weiter. »Suchen wir uns ein ruhigeres Plätzchen, um die Neuigkeiten auszutauschen.« Er führte Rafe aus dem Salon in ein Arbeitszimmer im hinteren Teil des Hauses.
Beide setzten sich, und Rafe nahm eine Zigarre von seinem Gastgeber. »Ich vermute, du hast einen Auftrag für mich.«
»Du vermutest richtig.« Lucien zündete zuerst Rafes Zigarre mit einer Kerze an, dann seine. »Hättest du Lust auf einen Ausflug nach Paris?«
»Hört sich gut an.« Rafe sog an seiner Zigarre, bis sie richtig brannte. »Ich habe mich in letzter Zeit ein wenig gelangweilt.«
»Diese Sache wird bestimmt nicht langweilig – der Auftrag betrifft eine Frau, die uns ein wenig Ärger macht.«
»Um so besser.« Rafe nahm einen tiefen Zug von seiner Zigarre und ließ den Rauch langsam durch einen Mundwinkel entweichen. »Soll ich sie töten oder küssen?«
Lucien runzelte die Stirn. »Ersteres bestimmt nicht. Was das zweite angeht –«, er zuckte die Schultern, »– das überlaß ich dir.«
Die Tür ging auf, und ein Mann mit dunklem Teint trat ein. Rafe erhob sich und streckte ihm die Hand entgegen. »Nicholas! Ich wußte nicht, daß du in London bist!«
»Clare und ich sind erst gestern abend angekommen.« Nachdem sie sich die Hände geschüttelt hatten, ließ sich der Earl of Aberdare lässig auf einen Stuhl fallen.
Als Rafe ebenfalls wieder Platz genommen hatte, bemerkte er: »Du siehst ausgesprochen gut aus.«
»Die Ehe ist eine wunderbare Sache.« Nicholas grinste schelmisch. »Du solltest dir auch eine Frau nehmen.«
Mit zuckersüßer Stimme erwiderte Rafe: »Eine exzellente Idee. Wessen Frau schlägst du vor?«
Die Männer lachten. »Ich hoffe, meinem Patenkind geht es genauso gut«, fuhr Rafe fort.
Die Ablenkung funktionierte bestens. Nicholas’ Gesicht erstrahlte augenblicklich in der begeisterten Miene eines stolzen, frischgebackenen Vaters, und schon erging er sich in einer Beschreibung der erstaunlichen Fortschritte, die der kleine Kenrick machte.
Die Männer im Arbeitszimmer bildeten drei Viertel der Gruppe, die in ihren jüngeren, wilderen Jahren den Spitznamen »Gefallene Engel« erhalten hatte. Sie waren Freunde seit Eton und gingen stets vertraut wie Brüder miteinander um, selbst wenn Jahre zwischen ihren einzelnen Treffen verstrichen. Das fehlende Mitglied war Michael Kenyon, Nicholas’ Nachbar in Wales. Nachdem die Entwicklung des Kindes gebührend bewundert und besprochen worden war, fragte Rafe: »Ist Michael mit dir gekommen?«
»Er ist noch nicht ganz reisefähig, aber er erholt sich mit erstaunlicher Geschwindigkeit. Bald ist er wieder so gut wie neu, wenn auch mit ein paar Narben mehr.« Nicholas lachte in sich hinein. »Clare hat darauf bestanden, ihn zu pflegen. Stellt euch das bitte vor: Hartnäckigkeit trifft auf Widerspenstigkeit! Ich denke, meine sture kleine Frau ist der einzige Mensch auf der Welt, der Michael lang genug ans Bett fesseln kann, damit er richtig gesund wird. Nun, da es ihm besser geht, fand ich, Clare brauche ein wenig Urlaub. Also habe ich sie mit nach London genommen.«
»Typisch für Michael, wieder in die Armee einzutreten, sobald Napoleon von Elba geflüchtet war«, sagte Lucien säuerlich. »Da die Franzosen ihn in Spanien nicht haben umbringen können, mußte er ihnen ja in Waterloo eine neue Chance geben.«
»Michael hat noch nie einer anständigen Schlacht widerstehen können, und Wellington brauchte jeden erfahrenen Offizier, den er bekommen konnte«, warf Rafe ein. »Aber ich hoffe auch, daß die Kriegszeit ein für allemal vorbei ist. Selbst Michael könnte eines Tages vom Glück im Stich gelassen werden.«
Diese Worte erinnerten Lucien an den Grund ihres Zusammentreffens. »Da ihr jetzt beide hier seid, kommen wir wieder aufs Geschäft zurück. Ich habe Nicholas gebeten, dabei zu sein, da er bei seinen Reisen auf dem Kontinent gelegentlich mit der Frau zusammengearbeitet hat, die ich eben erwähnte.«
Die beiden Männer tauschten Blicke aus. »Ich habe immer schon vermutet, daß du Lucien auf deinen Streifzügen durch Europa ein wenig geholfen hast«, sagte Rafe zu Nicholas.
»Zigeuner können überall hingelangen, und das habe ich mir oft zunutze gemacht. Offenbar bist du auch in den Dienst gezwungen worden.« Nicholas warf Lucien einen amüsierten Blick zu. »Du läßt wirklich kaum einen in deine Karten sehen. Daß Rafe und ich noch nicht einmal voneinander wußten ...! Aber es überrascht mich, daß du nun mit uns beiden sprichst. Sind wir plötzlich vertrauenswürdig geworden?«
Obwohl er wußte, daß man ihn nur necken wollte, ereiferte sich Lucien. »In meiner Branche ist es nur gesund, niemandem mehr zu verraten, als er wissen muß. Ich breche mit dieser Regel heute, weil du etwas wissen könntest, das Rafe vielleicht helfen wird.«
»Ich nehme an, die fragliche Dame gehört zu deinen Agenten«, sagte Rafe. »Was für eine Art Ärger macht sie denn?«
Lucien zögerte und überlegte, wie er am besten beginnen sollte. »Du hast wahrscheinlich die Friedenskonferenz in Paris verfolgt.«
»Ja, wenn auch nicht intensiv. Wurden die meisten Punkte nicht beim Wiener Kongreß festgelegt?«
»Ja und nein. Vor einem Jahr waren die Alliierten gewillt, die Kriege Napoleons Ehrgeiz in die Schuhe zu schieben, weswegen die Beschlüsse in Wien recht bescheiden waren.« Lucien nahm die Zigarre aus dem Mund und starrte mißbilligend auf die glühende Spitze. »Alles hätte ganz gut geklappt, wenn Napoleon im Exil geblieben wäre, aber seine Rückkehr nach Frankreich und die Schlacht bei Waterloo hat die Diplomaten aufgescheucht wie eine Katze die Tauben. Weil ein großer Teil der Franzosen den Kaiser unterstützten, greifen die Alliierten jetzt durch. Frankreich wird jetzt weit härter behandelt werden als vor Napoleons Hundert Tagen.«
»Das wissen wir alle.« Rafe schnippte die Asche von seiner Zigarre. »Wo passe ich da hinein?«
»Seit einer Weile herrscht ein heftiger, verdeckter Kampf um Einfluß. Und der wird sich hinziehen, bis die Verträge unterzeichnet sind«, sagte Lucien. »Es bedarf nicht viel, um die Verhandlungen zu stören – und es könnte bis zu einem Krieg gehen. Ein funktionierender Informationsfluß ist von immenser Bedeutung. Unglücklicherweise will meine Agentin Maggie, deren Arbeit bisher von unschätzbarem Wert gewesen ist, sich aus dem Geschäft zurückziehen und Paris verlassen. Möglichst noch, bevor die Konferenz beendet ist.«
»Biete ihr mehr Geld.«
»Das haben wir. Sie ist nicht interessiert. Ich hoffe, du kannst sie überreden, ihre Meinung zu ändern und wenigstens so lange zu bleiben, bis die Konferenz vorbei ist.«
»Ah, kehren wir zum Küssen zurück«, sagte Rafe mit einem vergnügten Funkeln in den Augen. »Ich befürchte, du willst, daß ich meine Ehre auf dem Altar britischer Interessen opfere.«
»Ich bin sicher, daß dir auch noch andere Mittel zur Überzeugung einfallen«, erwiderte Lucien trocken. »Du bist immerhin ein Duke – vielleicht fühlt sie sich geschmeichelt, daß wir dich nur ihretwegen nach Frankreich schicken. Du könntest auch an ihren Patriotismus appellieren.«
Rafe zog die Brauen zusammen. »Zwar bin ich geschmeichelt, daß du meinen Charme so hoch bewertest, aber wäre es nicht einfacher gewesen, wenn einer deiner Diplomaten, der schon in Paris ist, sich darum gekümmert hätte?«
»Leider gibt es Grund zu glauben, daß ein Mitglied der Delegation ... nicht verläßlich ist. Geheime Informationen sind aus der britischen Botschaft gelangt, was uns Probleme bereitet hat.« Lucien runzelte die Stirn. »Vielleicht sehe ich Schatten, wo keine sind, vielleicht war es kein Verrat, sondern nur Unachtsamkeit, aber diese Arbeit ist zu wichtig, um das Risiko undichter Kanäle einzugehen.«
»Ich bekomme langsam das Gefühl, daß du dir über mehr Sorgen machst, als den üblichen diplomatischen Zank«, bemerkte Rafe.
»Bin ich so durchschaubar?« fragte Lucien gequält. »Du hast leider recht – ich habe alarmierende Berichte erhalten, die auf ein Komplott hinweisen, das die Friedensverhandlungen stören oder sie möglicherweise gänzlich beenden soll.«
Rafe rollte die Zigarre zwischen Daumen und Zeigefinger und versuchte sich dabei eine einzelne Tat vorzustellen, die so vernichtend war, daß die Alliierten in ein Chaos gestürzt würden. »Geht es um ein Attentat? Alle Staatsoberhäupter der Alliierten – außer dem britischen Prinzregenten – sind mitsamt Europas führenden Diplomaten in Paris. Jemanden davon zu töten, könnte natürlich eine Katastrophe bewirken.«
Lucien blies einen Rauchkringel aus, der eine Art Heiligenschein über seinem blonden Kopf bildete. »Exakt. Ich hoffe bei Gott, daß ich mich irre, aber mein sechster Sinn sagt mir, daß sich da etwas Ernsthaftes zusammenbraut.«
»Wer soll der Attentäter, wer das Ziel sein?«
»Wenn ich das wüßte, dann müßte ich jetzt nicht mit euch reden«, erwiderte Lucien düster. »Ich habe bloß Andeutungen gehört, die aus einem halben Dutzend Quellen zusammengeschustert sind. Es gibt zu viele feindliche Splittergruppen, zu viele mögliche Ziele. Deswegen ist es ja so unglaublich wichtig, daß wir Informationen bekommen.«
Nicholas meldete sich zu Wort. »Ich habe gehört, daß es letzten Winter in Paris einen Anschlag auf Wellington gegeben hat. Könnte er wieder gemeint sein?«
»Das ist meine größte Befürchtung«, sagte Lucien. »Nach dem Sieg bei Waterloo ist er der am meisten geschätzte Mann in ganz Europa. Wenn er umgebracht wird, dann weiß der Himmel, was alles geschehen kann.«
Nüchtern dachte Rafe über die Worte seines Freundes nach. »Und deswegen soll ich diese Lady überreden, ihre Informationen weiterzuschicken, bis die Verschwörung aufgedeckt und die Konferenz beendet ist.«
»Exakt.«
»Erzähl mir von ihr. Ist sie Französin?«
Lucien zog eine Grimasse. »Es wird immer undurchschaubarer. Ich lernte Maggie durch jemand anderen kennen und weiß praktisch nichts von ihrem Vorleben. Auf jeden Fall wirkt und spricht sie wie eine Engländerin. Ich habe nie weiter nachgehakt, denn was zählte, war, daß sie Napoleon haßte und ihre Arbeit als einen persönlichen Kreuzzug betrachtet hat. Ihre Informationen waren stets gut, und sie hat mir niemals einen Grund gegeben, ihr zu mißtrauen.«
Rafe bemerkte die unausgesprochene Zurückhaltung. »Doch nun ist etwas geschehen, das dich an ihrer Zuverlässigkeit zweifeln läßt.«
»Ich kann mir immer noch kaum vorstellen, daß Maggie uns verraten will, aber ich weiß nicht mehr, ob ich meiner eigenen Menschenkenntnis trauen darf. Sie kann einen Mann von allem überzeugen, weswegen sie unter anderem auch so effektiv arbeitet.« Lucien zog die Brauen zusammen. »Die Lage ist zu ernst, um irgend etwas einfach so anzunehmen, und das schließt ihre Loyalität ein. Nun, da Napoleon auf dem Weg nach St. Helena ist, könnte sie mehr Schäfchen ins trockene bringen, indem sie britische Geheimnisse an andere Alliierte verkauft. Vielleicht hat sie es ja so eilig, Paris zu verlassen, weil sie als Doppel- oder Dreifachagentin genug Geld verdient hat und nun fliehen will, bevor man sie erwischt.«
»Gibt es irgendeinen Beweis für mangelnde Loyalität?«
»Wie ich schon sagte, hielt ich Maggie immer für eine Engländerin.« Lucien warf Nicholas einen Blick zu. »Du kennst Maggie als Maria Bergen. Kürzlich hast du mir einen Brief geschrieben, und anstatt sie mit Namen zu nennen, hast du von ihr als ›die Österreicherin, mit der du in Paris gearbeitet hast‹ gesprochen.«
Nicholas setzte sich kerzengerade im Stuhl auf und starrte ihn verdutzt an. »Du meinst, Maria ist eigentlich Engländerin? Das kann ich kaum glauben. Nicht nur, daß ihr Deutsch akzentfrei war, ihr ganzes Gehabe, ihre Gesten kamen mir so österreichisch vor.«
»Es kommt noch schlimmer«, fuhr Lucien mit widerwilligem Grinsen fort. »Ich wurde neugierig und befragte andere Männer, die sie in früheren Episoden ihrer Karriere kennengelernt haben. Der französische Royalist ist sicher, daß sie Französin ist, der Preuße sagt, sie stamme aus Berlin, und der Italiener würde auf das Grab seiner seligen Mutter schwören, daß sie aus Florenz kommt.«
Rafe konnte das Lachen nicht unterdrücken. »Also weißt du nun überhaupt nicht mehr, wo die Loyalität der Lady liegt – wenn sie überhaupt eine Lady ist.«
»Eine Lady ist sie, daran gibt es keine Zweifel«, fauchte Lucien. »Aber auf welcher Seite steht sie?«
Rafe war überrascht von der heftigen Reaktion seines Freundes, denn Lucien hielt normalerweise jede Sentimentalität aus seiner Arbeit heraus. Rafe gab seiner Stimme einen beruhigenden Klang. »Was soll ich tun, wenn ich herausfinde, daß sie uns betrügt – sie umbringen?«
Lucien warf ihm einen harten Blick zu, wie um zu prüfen, ob Rafe einen Scherz machen wollte. »Wie ich bereits gesagt habe, geht es hier nicht ums Töten. Wenn ihr nicht mehr vertraut werden kann, informierst du einfach Außenminister Castlereagh, daß er nichts mehr auf ihr Wort geben soll. Möglicherweise will er sie dazu benutzen, ihren anderen Arbeitgebern falsche Informationen zu übermitteln.«
»Laß mich kurz zusammenfassen, ob ich es richtig verstehe«, sagte Rafe. »Du willst, daß ich die Lady aufsuche und sie überrede, mit ihrem Talent mögliche Mordpläne aufzudecken. Zusätzlich soll ich feststellen, wo ihre Loyalität liegt, und wenn es irgendwelche Gründe für Mißtrauen gibt, soll ich die britische Delegation davon in Kenntnis setzen, sich nicht mehr auf ihre Arbeit zu verlassen. Richtig?«
»Exakt. Aber du mußt dich beeilen. Die Verhandlungen laufen nicht mehr allzu lange, also wird jegliches Komplott bald stattfinden müssen.« Lucien blickte zu Nicholas, der schweigend zugehört hatte. »Bei deiner Erfahrung mit Maggie in ihrer Maria-Bergen-Rolle – hättest du noch etwas hinzuzufügen?«
»Nun, sie ist unzweifelhaft die schönste Spionin in Europa.« Nicholas fügte noch ein paar Bemerkungen über sie an, aber die daraus folgende Diskussion erbrachte nichts.
Schließlich sagte Rafe: »Die Informationen, die wir haben, sind, gelinde gesagt, widersprüchlich. Offenbar ist unsere Maggie eine hervorragende Schauspielerin. Ich muß mir also selbst ein Bild machen und hoffen, daß sie sich für meinen berüchtigten Charme empfänglich zeigt.«
Sie standen alle auf. »Wie bald kannst du abreisen?« fragte Lucien.
»Übermorgen. Die schönste Spionin in Europa? Ich finde, das hört sich ziemlich vielversprechend an.« Seine Augen leuchteten auf, als er seine Zigarre ausdrückte. »Ich schwöre, ich werde für König und Vaterland mein Bestes geben.«
Anschließend kehrten sie zu der Party zurück und mischten sich unter die Gäste. Als Rafe fand, er hätte genug belangloses Zeug geredet, um normal zu erscheinen, hatte er es eilig, zu verschwinden. Dann kam es ihm in den Sinn, daß er vergessen hatte zu fragen, wie diese Maggie überhaupt aussah. Da Julien verschwunden war, machte er sich auf die Suche nach Nicholas.
Endlich sah er seinen Freund, der einen mit einem Vorhang separierten Alkoven betrat. Doch als Rafe den Vorhang beiseite schob, hielt er plötzlich inne, und seine Hand krampfte sich um den Stoff.
In dem dunklen Alkoven lagen sich Nicholas und seine Frau Clare in den Armen. Sie küßten sich nicht; wenn es so gewesen wäre, hätte Rafe nur gelächelt und wäre, ohne einen Gedanken daran zu verschwenden, verschwunden. Doch der Anblick, der sich ihm bot, war viel simpler und dennoch unendlich verstörender.
Clare und Nicholas lehnten mit geschlossenen Augen aneinander, sein Arm um ihre Taille, ihre Stirn an seiner Wange. Es war ein Bild absoluten Vertrauens und des Verständnisses, und es war weit intimer als jede noch so leidenschaftliche Umarmung.
Da die beiden ihn nicht bemerkt hatten, zog Rafe sich lautlos und mit verhärteter Miene zurück.
Es war nicht gut, auf seine Freunde neidisch zu sein.
Nach einem Tag voller hektischer Vorbereitungen war der Duke of Candover bereit, England zu verlassen. Er würde rasch reisen – nur mit einer Kutsche, seinem Kammerdiener und mit einer Garderobe, die der modebewußtesten Stadt Europas gerecht wurde.
Als die Uhr Mitternacht schlug, setzte er sich mit einem Brandy nieder und ging die Post des Tages durch, um zu sehen, ob etwas Dringendes anlag. Fast ganz unten im Stapel befand sich eine Nachricht von Lady Jocelyn Kendal. Oder vielmehr Lady Presteyne; da sie nun verheiratet war, mußte er aufhören, ihren Mädchennamen zu benutzen. In dem Brief dankte sie Rafe dafür, sie in die Arme ihres Mannes zurückzuschicken, erging sich in Beschreibungen über die Freuden der Ehe und drängte ihn, selbst über diese Sache nachzudenken.
Er lächelte ein wenig und freute sich, daß es für sie funktioniert hatte. Bei aller Schönheit, ihrem Rang und ihrem Reichtum war Jocelyn ein sehr nettes Mädchen. Und wenn sie und Lord Presteyne ein Faible für Romantik hatten, dann konnten sie ewig glücklich sein, obwohl Rafe so seine Zweifel hatte. Er hob sein Glas zu einem einsamen Toast auf sie und ihren glücklichen Ehemann, kippte dann den Brandy hinunter und schleuderte das Glas in den Kamin.
Der Toast kam von Herzen, doch sein Lächeln wurde bitter, als er die splittrigen Ergebnisse seines uncharakteristischen Ausbruchs musterte. Ein Mann, der für seine Gewandtheit bekannt war, sollte sich nicht so gehenlassen. Doch das Gefühl des Verlustes nagte an ihm.
Er schenkte sich noch ein Glas ein, setzte sich dann wieder in seinen Armsessel und musterte seine Bibliothek mit einem feindseligen Blick. Es war ein wunderschön geschnittener, geschmackvoll gestalteter Raum, der den Reichtum seines Besitzers widerspiegelte. In keiner seiner großen Besitzungen besaß Rafe einen Raum, in dem er sich so wohl fühlte wie hier. Wieso zum Teufel war er dann nur so deprimiert?
Müde gestand er sich ein, daß er seiner tristen Laune nur beikommen konnte, wenn er sich ihr ergab. Jocelyn war nicht das Thema; wenn er das Mädchen so dringend hätte haben wollen, dann hätte er sie heiraten können.
Was Rafe so verstörte, war die Tatsache, daß er sie deswegen begehrt hatte, weil sie ihn so an Margot erinnert hatte – wunderschöne, verräterische Margot, nunmehr seit zwölf Jahren tot. Äußerlich war die Ähnlichkeit gering, doch beide Frauen besaßen den hellwachen, spritzigen Geist, der so unwiderstehlich war. Immer wenn er mit Jocelyn zusammengewesen war, hatte er an Margot denken müssen. Sie hatte in ihm etwas berührt, wie es keine andere Frau je geschafft hatte. Und da er nicht mehr jung war, würde es auch keine andere mehr schaffen.
Während er an seinem Brandy nippte, versuchte er, objektiv über Margot Ashton nachzudenken, aber es war ihm unmöglich, seine erste Liebe im Licht der Vernunft zu betrachten. Die erste Liebe und übrigens auch die letzte; die Erfahrung hatte ihn für immer von romantischen Illusionen befreit. Und doch war damals jene Illusion so real erschienen.
Margot war nicht die schönste Frau gewesen, der er je begegnet war, bestimmt nicht die reichste oder vornehmste. Aber sie hatte Wärme und Charme im Überfluß besessen und nur so vor unvergleichlicher Lebendigkeit gesprüht.
Bittersüße Bilder stürzten auf ihn ein. Das erste Mal, als er sie gesehen hatte; der erste zögernde, wunderbare Kuß; lange Stunden über ein Schachbrett gebeugt, auf dem die einzelnen Spielzüge ein tieferes, leidenschaftlicheres Spiel maskiert hatten; das ernsthafte Gespräch mit dem leicht amüsierten Colonel Ashton, als er um ihre Hand angehalten hatte.
Am lebhaftesten drang nun die Szene auf ihn ein, als sie sich morgens in aller Frühe zu einem Ritt im Hyde Park getroffen hatten. Ein leichter Nieselregen fiel, als er durch die stillen Straßen von Mayfair trabte, doch der Himmel klarte auf, als er in den Hyde Park ritt. Am Himmel erschien plötzlich ein intensiv-bunter Regenbogen. Während er ihn bewunderte, tauchte Margot auf einer silbergrauen Stute aus dem Dunst am Fuß des Regenbogens auf. Sie wirkte wie eine Märchenkönigin aus einer Legende.
Sie hatte gelacht und ihm die Hand entgegengestreckt – als wäre der Goldschatz am Ende des Regenbogens Mensch geworden. Natürlich hatte er gewußt, daß dieser Zauber aus der Kombination von Licht und Wetter entstanden war, aber es kam ihm damals so verdammt real vor.
Zwei Wochen später war die Affäre beendet, und seine Illusion ebenso.
Seine tiefste Reue entsprang dem Wissen, daß es seine eigene Eifersucht und sein Zorn gewesen waren, die ihre Verlobung zunichte gemacht hatten. Wenn er mit einundzwanzig bereits die kühle Gefaßtheit besessen hätte, die er später entwickelt hatte, wenn er in der Lage gewesen wäre, ihren Betrug zu akzeptieren, dann hätte er die ganzen Jahre von ihrer Freundschaft profitieren können.
Denn als alles gesagt und entschieden war, war es diese Kameradschaft, die er am meisten vermißte. Er wußte, daß die Zeit seine Erinnerungen schöner färbte, denn keine Frau konnte wirklich so begehrenswert sein, wie seine Gedanken sie zeichneten. Doch niemals würde er aufhören zu vermissen, wie sie zusammen gelacht hatten, wie sich ihre Blicke quer durch einen Raum trafen, wie ihre Augen ihn auf eine wissende, intensive Art ansahen, so daß er den Rest der Welt um sich herum vergaß.
Seine Träumerei kam zu einem abrupten Ende, als der Stiel des Glases in seinen Fingern brach. Er schnitt sich in den Finger, der Brandy lief über seinen Schoß. Mit düsterer Miene stand er auf. Er hatte gar nicht gewußt, daß die Gläser so zerbrechlich waren. Der Butler würde tagelang schmollen, wenn er herausfand, daß der Bestand an teuren Kristallkelchen nun um zwei Exemplare reduziert war.
Rafe beschloß, in sein Schlafzimmer zu gehen. Ein bißchen Selbstmitleid mochte ja durchaus recht stimmungsvoll sein, aber er wollte am folgenden Tag auf eine anstrengende Reise gehen. Es war an der Zeit, die Gedanken an jugendliche Dummheiten zu begraben und ein wenig zu schlafen.
Kapitel 2
»Nein!«
Obwohl die Parfümflasche nur wenige Millimeter an seiner Schläfe vorbeisauste, machte Robert Anderson keinen Versuch, sich zu ducken, denn er wußte, daß Maggie höchst zielsicher war und ihn nicht wirklich verletzen wollte. Sie schickte ihm sozusagen nur eine Botschaft. Praktisch veranlagt, wie sie war, hatte sie ein billiges Parfüm gewählt, das ihr ein knauseriger Bayer mit schlechtem Geschmack geschenkt hatte.
Robin lächelte seine Gefährtin an. Ihr schöner Busen hob und senkte sich, und ihre Augen sprühten Funken. Graue Augen heute, denn sie trug einen silbernen Morgenrock. »Warum willst du diesen Duke, den Lord Strathmore schickt, denn nicht treffen? Du solltest dich geschmeichelt fühlen, daß du für das Außenministerium so wichtig bist.«
Die Antwort war eine Flut italienischer Unflätigkeiten. Er neigte den Kopf zur Seite und lauschte kritisch. Als ihr Ausbruch vorbei war, sagte er: »Sehr kreativ, Maggie, Liebes, aber findest du nicht, daß du aus der Rolle fällst? Sollte Magda, die Gräfin Janos, nicht ungarisch fluchen?«
»Ich kenne mehr Beleidigungen in Italienisch«, sagte sie hochmütig. »Und du weißt sehr gut, daß ich nur aus der Rolle falle, wenn du da bist.« Ihr Gehabe als würdevolle Adelige wich einem schelmischen Kichern. »Glaub ja nicht, daß du das Thema wechseln kannst. Es geht hier um den hochwohlgeborenen, edlen Duke of Candover.«
»Richtig.« Robin musterte sein Gegenüber nachdenklich. Sie kannten sich bereits sehr lange, und wenn ihre Beziehung auch keine intime mehr war, verband sie doch eine tiefe Freundschaft. Es sah ihr nicht ähnlich, so temperamentvoll zu reagieren, auch wenn sie seit zwei Jahren die Rolle der launischen ungarischen Gräfin spielte. »Was hast du denn gegen den Duke?«
Maggie setzte sich an ihren Frisiertisch und nahm eine Bürste aus Elfenbein auf. Sie begann ihre blonden Haare, die ihr über den Rücken fielen, zu bürsten, während sie ihn stirnrunzelnd im Spiegel ansah. »Der Mann ist ein penibler Tugendbold.«
»Heißt das, er hat sich nicht richtig von deinem Charme einfangen lassen?« fragte Robin interessiert. »Seltsam. Der Duke of Candover hat den Ruf, ein absoluter Frauenliebling zu sein. Ich kann mir nicht vorstellen, daß er einen appetitlichen Happen wie dich verschmähen würde.«
»Ich bin kein appetitlicher Happen, Robin! Lebemänner sind die schlimmsten Tugendbolde von allen. Frömmelnde Heuchler nach meiner Erfahrung.« Sie zerrte heftig an einem Knoten im Haar. »Versuch nicht, einen neuen Streit vom Zaun zu brechen, bevor wir den alten nicht beendet haben. Ich weigere mich, mit dem Duke of Candover irgend etwas zu tun zu haben, so wie ich mich weigere, weiterhin zu spionieren. Dieser Abschnitt meines Lebens ist vorbei, und niemand – weder du noch Candover noch Strathmore – kann meine Entscheidung ändern. Sobald ich ein paar geschäftliche Dinge erledigt habe, verschwinde ich aus Paris.«
Robin stellte sich hinter sie. Er nahm ihr die Bürste aus der Hand und zog sie sanft durch ihr goldenes Haar. Es war seltsam, daß sie sich in vielen Dingen wie ein Ehepaar verhielten, obwohl sie niemals verheiratet gewesen waren. Er hatte es immer geliebt, ihr Haar zu bürsten, und der Duft nach Sandelholz, der ihrem Haar entströmte, versetzte ihn zurück in die Zeit, als sie leidenschaftliche junge Geliebte waren, die sich nur wenig Gedanken um die Welt und ihre Zukunft machten.
Maggies Spiegelbild wirkte versteinert. Ihre Augen hatten nun eine kalte, graue Farbe, das Funkeln war verschwunden. Nachdem er ein paar Minuten gebürstet hatte, entspannte sie sich langsam.
»Hat Candover irgend etwas Schreckliches getan?« fragte er schließlich ruhig. »Wenn es dich aufregt, ihn wiederzusehen, dann erwähne ich das Thema nicht mehr.«
Sie wählte ihre Worte behutsam, denn sie wußte, daß Robin unangenehm empfänglich für versteckte Bedeutungen war. »Obwohl er sich sehr widerlich verhalten hat, ist es lange her, und es wäre kein Grund, ihn nicht wiederzusehen. Ich will einfach nur nicht, daß noch einer kommt und mich zu etwas drängt, was ich nicht mehr tun will.«
Robins Blick traf ihren im Spiegel. »Warum kannst du dann nicht einmal mit ihm sprechen, um ihm das mitzuteilen? Wenn du dich für frühere Gemeinheiten rächen willst, könntest du ihn treffend strafen, wenn du deine ganzen Verführungskünste mobilisierst. Du könntest ihn in den Wahnsinn treiben, während du sein Ersuchen ablehnst.«
»Ich bin nicht sicher, ob das funktioniert«, sagte sie trocken. »Wir haben uns nicht gerade im Einvernehmen getrennt.«
»Das macht doch nichts – wahrscheinlich hat er seitdem nur reuig und lüstern über dich nachgedacht. Die Hälfte der europäischen Diplomaten hat Staatsgeheimnisse ausgeplaudert, weil sie um ein Lächeln von dir gekämpft haben.« Robin grinste. »Zieh das grüne Ballkleid an, seufze tief und traurig, wenn du seine Bitte verwirfst, und gleite dann anmutig aus dem Zimmer. Ich wette, du kannst seinen Seelenfrieden für mindestens einen Monat stören.«
Sie musterte ihr Spiegelbild nachdenklich. Zwar besaß sie eine gehörige Portion von dem, was Männer verrückt machen konnte, aber sie hatte ihre Zweifel, daß Candover ihrem Charme erliegen würde. Dennoch: Zorn und Lust lagen nah beieinander, und Rafael Whitbourne war bei ihrem letzten Zusammentreffen in der Tat sehr, sehr zornig gewesen ...
Ein träges, spitzbübisches Lächeln verzog ihre Lippen. Dann warf sie den Kopf zurück und lachte. »Also gut, Robin, du hast gewonnen. Ich treffe mich mit diesem albernen Duke. Er hat wirklich ein paar schlaflose Nächte verdient. Aber ich garantiere dir, daß er an meiner Meinung nichts ändern wird.«
Robin küßte sie leicht auf ihren Scheitel. »Braves Mädchen.« Trotz ihrer vehementen Weigerungen bestand eine gute Chance, daß Candover doch etwas bewirkte. Vielleicht würde sie noch eine Weile bleiben. Und das wäre eine gute Sache.
Als Robin fort war, rief Maggie nicht sofort nach ihrer Zofe, um sich bei dem Rest ihrer Toilette helfen zu lassen. Statt dessen kreuzte sie die Arme auf dem Frisiertisch, legte den Kopf darauf und gab sich ihrem Gefühl der Trauer und Müdigkeit hin. Es war dumm gewesen, diesem Treffen zuzustimmen. Ja, Rafe Whitbourne hatte sich mies benommen, aber selbst damals schon hatte sie begriffen, daß seine Grausamkeit der Qual entsprungen war, und sie hatte niemals das Vergnügen haben können, ihn zu hassen.
Aber sie liebte ihn auch nicht; die Margot Ashton, die gedacht hatte, die Sonne kreiste um seinen hübschen Kopf, war vor einem Dutzend Jahren gestorben. In den folgenden Jahren, seit Robin sie unter seine Fittiche genommen und ihr einen Grund gegeben hatte, weiterzuleben, war Maggie sehr viele verschiedene Personen gewesen. Rafe Whitbourne war nur noch eine bittersüße Erinnerung, die für ihr gegenwärtiges Ich nicht mehr relevant war.
Liebe und Haß waren in der Tat die zwei Seiten ein und derselben Münze, denn beide bedeuteten starke Gefühle für jemanden. Das Gegenteil davon war Gleichgültigkeit. Da Gleichgültigkeit das einzige Gefühl war, das Rafe in Maggie auslösen konnte, lohnten kleine Racheakte nicht der Mühe. Sie wollte einfach nur mit dieser Episode ihres Lebens – mit Verrat, Irreführung und Informantionsbeschaffung – abschließen.
Und mehr noch: Sie wollte endlich eine Aufgabe erfüllen, die sie zu lange vor sich hergeschoben hatte, und anschließend nach England zurückkehren, das sie dreizehn Jahre nicht mehr gesehen hatte. Sie würde noch einmal ganz von vorne anfangen müssen, und diesmal ohne Robins Protektion. Sie würde ihn sehr vermissen, doch selbst die Einsamkeit würde eine Art Erleichterung mit sich bringen; sie beide kannten sich zu gut, als daß sich Maggie in seiner Gegenwart neu erfinden könnte.
Sie hob den Kopf und legte ihr Kinn auf eine Faust, während sie sich im Spiegel betrachtete. Ihre hohen Wangenknochen halfen ihr, die Ungarin überzeugend darzustellen, und sie sprach die Sprache gut genug, daß niemand je Zweifel an ihrer magyarischen Nationalität gehabt hatte. Aber wie würde Rafe Whitbourne sie nach all den Jahren sehen?
Ein bitteres Lächeln huschte über ihre Lippen – Lippen, denen mindestens elf schlechte Gedichte gewidmet waren. Offenbar konnte der Mann doch noch Gefühle in ihr erzeugen, wenn es auch nur Eitelkeit war. Sie musterte ihr Spiegelbild kritisch.
Maggie hatte ihr Aussehen niemals besonders großartig gefunden, denn ihrem Gesicht fehlte die klassische Zurückhaltung wahrer Schönheit. Ihre Wangenknochen waren zu hoch, ihr Mund zu groß und ihre Augen waren es ebenfalls.
Doch wenigstens sah sie nun ein wenig anders aus als mit achtzehn Jahren. Ihr Teint war immer schon makellos gewesen, und Reiten und Tanzen hatten ihren Körper in Form gehalten. Obwohl ihre Kurven voller geworden waren, hatte sich noch kein Mann darüber beschwert. Sicher, ihr Haar war dunkler geworden, doch statt zu einem stumpfen Braun zu werden, wie blondes Haar es oft tat, hatte es nun die Farbe reifenden, goldenen Weizens. Sie fand, daß sie im ganzen betrachtet besser aussah als zu der Zeit, als Rafe und sie verlobt gewesen waren.
Es war verführerisch, ihn sich als fett und glatzköpfig vorzustellen, aber dieser verfluchte Kerl hatte immer schon zu den Personen gehört, deren Aussehen sich mit zunehmendem Alter verbesserte. Seine Persönlichkeit war eine ganz andere Sache. Selbst mit einundzwanzig war er nicht frei von der Arroganz seines Standes und Reichtums gewesen, und die vergangenen Jahren hatten dies sicher nur verstärkt. Wahrscheinlich war er inzwischen unerträglich.
Als sie sich wieder dem Ankleiden zuwandte, sagte sie sich, daß es bestimmt amüsant werden würde, seine Selbstgefälligkeit zu reizen. Doch sie konnte nichts gegen das unangenehme Gefühl tun, daß sie einen gewaltigen Fehler beging, ihn zu treffen.
***
Der Duke of Candover war seit 1803 nicht mehr in Paris gewesen, und vieles hatte sich in der Stadt verändert. Doch selbst in der Niederlage war Frankreichs Hauptstadt immer noch das Zentrum Europas. Vier wichtige Herrscher und unzählige mindere Monarchen waren gekommen, um zusammenzutragen, was sie aus dem Wrack von Napoleons Reich noch herausholen konnten. Die Preußen wollten Rache, die Russen wollten mehr Gebiete, die Österreicher hofften, den Kalender zum Jahre 1789 zurückblättern zu können, und die Franzosen wollten den massiven Repressalien nach Napoleons wahnsinnigen und blutigen Hundert Tagen entgehen.
Die Briten versuchten wie üblich, vor allem fair zu sein. Es war, als wollte man versuchen, Kampfhunde zu einem vernünftigen Gespräch zu bringen.
Trotz der Anzahl der Herrscher war mit »König« immer Ludwig XVIII. gemeint, jener alternde Bourbone, dessen unsichere Hand Frankreichs Zepter hielt, während »Kaiser« stets Bonaparte bedeutete. Selbst in seiner Abwesenheit warf letzterer einen längeren Schatten als jeder andere anwesende Mensch.
Rafe mietete sich Zimmer in einem luxuriösen Hotel, dessen Name sich in den vergangenen drei Monaten dreimal geändert hatte, womit es die unterschiedlichen politischen Strömungen widerspiegelte. Nun hieß es Hotel de la Paix, da der Frieden ein Aspekt war, den die meisten Parteien für annehmbar hielten.
Er hatte gerade noch Zeit, sich zu baden und anzuziehen, bevor er zu dem österreichischen Ball gehen würde, wo Lucien das Treffen mit der mysteriösen Maggie arrangiert hatte. Rafe zog sich mit Sorgfalt an, da er den Vorschlag seines Freundes, die Lady zu bezaubern, noch sehr gut im Kopf hatte. Die Erfahrung hatte ihn gelehrt, daß er mit aufrichtigem Interesse und einem liebenswürdigen Lächeln fast alles von einer Frau haben konnte. Nicht selten boten ihm die Damen sehr viel mehr, als er ursprünglich gewollt hatte.
Von Kopf bis Fuß ganz der Duke, ging er also zum Ball, der eine glitzernde Versammlung der Berühmten und Berüchtigten Europas war. Unter den Gästen waren nicht nur alle wichtigen Monarchen und Diplomaten, sondern auch Hunderte Lords, Ladys, Flittchen und Schlitzohren, die stets von der Macht angezogen werden.
Rafe wanderte herum, nippte an seinem Champagner und grüßte Bekannte. Doch unter der oberflächlichen Fröhlichkeit spürte er die Wirbel gefährlicher Unterströmungen. Luciens Befürchtungen waren durchaus begründet: Paris war ein Pulverfaß, und ein einziger Funken konnte den ganzen Kontinent einmal mehr in einem neuen Krieg explodieren lassen.
Der Abend war schon ein gutes Stück vorangeschritten, als ein junger Engländer mit blondem Haar und einem schlanken Körperbau auf ihn zukam. »Guten Abend, Euer Hoheit, mein Name ist Robert Anderson. Jemand möchte Sie gerne treffen. Wenn Sie mit mir kommen würden?«
Anderson war kleiner und jünger als Rafe und besaß ein Gesicht, das ihm vage vertraut vorkam. Während sie sich ihren Weg durch das Gedränge bahnten, musterte Rafe unauffällig seinen Führer und fragte sich unwillkürlich, ob dieser Mann das schwache Glied der Delegation sein mochte. Anderson sah so gut aus, daß man ihn fast als schön bezeichnen konnte, und er vermittelte den Eindruck liebenswürdiger Leere. Wenn er ein gewitzter, gefährlicher Spion war, dann verbarg er es gut.
Sie verließen den Ballsaal und stiegen eine Treppe zu einem Korridor hinauf, der links und rechts von Türen gesäumt war. An der letzten Tür hielt Anderson an. »Die Gräfin wartet auf Sie, Euer Hoheit.«
»Kennen Sie die Lady?«
»Ich habe sie gelegentlich getroffen.«
»Wie ist sie?«
Anderson zögerte, dann schüttelte er den Kopf. »Das sollten Sie selbst herausfinden.« Er öffnete die Tür und sagte formell: »Euer Hoheit, darf ich Ihnen Magda, Gräfin Janos, vorstellen?« Nach einer respektvollen Verbeugung verschwand er.
Ein einziger Kerzenleuchter warf ein weiches Licht in das kleine, reich möblierte Zimmer. Rafes Blick wanderte sofort zu der Gestalt, die im Halbdunkel beim Fenster stand. Obwohl sie ihm den Rücken zugedreht hatte, wußte er sofort, daß sie schön sein mußte, denn ihre anmutige Haltung drückte Selbstvertrauen aus.
Als er die Tür schloß, wandte sie sich ihm mit einer langsamen, provozierenden Bewegung zu, die das Kerzenlicht bezaubernd über ihre vollen Kurven gleiten ließ. Ein fedriger Fächer verdeckte das meiste ihres Gesichts, und eine dicke goldene Locke fiel über ihre Schulter. Sie strahlte Sinnlichkeit aus, und Rafe verstand nun, warum Lucien gemeint hatte, sie könne das Urteilsvermögen eines Mannes benebeln. Während sein Körper sich in unerwünschter Reaktion verspannte, mußte er zugeben, daß sie die Kunst der wortlos angedeuteten Versprechungen sehr gut beherrschte.
Weniger subtil war ihr Dekolleté: Der Ausschnitt war so tief, daß jeder Mann, der noch nicht tot war, hinsehen mußte. Wenn diese Aufgabe von Rafe verlangte, seine Ehre zu opfern, um die Lady zu überreden, dann würde er es mit Vergnügen tun. »Gräfin Janos, ich bin der Duke of Candover. Ein gemeinsamer Freund bat mich, mit Ihnen über eine wichtige Sache zu reden.«
Ihre Augen beobachteten ihn neckend oberhalb des Fächers. »Tatsächlich?« schnurrte sie mit einem Hauch Magyaren-Akzent. »Vielleicht ist es für Sie oder Lord Strathmore wichtig, Monsieur le Duc, für mich jedoch nicht.« Langsam senkte sie den Fächer und zeigte ihre hohen Wangenknochen, dann eine kleine, gerade Nase. Sie hatte weiche, rosige Haut, einen großen, sinnlichen Mund ...
Rafe hielt ungläubig inne, während sein Herz heftig zu hämmern begann. Es heißt, jeder Mensch hätte irgendwo auf der Welt ein Ebenbild, und er hatte scheinbar soeben das von Margot Ashton getroffen.
Mit Mühe seinen Schock niederkämpfend, versuchte er, die Gräfin mit dem Bild in seinen Erinnerungen zu vergleichen. Diese Frau wirkte wie fünfundzwanzig; Margot mußte jetzt einunddreißig sein, aber sie könnte durchaus jünger aussehen.
Auf jeden Fall war die Gräfin größer als Margot, die nur knapp über der Durchschnittsgröße gewesen war, oder nicht? Aber Margots Haltung und ihre Vitalität hatte sie immer größer erscheinen lassen, als sie wirklich war. Es hatte ihn überrascht, wie tief er sich hinunterbeugen mußte, als sie sich zum ersten Mal küßten ...
Heftig riß er sich aus seinen chaotischen Emotionen heraus und zwang sich, seine Analyse fortzuführen. Die Augen dieser Frau schienen grün, ihr Aussehen war exotisch und fremdartig. Dennoch: Sie trug ein grünes Kleid, und Margots Augen waren immer veränderlich gewesen. Je nach Laune und Kleidung hatte sich die Farbe von Grau über Grün bis zu Braun ändern können.
Die Ähnlichkeit war unheimlich, und er fand keinen Unterschied, der sich nicht auf die lange Zeit und die beschönte Erinnerung zurückführen ließ. Obwohl die Nachricht von ihrem Tod ihn erreicht hatte, konnte ein Irrtum vorgelegen haben; oft wurden Neuigkeiten auf den langen Wegstrecken vertauscht oder verändert. Wenn Margot all die Jahre auf dem Kontinent gelebt hatte, mußte sie sich nicht mehr zwingend wie eine Engländerin geben.
Doch das Verhalten der Gräfin legte nahe, daß sie einander fremd waren. Wenn sie Margot war, dann würde sie ihn gewiß erkennen, denn er hatte sich kaum verändert. Und wie er sie kannte, hätte sie ihr Erkennen sofort gezeigt, wenn auch nur durch einen Fluch.
Statt dessen stand sie mit einem leichten, amüsierten Lächeln da und ließ Rafes Musterung über sich ergehen. Das Schweigen zog sich in die Länge, und er wußte, er mußte den nächsten Schritt machen.
Also schlüpfte er wieder in die Rolle des Dukes, der niemals um Worte verlegen war. Mit einer tiefen Verbeugung begann er: »Verzeihen Sie, Gräfin. Man hat mir gesagt, Sie wären die schönste Spionin Europas, aber selbst diese Beschreibung wird Ihnen nicht gerecht.«
Sie lachte freundlich und warm. Margots Lachen. »Was für schöne Worte, Euer Hoheit. Ich habe ebenfalls von Ihnen gehört.«
»Nichts, was mir Schande macht, hoffe ich.« Rafe beschloß, daß es nun Zeit für seinen berüchtigten Charme war. Er trat näher an sie heran und lächelte. »Sie wissen, warum ich hier bin, und die Sache ist ernst. Vergessen wir die Formalitäten. Ich würde es vorziehen, wenn Sie meinen Vornamen benutzen.«
»Und der lautet?«
Wenn sie Margot war und nur schauspielerte, dann tat sie es ausgesprochen gut. Sein Lächeln hatte einen Hauch von Angestrengtheit, als er ihre Hand hob und sie küßte. »Rafael Whitbourne. Meine Freunde nennen mich gewöhnlich Rafe.«
Sie entriß ihm die Hand, als hätte eine Schlange sie gebissen. »Ein Schwerenöter sollte auch kaum den Namen eines Erzengels besitzen.«
Und bei diesen Worten verschwanden Rafes Zweifel. »Mein Gott, Margot, du bist es wirklich«, sagte er verblüfft. »Du bist die einzige, die es je gewagt hat, meine mangelnde Ähnlichkeit mit Erzengeln zu erwähnen. Es war ein schönes Bonmot ... ich habe es selbst noch häufig verwendet. Aber wie zum Teufel bist du hierher gekommen?«
Sie bewegte neckisch den Fächer. »Wer ist Margot, Euer Hoheit? Irgendein dummes, kleines englisches Mädchen, das mir ähnelt?«
Ihre Lüge weckte in ihm plötzlichen und ungewöhnlich heftigen Zorn. Ihm fiel nur ein einziges Mittel ein, ihre Identität ein für allemal festzustellen. Mit einer raschen Bewegung trat er direkt vor sie, riß sie fest an sich und küßte sie auf ihren spöttischen Mund.
Es war Margot, er war sich bis ins Mark seiner Knochen sicher. Nicht nur, weil er wußte, wie sich ihr Körper anfühlte oder die vertraute Weichheit ihrer Lippen. Es war vor allem der verlockende, einzigartige Duft, den nur sie verströmte.
Aber er brauchte nicht einmal diese Merkmale, um sich ganz sicher zu sein, denn er hatte niemals eine andere Frau kennengelernt, die ein solches Verlangen in ihm weckte. Die Leidenschaft flammte in ihm auf, und er vergaß, warum er in Paris war, warum er sie umarmt hatte, vergaß alles außer dem Wunder in seinen Armen.
Margot erschauderte, und für einen verzauberten Augenblick drückte sie sich an ihn, öffnete ihre Lippen unter den seinen. Die Jahre schienen sich in nichts aufzulösen. Sie, Margot, lebte, und sie war zum ersten Mal seit über zwölf Jahren wieder eins mit sich und der Welt ...
Der Augenblick war zu Ende, fast bevor er begann. Sie versuchte, von ihm abzurücken, doch er hielt sie weiterhin fest, erforschte ihren Mund und nahm voll Staunen zur Kenntnis, wie wenig sie sich in dieser Hinsicht verändert hatte.
Als sie ihn heftig gegen die Brust stieß, ließ er sie unwillig los. Sie wich zurück, und ihre Augen schleuderten so wilde Blitze, daß er glaubte, sie wollte ihn schlagen. Er gestand sich selbst ein, daß sie Grund dazu hatte. Er würde nichts tun, um ihrem Schlag auszuweichen.
Doch plötzlich wandelte sich ihre Laune, und sie lachte mit echtem Vergnügen. In ihrem echten, akzentfreien Englisch sagte sie: »Du hast ganz schön gerätselt, nicht wahr?«
»Das kann man wohl sagen.« Rafe war froh, ein bißchen der alten Margot erhascht zu haben, und musterte, immer noch ungläubig, ihre Gestalt. Warum zum Teufel hatte Lucien ihm bloß nichts gesagt? Aber dann fiel ihm ein, daß keiner der Gefallenen Engel Margot je kennengelernt hatte. Wie hätte Lucien, ohne ihren Namen zu wissen, eine Verbindung zu dieser Maggie knüpfen sollen? »Bitte vergib mir meine Aufdringlichkeit«, sagte er nun bemüht gefaßt. »Aber ich fand, es war der beste Weg, deine Identität auf die Probe zu stellen.«
»Vergeben ist nicht meine Maxime«, sagte sie spöttisch und schlüpfte wieder in ihre Rolle. Es war keine Verbesserung.
Sie trat an das Buffet, wo Gläser und eine offene Flasche Bordeaux standen. Nachdem sie zwei Gläser voll eingeschenkt hatte, gab sie Rafe eins. »Unsere freundlichen Gastgeber haben für alles gesorgt, was ein ungezogenes Paar sich wünschen kann. Es wäre eine Schande, es zu verschwenden. Nimm doch bitte Platz.« Sie setzte sich auf einen der Stühle, wobei sie demonstrativ das samtene Sofa mied.
Als er sich auf dem anderen Stuhl niederließ, fragte sie: »Warum hattest du Schwierigkeiten, mich zu erkennen? Man sagt, ich sei für eine Frau meines fortgeschrittenen Alters gut erhalten.«
»›Das Alter kann ihr nichts anhaben ...‹?« Er lächelte schwach, als er die Zeile zitierte. »Das allein verwirrt schon – du siehst kaum älter aus als mit achtzehn. Aber der eigentliche Grund, warum ich dich nicht sofort als Margot Ashton erkannt habe, war, daß man dich für tot hält.«
»Ich bin nicht mehr Margot Ashton«, sagte sie mit gespannter Stimme, »aber tot bin ich auch nicht. Wie kommst du denn auf die Idee?«
Selbst jetzt, da er wußte, daß sie lebte, mußte er sich zwingen, gleichgültig zu scheinen, als er zu sprechen begann. »Du und dein Vater wart in Frankreich, als der Frieden von Amiens endete. Man berichtete, ihr beiden seid von französischem Pack ermordet worden, das seine Waffen und Dienste Napoleon anbieten wollte.«
Ihre rauchigen Augen verengten sich in einem Ausdruck, den er nicht richtig deuten konnte. »Diese Nachricht hat England erreicht?«
»Ja, und sie hat ziemlich viel Aufruhr erzeugt. Die Öffentlichkeit war aufgebracht, daß ein ehrenvoller Armeeoffizier und seine schöne, junge Tochter nur deswegen sterben mußten, weil sie Briten waren. Doch da wir uns ja bereits mit Frankreich im Krieg befanden, waren keine besonderen Sanktionen möglich.« Er studierte ihr Gesicht, während er seinen Wein trank. »Was stimmt denn an der Geschichte?«
»Genug«, sagte sie knapp. Sie stellte ihr Glas ab und stand auf. »Du bist hier, um mich zu überreden, meinen Dienst für England fortzusetzen. Erst wirst du an meine Vaterlandsliebe appellieren, dann wirst du mir eine beträchtliche Summe Geld bieten. Ich werde beides zurückweisen. Da der Ausgang der Sache feststeht, sehe ich nicht, warum wir unsere Zeit damit verschwenden sollen. Gute Nacht und auf Wiedersehen. Ich hoffe, du hast ein paar schöne Tage in Paris.«
Sie bewegte sich auf die Tür zu, hielt aber an, als Rafe eine Hand hob. »Bitte warte einen Moment.«
Nun, da er wußte, daß »Maggie« Margot war, hatte sich ein Teil seiner Aufgabe erledigt. Er wußte, daß sie wirklich Engländerin war, nicht französisch, nicht preußisch, italienisch, ungarisch, oder was auch immer sie zu spielen pflegte.
Abgesehen davon weigerte er sich grundweg zu glauben, daß sie ihr Land je verraten würde. Wenn britische Staatsgeheimnisse verkauft wurden, dann nicht durch sie. Doch er war sich nicht sicher, wie er nun vorgehen sollte. Bei der Antipathie, die Margot für ihn empfand, hätte Lucien seinen Gesandten nicht schlechter auswählen können. »Kannst du zehn Minuten für mich erübrigen, Margot?« fragte er sie. »Vielleicht habe ich etwas Überraschendes für dich.«
Einen Augenblick hing die Entscheidung in der Schwebe. Dann zuckte sie die Schultern und setzte sich wieder. »Ich bezweifle es, aber meinetwegen, rede. Und bitte denke freundlicherweise daran, daß ich nicht mehr Margot bin. Ich heiße Maggie.«
»Wo ist der Unterschied zwischen den beiden?«
Ihre Augen verengten sich wieder. »Das geht dich verdammt noch mal nichts an, Hoheit. Sag bitte, was du zu sagen hast, so daß ich gehen kann.«
Es war nicht leicht, bei einer solchen Feindseligkeit fortzufahren, aber er mußte es versuchen. »Warum willst du ausgerechnet in diesem Moment Paris verlassen? Das neue Abkommen wird noch vor Ende des Jahres ausgehandelt und unterzeichnet werden. Es sind vielleicht nur noch wenige Wochen.«
Sie machte eine abwehrende Geste. »Mit einem solchen Argument hat man mich schon einmal hingehalten. Der Wiener Kongreß sollte in sechs bis acht Wochen beendet sein, statt dessen dauerte er neun Monate. Kurz vor dem Ende kehrte Napoleon zurück, und meine Dienste waren einmal mehr unverzichtbar.«
Sie hob das Weinglas und nippte daran. »Ich bin es leid, mein Leben aufzuschieben«, sagte sie mit einer Spur Erschöpfung. »Bonaparte ist auf dem Weg nach Sankt Helena, um seine Seele den Möwen zu empfehlen, und ich muß mich endlich um längst überfällige Dinge kümmern.«
Er fühlte, wie sich ihre Stimmung verändert hatte, und wagte es, eine weitere persönliche Frage zu stellen. »Was für Dinge?«
Sie starrte in ihr Glas und schwenkte den Wein darin. »Ich will zuerst in die Gascogne.«
Rafe spürte ein Prickeln im Nacken, als er ahnte, was sie sagen wollte. »Warum?«
Sie blickte auf und sah ihn emotionslos an. »Um die Leiche meines Vaters zu finden und sie zurück nach England zu bringen. Es ist zwölf Jahre her. Es wird eine Weile dauern, bis ich herausgefunden habe, wo sie ihn begraben haben.«
Obwohl er richtig geraten hatte, konnte er sich kaum darüber freuen. Der Wein schmeckte plötzlich bitter, denn er mußte etwas aussprechen, das er lieber für sich behalten hätte. »Du brauchst nicht in die Gascogne zu reisen. Dein Vater ist nicht dort.«
Ihre Brauen zogen sich zusammen. »Was meinst du damit?«
»Ich war zufällig in Paris, als mich die Nachricht von eurem Tod erreichte, also ging ich in das Dorf in der Gascogne, wo die Morde geschehen waren. Man sagte mir, daß die zwei frischen Gräber die der ›deux Anglais‹ waren, und ich nahm an, daß du und dein Vater gemeint wart. Ich arrangierte alles, daß die Leichen nach England überführt wurden. Sie liegen auf dem Familienfriedhof auf dem Anwesen deines Onkels.«
Die beherrschte Maske löste sich auf, und sie beugte sich vor und vergrub das Gesicht in den Händen. Rafe hätte sie gerne getröstet, aber er wußte, er konnte ihr nichts geben, was sie nehmen würde.
Er hatte Margot und ihren Vater um die freundschaftliche, liebevolle Beziehung beneidet, die so ganz anders war als die distanzierte Höflichkeit zwischen ihm und seinem eigenen Vater. Colonel Ashton war ein liebenswerter, aufrichtiger Soldat gewesen, der seine Tochter weniger als Duchesse, als vor allem glücklich sehen wollte. Sein Tod durch die Hände des Mobs mußte sie vernichtet haben.
Nach einem langen Schweigen hob Maggie wieder den Kopf. Ihre Augen waren unnatürlich hell, aber sie war gefaßt. »Im zweiten Sarg muß Willis, der Bursche meines Vaters, gelegen haben. Er war klein, etwa von meiner Größe. Die beiden ... haben ihr Leben teuer verkauft, als sie angegriffen wurden.«