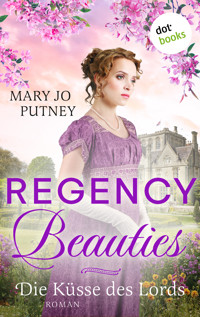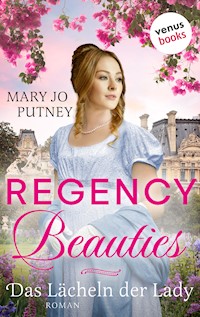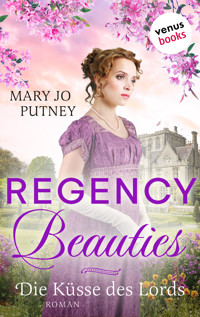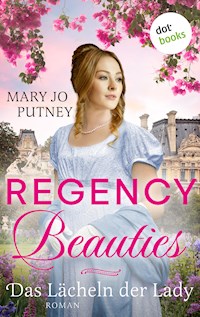4,99 €
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Samt und Seide
- Sprache: Deutsch
Sie folgt dem Ruf der Freiheit: Der berauschende historische Roman »Der Duft von wilden Granatäpfeln« von Mary Jo Putney jetzt als eBook bei dotbooks. Der Orient im 19. Jahrhundert: Zwölf Jahre ist es her, dass die Diplomatentochter Juliet der feinen britischen Gesellschaft den Rücken kehrte. Im glanzvollen Persien hat die rebellische junge Frau sich ein Leben in Freiheit und Wohlstand aufgebaut, fernab von den steifen Regeln ihres Heimatlandes und den Fesseln ihrer Ehe. Doch dann taucht ausgerechnet Ross Carlisle, der bekannte Abenteurer aus England, in ihrem kleinen Reich auf – der Mann, vor dem sie einst floh und mit dem sie auf dem Papier immer noch verheiratet ist. Er befindet sich auf einer hochgefährlichen Rettungsmission, und Juliet weiß: Ohne sie hat er keine Chance zu überleben. Gegen jede Vernunft schließt sie sich ihm an … »Dieser bemerkenswerte Roman voller Abenteuer und unstillbarer Liebe ist ein atemberaubendes Leseerlebnis, an das man sich für immer erinnern wird.« Romantic Times Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der opulente historische Roman »Der Duft von wilden Granatäpfeln« von Bestsellerautorin Mary Jo Putney. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 675
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Über dieses Buch:
Der Orient im 19. Jahrhundert: Zwölf Jahre ist es her, dass die Diplomatentochter Juliet der feinen britischen Gesellschaft den Rücken kehrte. Im glanzvollen Persien hat die rebellische junge Frau sich ein Leben in Freiheit und Wohlstand aufgebaut, fernab von den steifen Regeln ihres Heimatlandes und den Fesseln ihrer Ehe. Doch dann taucht ausgerechnet Ross Carlisle, der bekannte Abenteurer aus England, in ihrem kleinen Reich auf – der Mann, vor dem sie einst floh und mit dem sie auf dem Papier immer noch verheiratet ist. Er befindet sich auf einer hochgefährlichen Rettungsmission, und Juliet weiß: Ohne sie hat er keine Chance zu überleben. Gegen jede Vernunft schließt sie sich ihm an …
»Dieser bemerkenswerte Roman voller Abenteuer und unstillbarer Liebe ist ein atemberaubendes Leseerlebnis, an das man sich für immer erinnern wird.« Romantic Times
Über die Autorin:
Mary Jo Putney wurde in New York geboren und schloss an der Syracuse University die Studiengänge English Literature und Industrial Design ab. Nach ihrem Studium übernahm sie Designarbeiten in Kalifornien und England, bis es sie schließlich nach Baltimore zog, und sie mit dem Schreiben begann. Mit ihren Büchern gelang es ihr, alle Bestsellerlisten in den USA zu erklimmen, unter anderem die der New York Times, des Wall Street Journals, der USA Today, und der Publishers Weekly.
Die Website der Autorin: maryjoputney.com/
Bei dotbooks erscheinen von Mary Jo Putney außerdem die Romane »Im Land der wilden Orchideen«, »Regency Beauties – Die Küsse des Lords« und »Regency Beauties – Das Lächeln der Lady«.
***
eBook-Neuausgabe Juli 2022
Die amerikanische Originalausgabe erschien erstmals 1992 unter dem Originaltitel »Silk and Secrets« bei Onyx. Die deutsche Erstausgabe erschien 1994 unter dem Titel »Wilder als Hass, süßer als Liebe« bei Lübbe.
Copyright © der amerikanischen Originalausgabe Mary Jo Putney, 1992
Copyright © der deutschen Erstausgabe by
Gustav Lübbe Verlag GmbH, Bergisch Gladbach, 1994
Copyright © der Neuausgabe 2022 dotbooks GmbH, München
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover.
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © shutterstock
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (mm)
ISBN 978-3-98690-078-6
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
In diesem eBook begegnen Sie möglicherweise Begrifflichkeiten, Weltanschauungen und Verhaltensweisen, die wir heute als unzeitgemäß oder diskriminierend verstehen. Bei diesem Roman handelt es sich um ein rein fiktives Werk, das vor dem Hintergrund einer bestimmten Zeit spielt oder geschrieben wurde – und als solches Dokument seiner Zeit von uns ohne nachträgliche Eingriffe neu veröffentlicht wird. Diese Fiktion spiegelt nicht unbedingt die Überzeugungen des Verlags wider.
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Der Duft von wilden Granatäpfeln« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Mary Jo Putney
Der Duft von wilden Granatäpfeln
Roman
Aus dem Amerikanischen von Kerstin Winter
dotbooks.
Im Gedenken an meinen Vater, Laverne Putney. Als begeisterter Leser, der sich besonders für Geschichte interessierte, wäre er glücklich darüber gewesen, daß ich Schriftstellerin geworden bin, und hätte sich gewünscht, daß ich ein Buch über den Bürgerkrieg schreibe.
Vielleicht eines Tages, Pop.
O Western wind, when wilt thou blow,
That the small rain down can rain?
Christ, that my love were in my arms,
And in my bed again!
Anonymous, um 1530
(O westlicher Wind, wann wirst du dich erheben,
auf daß der kleine Regen niedergehen kann?
Jesus, auf daß meine Liebe wieder in meinen Armen liegt,
Und wieder in meinem Bett!)
Anmerkungen der Autorin
Schon als Kind war ich immer von den leeren Stellen auf der Landkarte fasziniert, die das geheimnisvolle Herz Asiens darstellten. Seit zweitausend Jahren ist dieses ferne, gefährliche Land von Karawanen durchgequert worden, die der Seidenstraße folgten, jenem antiken Handelsweg von China nach Rom. Aus den Namen der Oasenstädte – wie Samarkand, Buchara und Kaschgar – atmete pure Romantik.
Zentralasien wird gelegentlich Turkestan genannt, da viele der unzähligen Völker Turksprachen wie Usbekisch oder Turkmenisch sprechen. Es war die Heimat der barbarischen Nomadenstämme, die im Laufe der Jahrhunderte östlich nach China und westlich nach Kleinasien und Europa einfielen und friedliche Bauernvölker unterwarfen oder sogar vernichteten. Das östliche Turkestan ist heute die chinesische Provinz Singkiang, während das westliche Turkestan heute die russischen Republiken Usbekistan, Turkmenistan, Kirgisistan, Tadschikistan und Kasachstan einschließt.
Südlich dieses Gürtels der Turksprachen liegt ein ausgedehntes Gebiet, in dem iranische Sprachen vorherrschen. Diese schließen Persisch (im modernen Iran und in Afghanistan heute Farsi genannt), Kurdisch und Paschto ein, welches die Hauptsprache von Afghanistan und Westpakistan ist. Persisch war die lingua franca Zentralasiens und wurde – ähnlich wie das Französische in Europa – als Hof- und Literatursprache benutzt. Dazu kam das klassische Arabisch, das in der ganzen moslemischen Welt als Koransprache gebräuchlich war und ist.
Während Turkestan eine große ethnische und linguistische Mannigfaltigkeit aufwies, waren die meisten Menschen dort durch den Islam miteinander verbunden, was einige wilde Stämme jedoch nicht davon abhielt, ihre moslemischen Brüder zu versklaven. Zudem gab es Gemeinden von Juden, Christen und Hindus. Die Moslems behandelten Christen und Juden gewöhnlich respektvoll – sie nannten sie die »Leute der Schrift«, wegen der biblischen Schriften, die allen drei Religionen heilig sind.
Im neunzehnten Jahrhundert stießen die expandierenden Reiche Großbritannien und Rußland immer wieder im weiten Ödland Zentralasiens aufeinander, um in einem Konflikt, den man »The Great Game«, das Große Spiel, nannte, für ihren eigenen Vorteil zu kämpfen. Die Briten schwärmten nordwestlich von Indien aus, während die Russen sich südwärts bewegten und schließlich die unabhängigen zentralasiatischen Khanate Chiwa, Buchara und Kokand annektierten.
Aus dem »Great Game« entsprangen viele wahre Geschichten über Heldentum und Abenteuer, und dieses Buch ist durch eine Rettungsmission inspiriert worden, die 1844 wirklich stattgefunden hat: Der Emir von Buchara hatte zwei britische Armeeoffiziere, Colonel Charles Stoddart und Lieutenant Arthur Conolly, gefangengenommen. Natürlich glaubte die britische Regierung, die beiden Männer wären hingerichtet worden. Doch die Berichte waren widersprüchlich und undurchsichtig, und so beschloß schließlich eine Gruppe von Offizieren, daß für ihre Kameraden mehr getan werden sollte.
Ein exzentrischer anglikanischer Geistlicher namens Dr. Joseph Wolff meldete sich freiwillig, um in Turkestan um die Freilassung von Stoddart und Conolly zu bitten. Als Ex-Missionar im Mittleren Osten und in Zentralasien war Wolff höchstqualifiziert, diese Mission auszuführen, weswegen die besorgten Offiziere innerhalb kürzester Zeit das Geld aufbrachten, um seine Reisekosten zu decken. Wolff gelang es tatsächlich, unbehelligt bis nach Buchara zu kommen, jedoch nur, um dort zu erfahren, daß die beiden Gefangenen bereits exekutiert worden waren. Der Priester verlor bei dieser Mission fast sein eigenes Leben, konnte jedoch mit Hilfe des persischen Botschafters entkommen und sicher nach England zurückkehren.
Die Geschichte, die dieses Buch erzählt, ist erfunden, doch ich habe versucht, den Duft Turkestans einzufangen, und einige Begebenheiten basieren auf realen Vorfällen. Da die Geschichte drei Jahre vor der Reise des Dr. Wolff spielt, habe ich mir bei der Datierung der Hintergrundereignisse einige künstlerische Freiheiten erlaubt, doch die Figuren des Emir Nasrullah, des Nayeb Abdul Samut Khan und des Kalifen von Merv sind historische Personen, deren Charaktere im Buch genau nachgezeichnet worden sind. Die Bezüge auf britische Abenteurer wie Lady Hester Stanhope und Sir Alexander Burnes sind ebenfalls historisch stimmig.
Heute ist das ehemalige British India zu Indien, Pakistan und Bangladesh zerfallen, und das russische Reich erlebt massive Veränderungen, da lange unterdrückte ethnische Gruppen ihre Identität behaupten wollen.
Das Herz Zentralasiens hat sein Geheimnis bewahrt.
Prolog
August, 1840
Die Nacht brach schnell herein, und eine schmale Mondsichel leuchtete am wolkenlosen, indigofarbenen Himmel. Im Dorf rief der Muezzin die Gläubigen zum Gebet, und die monotonen Gesänge mischten sich mit dem betörenden Aroma von gebackenem Brot und dem beißenden Geruch des Rauches. Die Szene war vertraut, friedlich – eine Szene, wie sie die Frau schon zahllose Male zuvor erlebt hatte. Doch nun, als sie am Fenster innehielt, überkam sie für einen Moment eine seltsame Orientierungslosigkeit, und sie hatte Mühe, das Schicksal zu akzeptieren, das sie in dieses fremde Land geführt hatte.
Gewöhnlich sorgte sie dafür, daß sie zu beschäftigt war, um über ihre Vergangenheit nachzudenken, aber heute überschwemmte sie eine Woge von schmerzvollem Kummer. Plötzlich vermißte sie die wilden grünen Hügel ihrer Kindheit, und obwohl sie längst neue Freunde gefunden hatte, auf die sie sich verlassen konnte, fehlte ihr auf einmal der sichere Schoß der Familie.
Am meisten, mußte sie sich eingestehen, vermißte sie allerdings jenen Mann, der mehr als nur ein Freund gewesen war. Sie fragte sich, ob er wohl an sie gedacht hatte, und wenn, ob es voller Hass, Zorn oder mit kühler Gleichgültigkeit geschehen war. Um seinetwillen hoffte sie, daß er vor allem Gleichgültigkeit empfand.
Alles wäre leichter zu ertragen gewesen, wenn sie nichts mehr gefühlt hätte, dennoch konnte sie den Schmerz nicht bedauern, der auch noch nach so vielen Jahren ihren Alltag unterspülte. Der Schmerz war der letzte Rest der Liebe, und sie war noch nicht gewillt, diese Liebe zu vergessen, ja, sie zweifelte daran, daß sie jemals bereit dazu sein würde.
Ihr Leben hätte so anders verlaufen können. Sie hatte alles gehabt – mehr als die meisten Frauen sich je erträumen konnten. Wenn sie nur klüger gewesen wäre oder wenigstens nicht so impulsiv gehandelt hätte. Wenn sie sich nur nicht ihrer Verzweiflung hingegeben hätte.
Wenn, ach, wenn ...
Schließlich erkannte sie, daß ihre Gedanken einmal mehr in die nutzlose Litanei der Reue hineinrutschten. Sie holte tief Atem, riß sich zusammen und zwang sich, an die Aufgaben zu denken, die ihrem Leben Sinn gaben. Die erste Überlebensregel, die sie gelernt hatte, lautete: Nichts kann die Vergangenheit ändern!
Einen kurzen Moment berührte sie den Anhänger unter ihrem Kleid. Dann wandte sie dem Fenster und dem dunkler werdenden Himmel den Rücken zu. Sie hatte ihr Bett gemacht, nun mußte sie auch darin liegen. Allein.
Kapitel 1
London
August, 1840
Lord Ross Carlisle nippte an seinem Drink, während er wehmütig das verliebte Paar beobachtete, und er dachte darüber nach, daß dies ausreichte, um einen Mann in die entlegensten Ecken der Welt zu jagen. Und genau dort würde Ross hingehen, ans Ende dieser Welt. Daß die beiden Liebenden seine besten Freunde waren, machte es ihm nicht leichter.
Sein Blick glitt durch das komfortable, hell erleuchtete Wohnzimmer, wo sie sich gerade ihren Verdauungsdrink genehmigten: Brandy für die beiden Herren und Limonade für Lady Sara, die im dritten Monat schwanger war. Die Freunde hatten viele ähnliche Abende zusammen verbracht, und Ross wußte, daß er die anregenden Gespräche und diese Nähe vermissen würde.
Ross’ Gastgeber erinnerte sich schließlich wieder an seine Erziehung, löste sich aus der Umarmung mit seiner Frau und hob die Karaffe. »Noch einen Schluck Brandy, Ross?«
»Ein wenig, gerne. Nicht zu viel, sonst bin ich für die Fahrt morgen nicht klar genug.«
Mikhal Connery goß etwas von der bernsteinfarbenen Flüssigkeit in beide Kristallgläser. Während er seines hob, toastete er: »Auf daß du eine aufregende und erfolgreiche Reise hast.«
Seine Frau Sara hob ihr Glas ebenfalls und fügte hinzu: »Und auf daß du nach all der Aufregung sicher nach Hause zurückkommst.«
»Auf diese beiden Wünsche trinke ich mit Vergnügen.« Ross warf Sara einen innigen Blick zu und dachte, wie gut ihr die Ehe bekam. Sie war seine Cousine, und beide besaßen die ungewöhnliche Farbkombination aus braunen Augen und glänzendem goldenem Haar, doch Sara strahlte eine innere Gelassenheit aus, die Ross niemals kennengelernt hatte. Viele Jahre lang hatte er seinen zweifelhaften Frieden darin gefunden, daß er durch die Welt gereist war und sich Herausforderungen gestellt hatte, die seinen ganzen Verstand und seine ganze Kraft erforderten.
»Mach dir keine Sorgen, Sara. Das Morgenland ist weitaus weniger gefährlich als die vielen anderen Länder, in denen ich schon gewesen bin. Und ganz bestimmt ist es sicherer als die rauhen Berge, in denen ich deinen seltsamen Ehemann kennengelernt habe.«
Mikhal trank sein Glas leer und stellte es dann ab. »Vielleicht wäre es mal an der Zeit, das rastlose Wandern aufzugeben und dich zur Ruhe zu setzen, Ross«, meinte er mit trägem Blick, der die Belustigung in seinen tiefgrünen Augen verbergen sollte. Er legte seine Hand über Saras. »Eine Frau ist weit aufregender als eine Wüste oder eine Ruinenstadt.«
Ross lächelte. »Es gibt nichts Schlimmeres als Konvertierte. Als du vor anderthalb Jahren nach England kamst, hättest du bei dem Gedanken an Ehe laut gelacht.«
»Aber jetzt bin ich viel klüger geworden.« Mikhal legte einen Arm um seine Frau und zog sie an sich. »Es gibt natürlich nur eine Sara, aber irgendwo in England solltest auch du auf eine passende Braut stoßen.«
Vielleicht lag es am Brandy, vielleicht war es auch die reine Lust zu provozieren, die Ross nun antworten ließ: »Da hast du zweifellos recht, aber das nützt mir überhaupt nichts. Oder habe ich zu erwähnen vergessen, daß ich bereits eine Frau habe?« Ausgesprochen zufrieden erkannte er, daß er es tatsächlich geschafft hatte, seinen Freund zu überraschen.
»Du weißt verdammt gut, daß du so etwas niemals erwähnt hast«, entgegnete Mikhal, und seine schwarzen Augenbrauen zogen sich zusammen. Dann blickte er fragend seine Frau an.
Sara nickte. »Es stimmt wirklich, Lieber. Tatsächlich war ich sogar Brautjungfer bei der Hochzeit.« Sie wandte sich an ihren Cousin: »Es ist gut ein Dutzend Jahre her, nicht wahr, Ross?«
»Faszinierend.« Mikhal betrachtete plötzlich die Vergangenheit aus einer anderen Perspektive, und da es ihm absolut an der höflichen britischen Zurückhaltung mangelte, erklärte er nun mit lebhaftem Interesse: »Du hältst deine Frau aber wahrhaftig gut versteckt. Was ist das für eine abenteuerliche Geschichte, oder bin ich zu indiskret?«
»Du bist zu indiskret, Lieber«, antwortete Sara und funkelte ihn bedeutungsvoll an.
Ross lächelte schwach. »Du brauchst Mikhal nicht so böse anzusehen, Sarah. Es ist ja kein Geheimnis. Es ist nur sehr lange her.« Im plötzlichen Bedürfnis nach mehr Brandy schenkte er sich nach. »Ich war gerade frisch aus Cambridge zurückgekehrt, als ich Juliet Cameron kennenlernte. Sie war eine Schulfreundin von Sara, ein rothaariger Wirbelwind, und sie schien mir ganz anders als die Frauen, denen ich bis dahin begegnet war. Irgendwie lebendiger, unbeschwerter. Als Tochter eines schottischen Diplomaten hatte Juliet einen großen Teil ihrer Jugend an exotischen Orten wie Persien oder Tripolis verbracht, und da ich ja ein angehender Orientalist war, fand ich sie vom ersten Augenblick unwiderstehlich. Wir heirateten bald darauf, obwohl uns alle Welt prophezeite, es würde niemals funktionieren. Tja, und ausnahmsweise behielt alle Welt recht.«
Ross’ beiläufiger Tonfall war offenbar nicht überzeugend genug gewesen, denn Mikhal verengte die Augen in unangenehmer Scharfsicht. »Und wo ist deine Juliet jetzt?«
»Sie ist schon lange nicht mehr meine Juliet, und ich habe nicht die leiseste Ahnung, wo sie stecken mag.« Ross kippte den Inhalt seines Glases in einem Zug hinunter. »Nach sechs Monaten Ehe rannte sie weg und hinterließ mir lediglich die Nachricht, daß sie weder mich noch England je wiedersehen wolle. Laut ihrem Anwalt wächst ihr Vermögen, aber ich habe überhaupt keine Idee, wo und wie. So wie ich Juliet kenne, hat sie sich wahrscheinlich als Pascha in der Sahara niedergelassen und hält sich jetzt den ersten männlichen Harem der Welt.« Er stand auf. »Es ist schon spät. Ich sollte jetzt nach Hause gehen, wenn ich morgen vor Tagesanbruch aufbrechen will.«
Sara erhob sich, kam auf ihn zu und umarmte ihn herzlich. »Du wirst mir fehlen, Ross. Sei bitte vorsichtig!«
»Ich bin immer vorsichtig.« Ross küßte sie auf die Stirn und wandte sich dann an seinen Freund.
Er hatte die Absicht gehabt, ihm die Hand zu geben, aber Mikhal, wieder ganz unenglisch, drückte ihn kräftig an sich. »Und wenn das nicht reicht, dann sei gefährlich. Das kannst du ziemlich gut ... jedenfalls für einen englischen Gentleman.«
Ross grinste und klopfte dem anderen auf die Schulter. »Ich hatte gute Lehrer.«
Alle drei lachten, als Ross schließlich ging. Er hatte es immer vorgezogen, sich mit Lachen statt mit Tränen zu verabschieden.
***
Konstantinopel
Januar, 1841
Der britische Botschafter der Hohen Pforte lebte ein dutzend Meilen von Konstantinopel in einem Ort an der Meerenge des Bosporus. Als Ross die Botschaft zu einem Höflichkeitsbesuch betrat, stellte er amüsiert fest, daß die Einrichtung auch in Mayfair nicht fehl am Platz gewesen wäre. Als Bastion der britischen Lebensart konnte man der Residenz des Botschafters kein Versäumnis nachsagen, auch wenn sie von außen wie das Heim eines sehr wohlhabenden Türken aussah.
Ein Diener hatte Ross’ Karte hineingebracht, und es verstrichen nur wenige Minuten, bis der Botschafter selbst, Sir Stratford Canning, heraustrat, um seinen vornehmen Besucher persönlich zu begrüßen.
»Lord Ross Carlisle!« Der Botschafter reichte ihm die Hand. »Ich freue mich, Sie endlich einmal kennenzulernen. Ich habe Ihre beiden Bücher gelesen. Ich kann zwar nicht behaupten, daß ich Ihre Schlußfolgerungen immer billige, aber Ihre Werke waren höchst interessant und aufschlußreich.«
Ross lächelte und schüttelte Cannings Hand. »Für einen Autor reicht es, gelesen zu werden, Sir Stratford. Durchweg gebilligt zu werden, ist zuviel der Hoffnung. Ich habe soeben ein drittes Buch beendet, und so werden Sie bald noch mehr Dinge haben, die Sie mißbilligen können.«
Der Botschafter lachte. »Werden Sie sich lange in Konstantinopel aufhalten, Lord Ross?«
»Nur für etwa zwei Wochen, bis ich alle Vorbereitungen getroffen habe, um in den Libanon weiterzureisen. Danach möchte ich mir Nordarabien ansehen. Ich würde gerne mit den Beduinen ziehen.«
Canning erschauderte. »Lieber Sie als ich. Mein innigster Wunsch ist es, den Rest meines Lebens in England zu verbringen, aber man schickt mich immer wieder hierher. Das ist schon mein dritter Aufenthalt in Konstantinopel. Süßholzraspelei, wissen Sie – sie behaupten immer, niemand könnte den Posten so gut wie ich ausfüllen.«
Ross, der Cannings exzellenten Ruf kannte, lächelte. »Ich nehme stark an, daß das Außenministerium recht hat.«
»Ich wollte gerade in meinem Arbeitszimmer einen Tee zu mir nehmen. Hätten Sie Lust, mir Gesellschaft zu leisten?« Nachdem Ross genickt hatte, führte Canning ihn durch einen Flur in ein hübsches Büro, dessen Wände mit Bücherregalen gesäumt waren. »Ich habe ein paar Briefe für Sie, die seit einigen Wochen auf Sie warten.«
»Ursprünglich hatte ich geplant, bereits Anfang Dezember in Konstantinopel einzutreffen«, erklärte Ross, während er Platz nahm. »Doch dann beschloß ich, ein paar Wochen in Athen zu bleiben. Das ist der Vorteil, wenn man aus reinem Vergnügen reist.«
Canning klingelte nach dem Tee und öffnete dann eine Schublade in seinem Schreibtisch. Nachdem er einen Moment herumgestöbert hatte, zog er einen Stapel Briefe hervor, die mit einem Band zusammengebunden waren. Mit ernster Miene reichte er sie Ross. »Ich fürchte, einer der Briefe enthält schlechte Nachrichten. Er ist schwarz umrandet.«
Die Worte des Botschafters ließen Ross’ Plauderlaune schlagartig versiegen. Er nahm das Paket in Empfang und wollte wissen: »Würden Sie es mir übelnehmen, wenn ich ihn sofort lese?«
»Natürlich nicht.« Canning gab seinem Gast einen Brieföffner und setzte sich dann diskret hinter den Tisch.
Ross überflog schnell die Briefumschläge, auf denen er unter anderem Saras, Mikhals und die Handschrift seiner Mutter erkannte. Der schwarzgesäumte Umschlag lag zuunterst im Stapel. Er sammelte Kraft, bevor er das Siegel aufbrach. Sein Vater, der Duke of Windermere, war fast achtzig, und obwohl er sich für sein Alter bester Gesundheit erfreute, wäre es nicht überraschend, wenn der Tod ihn gerufen hätte. Falls es so war, so hoffte Ross nur, daß das Ende schnell gekommen war.
So vorbereitet, den Tod seines Vaters zu akzeptieren, brauchte Ross eine Weile, um zu begreifen, daß der Brief ihm nicht das mitteilte, was er erwartet hatte. Als er den Inhalt endlich in sich aufgenommen hatte, stieß er den Atem aus, schloß die Augen und rieb sich mit einer Hand die Schläfe, während er darüber nachdachte, wie diese Neuigkeiten sein Leben verändern würde.
Vorsichtig erkundigte sich Canning: »Kann ich etwas für Sie tun, Lord Ross? Möchten Sie vielleicht einen Brandy?«
Ross öffnete die Augen. »Nein, danke. Es geht mir gut.«
»Ist es Ihr Vater?« fragte der Botschafter zögernd. »Ich habe den Duke vor einigen Jahren kennengelernt. Eine höchst bemerkenswerte Persönlichkeit.«
»Nein. Nicht mein Vater.« Ross seufzte. »Mein Bruder – vielmehr mein Halbbruder –, der Marquess of Kilburn, starb letzten Monat ganz unerwartet.«
»Es tut mir leid. Ich kannte Lord Kilburn nicht, aber für Sie ist es sicher ein großer Verlust.«
»Kein persönlicher Verlust.« Ross starrte auf den Brief und empfand ein vages Bedauern, daß sein einziger Bruder ihm im Leben und nun im Tod praktisch ein Fremder geblieben war. »Kilburn war beträchtlich älter als ich, und wir standen uns nicht sehr nah.« Tatsächlich hatten sie kaum ein Wort miteinander gesprochen, und nun, da er tot war, gab es auch keine Möglichkeit mehr, die Kluft jemals zu schließen, die Stolz und Zorn zwischen ihnen aufgerissen hatte. Kilburn hatte die zweite Ehe seines Vaters niemals gebilligt, was sich auch auf das Kind übertragen hatte, das daraus entsprang. Es hatte dem Duke of Windermere sehr viel Kummer bereitet, daß diese Ehe, die ihn selbst so glücklich machte, ihn gleichzeitig von seinem ältesten Sohn und Erben entfremdet hatte.
Der Botschafter musterte ihn plötzlich aufmerksam. »Ich bin mit Ihrer familiären Situation nicht vertraut. Hat Ihr Bruder einen Sohn hinterlassen?«
Genau da lag die Krux in der Sache. »Kilburn hat eine Tochter aus erster Ehe«, antwortete Ross. »Nachdem seine Frau vor ein paar Jahren gestorben ist, hat er wieder geheiratet, und seine zweite Frau trug ein Kind unter dem Herzen, als ich England verließ. Es ist ein paar Tage nach Kilburns Tod auf die Welt gekommen – und unglücklicherweise ist es wieder ein Mädchen.«
»Also sind Sie jetzt der Marquess of Kilburn«, schloß Canning aus dieser Erklärung. Er räusperte sich. »Sie finden, daß das ein Unglück ist? Verzeihen Sie mir, Lord Kilburn, aber die meisten Menschen wären sicher nicht besonders traurig, ein Herzogtum zu erben. Es ist wohl kaum Ihr Fehler, daß Ihr Bruder keine Söhne gezeugt hat, die sein Erbe übernehmen können.«
»Ich hatte nie den Ehrgeiz, Duke of Windermere zu werden.« Ross versuchte, sich an die Tatsache zu gewöhnen, daß er nun den Titel seines Bruders trug. »Das Erbe anzutreten, bedeutet vor allem, daß die Zeit meiner Reisen vorbei ist. Meine Eltern wollen, daß ich sofort nach England zurückkehre, denn mein Vater kann es sich nicht leisten, auch noch seinen zweiten Sohn zu verlieren. Im übrigen gibt es eine Menge familiärer Angelegenheiten, die erledigt werden müssen.«
Canning nickte bedächtig. »Ich verstehe. Es tut mir leid für Sie. Ich hoffe nur, Sie können sich wenigstens damit trösten, daß Sie bereits viele Länder gesehen haben, von denen andere Männer nur träumen können.«
»Ja, ich weiß.« Ross bemühte sich, seine durcheinandergeratenen Gefühle zu sortieren. »Ich habe in meinem Leben sehr viel Freiheit und viele Privilegien genossen. Nun wird mir die Rechnung dafür präsentiert, und ich werde wohl den Preis zahlen müssen, den diese Privilegien mit sich ziehen.«
In diesem Moment wurde der Tee gebracht, und die nächste halbe Stunde plauderten sie über weniger persönliche Dinge.
Als Ross sich schließlich erhob und zum Gehen wandte, sagte der Botschafter: »Ich hoffe doch, daß Sie mit uns essen, bevor Sie Konstantinopel wieder verlassen. Lady Canning legt großen Wert darauf, Sie kennenzulernen.« Er stand ebenfalls auf, um seinen Besucher zur Tür zu geleiten. »Vielleicht morgen abend?«
»Es wird mir ein Vergnügen sein.«
Die beiden Männer hatten das Arbeitszimmer verlassen und schon fast die Eingangshalle erreicht, als ein weiterer Besucher angekündigt wurde. Canning murmelte eine leichte Verwünschung, doch als er den Neuankömmling sah, glätteten sich seine Gesichtszüge schnell zu diplomatischer Freundlichkeit. »Entschuldigen Sie mich bitte einen Moment, Lord Ross. Es wird nicht lange dauern.«
Ross blieb in der schattigen Halle zurück. Im nächsten Moment erstarrte er beim Anblick der schlanken Europäerin mit dem kastanienbraunen Haar, die soeben angekommen war. Doch sein Erschrecken war fast genauso schnell überwunden, wie es ihn überfallen hatte. Das rötlichbraune Haar war mit silbrigen Strähnen durchzogen, und das attraktive, ernsthafte Gesicht der Frau war durch ein gutes halbes Jahrhundert Lebensjahre gezeichnet. Er kannte diese Frau, und ihre Anwesenheit hier war genauso überraschend, als wenn ihre Tochter selbst hier aufgetaucht wäre.
Canning trat hervor und begrüßte die Besucherin. »Guten Tag, Lady Cameron. Es tut mir aufrichtig leid, aber ich habe seit Ihrem letzten Besuch nichts Neues erfahren.«
»Aber ich habe etwas Neues gehört, und zwar von einem persischen Händler, der soeben in Konstantinopel eingetroffen ist. Er war monatelang in Buchara, und er schwört, daß kein Engländer dort exekutiert worden sei.« Lady Cameron heftete ihren eindringlichen Blick auf den Botschafter. »Mein Sohn lebt, Sir Stratford! Will denn die britische Regierung gar nichts unternehmen, um einen Mann zu retten, der in Erfüllung seiner Aufgaben gefangengenommen wurde?«
Geduldig antwortete Canning: »Lady Cameron, es sind gut hundert Gerüchte im Umlauf, die sich auf das Schicksal Ihres Sohnes beziehen, aber fast alle stimmen darin überein, daß er höchstwahrscheinlich tot ist. McNeill, der britische Botschafter in Teheran, hat keinen Zweifel an diesen Geschehnissen, und er ist Buchara am nächsten.« Seine Stimme wurde leiser: »Es tut mir sehr leid. Ich weiß, daß Sie es nicht glauben wollen, aber niemand kann Ihrem Sohn mehr helfen. Nicht einmal die Regierung Ihrer Majestät.«
Ross trat vor und stellte sich zu den beiden. »Lady Cameron, verzeihen Sie, daß ich mitgehört habe. Was ist denn passiert?«
Als sie den Klang seiner Stimme vernahm, drehte sich die Frau zu ihm um. »Ross!« Sie trat mit ausgestreckten Armen auf ihn zu, und ihr Gesicht erhellte sich. »Du bist die Antwort auf meine Gebete!«
»Sie kennen sich?« fragte Canning verblüfft.
»Das kann man so sagen.« Ross ergriff die Hände der Frau und beugte sich herunter, um sie auf die Wange zu küssen. »Lady Cameron ist meine Schwiegermutter.«
Canning schnitt eine Grimasse. »Dann ist es wirklich nicht gerade Ihr Glückstag heute. Ich nehme an, die Nachricht von Major Camerons tragischem Tod ist erst eingetroffen, nachdem Sie England verlassen haben.«
»Ich habe nichts gehört.« Es war schon einige Jahre her, daß Ross seine Schwiegermutter zum letzten Mal gesehen hatte, aber er hatte sie immer sehr gemocht und war dankbar dafür, daß sie ihm nicht die Schuld an Juliets Flucht zuwies. Er runzelte die Stirn, während er ihr müdes Gesicht musterte und erkannte, daß ihre frühere Unentschlossenheit durch die eiserne Entschlußkraft, die ihre wunderbare Tochter charakterisierte, ersetzt worden war. »Ist Ian etwas zugestoßen?«
»Ich muß es leider annehmen. Er hatte ja stets das größte Talent, in Schwierigkeiten zu geraten, mit Ausnahme von Juliet vielleicht. Sie mit ihren Brüdern herumstromern zu lassen, war der größte Fehler, den ich in meinem Leben begangen habe.« Jean Cameron versuchte ein Lächeln, doch es mißlang kläglich. »Wie du ja weißt, Ross, war Ian in Indien stationiert. Anfang letzten Jahres wurde er nach Buchara geschickt, um dort um die Freilassung der russischen Gefangenen zu bitten, die dort festgehalten wurden. Der Gedanke war, jeden Grund für Provokation zu beseitigen, der Rußland eine Ausrede bieten konnte, in das Khanat einzudringen. Schließlich möchte England, daß Buchara unabhängig bleibt. Nun, der Emir lehnte nicht nur dieses Ersuchen ab, sondern nahm Ian auch gleich gefangen.« Sie warf dem Botschafter einen beißenden Blick zu. »Und die Regierung, die meinen Sohn dorthin geschickt hat, läßt ihn nun im Stich.«
Canning seufzte kummervoll. »Wenn wir irgend etwas tun könnten, dann würden wir es gewiß tun. Aber Sie müssen akzeptieren, daß es zu spät ist, Lady Cameron. Der Emir von Buchara ist gefährlich und unberechenbar, und er verabscheut Europäer. Ihr Sohn war ein tapferer Mann. Er wußte, auf welches Risiko er sich einließ, als er dorthin ging.« Die Worte klangen wie die Inschrift auf einem Grabstein.
Lady Cameron öffnete den Mund, um etwas zu erwidern, als noch mehr Besucher angekündigt wurden, diesmal eine Gruppe reichgekleideter osmanischer Beamter. Nach einem kurzen Blick auf die Neuankömmlinge sagte Canning zu Ross: »Leider muß ich mich jetzt um meine neuen Gäste kümmern, aber wenn Sie und Lady Cameron noch etwas zu besprechen haben, dann können Sie gerne den Raum schräg gegenüber des Flurs benutzen.«
Lady Cameron warf ihm einen flehenden Blick zu. »Ja, Ross, wir müssen reden.«
Als Ross seiner Schwiegermutter in das kleine Empfangszimmer folgte, das Canning ihnen zugewiesen hatte, prophezeite ihm eine schwache, aber verläßliche Stimme in seinem Hinterkopf, daß Ärger im Anmarsch war.
Sobald die Tür geschlossen war, begann Lady Cameron rastlos hin- und herzulaufen. »Es ist wirklich eine Erleichterung, ein freundliches Gesicht zu sehen«, platzte sie heraus. »Canning und seine Leute sind höflich, aber sie alle behandeln mich wie eine dumme, unausgeglichene Frau, die sich nicht mit den Tatsachen abfinden will. Sie zucken zusammen, sobald ich auftauche.«
»Es bereitet ihnen Unbehagen zu wissen, wie hilflos sie sind«, gab Ross ruhig zurück. »Canning scheint zu glauben, daß Ians Tod, absolut sicher ist.«
»Aber mein Sohn ist nicht tot! Ich würde es spüren, wenn er nicht mehr lebte!« Sie warf Ross einen verlorenen Blick zu. »Das ist ein mütterlicher Instinkt, verstehst du? Auch wenn ich Juliet furchtbar vermisse, so mache ich mir über sie doch keine Sorgen, denn ich weiß, daß es ihr gutgeht, zumindest körperlich. Ian geht es nicht gut, aber er ist nicht tot ... und da bin ich mir absolut sicher!«
Ross zögerte einen Moment, bevor er behutsam antwortete: »Wenn man bedenkt, wie in diesem Teil der Welt Gefangene behandelt werden, könnte Ian Glück gehabt haben, wenn er schnell getötet worden ist.«
Sie warf ihm einen funkelnden Blick zu. »Du hast gut reden. Kümmert es dich überhaupt, ob Ian tot oder lebendig ist?«
»Heute habe ich erfahren, daß mein eigener Bruder gestorben ist.« Ross schloß kurz die Augen und dachte an seinen ungezähmten rothaarigen Schwager. Ian war knapp ein Jahr älter als Juliet und genauso überschwenglich und voller Leben wie seine Schwester. »Ich bedaure den Verlust meines eigenen Bruders nicht halb so sehr, wie ich Ians bedauern würde«, gestand er heiser.
Seine ruhige Bemerkung riß Lady Cameron unsanft aus ihrem Zorn. Sie fuhr sich mit einer müden Geste über die Stirn und sagte: »Stimmt, Sir Stratford hat eben angedeutet, du habest heute wirklich Pech. Es tut mir leid, Ross, ich wollte dich nicht treffen.« Da sie mit den Familienverhältnissen der Carlisles vertraut war, erkundigte sie sich nun: »Hat Kilburn es noch geschafft, einen Sohn in die Welt zu setzen?«
Als Ross den Kopf schüttelte, verengten sich ihre Augen nachdenklich. »Also wirst du ein Duke werden. Dann sollte ich dich wohl jetzt Kilburn nennen.«
»Wir kennen uns viel zu lange, um jetzt so formell werden zu müssen.« Er verzog bitter den Mund. »Ein zukünftiger Duke zu sein, ist ein verdammt langweiliges Geschäft. Ich werde in ein paar Tagen nach England abreisen.«
»Ich beneide deine Mutter. Es ist schade, daß meine Kinder keine Lust dazu haben, brav und sicher in Schottland zu leben. Statt dessen sind sie in alle vier Himmelsrichtungen verstreut. Und deswegen bin ich allein hier.« Lady Cameron setzte sich auf das Sofa und breitete anmutig ihre üppigen Röcke aus. Dann kam sie wieder auf das Thema zurück, das ihr am meisten am Herzen lag. »Sir Stratford tat so, als gäbe es einen eindeutigen Beweis, daß Ian tot ist, aber das ist nicht der Fall. Du weißt, wie es in diesem Teil der Welt zugeht – Buchara liegt über zweitausend Meilen von hier entfernt, und es gibt keine verläßliche Möglichkeit zu erfahren, was wirklich dort geschehen ist. Der nächste britische Konsul, Sir John McNeill, sitzt in Teheran, was immer noch gut tausend Meilen entfernt ist.«
»Wie lauten denn die Berichte, die McNeill und Canning gehört haben?«
Sie zuckte beiläufig die Schultern. »Einmal, daß es seit Jahren keine englischen Reisenden mehr in Buchara gegeben hat; dann, daß es einen Engländer dort gibt, der zum Islam übergetreten ist und nun Hauptmann der Artillerie des Emirs ist; weiter, daß letztes Jahr ein Engländer angekommen ist, der erschossen, geköpft oder im Kerker des Emirs eingesperrt wurde. Es wird ebenfalls erzählt, daß der Emir gut ein Dutzend Europäer gefangenhält, aber es sollen alles Russen sein. So viele Gerüchte ... und sie besagen nichts. Gar nichts. Der persische Händler, mit dem ich heute morgen gesprochen habe, war vor kurzem noch in Buchara, und er schwört, nichts davon gehört zu haben, daß ein Europäer hingerichtet worden ist. Wie auch immer – die Botschaft zieht es vor, an Ians Tod zu glauben, weil es einfacher für sie ist.«
»Ich glaube, da tust du der Botschaft Unrecht. Selbst wenn es keine öffentliche Exekution gegeben hat, ist das noch lange kein Beweis dafür, daß Ian noch lebt.«
Jean Cameron kratzte halb amüsiert, halb ernst die Stirn. »Das, was mich immer schon an dir gestört hat, Ross, ist deine Aufrichtigkeit. Das reicht, um einen hitzköpfigen Schotten wild zu machen.«
Er wandte sich ab und schritt durch das kleine Zimmer, bis er vor einem wenig bemerkenswerten Bild einer englischen Landschaft stehenblieb. »Stimmt. Auf Juliet hatte es einen ähnlichen Effekt.«
Er hörte, wie sie hinter ihm scharf die Luft einzog, und er wußte, daß sie ihre Bemerkung bereute. Trotz ihrer Zuneigung zueinander war es immer besser gewesen, wenn sie sich nicht getroffen hatten, denn eine Unterhaltung war stets mit Spannung verquickt, da sie – gewöhnlich vergeblich – versuchten, schmerzhafte Themen zu vermeiden.
In dem Versuch, das Schweigen zu durchbrechen, fügte sie schnell hinzu: »Ich habe es aufgegeben, von der Botschaft irgendwelche Hilfe zu erwarten. Ich habe schon daran gedacht, selbst nach London zu gehen und die Leute da anzustacheln, aber die Zeit ist knapp, und es würde mich Monate kosten, um etwas zu erreichen. Und nun weiß ich nicht mehr, was ich tun soll.«
Ross wandte sich langsam wieder zu ihr um. »Ich weiß, daß du es nicht hören willst, aber der beste Plan wäre wirklich, endlich zu akzeptieren, daß es nichts gibt, was du tun kannst. Wie Canning schon sagte, mußte Ian sich des Risikos bewußt gewesen sein, als er nach Buchara ging. Es ist bei jedem Europäer, der das Land besucht, schon fraglich, ob er es überlebt, und ich glaube kaum, daß ein Offizier, der mit einer Bitte der britischen Regierung kommt, dort willkommen geheißen wird, egal, wie diplomatisch er sich auch gibt.«
Sie öffnete den Mund, besann sich dann aber und schwieg. Nach einem langen Moment des Nachdenkens meinte sie schließlich: »Weißt du, ich war so in meinen Gedanken verstrickt, daß ich ganz vergessen hatte, daß du mit Lieutenant Burnes vor ein paar Jahren in Buchara gewesen bist. Ich frage mich, warum du keinen Bericht darüber veröffentlicht hast wie bei deinen anderen Reisen.«
»Alex Burnes war der Anführer dieser Expedition, und in seinem Buch stand alles, was wichtig war. Im übrigen war ich in dieser Zeit mehr daran interessiert, die Sahara zu durchqueren, als nach Hause zu fahren und zu schreiben.« Ross suchte ihren Blick und setzte dann langsam, jedes Wort betonend, hinzu: »Und gerade weil ich in Buchara war, denke ich, daß die Situation hoffnungslos ist. Der Emir ist ein launenhafter Mensch, der meint, die Wüste würde ihn vor jeder Vergeltung beschützen. Er würde keinen Moment zögern, die Hinrichtung eines unbequemen oder ärgerlichen Europäers zu befehlen.«
Er konnte den Moment förmlich spüren, in dem ihre Trauer in Aufregung umschlug. »Ross, du bist einer der wenigen Engländer, die selbst in Buchara gewesen sind«, sagte sie eifrig. »Wirst du dorthin reisen, um herauszufinden, was mit Ian geschehen ist? Wenn er lebt, kannst du um seine Freilassung bitten. Und wenn nicht ...« Sie stöhnte qualvoll. »Es ist besser, Sicherheit zu haben, als den Rest des Lebens im ungewissen bleiben zu müssen.«
Jean Cameron war also doch nicht ganz so überzeugt davon, daß Ian noch lebte, wie sie vorgab. Ross empfand tiefes Mitleid für sie, aber das änderte nichts an den Tatsachen. Er hatte zu viele Todesfälle zur Kenntnis nehmen müssen, um noch an Wunder zu glauben.
»Es tut mir leid, aber ich muß nach England zurückkehren. Nachdem mein Bruder tot ist, werde ich dort gebraucht. Da ich soeben meine Pläne verworfen habe, nach Arabien zu reisen, kann ich mich jetzt kaum nach Buchara davonmachen. Es wäre etwas anderes, wenn eine solche Reise wirklich einen Zweck hätte, so aber sieht es nicht aus. Auf die eine oder andere Art hat sich Ians Schicksal bestimmt schon vor einer ganzen Weile erfüllt.«
»Aber es hat einen Zweck«, argumentierte sie stur. »Und nicht nur für mich. Ian ist mit einem englischen Mädchen verlobt. Was denkst du wohl, wie sie diese Ungewißheit empfinden muß?«
Bis zu diesem Moment hatte Ross seine Haltung bewahren können, doch ihre Worte trafen ihn tief. »Ich bin sicher, sie fühlt sich, als würde sie in der Hölle schmoren«, gab er rauh zu. »Niemand kann das besser als ich nachempfinden. Aber die Verpflichtungen meiner Familie gegenüber gehen vor.«
Ihr Gesicht verfärbte sich, aber sie wollte noch nicht aufgeben. »Bitte, Ross«, flehte sie leise. »Ich könnte noch einen weiteren Verlust eines meiner Kinder nicht ertragen.«
Die Intensität ihrer Bitte erinnerte ihn einen Moment auf qualvolle Weise an Juliet. Ross wirbelte herum und schritt wütend durch den Raum. Zehn Schritte hin, zehn zurück. Die ganzen Jahre über hatte er seine gescheiterte Ehe mit vielen Empfindungen betrachtet: mit Zorn, Kummer und endlosen verzehrenden Fragen, warum Juliet ihn verlassen hatte. Und unvermeidlich war das Schuldgefühl gekommen, als er sich gefragt hatte, welches namenlose Verbrechen er wohl begangen hatte, das seine junge Frau dazu gebracht hatte, zu fliehen und sich in irgendeinem fernen Land zu vergraben. Ohne ihre Ehe hätte Juliet niemals das Bedürfnis verspürt, ihre Unabhängigkeit auf eine solch unwiederbringliche Art zu demonstrieren.
Er hatte mit seiner Schwiegermutter diesen Punkt niemals besprochen, aber er war überzeugt, daß sie wußte, wieviel Schuld er sich selbst an dem gab, was geschehen war. Und nun benutzte Jean dieses Wissen, um ihn in eine gefährliche, nutzlose Mission zu drängen.
Er hielt an und starrte aus dem Fenster, vor dem die schrägen Strahlen der tiefstehenden Sonne eine exotische Szene von Kuppeln und Minaretten beleuchteten. Aufmerksam musterte er die Fensterkonstruktion, um sich Zeit zu geben, seine Gefühle wieder unter Kontrolle zu bekommen. Anders als in türkischen Häusern hatte dieses Fenster Glasscheiben, um die kalte Winterluft draußen zu halten. Mit nur wenigen Zentimetern Abstand davon war ein Gitter sowohl zum Schmuck als auch zum Schutz befestigt, falls der Mob sich jemals dazu entschließen sollte, seinen Zorn auf die Ungläubigen zu richten.
Das zerbrechliche, importierte Glas war ein passendes Symbol der Präsenz Englands in Asien. Hier konnte ein Fremder auf tausenderlei Art sterben: durch Krankheit, durch die grausame Hitze, Kälte oder vor Durst, durch die Hände von Räubern oder durch den wütenden Mob. Ross hatte dieses Wissen immer verdrängt, doch nun schuldete er es seinen Eltern, etwas mehr darauf zu achten, daß er am Leben blieb.
Als sein Ärger verblaßte, zog er scharf die Luft ein. Eigentlich hatte er nur wenig Lust, so bald schon nach England zurückzukehren. Und so sehr er sich auch bemühen würde, seinen Verpflichtungen der Familie gegenüber nachzukommen, so würde er schließlich doch scheitern, und alles nur, weil er im Alter von einundzwanzig Jahren diese unglückliche Ehe eingegangen war. Solange Juliet lebte, konnte er keinen Erben zeugen, der den Namen der Carlisle weitertragen würde. Doch trotz dieser Tatsache konnte er ihren Tod nicht herbeiwünschen, auch wenn er dann eine zweite Frau heiraten und seine freudlose Pflicht erfüllen konnte. Es war wirklich bedauerlich, daß sein älterer Bruder nur Mädchen gezeugt hatte.
Ross hatte seine Frau enttäuscht, und er hatte seine Familie enttäuscht. Vielleicht, dachte er müde, würde er tatsächlich ein wenig Absolution finden, wenn er das tat, was Jean Cameron von ihm verlangte. Es gab nur zwei wirkliche Gründe, die ihn zurückhielten. Wenn er zu Tode kam, würde es hart für seine Eltern sein. Und wenn sein Vater starb, während er in Buchara war, dann würde es hart für ihn werden. Aber schließlich war er inzwischen ein Experte für Schuldgefühle.
Er wandte sich wieder um und lehnte sich an den Fensterrahmen. »Du bist eine skrupellose Frau, Jean«, sagte er resigniert. »Du weißt, daß ich kaum ablehnen kann, wenn du mich auf diese Art bittest.«
Einen Augenblick schloß sie die Augen, um die Tränen der Erleichterung zurückzuhalten. »Ich weiß es, und es schmeichelt meiner Ehre nicht, daß ich nach jedem Mittel greife, das sich mir bietet«, antwortete sie mit bebender Stimme. »Aber ich würde dich nicht darum bitten, wenn ich glaubte, es kostete dich das Leben.«
»Ich wünschte, ich könnte deinen Optimismus teilen«, entgegnete er trocken. »Ich hatte Glück, einmal nach Buchara zu reisen und lebendig zurückzukehren. Ein zweites Mal dorthin zu gehen, fordert das Schicksal entschieden heraus.«
»Du wirst sicher zurückkehren«, erklärte sie, wobei sie sich weigerte, ihre Hoffnung durch seine Worte vermindern zu lassen. »Und nicht nur das. Ich habe das seltsame Gefühl, daß diese Mission nicht nur Ian, sondern auch dir selbst vieles nützen wird.«
Er hob ironisch eine Augenbraue. »Wenn ich dich daran erinnern darf, war es auch so ein Gefühl, das dir sagte, Juliet und ich wären füreinander bestimmt, während der Rest der Welt starke Zweifel daran hegte. Wenn du deine Erlaubnis nicht gegeben hättest, hätten wir nicht heiraten können, und uns allen wäre ein großer Teil des Kummers erspart geblieben. Ich will dir nicht die Schuld dafür geben, daß du unterstützt hast, was Juliet und ich beide wünschten, aber verzeih mir, wenn ich nicht unbedingt von der Verläßlichkeit deiner mütterlichen Instinkte überzeugt bin.«
Sie löste ihren Blick von seinem. »Ich verstehe immer noch nicht, was schiefgelaufen ist«, murmelte sie kleinlaut. »Du und Juliet erschient so richtig füreinander. Und tief in meinem Herzen glaube ich auch jetzt noch nicht, daß ihr mit eurer Ehe einen Fehler begangen habt.«
»Gott schütze uns vor Geistern, Unholden, spinnenbeinigen Geschöpfen, die uns in der Nacht plagen, und vor berechnenden schottischen Müttern mit einer fehlerhaften Intuition«, sagte Ross, indem er das alte schottische Gebet ironisch verdrehte. Sein Tonfall blieb jedoch herzlich. Wenn er ein Kind gehabt hätte, wäre er vermutlich genauso skrupellos, wenn es darum ging, es zu beschützen. Er kam auf sie zu und legte ihr eine Hand auf die Schulter. »Ich schwöre, ich werde mein Bestes tun, um herauszufinden, was mit Ian geschehen ist. Und wenn es möglich ist, bringe ich ihn nach Hause zurück.«
Daß er wahrscheinlich schon froh sein konnte, wenn er Ians Knochen nach England bringen konnte, schluckte er hinunter.
Kapitel 2
Nordosten Persiens
April, 1841
Ross nahm den Wasserschlauch, der hinter seinem Sattel befestigt war, und trank einen winzigen Schluck, gerade genug, um den Staub in seinem Mund fortzuspülen, dann ließ er ihn wieder nach hinten fallen. Das Hochplateau des nordöstlichen Persiens war kalt, trocken und öde, obwohl es im Vergleich zu der Karakum-Wüste, die er morgen erreichen würde, noch ein wahres Paradies war.
Trotz seines schnellen Tempos waren über drei Monate vergangen, seit Jean Cameron ihn überredet hatte, nach Buchara zu reisen. Er hatte zwei nervenaufreibende Wochen in Konstantinopel verbracht, um die Reise vorzubereiten. Zwar war er mit allem ausgerüstet – vom Kompaß und Fernglas bis zu Geschenken, wie die arabische Übersetzung von Robinson Crusoe –, und es war auch kein Problem gewesen, die nötigen Reisedokumente und Pässe zu bekommen. Die Schwierigkeit hatte vielmehr darin gelegen, Empfehlungsschreiben von einflußreichen Osmanen zu erhalten. Einzig der Botschafter war sehr hilfsbereit gewesen, obwohl er von Ross’ Mission überhaupt nichts hielt. Ohne ihn hätte er die Schreiben nie zusammenbekommen, die er vorsorglich in seinen Mantel eingenäht hatte.
Ross besaß Briefe von dem Sultan des Osmanischen Reiches und dem reis effendi, der Staatsminister für Auslandsangelegenheiten war. Noch wertvoller aber war sicherlich die Empfehlung von Scheich Islam, der der höchste moslemische Mullah in Konstantinopel war. Die Schreiben waren an eine Vielzahl einflußreicher Männer gerichtet, den Emir und die Mullahs von Buchara eingeschlossen. Ross besaß genug Erfahrung in diesem Teil der Welt, um genau zu wissen, daß solche Briefe lebensrettend sein konnten, dennoch war er ungeduldig geworden, weil es so lange gedauert hatte, bis sie ihm ausgehändigt worden waren.
Dann hatte er endlich mit dem Dampfer über das Schwarze Meer nach Trapizunt abreisen können. Von dort war er über Land weitergezogen, hatte jedoch fast drei Wochen bei Erzurum wegen Schneestürmen festgesessen. Der einzige Lichtblick war eine Gruppe von usbekischen Händlern gewesen, die sich unter den anderen gestrandeten Reisenden befand. Ross hatte die Zwangsverzögerung genutzt, um sein Usbekisch aufzubessern, welches die Amtssprache von Buchara war.
Nachdem der Schnee genügend geschmolzen war, um die Reise wieder aufzunehmen, waren weitere drei Wochen verstrichen, bis er endlich Teheran erreichte, wo er die britische Botschaft aufsuchte und die Situation mit dem Botschafter, Sir John McNeill, besprach. McNeill hatte genug Gerüchte gehört, um überzeugt zu sein, daß Ian Cameron tot war, aber er kannte ebenso eine Geschichte über einen Beamten aus Buchara, der angeblich exekutiert worden war und dann fünf Jahre später plötzlich im Gefängnis des Emirs auftauchte. Die einzige Schlußfolgerung, die Ross daraus ziehen konnte, war, daß er die Wahrheit niemals erfahren würde, wenn er sich nicht selber bis Buchara vorwagte.
Nachdem er weitere Briefe vom Schah und seinem Premierminister erhalten hatte, hatte Ross zwei Perser, Murad und Alladah, als Führer und Diener angeheuert. Sie hatten die knapp sechshundert Meilen von Teheran bis Meshed ohne große Zwischenfälle bewältigt. Als Ferengi erregte Ross überall beträchtliches Aufsehen, aber daran war er gewöhnt. Das Wort »Ferengi« ging auf die Kreuzzüge zurück und war ursprünglich bloß die arabische Bezeichnung für Franken gewesen, war aber im Laufe der Zeit auf alle Europäer übertragen worden. In all den Jahren seiner Reisen war Ross schon mit allen möglichen Betonungen – von Neugier bis Verachtung – »Ferengi« genannt worden.
Nun fehlten nur noch fünfhundert Meilen, bis er sein Ziel erreicht hatte. Die restliche Strecke sollte er in einem Monat zurücklegen können, es handelte sich jedoch um den gefährlichsten Teil der Reise, denn sie mußten die Karakum durchqueren, die Schwarze Wüste – ein Ödland mit wenigen Wasserstellen und vielen räuberischen turkmenischen Nomaden.
Während Ross ein wachsames Auge auf die hellen, zerklüfteten Berge ringsherum warf, zügelte Alladah sein Pferd, um an seiner Seite zu reiten. »Wir hätten in Meshed auf eine Karawane warten sollen, Kilburn«, sagte er mit düsterem Unterton. »Drei Männer, die allein reiten, bieten eine lohnende Zielscheibe. Diese Räuber, die turkmenischen Banditen, werden uns erwischen.« Er spuckte verächtlich aus. »Das sind Menschenhändler, ein Schandfleck für den Glauben. Sie werden Murad und mich in Buchara als Sklaven verkaufen. Dich werden sie vielleicht sogar töten, denn du bist ein Ferengi.«
Ross unterdrückte ein Seufzen. Sie hatten schon ein dutzendmal über dieses Thema gesprochen, seit sie Meshed verlassen hatten.
»Wir werden bei Sarakhs auf die Karawane stoßen, wenn nicht schon früher. Und wenn uns Räuber verfolgen, dann galoppieren wir ihnen einfach davon. Habe ich euch nicht in Teheran die besten Pferde besorgt?«
Alladah musterte die Tiere und gab fast widerwillig zu: »Es sind prächtige Pferde, das stimmt schon. Aber die Turkmenen werden im Sattel geboren. Sie kennen keine Ehre, ihr Lebenszweck ist Plündern und Rauben. Wir können ihnen nicht davongaloppieren.«
Wie gewöhnlich beendete Ross das Gespräch mit den Worten: »Vielleicht bekommen wir sie gar nicht zu Gesicht. Wenn doch, fliehen wir. Und wenn es geschrieben steht, daß wir als Sklaven gefangengenommen werden, so soll es geschehen.«
»So soll es geschehen«, wiederholte Alladah kummervoll.
Das Oberhaupt der Festung von Serevan schritt die Mauern ab und durchmaß die Ebene unter sich mit scharfen, wachsamen Blicken, als der junge Schafhirte mit einer Nachricht eintraf, die er für wichtig hielt.
Nach einer tiefen Verbeugung meldete der Junge: »Gul-i Sahari, heute morgen sah ich drei Reisende, die sich auf der Bir-Bala-Straße nach Osten bewegten. Sie ziehen allein, nicht als Teil einer Karawane.«
»Was für Narren, so schutzlos durch dieses Land zu reiten«, lautete die gleichmütige Antwort. »Und noch dümmer, sich so nah an der Grenze zu bewegen.«
»Ihr sprecht wahr, Gul-i Sahari«, stimmte der Hirte zu. »Aber da ist ein Ferengi, ein Europäer, bei ihnen. Zweifellos ist es seine Dummheit, die sie anführt.«
»Weißt du, wo genau sie sich aufhalten?«
»Inzwischen müßten sie sich dem kleinen Salzsee nähern«, antwortete der Hirte. »Heute morgen hörte ich von einem Freund meines Vetters, daß sein Onkel gestern eine Bande von Turkmenen ausgemacht hat.«
Das Oberhaupt runzelte die Stirn und entließ dann den Hirten mit einer Silbermünze, auf die der Junge gehofft hatte. Einige Minuten lang beobachtete Gul-i Sahari gedankenverloren den Horizont. Da war also ein Ferengi – ein unwissender Ferengi – auf der Bir-Bala-Straße. Es mußte etwas unternommen werden.
Als das Terrain rauher wurde, erhöhte Ross seine Wachsamkeit, denn nun würde es Räubern noch leichter sein, gefährlich nah an sie heranzukommen. Obwohl er kaum glaubte, daß sich in dieser Gegend Turkmenen aufhielten, denn aufgrund der Armut schien dieses Grenzgebiet es kaum wert zu sein, daß Banditen ihre Zeit hier vergeudeten. Er warf einen Blick auf die kargen Berge, dann richtete er seine Aufmerksamkeit wieder auf den Pfad, der nicht aussah, als würde er oft benutzt. »Murad, wie weit ist es bis zum nächsten Dorf?«
»Vielleicht zwei Stunden, Kilburn«, antwortete der junge Perser voller Unbehagen. »Wenn das die richtige Straße ist. Der Winter ist hart gewesen, und die Berge sehen nicht mehr wie vorher aus.«
Ross interpretierte die Bemerkung so, daß sie sich mal wieder verirrt hatten, und stöhnte laut auf. Er dachte an Murads Beteuerungen in Teheran, jeden Fels und jeden Busch im östlichen Persien zu kennen. Wenn Ross nicht selbst ein scharfes Auge auf Landkarte und Kompaß geworfen hätte, wären sie inzwischen in Bagdad gelandet.
»Vielleicht sollten wir auf unseren Spuren zurückreiten, bis die Berge wieder vertraut aussehen«, bemerkte er trocken.
Murad warf einen Blick über seine Schulter zurück und zeigte seine Beleidigung über Ross’ mangelndes Vertrauen deutlich. Doch plötzlich starrte er an Ross vorbei, und seine Miene verzog sich zu einem Ausdruck echter Angst.
»Banditen!« rief er. »Reitet um euer Leben!«
Ross und Alladah drehten sich ebenfalls in ihren Sätteln um und zählten gut ein halbes Dutzend Reiter in traditioneller turkmenischer Kleidung, die etwa eine Viertelmeile entfernt um eine Biegung herumgeritten waren. Sobald die Turkmenen bemerkten, daß sie entdeckt waren, trieben sie ihre Pferde an und stießen wilde Schreie aus. Einer von ihnen feuerte einen Schuß ab.
»Verdammt!« fluchte Ross. »Vorwärts!«
Die drei Männer trieben ihre Pferde in vollem Galopp voran, und Ross betete im stillen, daß der Pfad nicht einfach hinter dem nächsten Felsen aufhören würde. Auf einer freien Fläche sollten sie in der Lage sein, ihren Verfolgern davonzureiten, denn sie besaßen eindeutig die besseren Pferde. Turkmenische Pferde waren zäh und ausdauernd, aber sie waren kleiner, und der monatelange, karge Winter hatte bestimmt an ihren Kräften gezehrt. Wenn Schnelligkeit allein nicht ausreichte, so hatte Ross immer noch sein Gewehr, obwohl er es vorzog, sowohl aus menschlichen als auch aus praktischen Gründen, niemanden zu erschießen.
Eine ganze Weile sah es so aus, als würden sie sich retten können, denn der Abstand zwischen den beiden Gruppen vergrößerte sich langsam. Doch dann trat Ross’ Pferd in das Eingangsloch einer verborgenen Tierhöhle. Das Pferd strauchelte, stürzte mit einem schrillen Wiehern zu Boden und riß das Packpferd mit sich. Mit einer blitzschnellen Reaktion, die sich in dreißig Jahren Reiterfahrung entwickelt hatte, stieß Ross sich aus dem Sattel ab und rollte zur Seite, um nicht unter den stürzenden Pferden eingequetscht zu werden.
In Sekundenbruchteilen geschah alles zugleich. Als Ross sich instinktiv krümmte, um sich abrollen zu können, sobald er auf dem harten Felsgrund aufschlug, brüllte Murad etwas und zügelte sein Pferd in einem kurzen Moment des Zögerns, ob er seinem Arbeitgeber zur Hilfe eilen sollte. Doch sein Überlebenswille siegte, und er gab dem Pferd die Sporen, um die Flucht zu ergreifen. Ross schlug hart auf, dann hüllte gnädige Dunkelheit ihn ein.
Doch nur einen Augenblick später kam sein Bewußtsein zurück. Er lag, nach Atem ringend, auf dem Rücken und spürte einen heftigen Schmerz in seiner linken Seite, die das meiste des Sturzes abgefangen hatte. Die Vibration der donnernden Hufe ließ den Boden erzittern, und er hob den Kopf, um sechs Pferde aus der entsetzlichen Froschperspektive auf ihn zustieben zu sehen.
Sein Hut war ihm vom Kopf gerollt. Beim Anblick des goldblonden Haares ertönte ein Schrei: »Ferengi!«
Im allerletzten Moment, bevor sie ihn zertrampelten, wurden die Pferde herumgerissen. Ihre tanzenden Hufe wirbelten Staub und Steine auf, als die Reiter die liegende Gestalt einkreisten. Ross betrachtete die großen, schwarzen Schaffellhüte, die den Turkmenen einen militärischen Anstrich verliehen, der an die Husaren erinnerte. Sie trugen mongolisches Blut in ihren Adern, und die dunklen Schlitzaugen, die auf den Gefangenen hinabstarrten, zeigten die verschiedensten Regungen von Neugier über Gier bis zu unverhüllter, schlichter Bösartigkeit.
Ross zwang den Nebel in seinem Hirn beiseite. Er mußte nachdenken, denn die Männer waren alle jung, und erfahrungsgemäß war jungen Menschen das Leben weniger wert als alten. Sie konnten ihn im Affekt töten, ohne weiter darüber nachzudenken. Sein Gewehr hing noch an seinem Pferd, welches zwanzig Fuß entfernt auf der Erde lag. Die rechte Vorderhand stand in unnatürlichem Winkel ab. Das Packpferd hatte sich wieder auf die Füße gekämpft und wirkte unverletzt. In wenigen Augenblicken würden die Turkmenen beginnen, das Gepäck zu plündern, doch noch war er das Zentrum ihrer Aufmerksamkeit.
Als Ross sich aufstützte, knurrte einer der Turkmenen »Russenschwein!« und schlug mit seiner Reitpeitsche zu.
Instinktiv hob Ross den Arm, um sein Gesicht vor der Peitsche zu schützen. Doch der heftige Schlag schleuderte ihn zurück und drang schmerzhaft durch seinen Mantel. Als das Pferd seines Angreifers zurücktänzelte, sprang Ross rasch auf die Füße. Glücklicherweise war das Turkmenische ähnlich wie Usbekisch, so daß er verstehen und antworten konnte.
»Nicht Russe ... Engländer!« krächzte er durch den Staub in seiner Kehle.
Der mit der Peitsche spuckte aus. »Bah! Engländer sind genauso schlimm!«
»Schlimmer, Dil Assa!« hob ein anderer an. »Los, töten wir diesen Ferengi-Spion und schicken wir den britischen Generälen in Kabul seine Ohren.«
Ein dritter meldete sich zu Wort: »Warum töten, wenn wir ihn in Buchara für eine hübsche Summe verkaufen können?«
Dil Assa knurrte: »Geld ist schnell ausgegeben. Aber einen Ungläubigen zu töten, sichert uns einen Platz im Paradies.«
»Aber wir sind viele«, warf ein anderer ein. »Kommen wir alle ins Paradies, nur weil wir einen einzigen untreuen Spion töten?«
Bevor die Männer sich in ihre theologische Diskussion vertiefen konnten, warf Ross ein: »Ich bin kein Spion. Ich will nach Buchara, um etwas über meinen Bruder herauszufinden. Ich trage einen Brief des Scheichs Islam bei mir, der allen Gläubigen befiehlt, mich in meinem Auftrag zu unterstützen.«
»Scheich Islam bedeutet uns nichts«, stieß Dil Assa verächtlich hervor. »Wir kümmern uns nur um den Segen unseres Kalifen.«
Ross hatte geahnt, daß Scheich Islam nur ein Glückstreffer gewesen wäre. Er war nun bereit, direkt an die Habgier der Männer zu appellieren. »Bei den Ferengis bin ich ein hoher Herr. Wenn ihr mir helft, werdet ihr reich belohnt.«
»Du bist ein englischer Hund, und wie ein Hund sollst du sterben!« Dil Assa nahm sein altes Luntenschloßgewehr und richtete die Mündung auf Ross. Im gleichen Moment begannen seine Kameraden, auf ihn einzureden, doch es war zu schnell, als daß Ross etwas verstehen konnte. Einige schienen einverstanden zu sein, sein Leben gegen eine mögliche Belohnung zu verschonen, andere rangen offenbar um das Vorrecht, den Ungläubigen zu töten. Ohne sich um die Meinung seiner Leute zu kümmern, zog Dil Assa den Hahn zurück und zielte mit schwarzem, tödlichem Blick auf Ross.
Die Öffnung am Ende des Laufes drohte so riesig und so fatal wie der Schlund einer Kanone. Einen Augenblick war Ross wie erstarrt bei dem Anblick. In einem Dutzend anderer Länder war er so vielen Möglichkeiten zu sterben entkommen, und nun hatte ihn sein Glück verlassen. Er hatte keine Zeit, sich zu fürchten. Statt dessen mußte er daran denken, daß Jean Camerons Intuition einmal mehr versagt hatte.
Wie auch immer, er zog es vor, kämpfend zu sterben, als wie ein Schwein im Koben abgeschossen zu werden. Mit einem verzweifelten Satz warf er sich auf Dil Assa, und wieder explodierte die Welt in einem Chaos der Gewalt. Der Schuß löste sich ohrenbetäubend nah, gleichzeitig donnerte eine ganze Salve von Schüssen auf, und das Echo des Feuers wurde von den zerklüfteten Bergen zurückgeschleudert. Die turkmenischen Pferde wieherten, stiegen und tänzelten aufgescheucht umeinander herum, und plötzlich fühlte Ross einen scharfen Schmerz in der Schulter. Die Gewalt des Treffers riß ihn herum und warf ihn brutal zu Boden. Während er stürzte, fragte er sich noch, ob ihn eine Kugel oder nur ein wirbelnder Huf der aufgebrachten Pferde erwischt hatte. Aber letztendlich war die Antwort ganz egal ...
In diesem Moment stieß einer der Turkmenen einen Warnschrei aus und wies auf die nahe Hügelkette. Ein Dutzend Reiter kamen mit donnernden Hufen den Pfad hinuntergaloppiert, während sie unablässig ihre Gewehre abfeuerten.
Ross schaffte es, wieder auf die Füße zu kommen. Er sprintete zu seinem verletzten Pferd und riß das Gewehr und Munition vom Sattel. Er hatte vor, sich auf das Packpferd zu schwingen und so schnell und weit wie möglich zu flüchten, bevor er mitten in eine Schlacht zwischen zwei ansässigen Stämmen geriet.
Dil Assa sah den Ferengi laufen, brüllte auf und wirbelte sein Gewehr herum, bis er den Lauf zu fassen bekam. Die Waffe wie eine Keule schwingend, gab er seinem Pferd die Sporen und ritt hinter Ross her. Ross konnte sich gerade noch ducken, um dem Kolben, der ihm den Schädel einschlagen sollte, zu entgehen.
Dann plötzlich zogen sich die Turkmenen zurück und flohen vor den Neuankömmlingen. Die Pferde schossen an ihm vorbei, und eines streifte ihn, so daß Ross wieder zu Boden geschleudert wurde.
Dieses Mal schwanden ihm nicht gleich die Sinne, obwohl sich sein Blick verschleierte. Benommen dachte er darüber nach, daß er keinen so üblen Tag mehr erlebt hatte, seit er Mikhal im Hindukush kennengelernt hatte. Sein ganzer Körper fühlte sich taub an, und er war nicht in der Lage herauszufinden, ob er tödlich verwundet oder nur angeschlagen und atemlos war.
Von dort, wo er lag, konnte er die Szene bestens beobachten. Er sah, wie sich die Gruppe der unbekannten Reiter teilte, die eine Hälfte die Verfolgung der Turkmenen aufnahm, während die andere Gruppe direkt auf ihn zukam. Nach ihren Kleidern zu schließen waren es Perser, und mit ein wenig Glück waren sie weniger blutdürstig als die Nomaden zuvor.
Doch als die Reiter näher herankamen, blinzelte Ross überrascht. Er konnte nicht glauben, was er da sah. Was bei allen Teufeln tat ein Tuareg-Krieger in Zentralasien, dreitausend Meilen von der Sahara entfernt?
Groß, wild und stolz waren die Tuaregs eine Legende unter den Nomaden der tiefen Wüste. Es war auch der einzige moslemische Stamm, in dem die Männer ihre Gesichter verschleierten, die Frauen jedoch nicht. Ross kannte die Tuaregs gut, denn er hatte monatelang mit ihnen gelebt, als er durch Nordafrika reiste, und es war einfach unfaßbar, einen Targi, wie die Einzelpersonen genannt wurden, so weit von seiner Heimat entfernt vorzufinden.
Als die Reiter ihn fast erreicht hatten, kämpfte sich Ross erschöpft auf die Füße. Er spürte überall Prellungen, und durch die Risse in seiner Kleidung konnte er blutige Abschürfungen sehen, aber es schien keine ernsthaften Verletzungen zu geben. Er war noch einmal glimpflich davongekommen. Zumindest bisher!
Die Reiter hielten in kurzer Entfernung zu ihm und starrten ihn an. Ross stellte fest, daß er recht gehabt hatte. Der Reiter in der Mitte trug die fließenden schwarzen Gewänder und den Schleier, der die Tracht der Tuaregs charakterisierte. Der lange schwarzblaue Schleier, Tagelmoust genannt, war fest um den Kopf und den Hals des Mannes gewickelt und ließ nur einen schmalen Schlitz für die Augen frei. Es wirkte unheilvoll, um es gelinde auszudrücken.
Außer dem Targi bestand die Gruppe aus drei Persern und zwei Usbeken. Die Mischung war nicht gerade gewöhnlich – vielleicht kamen sie von einem Grenzfort und dienten dem Schah. Ross spürte keine derartige Feindlichkeit, wie sie von den Turkmenen ausgegangen war, doch sie wirkten auch nicht besonders freundlich. Am wenigsten der Targi, der selbst durch die verhüllenden Lagen seines Schleiers noch eine bedrohliche Ausstrahlung besaß.