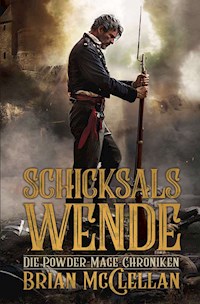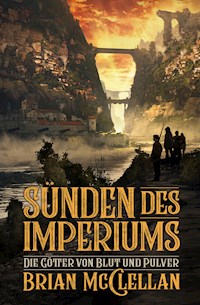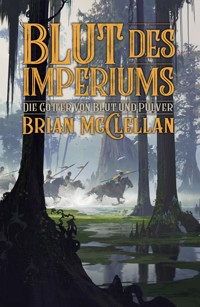Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Cross Cult
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Magie ist eine begrenzte Ressource – und sie wird knapp! Demir Grappo ist ein Ausgestoßener: Er hat seinem Leben als reicher, angesehener Mann, seinen Pflichten und seiner Familie den Rücken gekehrt. Nun fristet er sein Dasein als Gauner, heimatlos und einsam. Doch als seine Mutter brutal ermordet wird, muss Demir aus dem Exil zurückkehren, um seinen Platz als Familienoberhaupt einzunehmen. Es stellt sich heraus, dass sie zu viel wusste: Jene Macht, die die Zivilisation in Gang hält – das Götterglas – geht zur Neige. Nun muss Demir unter alten Freunden und Feinden Verbündete finden, den mächtigen Gildenfamilien entgegentreten, die bloß daran interessiert sind, an sich zu raffen, was noch übrig ist. Ein Krieg steht bevor – ein Krieg, der keinem vergangenen gleicht. Und nur Demir und seine bunt zusammengewürfelte Gruppe Außenseiter können vielleicht noch verhindern, dass das Leben, wie sie es kennen, für immer zu Ende geht. "Wunderbarer Weltenbau und eine wahrhaft epische Erzählung – dies ist Brians bestes Werk bisher. Ich empfehle es von ganzem Herzen jedem, der auf der Suche nach einer neuen Lieblings-Fantasy-Reihe ist!" (Brandon Sanderson)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1087
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
PROLOG
Kapitel 1: NEUN JAHRE NACH DER BRANDSCHATZUNG VON HOLIKAN
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Kapitel 61
Kapitel 62
EPILOG
DANKSAGUNG
PROLOG
Die Sonne versank bereits hinter den Bergen, als Demir Grappo sich seinen Weg über das Schlachtfeld bahnte. Die zarten Wolken im tiefroten Himmel erinnerten an die Flammen eines gewaltigen Hafenofens, ein wunderschöner Anblick – bis auf das Blutbad, das sich über die gesamte Ebene erstreckte. Um die Schreie und das Stöhnen der Sterbenden aus seinem Bewusstsein zu verbannen, starrte Demir auf den Sonnenuntergang. Besaß sein Heer einen Kriegsmaler? Wurden nicht die meisten Streitmächte von einem begleitet? Wenn nicht, sollte er einen finden.
Er hob die Hände und hielt die Finger wie einen Rahmen vor den Himmel. Ein wahrlich atemberaubender Anblick. Dann ließ er langsam die Hände sinken, bis sich das bereits in der Dämmerung versinkende Schlachtfeld in den Fingerrahmen schob. Dieses war … weniger schön.
Demir war mit Legenden von glorreichen Schlachten aufgewachsen. Geschichten voller Heldentaten, letzter Gefechte und unterlegener Kavallerien, die dennoch angriffen. Erzählungen über nicht aufzuhaltende Stürmer, die sich in ihren bunten magischen Rüstungen durch die Infanterie pflügten, während Glastänzer glitzernde Quarzsplitter auf das Schlachtfeld niederregnen ließen.
Von der grausamen Realität fehlte in diesen heroischen Beschreibungen jedoch jede Spur. Über die Schießpulverwolken und den widerwärtigen Morast aus Schlamm und Blut unter den Stiefelsohlen wurde kein Wort verloren. Keiner von Demirs Hauslehrern hatte je von den Angst- und Schmerzensschreien der Männer und Frauen erzählt, den Wehklagen um getötete Freunde. Und den Gestank hatten sie definitiv nicht erwähnt.
Und das Blut. So viel Blut. Das gab es immer, wenn Glastänzer zum Einsatz gekommen waren.
Demir hatte in sieben Tagen drei Siege errungen. Er konnte nicht leugnen, dass sein Herz so hoch schlug wie noch nie, wenn eine Schlacht sich seinen Befehlen entsprechend entwickelte. Ein großartiges Gefühl, den Feind fliehen zu sehen und die Siegesschreie seiner Soldaten zu hören. Aber das hier, die Heiler und ihre Gehilfen, die Priester, die nach dem Gefecht über das Feld zogen, wurden nicht besungen.
Demir betrachtete den durch den Angriff eines Glastänzers entstandenen Blutsumpf. Die Leichen waren von Abermillionen Glassplittern aufgeschlitzt. Die Überlebenden sahen wie etwas aus einer Gruselgeschichte aus und schrien vor Schmerz, bis ein Heiler es endlich mit einer Auswahl von Göttergläsern zu ihnen schaffte, um sie abzulenken, ihre Qual zu lindern und die Heilung zu beschleunigen.
War das hier sein Werk? Die Soldaten waren immerhin Rebellen gewesen, und im Chaos des Kampfes konnte man leicht den Überblick verlieren. Demirs Blick fiel auf eine verwundete junge Frau, die gerade auf ein kostbares Stück schmerzstillendes Milchglas biss und sich aufsetzte. Sie starrte Demir so verängstigt an, dass er sich dabei ertappte, die auf seine linke Hand tätowierten überlappenden Dreiecke zu bedecken, die seine magischen Kräfte verrieten.
Seine Hauslehrerin hatte ihm einst erklärt, dass es gut und richtig für Glastänzer sei, über allen anderen zu stehen. Es war eine Gabe, behauptete sie, die ihn neben der magischen Fähigkeit, normales Glas zu manipulieren, anderen gegenüber auch auf geistiger Ebene überlegen machte. Andere würden ihn immer fürchten, weil sie wussten, dass er sie mit einem einzelnen Gedanken töten konnte.
Den Beweis dafür sah er vor sich: Hunderte von Männern und Frauen, die in Stücke geschnitten worden waren. Sie taten recht, ihn zu fürchten. Noch nie hatte er seine eigene Zerstörungskraft so greifbar erlebt wie in den letzten sieben Tagen auf dem Schlachtfeld, und wenn er ehrlich war, machte sie ihm Angst. Würde er sich mit der Zeit daran gewöhnen? Er war schließlich erst zwanzig Jahre alt und dies sein erster Feldzug. Würde er abstumpfen? Oder würde es ihn immer anwidern?
Suchend sah Demir sich nach etwas um – irgendetwas –, das ihm Halt geben konnte. Seinen Offizieren war noch nicht aufgefallen, dass er verschwunden war, und abgesehen von den Toten und den Schwerverletzten sowie den Heilern und Priestern, die sich um sie kümmerten, war er allein. Die Überlebenden machten sofort einen großen Bogen um ihn, wenn sie seine schwarze Uniform mit dem Glassymbol eines Glastänzers erkannten. Auch wenn sie ihn vielleicht nicht persönlich kannten, konnten sie sich leicht zusammenreimen: Er war General Grappo, der Glastänzer-Kommandant.
Wie er das hasste. Warum konnten sie statt der tödlichen Magie, die er sich nie gewünscht hatte, nicht die Siege sehen, die er ihnen verschaffte?
Schließlich fiel sein Blick auf eine vertraute Gestalt, und er lenkte seine ziellosen Schritte in ihre Richtung. Er kam an einem Heiler vorbei, der einer verwundeten Soldatin ein Stück weißes Götterglas reichte, das wie ein Hufnagel geformt war. »Draufbeißen, bis die Schmerzen verfliegen«, wies der Heiler sie an und sah zu Demir auf, als wäre er hierfür verantwortlich. Der Soldatin hing der halbe Darm aus dem Bauch. Mehr als ein paar Stunden würde sie nicht überleben, aber die Kräfte des Milchglases würden ihr das Sterben erleichtern. Spontan versuchte Demir, das kleine Stück Milchglas mit seiner Magie abzutasten, doch es blieb seinen Sinnen gegenüber kalt und tot. Götterglas war die einzige Art von Glas, die ein Glastänzer nicht manipulieren konnte.
Er versuchte, den Heiler und seine Patientin zu vergessen, und hielt weiter auf den Mann zu, der an einer kleinen freien Stelle zwischen den Toten kniete. Demir kannte ihn gut genug, um zu wissen, dass er wahrscheinlich nicht betete, sondern seinen Geist klärte, wie er es nannte. Das tat er vor und nach jeder Schlacht. Wenn sich doch nur mehr Soldaten mit solcher Sorgfalt um ihr Seelenwohl kümmern würden.
Idrian Sepulkis Haut war dunkel wie Kohle, seine Schultern breit und seine Beine stark wie Baumstämme. Er war über eins achtzig groß und trug die Rüstung eines Stürmers: eine Halbrüstung aus Stahlringen, in die hochresonantes Götterglas eingearbeitet war – Verzierungen aus schmerzunterdrückendem Milchglas, gelbe Schmiedeglasstreifen zur Unterstützung seiner Kraft und Schnelligkeit sowie winzige lila Tupfen aus Klugglasfragmenten, die sein Denkvermögen schärften. Doch das dunkelblaue Hammerglas, das härter als Stahl war und die Rüstung so gut wie unzerstörbar machte, überwog. Idrians ebenfalls mit Götterglas durchwirkter Mandelschild und riesiges Bastardschwert lagen blutverkrustet neben ihm auf dem Boden. Sein Helm war mit zwei eng an den Stahl anliegenden Widderhörnern aus Hammerglas verziert. Die anderen Soldaten nannten Idrian den Rammbock.
Eine durchschnittliche Person wäre an einer solch hohen Konzentration von Götterglas in Minutenschnelle erkrankt und Stunden später gestorben, aber Idrian war ein Glassalier – wie alle Stürmer gehörte er zu den seltenen Menschen, denen die Glasmürbe nicht zusetzte. Demir blickte auf seine Handrücken und sah, dass seine Haut schuppig geworden war und lila glänzte – das erste Symptom von Glasmürbe, ausgelöst durch seinen Gebrauch von Klugglas in der Planung und Durchführung der Schlacht. Wenn er nicht vorsichtig war, würden die Stellen sich fischschuppenartig verhärten und sich nicht mehr von seiner Haut lösen. Die nächsten Tage musste er genau überlegen, welcher Magie er sich aussetzen wollte.
»Stürmer Sepulki«, begrüßte Demir Idrian. Der Soldat spähte mit einem Auge zu ihm hoch, erkannte ihn und wollte aufstehen. Demir winkte ab. »Ich wollte nicht stören.«
»Sie stören nicht, Herr General«, antwortete Idrian mit seiner tiefen, sonoren Stimme. »Ich lasse nur von der Gewalt in meinem Kopf ab.« Jetzt öffnete er auch das andere Auge. Sein rechtes war vor langer Zeit durch ein künstliches aus lila Klugglas ersetzt worden. Demir hatte vor ein paar Wochen herumgefragt, wie Idrian zu dem Glasauge gekommen war und warum es ihn noch nicht umgebracht hatte, doch niemand schien etwas darüber zu wissen. Es kam zwar gelegentlich vor, dass Götterglas im Körper eingesetzt wurde, es war jedoch selbst für einen Glassalier hochgefährlich.
»Das klingt gesund und vernünftig«, gab Demir zurück. »Ich habe selbst eben den Sonnenuntergang genossen.«
Idrian starrte Demir mit seinem beunruhigenden lila Auge an. In seinem gesunden lag keinerlei Furcht, wofür Demir dankbar war. Immerhin gab es einen in dieser Armee, der ihn nicht nur als Monster ansah. Doch die Stürmer waren kaum mehr als vom Staat bezahlte Mordmaschinen. Wer Macht hatte, verstand andere mit Macht. »Ganz schön beeindruckend, Herr General. Glückwunsch zu diesem Sieg!«
Demir quittierte das mit einem gleichgültigen Nicken und fragte sich, ob es den Stürmer störte, jemanden, der nicht einmal halb so alt war wie er, mit einem ranghöheren Titel anzusprechen. »Es sieht wirklich nach einem Sieg aus, nicht wahr?«
»Der Feind wurde in den Boden gerammt. Die verbliebenen Streitkräfte haben sich in die Berge geflüchtet. Holikan ist wehrlos und gehört uns.« Idrian nickte leicht. »Zumindest ist das mein Wissensstand. Haben Sie neuere Informationen?«
»Nein, darauf scheint es hinauszulaufen.«
Idrian schnaubte. »Danke, Herr General. Wissen Sie zufällig, wo mein Bataillon ist?«
Demir überschlug in Gedanken die Tausende von Befehlen, die er in den letzten vierundzwanzig Stunden gegeben hatte. Normalerweise behielt er kein einzelnes Bataillon im Blick, aber Idrian gehörte den Eisenhornböcken an, die Demirs Onkel Tadeas unterstanden und die besten Pioniere im Ossanischen Reich waren. Normalerweise wäre Idrian bei seinem Bataillon geblieben, aber Demir hatte für diese Schlacht einen weiteren Stürmer gebraucht.
»Die haben noch nicht wieder zu uns aufgeschlossen«, sagte er. »Vermutlich sprengen sie noch Brücken über den Tien.« Er runzelte die Stirn. »Wir sollten einen Kurier schicken und sie wissen lassen, dass wir den Krieg gewonnen haben. Es ist unnötig, etwas zu zerstören, das nicht zerstört werden muss.«
»Natürlich, Herr General. Soll ich losreiten und die Nachricht selbst überbringen?«
»Sie möchten wohl gern wieder zu ihnen stoßen?«
»Sie sind meine Freunde, Herr General. Es macht mich unruhig, dass sie ihren Stürmer nicht bei sich haben.«
»Ah ja! Aber bleiben Sie noch ein bisschen bei mir, zumindest bis ich wirklich sicher bin, dass der Feind sich ergeben hat. Wir werden einen Kurier losschicken, und ich sorge dafür, dass Sie bald wieder zu Ihrem Bataillon kommen.«
»Danke, Herr General.« Idrian zögerte. »Wenn ich noch etwas hinzufügen darf?«
»Ja?«
»Die Soldaten nennen Sie den Prinz der Blitze. Ich dachte, das würden Sie vielleicht wissen wollen.«
»Das habe ich noch nicht gehört.« Demir wiederholte den Namen im Geiste. »Machen die sich damit über mein Alter lustig oder feiern sie meine Kriegsführung?«
Idrian rang etwas zu lange mit sich.
»Na, kommen Sie schon, seien Sie ehrlich.«
»Beides, glaube ich.«
Demir lachte leise. »Gefällt mir.« Der Prinz der Blitze. Die meisten ruhmreichen Männer waren doppelt so alt wie er, bevor sie sich einen derartigen Ehrentitel verdienten. Er summte vor sich hin. Ihm gefiel, wie dieser Spitzname klang. Er ließ ihn fast das Blut vergessen, das seine Stiefel durchtränkte. Vielleicht würde er sich an all das hier gewöhnen. Vielleicht würde er sich am Töten und daran, anderen den Befehl zum Töten zu geben, eines Tages nicht mehr stören.
Er erschauderte. Nein. Er war vor allem ein Politiker und erst danach ein Glastänzer und General. Mit diesem Feldzug war er nur durch eine Verkettung von Umständen betraut worden, und in ein paar Tagen wollte er in seine Heimatprovinz zurückkehren, wo er dieses Blutvergießen vergessen und sich darauf konzentrieren konnte, seinem Volk zu helfen.
Idrian stand langsam auf. Er überragte Demir um gute zwanzig Zentimeter. »Herr General, ich glaube, Ihr Stab sucht nach Ihnen.«
Als Demir Idrians Blick folgte, sah er eine kleine Gruppe Reiter näher kommen. Es handelte sich um eine seltsame Mischung aus Regierungsvertretern Ossas, die die Verhandlungen mit dem Feind überwachen sollten, und sturmerprobten Offizieren, die mitgeschickt worden waren, damit dieser junge Emporkömmling von einem Gouverneur seinen ersten Feldzug nicht vollkommen in den Sand setzte. Sie grinsten alle übers ganze Gesicht. Demir konnte ihnen ansehen, dass sie sich von seinem Sieg Prestige, Ländereien und Belohnungen versprachen. Doch das störte ihn nicht. Wenn er den Ruhm mit ihnen teilte, würden sie ihm in Zukunft verpflichtet sein – und das könnte ihm eines Tages zugutekommen.
Er ließ seinen Blick langsam über die Reiter schweifen und überlegte, wen von ihnen er in Zukunft einsetzen, wer ihm Probleme bereiten und wen er vergessen konnte. Tavrish Magna mit dem dicken Bauch riss gern Witze und hatte keine großen Ambitionen. Helenna Dorlani verbreitete ständig Gerüchte und sabotierte Demir so unauffällig wie eine Kompanie von Kürassieren. Für eine kleine Bestechung verriet ihre Cousine Jevri sie nur zu gern an Demir. Drei Mitgliedern der kleinen Gildenfamilie Forlio war es gelungen, sich in Demirs Stab einzuschleichen. Sie würden aus diesem Feldzug wohl das meiste herausschlagen, während Jakeb Stavris im Rat Geschäfte abgeschlossen hatte, die von Demirs Niederlage ausgegangen waren. Seine Verluste würden in die Hunderttausende gehen, und seiner Miene nach zu urteilen wusste er das.
Es war eine tückische Gruppe, sowohl was ihre Persönlichkeiten anging als auch ihre politischen Ambitionen – gefährliche Schlangen, die sich um Demirs Beine wanden und jederzeit zubeißen konnten. Selbst nach diesem Sieg musste er sich vorsehen, dass sich keiner von ihnen gegen ihn stellte, nur um sich zu profilieren.
Capric Vorcien, ein guter Freund, den Demir als Rückendeckung vor den anderen mitgenommen hatte, ritt der Gruppe voraus. Er war ein großer, schlanker Mann Anfang zwanzig und hatte das typische schwarze Haar und die olivfarbene Haut eines Ossaners. Das auf seine rechte Hand tätowierte umgedrehte Dreieck, das von den Wellenlinien eines Sonnenuntergangs in der Wüste durchzogen war, wies ihn als Mitglied der Gildenfamilie Vorcien aus. Mit ausladender Geste salutierte er Demir und sprang vom Pferd.
»Ein Hoch auf den siegreichen Grappo!«, rief Capric. Sein Ruf wurde von den anderen mit unterschiedlicher Begeisterung wiederholt. Demir blickte wieder zu der Gruppe, taxierte immer noch jeden Einzelnen und sah die verborgene Wahrheit in ihrem Blick. Hinter ihrer Freude über die gewonnene Schlacht lauerte Angst, genau wie bei den Soldaten. Wie viele Glastänzer gehörten dem Offiziersstab an? Nur sehr wenige. Capric war der Einzige, der sich nicht verhielt, als bewege er sich auf dünnem Eis. »Das war eine unglaubliche Schlacht«, gratulierte er Demir.
»Nicht schlecht«, winkte dieser ab. »Der Gegenangriff ihrer Dragoner hat mich überrumpelt.«
»Aber du hast sie dennoch vernichtet. Glasverdammt, Mann, steh doch zu deinem Sieg!« Capric packte Demir bei der Hand und zog ihn an sich. »Sieh über meine linke Schulter«, raunte er. »Wenn du deinen nächsten Plan ausführen willst, tu es jetzt.«
Demir entdeckte in seinem Stab drei Fremde: eine von zwei Leibwächtern begleitete Frau mittleren Alters, deren blondes Haar auf eine Abstammung aus den östlichen Provinzen hinwies. Alle drei wirkten abgekämpft und geschlagen. Demir löste sich aus Caprics Umarmung und deutete auf die Gruppe. »Wer ist denn das?«, fragte er laut, obwohl er genau wusste, um wen es sich handelte.
»Die Ortsvorsteherin von Holikan ist gekommen, um sich zu ergeben.«
Auf Caprics Handzeichen hin kam die Frau mit flehend ausgestreckten Händen auf Demir zu. Sie ließ sich auf die Knie fallen und drückte ihr Gesicht auf den Boden. »Hiermit ergibt sich die Stadt Holikan«, begann sie. »Ich habe keine Bedingungen – aber ich biete mein Leben für das meiner Bürger an. Sie haben den Zorn des Reichs nichts verdient.«
Blinzelnd starrte er zu ihr hinunter. Er hatte über diese Situation lange mit Capric diskutiert. Dies war der Moment, von dem der weitere Verlauf seiner politischen Karriere abhing, aber Demir war dennoch überrascht. Neben der auf der Erde liegenden Ortsvorsteherin zog Helenna Dorlani eine kurze silberne Lanze und hielt Demir den Griff hin. Der Tradition entsprechend musste er die Kapitulation akzeptieren und die Ortsvorsteherin auf der Stelle hinrichten, indem er ihren Hals mit der zeremoniellen Waffe durchbohrte. Sie war schließlich eine Rebellin, eine Aufwieglerin und Verräterin des Ossanischen Reichs. Demir spürte, wie sein Selbstvertrauen angesichts des bevorstehenden zeremoniellen Blutvergießens ins Wanken geriet, und warf einen Blick auf Idrian. Doch als wollte er sagen, dass ein Soldat mit derartigen Angelegenheiten nichts zu tun hatte, war der Stürmer zwei große Schritte zurückgewichen.
Demir nahm die Lanze von der Regierungsvertreterin entgegen und wandte sich Capric zu, der lediglich mit den Schultern zuckte. Er kannte die Einstellung seines Freundes und wusste, dass dieser nicht vorhatte, veraltete Traditionen zu befolgen, nur um es dem Rat recht zu machen. Demir wirbelte die Lanze herum und schlug sich mit dem Stab nachdenklich auf die linke Handfläche. »Stehen Sie auf.«
Die Ortsvorsteherin blickte zu Demir auf und dann zu den versammelten Offizieren. Die Tatsache, dass sie nicht erstochen wurde, schien sie zu verwirren.
Demir stieß die Lanze mit der Spitze in die Erde und stützte sich darauf ab, während er der Frau unter den Arm griff und sie hochzog. Er streckte ihr seine Hand hin. »Guten Abend! Ich bin Demir Grappo.«
Sekundenlang starrte die Ortsvorsteherin auf seine andere Hand – oder vielmehr auf sein Glastänzersymbol. Schließlich schüttelte sie seine Hand. »Ich bin Myria Forl, die Ortsvorsteherin von Holikan.« Sie zögerte einen Moment und fügte dann hinzu: »Ich habe von Ihnen gehört, Demir Grappo.«
»Nur Gutes, hoffe ich.«
Sie nickte. »Was machen Sie hier? Sie sind doch zwei Provinzen weiter Gouverneur – ein Politiker und kein Krieger.«
»Krieger?« Demir lachte und zeigte mit dem Daumen auf Idrian. »Er ist ein Krieger. Ich habe lediglich etwas Hirn. Und nun verraten Sie mir, Myria: Was wollen Sie?«
»Ich … ich verstehe nicht …«
»Vor sieben Monaten haben Sie Ihre Unabhängigkeit vom Ossanischen Reich erklärt. Sie haben zwei Armeen besiegt, in Ihrer Provinz Anhänger gesammelt und, soweit ich sehen kann, eine verdammt gute Rebellion angezettelt, bis ich hier aufgetaucht bin. Und dennoch … bezeichnen Sie sich weiterhin als Ortsvorsteherin.«
»Weil ich das bin«, gab sie fassungslos zurück.
»Dann ging es Ihnen also nicht um mehr Macht? Sie haben sich nicht zur Königin von Holikan gemacht?«
»Nein!«, sagte sie mit Nachdruck. »Ich habe unsere Unabhängigkeit erklärt, weil Ossa uns nur wie Provinzler behandelt. Wir sind keine Gleichberechtigten und werden es auch nie sein. Wir verlangen gerechte Steuern, eine örtliche Verwaltung und …«
Demir schnitt ihr sanft das Wort ab. »Ich weiß. Ich habe Ihre Forderungen gelesen. Alle siebenundachtzig. Ich wollte Sie nur persönlich fragen.«
Jemand räusperte sich. Als Demir sich umdrehte, sah er, dass Helenna Dorlani die Silberlanze aus dem Boden gezogen und abgewischt hatte und sie ihm nun wieder hinhielt. »General Grappo, die Tradition verlangt, dass Sie das Blut der Rebellenanführerin vergießen und dann die Stadtbevölkerung dezimieren.« Sie wirkte verwirrt. Immer wieder zuckte ihr Blick zu dem Symbol auf Demirs linker Hand, als würde sie sich fragen, warum ein Glastänzer nicht töten wollte.
Demir ignorierte sie und blickte zur Stadt hinüber, wo in der anbrechenden Dunkelheit immer mehr Lampen in den Fenstern angingen. Er konnte sich die Angst der Einwohner vorstellen, die mit angesehen hatten, wie ihre Armee in die Flucht geschlagen worden war. Die Traditionen von Ossa waren ihnen nur zu gut bekannt. »Dezimieren«, knurrte Demir. »Allen Einwohner befehlen, Lose zu ziehen, und sie dann zwingen, jeden Zehnten zu ermorden. Keine Gnade für Kinder oder Kranke. Das klingt unschön.«
»Das soll es auch sein«, beharrte Helenna. »Es ist eine Strafe.«
»Wofür? Für den ketzerischen Wunsch, in ihrem eigenen Land als Bürger behandelt zu werden?« Demir schnaubte. »Ich finde nicht, dass die Strafe dem Vergehen angemessen ist. Ich erlaube das nicht.«
»Aber …«, stammelte Helenna, »das müssen Sie!« Sie wandte sich an Capric: »Sagen Sie ihm, dass er die Traditionen befolgen muss.«
Demir ließ seinen Freund nicht an seiner Stelle antworten. »Und in welchem Gesetz steht das geschrieben?«, fragte er ruhig. »In keinem. Ich mag zwar noch jung sein, aber ich regiere meine eigene Provinz, seit ich vierzehn bin. Es gibt einen Unterschied zwischen dem Gesetz und der Tradition – und die Gesetze sind mir so vertraut wie mein eigenes Glasabzeichen.« Er hob seine tätowierte rechte Hand, damit alle das auf dem Kopf stehende Dreieck sehen konnten, von dessen Mitte gezackte Blitze ausgingen. Es war das Abzeichen der Gildenfamilie Grappo und ergänzte das Glastänzersymbol auf seiner linken Hand – die zwei Tätowierungen, die im Reich für wahre Macht standen. Er atmete tief durch. »Verehrte Ortsvorsteherin, liefern Sie Holikan hiermit Demir Grappo vom Ossanischen Reich aus?«
Myria Forl musterte ihn misstrauisch. »Ja.«
»Wunderbar.«
Noch während sie sprachen, zog Capric etwas aus seinen Satteltaschen. Feierlich schüttelte er den schwarz-roten Umhang aus. Ein Lächeln umspielte Demirs Mundwinkel, und einen Moment lang setzte sein Herzschlag aus. Der opulente Siegerumhang war ein alberner Bestandteil der Traditionen, nichts weiter als Pomp.
Aber er hatte ihn sich bitter verdient und genoss es, als Capric den schweren Stoff über seine Schultern drapierte und dann die Goldkette schloss. Mit einem Kuss auf Demirs linke Wange und einer kurzen Verbeugung beendete Capric die Zeremonie. »Eine stolze Leistung, Prinz der Blitze.«
Als Demir nach dem üblichen Lob seinen neuen Ehrentitel hörte, stellten sich ihm die Nackenhaare auf. Mit unbewegter Miene nickte er Capric zu. »Die Stadt Holikan steht ab sofort unter meinem Schutz«, rief er dann. »Die Einwohner sind keine Rebellen, sondern unsere Verwandten, und als solche werden wir sie auch behandeln!«
Die Offiziere starrten ihn überrascht an. Natürlich wagte keiner von ihnen, ihrem General zu widersprechen, besonders nicht einem Glastänzer – Demir wusste allerdings, dass sie in Gedanken bereits wutentbrannte Briefe an die Hauptstadt verfassten.
»Was machen Sie denn, verpisst noch mal?«, flüsterte Myria.
Er antwortete ihr ebenso leise: »Ich bin nicht nur ein Bürger von Ossa, sondern auch der Gouverneur einer Provinz. Mein Volk beklagt sich über das Gleiche wie Ihres. Ich werde dem Rat die Beschwerden vorlegen.«
»Das wird nicht auf Anklang stoßen.«
»Der Rat besteht aus lauter reichen, selbstgefälligen Dummköpfen. Ich weiß das, weil ich selbst einer bin. Wir sind nie zufrieden.«
»Sie müssen verrückt sein, wenn Sie glauben, dass Sie sich denen widersetzen können.«
»Der Unterschied zwischen Genie und Wahnsinn liegt lediglich im Erfolg. Außerdem …« Demir warf einen Blick auf das sie umgebende Schlachtfeld. Der Anblick drehte ihm den Magen um, und er sehnte sich plötzlich danach, in seine Provinz heimzukehren. Er hatte in dieser Woche bewiesen, wie gut er Krieg führen konnte, aber seine friedliche Arbeit als Gouverneur, bei der er sich den ganzen Tag dem Weichenstellen für die Regierung widmen konnte und danach mit seiner Geliebten ins Bett ging, war ihm wesentlich lieber. Kurz dachte er daran, dass die meisten seiner gleichaltrigen Mitbürger sich nur um ihr Studium sorgen mussten und wo sie ihre nächste Bettgespielin und einen kräftigen Schluck herbekamen. Er fragte sich, wie es sich wohl anfühlte, einfach mal nichts zu tun. Das war für ihn nie eine Option gewesen. »Ich habe erkannt, dass mir die Lebenden lieber sind als die Toten, und ich habe lieber Freunde, als dass ich mir Feinde mache.«
Demir warf einen Blick über die Schulter. Idrian stand immer noch an derselben Stelle. Der große Stürmer spähte nachdenklich an Demir vorbei in die Ferne und rieb sich sein Götterglasauge. Demir fragte sich, ob Idrian etwas gegen seine Entscheidung einzuwenden hatte. Vielleicht würde er ihn eines Tages danach fragen.
»Stürmer Sepulki«, sprach Demir ihn an. »Ich stelle die Ortsvorsteherin unter Ihren Schutz. Sorgen Sie dafür, dass ihr nichts geschieht, während wir hier alles ins Reine bringen, ja?«
Idrian nickte schweigend.
»Gut.« Demir schob die Hand in eine korkgepolsterte Tasche seiner Uniform und zog ein drei Zentimeter langes Stück Klugglas heraus, das wie ein winziger Löffel aussah. Der Löffelgriff war zu einem spitz zulaufenden Haken geformt, den er sich durch eins der Löcher in seinem rechten Ohrläppchen steckte. Klugglas wurde recht häufig verwendet. Da es den Verstand schärfte, war es vor allem unter Händlern, Beamten und Politikern beliebt. In seiner reinsten Hochresonanzvariante trieb Klugglas seinen Träger zumeist in den Wahnsinn. Neben sich selbst kannte Demir niemanden, dessen Psyche stark genug war, um es zu benutzen.
Die Magie wirkte sofort – ein fast unmerkliches Summen und Vibrieren, das sich sein Gehirn durchdrang, seinen Verstand schneller arbeiten ließ und es ihm ermöglichte, sich die verschiedenen Möglichkeiten, wie es weitergehen könnte, bildlich vorzustellen. Mit unmenschlicher Schnelligkeit stellte er Überlegungen an, fällte Wochen im Voraus Entscheidungen und bereitete sich auf seine nächsten hundert Schritte vor, als wäre es ein kompliziertes Spiel.
Doch es handelte sich nicht um ein Spiel. Es ging um seine Karriere und das Leben all dieser Menschen, und vielleicht sogar um die Zukunft des Reichs. Er würde seinen Sieg nutzen, um dadurch den Namen seiner Gildenfamilie zu stärken, wie es jeder brave Bürger von Ossa getan hätte. Aber er würde ihn auch dazu benutzen, um Millionen von Menschenleben zu verbessern. Schon im Alter von zwölf Jahren hatte er entschieden, dass Ambitionen nicht nur auf einen selbst beschränkt sein mussten. Demir hatte Ambitionen für alle.
Eines Tages würde die Welt erkennen, dass mehr in ihm steckte als die ihm angeborene Magie, und sie würde ihn ohne Angst anlächeln.
Er war zufrieden mit seinen Plänen. Dann fiel ihm wieder ein, dass die Glasmürbe eingesetzt hatte, und er zog das Klugglas aus seinem Ohrläppchen und steckte es zurück in die Tasche, wo der Samt und Kork ihn vor den Kräften des Götterglases schützten, wenn er es nicht brauchte. Einen Moment lang ließ er seine Finger in der Tasche und befühlte seine Auswahl an Götterglas. Jede Art war anders geformt, damit sie, ohne nachzusehen, ausgewählt werden konnte – eine tröstliche Sammlung magischer Stützen für seinen schwachen sterblichen Körper.
Ein Mitglied seines Stabs, immer noch zu Pferde, riss ihn aus seinen Gedanken. »Herr General, irgendwas geht da hinten im Lager vor.«
Demir musste sich bewusst dazu zwingen, von seinen Überlegungen abzulassen. Er ließ Myrias Arm mit einem beruhigenden Tätscheln los, als wären sie alte Freunde, und blickte dann zum weit entfernten Lager. Die Ebene war fast vollkommen flach, und erst nachdem er sein Pferd fand und in den Sattel stieg, konnte er sehen, was sein Stabsmitglied meinte.
Im Lager ging tatsächlich etwas vor. Hunderte, nein Tausende von Fackeln waren entzündet worden, und eine große Prozession entfernte sich vom Lager und marschierte über das Plateau direkt auf Holikan zu. Die Fackeln flackerten, während die letzte Helligkeit des Tages hinter dem Horizont verschwand. Trotz seiner Intelligenz war Demir vollkommen verblüfft. Nach der Schlacht waren einige Regimenter losgeschickt worden, um die Verwundeten zu versorgen, dem fliehenden Feind nachzujagen und die Außenposten zu sichern, doch der Großteil der Soldaten war zurück in ihre Zelte beordert worden, wo man die Verwundeten und Toten zählen und eine blutdürstige Armee unter Kontrolle halten konnte. Warum also marschierten sie auf die Stadt zu, verpisst noch mal?
»Capric«, rief er. »Finde raus, was da los ist.«
Capric warf einen finsteren Blick in Richtung Stadt, bevor er in den Sattel stieg. Demir sah ihm wie gebannt nach. Es war, als hakten seine Gedanken – er wusste, dass irgendetwas nicht stimmte, konnte aber keine Erklärung dafür finden. Dies gehörte nicht zu seinem Plan. Er wollte nicht wirken, als würde er in Panik verfallen, aber einfach nur abwarten konnte er auch nicht. Langsam ritt Demir gen Süden und spürte, wie sich in seinem Bauch Furcht vor dem Unbekannten ausbreitete. Er griff mit der linken Hand nach seinem Siegerumhang und rieb nervös den Stoff zwischen seinen Fingern.
Erst als Capric außer Atem zurückgaloppiert kam, packte ihn die Angst.
»Demir«, brüllte Capric. »Irgendwas ist mit der Kommunikation schiefgelaufen. Das achte Bataillon glaubt, es soll die Stadt brandschatzen.«
»Brandschatzen …«, raunte Demir. »In welchem glasverdammten Jahrhundert leben wir denn? Wir brandschatzen keine Städte! Reite zurück und befiehl ihnen, ins Lager zurückzukehren! Sorge dafür, dass der Befehl bis zu jedem Oberst durchdringt. Los!«
Capric galoppierte davon, und Demir warf einen kurzen Blick über die Schulter auf seinen Stab. Er musterte erst Helenna Dorlani, dann Jakeb Stavri und den ältesten der Forlio-Brüder. Alle sahen gleichermaßen verwirrt und überrascht aus – genau wie Demir selbst, nahm er an. »Wer hat den Befehl gegeben, die Stadt zu brandschatzen?«, fuhr er sie an.
Sie wechselten Blicke untereinander und schüttelten den Kopf. »So was würde niemand befehlen«, beteuerte Jakeb. »Dezimieren, ja. Aber es hat schon seit hundert Jahren niemand mehr eine Stadt geplündert!«
Fluchend wandte Demir sich ab und beobachtete die Fackeln, bis er erkannte, dass die Soldaten die Außenbereiche der Stadt erreichen würden, bevor Capric sie einholen konnte. Und wenn sie erst mit dem Plündern angefangen hätten, würde niemand sie mehr aufhalten können. Demir drückte seinem Pferd die Fersen in die Flanken und trieb es zum Galopp an. Dabei hörte die überraschten Flüche seines Stabs kaum. Die Dunkelheit zwang ihn schon bald, sein Pferd auf dem unebenen Flachland zu zügeln, und es dauerte fast zehn Minuten, bis er die Kolonne erreichte.
Der abgehetzte Capric begrüßte ihn. »Jeder Oberst sagt, er hätte den Befehl, die Stadt zu plündern!«
»Wer hat den Befehl gegeben?«
Capric verzog das Gesicht. »Du.«
»Was?«
»Sie haben den Befehl zum Brandschatzen der Stadt alle schriftlich, mit deinem persönlichen Siegel versehen.«
»Nein … nein«, stöhnte Demir, während die Soldaten mit Fackeln und Musketen in den Händen an ihm vorbeiströmten. Einige blickten ernst drein, andere jubelten angesichts des dunklen Versprechens dieser Nacht, ihren blutigen Durst zu stillen. Allesamt befolgten sie Befehle. Anscheinend Demirs Befehle. Mit zitternden Fingern tastete er nach seinem Klugglas und steckte es sich lange genug ins Ohrläppchen, um seine Erinnerungen auf der Suche nach einem Irrtum zu durchforsten.
Hatte er ein unklar formuliertes Befehlsschreiben ausgesandt? Hatte er etwas Unüberlegtes zu einem seiner Sekretäre gesagt? Es wollte ihm nichts in den Sinn kommen, und das verängstigte ihn zutiefst. Selbst bei der klarsten Kommunikation konnte es Missverständnisse geben, aber dies war schlimmer als alles, was ihm je zu Ohren gekommen war.
Er musste herausfinden, was passiert war, aber zuerst musste er die bevorstehende Katastrophe abwenden. Demir zeigte mit dem Finger auf einen Offizier unter den Soldaten. »Sie da, Hauptmann, halten Sie Ihre Männer an!« Entweder hörte der Hauptmann ihn nicht, oder er ignorierte ihn. Die Soldaten gingen so sehr in ihrer neuen Mission auf, dass sie Demir nicht einmal bemerkten. Er trieb sein Pferd dichter an sie heran und wünschte sich, er hätte eine Pistole, um in die Luft schießen zu können. »Halt!«, schrie er. »Stehen bleiben! Sorgen Sie für Ordnung, verdammt noch mal!«
Wut kämpfte gegen seine wachsende Panik an. Er streckte die Hand nach den verstreuten Glassplittern aus, die von der Schlacht übrig geblieben waren, und hob sie in Gedanken auf. Hunderte von Splittern erhoben sich in die Luft und schwebten still wie gefrorene Regentropfen in Erwartung seines gedanklichen Befehls. Konnte er seine eigenen Männer töten, um eine Tragödie zu verhindern? Wie viele würde er abschlachten müssen, bis sie auf ihn aufmerksam wurden? Nach ein paar Sekunden ließ er los. Die Splitter fielen harmlos zu Boden, ohne von den marschierenden Soldaten bemerkt zu werden.
Er hörte einen Schuss, dann noch einen. Von der Stadt her wurden Schreie laut, gefolgt von Jubelrufen. Demir spürte, wie er die Kontrolle verlor, und tief in seiner Brust breitete sich eine noch nie zuvor verspürte Panik aus. Er wendete sein Pferd und jagte im Galopp auf den Stadtrand zu, wo die Schüsse, Schreie und Rufe lauter und chaotischer wurden. Schon bald kam er an einer toten Frau vorbei, die von mehreren Bajonettstichen durchbohrt am Wegesrand lag. Demir wurde schlecht. Er sah eine weitere Leiche, dann noch eine – offensichtlich alles Zivilisten.
Ein stärkerer Mann – ein erfahrenerer Glastänzer – hätte hart durchgegriffen und dem Massaker auf schnelle, brutale Art ein Ende gesetzt. Demir wusste, dass er das immer noch tun konnte, aber er konnte sich nicht dazu überwinden. Sein Verstand raste. Waren sie alle verrückt geworden? Wie konnte auch nur ein einziger seiner Offiziere glauben, dass er einen solchen Befehl geben würde? Er hatte sie in kürzester Zeit über die Berge geführt und ihnen zu drei großartigen Siegen verholfen, doch der Triumph hatte ihn nie grausam gemacht.
Als er den Stadtrand erreichte, sah er, dass Tausende seiner Soldaten bereits in die Stadt vorgedrungen waren. Im flackernden Schein der Fackeln rannten sie von Haus zu Haus, rafften alles Wertvolle an sich, warfen Kinder auf die Straße und töteten Männer und Frauen, während der Rauch der in Brand gesetzten Gebäude immer dichter wurde.
Demir ritt weiter und suchte nach den Offizieren, nach irgendwem, mit dessen Hilfe er die Situation unter Kontrolle bringen konnte. Er war halb blind vom Rauch, verwirrt und wusste nicht mehr, wo er war, als sein Pferd über einen umgeworfenen Karren stolperte und stürzte. Es gelang ihm gerade noch abzuspringen, doch er landete auf seiner linken Hand. Schmerz schoss seinen Arm hinauf. Demirs Pferd rollte sich wiehernd herum, sprang wieder auf und galoppierte in die Nacht davon.
Der Schmerz und das Chaos ließen Demir keinen klaren Gedanken fassen. Er hielt sich das Handgelenk und rannte durch das Getöse von Haus zu Haus, um seinen Soldaten zu befehlen aufzuhören. Er beschimpfte sie, herrschte sie an und bettelte schließlich. Ein paar von ihnen musterten seine verdreckte Uniform mit gerunzelter Stirn. Keiner von ihnen erkannte ihn. Wie sollten sie auch? Nur wenige hatten ihn je aus der Nähe gesehen, und er schaffte es nicht, den Handschuh seiner gebrochenen linken Hand auszuziehen, um ihnen sein Glastänzersymbol zu zeigen.
»Wer ist das denn?«, fragte einer.
»Irgendein Spinner«, gab ein anderer zurück.
»Er hat aber eine Offiziersuniform an und einen teuren Umhang.«
»Die Offiziere betrinken sich alle in Grappos Zelt. Wir haben Befehle auszuführen. Wenn wir nicht schnell sind, reißt sich ein anderer die guten Sachen unter den Nagel. Ein dreifaches Hurra auf den Prinz der Blitze!«
Dann lachten sie und kümmerten sich nicht weiter um ihn. Irgendwer packte ihn schließlich bei seinem Siegerumhang und warf ihn in den Straßengraben. Es gelang Demir kaum, seinen Sturz abzufangen, und er landete mit dem Gesicht im Dreck.
Halb im schlammigen Jauchegraben versunken, starrte Demir zur Straße hoch. Er bebte vor Wut und Angst am ganzen Körper. Vor nicht einmal einer halben Stunde hatte er sich für Holikans Schutz verbürgt, und jetzt gab es Befehle mit seinem Siegel, die Stadt zu plündern. Mit zitternden Fingern tastete er in seiner Tasche nach dem Himmelsglas, um seine Nerven zu beruhigen. Er zog eine Handvoll Glasstücke heraus, die ihm sofort entglitten und in das schlammige Wasser fielen. Verzweifelt tastete er danach, konnte sie aber nicht finden.
Dann hörte Demir auf der anderen Straßenseite ein Kind schreien, sah hinüber und entdeckte das kaum vier oder fünf Jahre alte schreiende Mädchen. Er kam auf die Beine und kämpfte sich aus dem stinkenden Graben heraus. Wenn er schon nicht alle retten konnte, dann wenigstens dieses Kind.
Das Dröhnen galoppierender Hufe ertönte alle anderen Geräusche, und Demirs Weg wurde plötzlich von mehreren Dutzend seiner Dragoner blockiert. Noch nie hatte er sie aus unmittelbarer Nähe erlebt, und hätte er das nicht schon im Jauchegraben getan, dann hätte er sich bei ihrem donnernden Vorbeipreschen die Hosen nass gemacht. Er suchte in seiner Tasche nach Götterglas, erinnerte sich dann, dass er alles verloren hatte, und nahm seinen Mut zusammen. Die Dragoner waren schon bald an ihm vorbeigaloppiert, und er stolperte weiter, bis sein Blick auf die Stelle fiel, an der das Kind gestanden hatte.
Das Mädchen war niedergetrampelt worden. Der kleine Körper lag still und unbeweglich da, gebrochen und voller Blut. Demir taumelte auf das tote Kind zu, riss sich seinen Siegerumhang ab, wickelte es hinein und rannte gerade noch vor der nächsten Dragonergruppe zurück auf die andere Straßenseite. Am ganzen Körper zitternd, ließ er sich mit der kleinen Leiche an die Brust gedrückt auf die Eingangstreppe eines leer stehenden Geschäfts sinken.
Und der Albtraum hatte gerade erst begonnen.
Als Demirs Stab ihn schließlich fand, saß er noch immer bewegungslos da. Seit mehr als zwölf Stunden hatte er weder geschlafen, gegessen noch einen zusammenhängenden Gedanken gefasst. Er kauerte mit dem in seinen Siegerumhang gehüllten toten Kind in den Armen auf der Treppe, von der aus er die ganze Nacht hindurch alle Gräueltaten, die eine siegreiche Armee einer Stadt antun konnte, beobachtet hatte. Sein Kopf lehnte an der kühlen steinernen Türschwelle des Geschäfts, seine Augen brannten vom beißenden Rauch der hundert brennenden Häuser, sein Mund war ausgetrocknet und sein Handgelenk geschwollen.
Es war Idrian, der ihn fand und die anderen herüberrief. Der Stürmer hatte seine Rüstung gegen seine Offiziersuniform mit den aufgestickten Widderhörnern getauscht, die ihm seinen Spitznamen eingebracht hatte. Er kniete sich neben Demir und sah ihm prüfend ins Gesicht. Dieser zuckte vor dem lila Götterglasauge zurück.
»Ist alles in Ordnung, Herr General?«
Demir fand keine Worte. Er fühlte sich leer, wie ausgehöhlt. Er wusste, dass seine Beine ihn tragen würden, aber allein der Gedanke aufzustehen schien unmöglich. Mit der Zunge fuhr er über seine aufgesprungenen Lippen, bemühte sich um Worte und scheiterte. Er spürte, wie sich Tränen in seinen Augen sammelten, und versuchte, sich abzuwenden. Er wollte nicht, dass der Stürmer sie sah.
»Das hätte nicht passieren sollen«, brachte er schließlich hervor. »Ich habe die Befehle dazu nicht gegeben.«
»Das weiß ich, Herr General«, erwiderte Idrian behutsam. »Es gab einen Fehler in der Kommunikation. Wir werden herausfinden, was da los war, das verspreche ich Ihnen.«
Langsam gesellte sich der Rest seines Stabs zu Idrian und starrte auf Demir herab. Das siegesfrohe Gelächter von gestern war durch schockierte und angewiderte Blicke ersetzt worden. Capric kam Demir nah genug, um nachsehen zu können, was in den Siegerumhang gewickelt war, und taumelte zurück bis an den Graben, wo er sich übergab. Idrians gesundes Auge richtete sich kurz auf das tote Kind, doch er zuckte nicht zurück. Demir konnte die Blicke seines Stabs spüren – wie sie ihn abschätzend musterten und sich fragten, wie diese Ereignisse sich auf ihre Karriere oder Gildenfamilie auswirken würden. Er konnte sehen, dass jeder Einzelne von ihnen nach einer Möglichkeit suchte, sich von dieser Katastrophe zu distanzieren.
Eine Rebellenstadt durch Unterwerfung und Dezimierung zu bestrafen war eine Sache, sie in Brand zu stecken etwas ganz anderes.
Demir bemühte sich nachzudenken. Er versuchte, alle seine Sinne zu konzentrieren und zu kalkulieren, welche Möglichkeiten ihm noch blieben. Er hatte Holikan vor mehr als einem Dutzend Zeugen unter seinen Schutz gestellt – und dann hatte seine Armee es gebrandschatzt. Die Soldaten hatten augenscheinlich auf seine Befehle hin gemordet, Feuer gelegt und geplündert. Er musste eine Untersuchungskommission ins Leben rufen und dieses Desaster irgendeinem anderen in die Schuhe schieben, einer echten Person oder einer erfundenen.
»Klugglas«, krächzte er.
Capric kam wieder zu ihm und drückte ihm ein Stück in die Hand. Demir steckte es sich in ein Piercing, um zu denken. Aber sein Kopf war leer, und das Klugglas verursachte hinter seinen Augen stechende Schmerzen, bis er es wieder entfernte und Capric zurückgab. Er konnte keine Kalkulationen mehr anstellen. Die Zukunft war finster und still.
Sein Verstand war gebrochen.
»Myria Forl?«, fragte er und sah auf der Suche nach der Ortsvorsteherin auf.
»Sie ist in Sicherheit«, beruhigte Idrian ihn. »Herr General, Ihr Onkel ist gegen Mitternacht gekommen, und ich habe sie bei unserem Bataillon untergebracht. Niemand wird ihr etwas antun.«
Demirs Blick fiel auf die schwarzen Rauchsäulen, die über ihnen in den Himmel stiegen. »Ich wünschte, sie wäre nicht in Sicherheit. Ich wünschte, sie könnte nicht sehen, was ich getan habe.«
»Sie haben das nicht getan«, sagte Idrian nachdrücklich. »Es war ein Versehen. Mit den Befehlen ist irgendetwas schiefgegangen.«
Demir musterte die Gesichter seines Stabs. Alle wichen seinem Blick aus – diesmal nicht aus Angst, sondern aus Scham. Er hatte das nicht angerichtet, das stimmte, aber er trug die Verantwortung.
All seine Muskeln schmerzten, als es Demir gelang, langsam aufzustehen, ohne die Kinderleiche fallen zu lassen. Er merkte, dass die Tür des Geschäfts offen stand und es geplündert worden war, obwohl er sich an keine Soldaten erinnern konnte, die sich an ihm vorbeigeschoben hatten. Er legte das immer noch in seinen Siegerumhang gehüllte Kind auf den Tresen.
Kurz strich er dem Mädchen über die Haare, versuchte, sich an ein Gebet aus seiner Kindheit zu erinnern, und wünschte sich, an einen Gott zu glauben, zu dem er beten könnte. Demir bemühte sich, seine Gedanken zu ordnen. Wie konnte er nach dem, was geschehen war, jemals wieder einem anderen Menschen unter die Augen treten? Wie konnte er zu seiner Gilde, seinen Liebhaberinnen oder den Einwohnern seiner Provinz zurückkehren? Würde er jemals wieder einem Menschen ins Gesicht sehen können? Er kehrte zum Eingang zurück. Zum ersten Mal seit Jahren spürte er, wie jung er war – hilflos, unerfahren und von dem innigen Wunsch besessen, dass ein Erwachsener kommen und alles wieder richten würde.
Idrian drückte Demir ein Stück Milchglas in die Hand. Das Götterglas war nicht von so hoher Qualität wie das, das Demir verwendete, aber der magische Effekt stellte sich sofort ein: Die Schmerzen fielen von seinen Knochen ab. »Wir sollten uns um Ihr Handgelenk kümmern«, meinte Idrian. »Sieht aus, als wäre es gebrochen.«
Trotz Idrians Milchglas schmerzte Demirs Handgelenk so stark, dass es taub wie seine Seele war. »Wer ist mein Stellvertreter?« Niemand antwortete. Er sah jedem seiner Stabsmitglieder ins Gesicht. »Ich habe keine Ahnung.« Ein verrückt klingendes Lachen entrang sich ihm. »Ich habe arrogant geglaubt, dass ich keinen brauche. Tja. Wer es auch sein mag – herzlichen Glückwunsch zur Beförderung!«
»Herr General?«, hakte Idrian nach.
»Ich trete zurück.«
»Sie können nicht zurücktreten!«, rief jemand. »Das ist doch Ihr großer Triumph!«
In der Hoffnung auf etwas Rückendeckung sah Demir zu Capric. Sein Freund starrte mit offenem Mund auf die Dutzende von Leichen, die auf der Straße lagen, allesamt Zivilisten. Ein Triumph. Vielleicht konnte er das hier noch irgendwie retten. Seine Mutter, ein politisches Genie, würde es auf jeden Fall versuchen. Aber wenn er nach diesen Ereignissen hier an der Spitze eines Triumphzugs zurück nach Ossa marschierte, würde er nie mehr in den Spiegel blicken können.
Er wich Idrians Blick aus. »Entschuldigen Sie sich für mich bei Myria Forl. Sagen Sie meinem Onkel, es tut mir leid, dass ich den Feldzug nicht beende. Capric, du verfasst meinen Rücktritt. Meine Unterschrift kannst du fälschen.«
Demirs Mutter würde enttäuscht sein. So vielversprechend, würde sie sagen. So ein Dummkopf. Wir hätten das wieder ins Reine bringen können. Er stolperte die Stufe hinunter, fing sich und ging weiter. »Sag ihnen, sie sollen mich nicht suchen kommen«, rief er ihm über die Schulter zu. »Der Prinz der Blitze ist tot.«
1
NEUN JAHRE NACH DER BRANDSCHATZUNG VON HOLIKAN
Demir Grappo stand in der hintersten Reihe eines Amphitheaters, der kleinen Knüpplerarena der Provinzstadt Ereptia. Selbst für provinzielle Verhältnisse war Ereptia ein rückständiger Ort, ein kleines Städtchen mit weniger als zehntausend Einwohnern im Herzen des Weinanbaugebiets. Die meisten Menschen waren als einfache Arbeiter in den weitläufigen Weinbergen angestellt, die reichen ossanischen Gildenfamilien von auswärts gehörten. Ereptias einziges Amphitheater bot ein paar Hundert Zuschauern Platz, doch zum Schaukampf an diesem Nachmittag waren nur ein Drittel der Bänke gefüllt.
Knüppeln war der Nationalsport des Reichs – bedeutender und beliebter als Pferderennen, Hahnenkämpfe, Jagen und Boxen zusammen. Die beiden Kämpfer in der Arena trugen hochresonante Ohrringe aus Schmiedeglas, die sie kräftiger und gewandter machten, und schlugen sich mit beschwerten Knüppeln zu Brei, bis einer von ihnen aufgab.
Oder starb.
Demir fand, dass diese die niederen Triebe ansprechende Sportart – bei der die Kämpfer sich für Ruhm und Ehre zum Krüppel schlagen ließen und ihnen dabei zugejubelt wurde – Ossa perfekt beschrieb. Irgendwann würde er darüber eine philosophische Abhandlung verfassen.
Mit seinem Wettschein in der Hand sah er zu, wie die zwei Kämpfer sich unter den Flüchen und Ermutigungsrufen des spärlichen Publikums quer durch die Arena prügelten. Die eins achtzig große Frau mit der milchweißen Haut einer Purnianerin hieß Slatina, hatte kurzes blondes Haar und bestand nur aus Muskeln. Overin, der kleinere Mann, war schneller als sie, hatte eine Glatze, einen dichten schwarzen Bart und die hellolivfarbene Haut der östlichen Provinzen.
Sie waren ebenbürtige Kämpfer – Muskeln gegen Gewandtheit –, und das Publikum war außer sich vor Begeisterung, wenn die Schläge trafen, Haut aufplatzte und Blut auf den Sandboden der Arena spritzte. Demir achtete mehr darauf, wie sie kämpften, als darauf, wer gewann. Es war ein guter Kampf, der kaum Zweifel daran ließ, dass es um Leben und Tod ging.
Als Overin schließlich unter Slatinas Knüppel zu Boden ging und zitternd die Hand hob, bevor sie ihm den tödlichen Schlag versetzen konnte, wusste Demir, dass alle darauf hereingefallen waren: Weder die Punktrichter noch die Zuschauer oder die Buchmacher ahnten, dass die beiden Kämpfer für den unvermeidlichen Ausgang bezahlt worden waren.
Demir drückte sich im Amphitheater herum, bis auch die letzten Zuschauer gegangen und die Knüppler längst mit Heilglas versorgt und weggebracht worden waren. Er hielt die Augen und Ohren offen, um sich zu überzeugen, dass niemand das abgekartete Spiel durchschaut hatte. Nachdem er sicher war, dass die Vorstellung kein Misstrauen erregt hatte, schlenderte er die Treppe zum Hauptausgang hinunter und über die Straße zu der kleinen, heruntergekommenen Pinte, in der einer von Ereptias vielen Buchmachern seine Geschäfte betrieb. Demir setzte sich auf einen der Hocker an der Bar, legte seinen Wettschein auf den Tresen und klopfte mit dem Finger darauf.
»Ich brauche ein neues Stück Himmelsglas«, sagte Demir und zupfte an seinen Handschuhen, die seine beiden Glasabzeichen verbargen.
Morlius, der Wirt und Buchmacher mittleren Alters, wirkte gehetzt, spülte aber in aller Ruhe Humpen im Wasserfass unter der Bar aus. Normalerweise kaufte Demir kein Götterglas in Kneipen, aber derartige Luxusgüter konnte ein Fremder in solch entlegenen Landstrichen nirgendwo anders erwerben.
Morlius würdigte ihn kaum eines Blickes. »An Himmelsglas komme ich zurzeit überhaupt nicht ran.«
»Nicht mal an die Billigsorten?«
»Nicht mal die. Keine Ahnung, warum. Aus Ossa kommt einfach nichts, und das bisschen, was ich letzten Monat kriegen konnte, haben die Weinbergverwalter aufgekauft.«
»Scheiße!« Die beruhigende Wirkung des Himmelsglases war für Demir zwar nicht lebenswichtig, machte ihm das Leben aber leichter. Sein letztes Stück hatte seit drei Tagen keine Resonanz mehr, und seit Holikan fiel ihm das Schlafen schwer. Er rieb sich die Schläfen. »Und Rauschglas?«
Morlius schüttelte den Kopf.
»Na gut. Dann ein Glas von Ereptias Bestem, auf die Rechnung hier.« Er tippte wieder auf den Wettschein des Buchmachers.
»Sie haben wohl gewonnen?« Morlius sah ihn mürrisch an.
»Und ob!« Demir bedachte ihn mit seinem charmantesten Lächeln. »Der Nachmittag hat mir Glück gebracht.« Er schob den Zettel über den Tresen. »Kriege ich jetzt was zu trinken?«
Morlius griff nicht nach einem Weinglas. »Gestern haben Sie auch gewonnen. Und vorgestern.«
»Und die drei Tage davor habe ich verloren.« Demir behielt sein Lächeln bei. »Nach Pech kommt wohl Glück, schätze ich.«
»Mit Glück hat das nichts zu tun, denke ich.«
Demir ließ aus seinem Lächeln gespielte Verwirrung werden. Er achtete immer darauf, fast so oft zu verlieren, wie er gewann. Hatte er einen Fehler begangen? Oder hatte jemand Morlius einen Tipp gegeben? »Ich weiß nicht, was Sie damit sagen wollen«, schnaubte er. Morlius hatte keinen guten Ruf. Es wurde gemunkelt, dass er die Knüppler vor den Kämpfen unter Rauschmittel setzte, um den von ihm gewünschten Sieg zu garantieren. Oft tat er das nicht – nicht so oft, dass die Obrigkeit darauf aufmerksam wurde –, aber die Gerüchte waren fundiert genug, dass Knüppler seine Kneipe mieden.
Gegen diese Art von Machenschaften hatte Demir nichts, das wäre heuchlerisch gewesen. Er hatte nur etwas gegen die Behandlung der Knüppler. Seine Kämpfer bekamen immer einen Anteil an den Gewinnen. Das war die Abmachung.
Einer von Morlius’ Schlägern kam mit einem neuen Weinfass aus dem Keller. Morlius nickte nicht gerade unauffällig in Demirs Richtung. Der Schläger stellte das Fass ab, schloss die Kneipentür und stellte sich hinter ihn. Morlius zog einen Knüppel unter dem Tresen hervor. »Hab von einem Mann drüben in Wallach gehört, der wie Sie aussehen soll. Den hat man dabei erwischt, wie er die Kämpfe manipuliert hat. Bevor sie ihn aufhängen konnten, hat er sich aus dem Staub gemacht. Mein Cousin hat seinetwegen Tausende verloren.«
Demir seufzte und warf einen Blick über seine Schulter. Der Schläger hinter ihm war über einen Meter neunzig groß, kräftig gebaut und hatte die mehrmals gebrochenen Finger und das zerschlagene Gesicht eines ehemaligen Knüpplers. Demir sah, wie er ein langes Messer aus dem Gürtel zog.
»Sie bedrohen aufgrund der ungenauen Beschreibung eines Gauners drei Orte weiter einen Kunden mit dem Messer?«, spottete Demir. Er war noch nicht bereit, Ereptia zu verlassen. Slatina war nicht nur eine talentierte Knüpplerin und gute Schauspielerin – sie wollte ihn nächstes Wochenende auch ihren Eltern vorstellen. Demir liebte es, Eltern kennenzulernen. Es war, als blicke man in die Zukunft und sähe, wie jemand sich in dreißig Jahren geben würde. »Machen Sie doch keinen Quatsch, Morlius. Das war ja nicht mal eine hohe Wette. Wenn Sie heute nicht in der Lage sind zu zahlen, können wir es mit meiner nächsten Zeche verrechnen.«
Wäre Morlius pfiffig gewesen, hätte er Demir ein Betäubungsmittel gegeben, ihn ausgeraubt und auf der anderen Seite der Stadt in einer dunklen Gasse abgeladen. Aber Morlius war nicht pfiffig. Er wusste nicht, wann er seine Raffgier besser zügeln sollte. Demir drehte sich auf seinem Hocker, sodass seine eine Schulter auf Morlius und den Tresen gerichtet war und die andere auf den Schläger. Hinter diesem befand sich zur Straße hin ein Fenster, und Demir entdeckte draußen etwas, das vorher nicht da gewesen war: eine äußerst vornehme Kutsche mit himmelblauen Vorhängen, sechs Leibwächtern auf den Trittbrettern und dem eingeschnitzten Glasabzeichen der Vorcien-Gilde auf der Tür.
Demir war sofort abgelenkt. Was machte ein Vorcien in dieser abgelegenen Provinz?
Morlius packte ihn plötzlich am Handgelenk und holte mit dem Knüppel aus. »Ich finde, die Beschreibung passt perfekt.«
Demir stöhnte innerlich. Also kein Geld für seine Wette. Und kein Abendessen mit Slatina. Stattdessen würde er in die nächste Stadt weiterziehen müssen, sein Leben wieder umwerfen und Freunde und Liebhaberinnen verlassen müssen, wie er es in den letzten neun Jahren schon Dutzende Male getan hatte. Allein der Gedanke ließ ihn verzagen, doch er machte ihn gleichzeitig auch wütend. Er warf sein geistiges Netz aus und merkte sich mit seinen Glastänzerkräften jede einzelne Fensterscheibe und Weinflasche in der Bar.
»Lassen Sie meine Hand los«, sagte Demir tonlos.
»Sonst …?« Morlius grinste ihn an.
Demir setzte ein klein wenig magischen Druck ein, und hinter Morlius zerschellte eine Weinflasche. Der Wirt zuckte zusammen. Eine zweite platzte, dann eine dritte. Mit einem wortlosen Schrei wirbelte Morlius zu dem Flaschenregal herum und streckte die Hände nach den Flaschen aus, ohne sie zu berühren. Demir zerbrach noch zwei weitere und zog dann langsam und bedacht seinen linken Handschuh aus. Er legte seine Hand flach auf den Tresen. Als Morlius sich wieder zu ihm umdrehte, konnte er das Glastänzersymbol sehen.
Morlius riss die Augen auf. In seinem Blick stand die panische Angst, die Demir aus so vielen Augen entgegengestarrt hatte, seit er mit achtzehn tätowiert worden war. Demirs Magen krampfte sich unter diesem Blick zusammen, aber er verzog keine Miene. Morlius war schließlich kein Freund, sondern hatte gerade unabsichtlich sein Leben in Ereptia zerstört. Sollte er doch vor Angst vergehen.
»Ich … ich … ich …«, stammelte Morlius.
Demir lehnte sich über den Tresen und konzentrierte seine gesamte Abscheu auf den Mann. »Lassen Sie sich ruhig Zeit.« Der Schläger hinter ihm flüchtete zurück in den Keller und knallte die massive Holztür hinter sich zu. Kluger Mann. »Ich hab’s nicht eilig.« Demir ließ eine weitere Weinflasche zerplatzen und freute sich darüber, wie Morlius zusammenzuckte. Er wusste, dass der Buchmacher ihm nichts tun würde. Wer würde das einem leibhaftigen Glastänzer gegenüber schon wagen? In diesem Moment hätte Demir mit allem davonkommen können.
Er atmete tief durch. Jetzt hatte er schlechte Laune. Obwohl er bereits die Oberhand hatte, musste er sich mit aller Kraft davon abhalten, nicht jedes Stück Glas in der Bar zu zerstören und Morlius die Splitter ins Gesicht zu werfen. So war Demir nicht. Er legte einen Finger auf seinen Wettschein und schob ihn wieder zu Morlius hinüber. Der Buchmacher starrte mehrere Sekunden lang darauf, bis er verstand. Er nahm seinen Geldbeutel vom Gürtel und legte ihn auf den Tresen.
»Nehmen Sie das. Bitte!« Jetzt bettelte er. Wie schnell sich das Blatt doch gewendet hatte.
»Ich beraube Sie nicht«, sagte Demir sanft. »Ich bin nur ein Kunde, der seinen Wettschein einlöst.«
Aus irgendeinem Grund schien das für den Mann noch schlimmer zu sein. Mit zitternden Händen öffnete er den Geldbeutel und begann, die schweren Reichsmünzen abzuzählen. Zweimal stieß er den Münzstapel mit seinen zitternden Fingern um, dreimal sah er auf dem Wettschein nach, dann nickte er Demir schließlich zu.
Die meisten Glastänzer, die Demir kannte, wurden ihrem Ruf mehr oder weniger gerecht und drohten gern mit ihren Kräften, um anderen gegenüber im Vorteil zu sein. Sie stahlen, bedrohten und schändeten, ohne sich um die Konsequenzen zu scheren. Demir bereitete das kein Vergnügen. Gut, er genoss es manchmal, jemanden wie Morlius in seine Schranken zu verweisen. Aber Freude hatte er daran nicht.
Er kehrte die Münzen in seine Handfläche und steckte sie in seine Tasche. »Ich möchte Ihnen noch sagen, dass ich mich von allen in Wallach im Guten getrennt habe. Alle Punktrichter und Kämpfer sind durch meine abgekarteten Wettkämpfe reich geworden. Nur der Buchmacher mochte mich nicht. Der war so dumm, das Geld seiner Kunden zu verwetten – ich nehme an, dass das Ihr Cousin ist. Seien Sie klüger als er, Morlius. Sein Leben habe ich ihm gelassen, aber ich habe einen armen Schlucker aus ihm gemacht.«
»Äh … äh … ja.«
»Wenn Sie auch nur ein Wort über das hier verlieren oder ich herausfinde, dass Sie einem meiner Kämpfer ein Rauschmittel gegeben haben«, Demir nickte in Richtung des Flaschenregals, »muss ich mich diesem ganzen Glas hier doch noch zuwenden.« Er schlug mit der flachen Hand auf den Tresen. »Schönen Tag noch, Morlius!«
Demir wandte sich ab, bevor sich die Enttäuschung in seinem Gesicht abzeichnen konnte. Wieder ein Leben, das er aufgeben, wieder eine Stadt, die er verlassen musste, ehe jemand herausfand, wer er wirklich war. Seine falsche Identität, die nur durch Drohungen aufrechterhalten blieb, hatte einen weiteren Sprung bekommen. Sollte er sich von Slatina verabschieden? Sie würde eine Erklärung erwarten, und das zu Recht. Sie kannte nicht einmal seinen wahren Namen. Es war besser, einfach zu verschwinden. Plötzlich fühlte er sich erschöpft und wünschte sich, irgendetwas in seinem Leben wäre wenigstens halbwegs normal.
Die Vorcien-Kutsche draußen hatte Demir vollkommen vergessen und war schockiert, als er die Kneipentür aufstieß und sich einem altvertrauten Freund gegenübersah. Neun Jahre war es her, seit er Capric Vorcien das letzte Mal gesehen hatte. Er war dünner und würdevoller geworden, seine Gesichtszüge mit Anfang dreißig waren markanter, fast raubvogelartig. Seine Jacke und Tunika waren aus teuren Stoffen, und er stützte sich mit einer Hand auf einen schwarzen Spazierstock. Hinter ihm standen zwei Leibwächter auf der Straße.
»Demir?«, fragte er überrascht.
Dieser starrte Capric einen Moment lang eindringlich an, schüttelte verwirrt den Kopf und musterte ihn dann erneut. Tatsächlich, es war wirklich Capric Vorcien. »Glasverdammt noch mal! Capric? Heilige Pisse, was machst du denn hier?«
»Ich suche dich. Alles in Ordnung mit dir? Du siehst schlimm aus. Hast du die Neuigkeiten schon gehört?«
Demir wurde eiskalt. Er hatte alles in seiner Macht Stehende getan, damit man ihn nicht fand. Wenn Capric nun mit schlechten Neuigkeiten hier auftauchte, musste es sich um eine Katastrophe handeln. Er streckte die Hand aus, und Capric schüttelte sie. »Habe ich nicht. Was bringt dich denn in meine Ecke der Provinzen?«
»Du hast eine eigene Ecke? Breenen meint, dass du nirgendwo länger als sechs Monate gewohnt hast, seit du aus Holikan geflohen bist.« Demir spürte, wie sein Auge bei dem Wort Holikan zu zucken begann, und Capric sprach schnell weiter. »Entschuldige. Ich wollte nur … Es klingt, als wärst du viel unterwegs gewesen.«
»War ich auch«, bestätigte Demir. »Wenn man zu lange in derselben Stadt lebt, fragen sich die Leute irgendwann, warum man nie die Handschuhe auszieht. Und warum plaudert Breenen darüber, wo ich mich herumtreibe? Hat meine Mutter dich losgeschickt, damit du mich zurückholst?«
Capric sah sich um. »Können wir uns unter vier Augen unterhalten? Meine Kutsche steht gleich hier.«
Normalerweise hätte Demir Nein gesagt. Seine Freunde in diesem verschlafenen Städtchen hätten ihn mit Fragen gelöchert, wenn er in eine Privatkutsche mit dem Glasabzeichen einer Gildenfamilie eingestiegen wäre. Aber seine Auseinandersetzung mit Morlius hatte seiner Zeit hier bereits ein Ende gesetzt. Und es war besser, schlechte Neuigkeiten gleich zu erfahren. »Dann wollen wir mal.«
Die Kutsche war von Kindern belagert, die die Leibwächter abwechselnd verspotteten und anbettelten. Als Demir und Capric näher kamen, scheuchten die Leibwächter sie weg. Drinnen holte Capric sofort eine Flasche Sherry heraus und schenkte ihnen auf dem kleinen Klapptisch zwei Gläser ein, während Demir ihn eingehend musterte. Er versuchte, Caprics Auftauchen zu deuten, trank einen Schluck und stellte das Glas wieder hin. »Also, was ist los, Capric? Wie hast du mich gefunden und warum bist du hier?«
Capric stürzte seinen Sherry hinunter, schenkte sich ein zweites Glas ein und trank es halb aus, bevor er antwortete. »Es tut mir sehr leid, Demir.«
»Was denn?«
»Deine Mutter ist gestorben.«
Demir wurde bleich. »Soll das ein Witz sein?«
»Ich wünschte, es wäre einer. Breenen hat mir gesagt, wo du zu finden bist, und ich bin so schnell gekommen, wie ich konnte, damit du es nicht aus den Zeitungen erfahren musst.«
Demir musterte Caprics müde, ernste Miene mehrere Sekunden lang, um sich von der Wahrheit zu überzeugen, stieß dann die Tür auf und erbrach sein Frühstück auf das Kopfsteinpflaster. Er fühlte eine sanfte Hand auf seinem Rücken, während er sich übergab, und wischte sich dann den Mund mit einem Taschentuch ab, das Capric ihm hinhielt.
Unzählige Gedanken brachen über ihn herein: Reue, Pläne und Anschuldigungen. Er hatte seine Mutter in den letzten zehn Jahren zwar nur ein paarmal gesehen, aber sie war stets wie ein verlässliches Licht gewesen, das in der Ferne in einem Fenster brannte. Nun, da ihr Licht erloschen war, verfluchte er sich, dass er sie nicht öfter besucht hatte – und dass er ihre Erwartungen an ihn als Wunderkind enttäuscht hatte. Er tastete seine Taschen nach Himmelsglas ab, bevor ihm einfiel, dass er nichts mehr hatte. Als er wieder aufsah, hielt Capric ihm ein hellblaues Stück hin.
Dankbar nahm Demir es und steckte das gebogene Ende in eins seiner Ohrlöcher. Sein rasender Herzschlag und Verstand beruhigten sich sofort. Er atmete tief durch und sammelte sich.
»Wie ist es passiert?«, fragte er.
»Es war unschön«, warnte Capric ihn.
Demir machte sich auf das Schlimmste gefasst. »Das ist der Tod immer.«
»Sie wurde auf den Stufen des Regierungspalasts totgeschlagen.«
Unwillkürlich stieß Demir ein Geräusch aus, das halb Lachen, halb Schluchzen war. Adriana Grappo war ein Freigeist gewesen, eine der wenigen im Rat, die sich mit Herz und Seele für die Verbesserung der Lebensumstände des gemeinen Volks eingesetzt hatten, statt sich zu bereichern. In Ossa starben Reformer schon lange in aller Öffentlichkeit. Sie wurden von ihresgleichen umgebracht, weil sie zu radikale gesellschaftliche Veränderungen durchsetzen wollten.
»Wer war es?«
Capric schüttelte den Kopf. »Das wissen wir noch nicht. Sechs Maskierte haben sich plötzlich auf sie gestürzt, es schnell erledigt und sich in alle Richtungen zerstreut, bevor die Wachen gerufen werden konnten. Und bevor du etwas sagst – ich weiß, was du denkst. Dass sie nicht wegen ihrer Reformen getötet wurde. Klar, die Besteuerung, die sie vorgeschlagen hat, hat die Elite aufgeregt, aber alle haben deine Mutter geliebt. Der Rat ist außer sich vor Wut. Ich würde mich sehr wundern, wenn sie die Schuldigen nicht schon vor meiner Rückkehr schnappen.«
Demir zwang sich, seine zu nichts führenden Verschwörungstheorien zu begraben, und versuchte, sich auf das beruhigende Summen des Himmelsglases in seinem Ohr zu konzentrieren. Capric hatte recht. Adriana war stets die Gratwanderung zwischen radikaler Reform und harmloser Politik gelungen. Sie hatte immer gewusst, wann sie Druck machen konnte und wann sie sich zurückziehen musste. »Dann ist es also niemand aus dem Rat gewesen?«
»Das kann ich mir wirklich nicht vorstellen.«
Demir lehnte seinen Kopf an die Kutschwand. Aber wer war es dann gewesen? Wen hatte sie sich während seiner Abwesenheit zum Feind gemacht? »Ist bereits eine Untersuchung im Gange?«
»Ja, eine sehr gründliche.«
»Wurde Onkel Tadeas schon informiert?«
»Das weiß ich nicht. Der Rat hält den Mord geheim, bis er mehr Informationen hat. Adriana war sehr beliebt beim Volk. Wenn sie ihren Tod bekannt geben, bevor sie eine sichere Spur haben, könnte es zu Ausschreitungen kommen.«