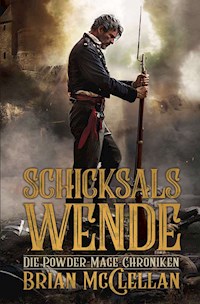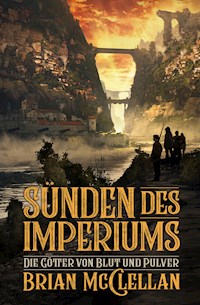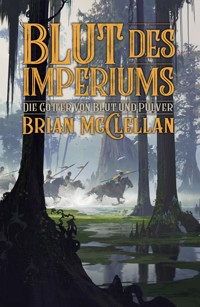
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Cross Cult
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Im Abschluss von Brian McClellans epischer Fantasy-Trilogie über Magie und Schießpulver müssen ein Söldner, ein Spion und ein General Verbündete finden, um das Blatt des Krieges zu wenden. Die Dynize haben den Landfall-Gottesstein entschlüsselt, und Michel Bravis soll nach Greenfire Depths zurückkehren, um alles zu tun, was er kann, um sie daran zu hindern, die Macht des Steins zu nutzen. Ben Stykes Invasion von Dynize wird zu einem Reinfall, als ein Sturm seine Flotte zerstreut. Er geht mit nur zwanzig Lanzenreitern an Land und ist gezwungen, sich statt auf seine Muskeln voll und ganz auf seinen Verstand zu verlassen. Lady Vlora Flint, die ihrer Zauberkraft beraubt und körperlich und seelisch gebrochen ist, marschiert an der Spitze einer adranischen Armee nach Landfall, um sich an denen zu rächen, die sich gegen sie verschworen haben. Doch sie sieht sich unüberwindbaren Hindernissen und dem größten General von Dynize gegenüber.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 987
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Brandon Sanderson,dafür, dass du der erste Profi warst, derwirklich an meine Arbeit als Schriftstellergeglaubt hat, und dafür, dass du mirgezeigt hast, wie man mit diesem seltsamenJob seinen Lebensunterhalt verdient
Inhalt
PROLOG
KAPITEL 1
KAPITEL 2
KAPITEL 3
KAPITEL 4
KAPITEL 5
KAPITEL 6
KAPITEL 7
KAPITEL 8
KAPITEL 9
KAPITEL 10
KAPITEL 11
KAPITEL 12
KAPITEL 13
KAPITEL 14
KAPITEL 15
KAPITEL 16
KAPITEL 17
KAPITEL 18
KAPITEL 19
KAPITEL 20
KAPITEL 21
KAPITEL 22
KAPITEL 23
KAPITEL 24
KAPITEL 25
KAPITEL 26
KAPITEL 27
KAPITEL 28
KAPITEL 29
KAPITEL 30
KAPITEL 31
KAPITEL 32
KAPITEL 33
KAPITEL 34
KAPITEL 35
KAPITEL 36
KAPITEL 37
KAPITEL 38
KAPITEL 39
KAPITEL 40
KAPITEL 41
KAPITEL 42
KAPITEL 43
KAPITEL 44
KAPITEL 45
KAPITEL 46
KAPITEL 47
KAPITEL 48
KAPITEL 49
KAPITEL 50
KAPITEL 51
KAPITEL 52
KAPITEL 53
KAPITEL 54
KAPITEL 55
KAPITEL 56
KAPITEL 57
KAPITEL 58
KAPITEL 59
KAPITEL 60
KAPITEL 61
KAPITEL 62
KAPITEL 63
KAPITEL 64
KAPITEL 65
KAPITEL 66
KAPITEL 67
KAPITEL 68
KAPITEL 69
MICHEL
VLORA
STYKE
DANKSAGUNGEN
PROLOG
Ka-sedial meditierte in einem Bad aus Sonnenlicht im obersten Stockwerk des ehemaligen Stadthauses von Kanzlerin Lindet in der Oberstadt von Landfall. Es war ein prächtiger Raum, gefüllt mit Kunst, astronomischen Instrumenten, seltenen Büchern und mechanischen Rätseln; der Spielplatz von jemandem, der Bildung mit Leidenschaft betrachtet. Er hatte den Raum weitgehend unberührt gelassen, seit er die Macht übernommen hatte, und er hatte beschlossen, dass er die Vorbesitzerin durchaus mochte. Er und Lindet würden eine lange, interessante Diskussion führen, bevor er ihr den Kopf abschlug.
Er saß auf einem gepolsterten Hocker und blickte durch eine große Buntglasscheibe nach Osten. Mit geschlossenen Augen genoss er diesen Moment der Ruhe, die schließlich ein seltener Luxus war. Er fragte sich, ob er in den kommenden Tagen ganz darauf würde verzichten müssen. Die meisten Menschen dachten, dass Herrschen ein Luxus sei. Über diesen Gedanken musste er innerlich glucksen. Zu herrschen, war eine Pflicht, eine schreckliche Verantwortung, an der sich nur wenige mit Erfolg messen konnten. Ein Klopfen an der Tür unterbrach seine Grübeleien, und Sedial rieb sich den hartnäckigen Schmerz hinter seinem linken Auge weg, bevor er seine Hände gelassen auf seine Knie legte. »Herein.«
Die Tür wurde geöffnet, und das Gesicht eines Mannes im mittleren Alter mit harten, kantigen Gesichtszügen, einem eckigen Kiefer und einer militärischen Haltung erschien. Er war mittelgroß und hatte eine kräftige Statur sowie die schwarzen Tätowierungen eines Drachenmannes. Ji-noren war offiziell der Leibwächter von Sedial. In Wirklichkeit war er Sedials Spionagemeister und militärischer Berater, und einer von etwa einem Dutzend Drachenmännern, die ihm gegenüber loyal waren und nicht dem Kaiser.
»Ja?«, fragte Sedial.
»Wir haben das Mädchen gefunden.«
»Das Mädchen?«
»Das Ihr Ichtracia gegeben habt.«
Sedial schnaubte bei der Erwähnung seiner verräterischen Enkelin. »Bring sie rein.«
Es dauerte einige Augenblicke, bis Ji-noren eine zierliche Palo-Frau von etwa neunzehn Jahren hereinbrachte. Wäre Sedial jung genug gewesen, um diese Art von Zeitvertreib noch zu genießen, hätte er sie sehr attraktiv gefunden. Sie zitterte heftig, als Ji-noren ihr eine Hand auf die Schulter legte. Er hatte sie aus den Einwohnern dieses riesigen Slums, den Greenfire-Tiefen, ausgesucht, und sie war als Friedensangebot für Ichtracia gedacht gewesen, eine Sklavin, mit der sie machen konnte, was sie wollte. Ichtracia hatte das Mädchen einfach freigelassen und Sedials Befehle ignoriert.
Sedial betrachtete das Mädchen einen Moment lang und versuchte, mit seiner Magie auch nur die kleinste Spur seiner Enkelin an ihr zu finden. Wenn sie nur ein bisschen Zeit miteinander verbracht hatten, dann müsste er dort etwas finden, und sei es nur ein Flüstern.
Nichts.
Er zog ein Lederetui aus seinem Ärmel, entrollte es und brachte eine Reihe von Nadeln und Glasfläschchen zum Vorschein. Er zog eine der Nadeln heraus. »Gib mir deine Hand.« Die Frau atmete heftig. Ihre Augen rollten wie die eines verängstigten Pferdes, und Sedial hätte Noren fast befohlen, ihr ein wenig Vernunft einzuprügeln. Stattdessen streckte er die Hand aus und packte sie am Handgelenk. Er stach ihr in eine Vene auf dem Handrücken, ignorierte den erschrockenen Laut, den sie von sich gab, und verwischte den Blutstropfen mit seinem Daumen. Dann ließ er sie los.
Er starrte auf den scharlachroten Tropfen. Er atmete ein paarmal tief durch, berührte das Blut mit seiner Magie und spürte, wie sie eine Brücke zwischen seinem Körper und ihrem, zwischen seinem Geist und ihrem herstellte. »Wann hast du Ichtracia das letzte Mal gesehen?«, fragte er.
Die Unterlippe des Mädchens zitterte. Sedial übte mit seiner Magie sanften Druck aus, und die Worte sprudelten plötzlich aus ihr heraus. »Nicht seit dem Tag, an dem Ihr mich bei ihr gelassen habt. Sie hat mich, schon wenige Minuten nachdem Ihr gegangen seid, weggeschickt!«
»Und seitdem hattest du keinen Kontakt mehr zu ihr?«
»Nein!«
»Hast du auch nur eine Ahnung, wo sie sich versteckt halten könnte?«
»Habe ich nicht, Großer Ka! Es tut mir leid!«
Sedial seufzte und wischte sich das Blut an seinem Daumen mit einem sauberen Stofffetzen vom Tisch neben ihm ab. Er steckte die Nadel zurück in das Lederetui und rollte es zusammen, dann schnippte er abweisend mit der Hand. »Sie weiß nichts. Bring sie zurück in die Tiefen.«
Ji-noren packte sie an der Schulter, aber die Frau weigerte sich, sich von ihm abzuwenden. Ihr Blick blieb an seinem hängen, und ihre Zähne klapperten. »Ihr …«
»Ich was, meine Liebe?«, fragte er ungeduldig. »Ich werde dich nicht foltern?« Er schenkte ihr sein bestes großväterliches Lächeln. »Glaube mir, wenn ich denken würde, dass das helfen könnte, wärst du schon auf dem Weg zu meinen Knochenaugen. Aber du bist nichts weiter als eine willensschwache Unbeteiligte, und trotz allem, was man dir vielleicht erzählt hat, zerquetsche ich keine Insekten aus schierer Bosheit. Nur aus Notwendigkeit.« Er machte noch eine Geste in Richtung Ji-noren, und im nächsten Moment war das Mädchen verschwunden.
Ji-noren kam ein paar Minuten später zurück. Er stand an der Tür und wartete schweigend, während Sedial versuchte, wieder in diese glückselige Meditation zu fallen, die er vorhin gehabt hatte. Es klappte nicht. Der Moment der Ruhe war vorbei. Sein Kopf schmerzte, und die Stelle hinter seinen Augen pochte jedes Mal heftig, wenn er seine Magie einsetzte. Er stieß einen kleinen Seufzer aus und rappelte sich auf die Beine. Er durchquerte den Raum zu einem Schreibtisch, wo er sich auf den Stuhl sinken ließ, und begann, eine Reihe von Arbeitsaufträgen zur Umverteilung von Palo-Arbeitern aus den Wohnungsbauprojekten im Norden zu einer neuen Festung im Süden zu unterschreiben.
»Haben wir keine andere Möglichkeit, Ichtracia zu finden?«, fragte Ji-noren leise.
»Nein«, antwortete Sedial, während er einen der Arbeitsaufträge überflog und seine Unterschrift darunter setzte. »Haben wir nicht. Die weltlichen Mittel haben versagt – wir haben jeden verhört, der auch nur eine schwache Verbindung mit ihr gehabt hat.«
»Und magische Mittel?«
»Die Dynize-Privilegierten haben vor langer Zeit gelernt, sich vor den Knochenaugen zu verbergen. Selbst unser Familienblut ist nicht stark genug, um es mir zu erlauben, ihre Verteidigung zu durchbrechen.«
»Was ist mit dem Spion, Bravis?«
Sedial sah auf die blauen Flecken an seinem Handgelenk hinunter. Sie stammten von der einen Enkelin – von Ichtracias Magie –, der Schmerz hinter seinem Auge von der anderen. »Ka-poel beschützt ihn«, sagte er leise und hob seinen Blick zu einer kleinen Kiste auf dem Regal. Die Kiste enthielt den Finger des Spions und mehrere Fläschchen mit seinem Blut. Sie hatten sich als nutzlos erwiesen, aber er behielt sie trotzdem.
»Ich habe die Suche auf dreihundert Meilen ausgeweitet«, sagte Ji-noren. »Wir werden sie finden.«
Diese Zusicherung löste in Sedials Brust einen Anfall von Wut aus. Er kämpfte sie nieder, unterschrieb einen weiteren Arbeitsauftrag und versah ihn mit seinem Dienstsiegel. Er sollte nicht auf Soldaten angewiesen sein, die Keller durchkämmten und Dachböden durchwühlten, um seine Enkelin und diesen dreckigen Spion zu finden. Er war das mächtigste Knochenauge der Welt. Sie zu finden, sollte so einfach sein wie ein Gedanke. Die Stelle hinter seinem Auge pochte. Das zweitstärkste Knochenauge. Trotz seines Zustandes verspürte er einen Hauch von Stolz auf Ka-poel. Sie wäre eine tolle Schülerin gewesen – oder eine mächtige Opfergabe. Vielleicht würde sie sich noch als Letzteres erweisen. »Ichtracia und der Spion sind entweder schon auf der anderen Seite des Kontinents, oder sie verstecken sich direkt vor unserer Nase. Konzentriert eure Bemühungen weiter auf die Stadt.« Er richtete sich wieder auf, ließ seinen Rücken knacken und schenkte Ji-noren ein Grinsen. »Ka-poel will zu viel auf einmal. Sie beschützt Dutzende mit ihrer Magie, anstatt sie als Waffe zu benutzen. Wenn sie nicht so abgelenkt wäre, hätte sie mich schon getötet.«
Ji-noren runzelte die Stirn, als würde er sich fragen, wie das eine gute Nachricht sein konnte.
Sedial klopfte Ji-noren auf die Schulter. »Sie wird weiterhin denselben Fehler machen. Irgendwann wird sie dadurch gegen meine Angriffe geschwächt sein, und dann werde ich sie brechen.«
»Ah. Wissen wir, wo sie ist?«
»Im Westen, immer noch. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo, aber ich vermute, dass sie nach dem letzten Götterstein sucht.«
»Sie weiß nicht, dass wir ihn schon haben.«
»Nein, ich glaube nicht.« Sedial wandte sich an den Drachenmann. »Du runzelst immer noch die Stirn.«
»Wir haben viele Feinde an diesem Ort«, bemerkte Ji-noren.
»Wie wir erwartet haben.«
»Mehr als erwartet«, sagte Ji-noren. »Und viel mächtiger. Habt Ihr die Berichte darüber gelesen, was die beiden Pulvermagier mit der Armee angestellt haben, die wir Lady Flint hinterhergeschickt haben?«
Sedial ignorierte die Frage. Eins nach dem anderen. »Mach dir keine Sorgen, mein Freund«, sagte er, während er den Raum in Richtung Tür durchquerte. Es war fast Teezeit, und vielleicht würde er seinen Tee noch genießen können, bevor ein weiterer Bote mit irgendeinem lächerlichen Problem kam, das gelöst werden musste. »Wir haben fast jede Schlacht gewonnen, die wir auf diesem verfluchten Kontinent geschlagen haben. Wir sind im Besitz von zwei Göttersteinen. Sobald wir die Magie gebrochen haben, mit der Ka-poel den Götterstein vor Landfall belegt hat, werden wir in der Lage sein, zu handeln.«
»Und was ist mit Lady Flint, was ist mit dieser neuen adronischen Armee im Norden?«, beharrte Ji-noren. »Sie haben den dritten Götterstein.«
»Aber sie haben keine Ahnung, wie sie ihn benutzen sollen.« Sedial hielt inne und fügte dann beruhigend hinzu: »Sie haben etwa dreißigtausend Soldaten. Wir sind ihnen allein in dieser Region vier zu eins überlegen.«
»Sie haben jetzt Privilegierte und Pulvermagier.«
»Wir werden sie kaufen«, sagte Sedial. »Die adronische Delegation wird wesentlich nachgiebiger sein als die sture Lady Flint. Sie hat vielleicht eine Armee bekommen, aber sie hat sich auch die Politik der Neun eingehandelt. Ich vermute, dass ihr Letzteres viel schwerer fallen wird als Ersteres.«
Er legte seine Hand auf die Tür, als er Schritte hörte, die mit Dringlichkeit die Treppe heraufkamen. Er verdrehte die Augen und öffnete die Tür gerade noch rechtzeitig, um zu sehen, wie ein Bote, bedeckt mit Schweiß und Straßenstaub, schnaufend zum Stehen kam. »Was gibt es?«, fragte Sedial.
»Wir haben es geschafft, Sir.«
Sedial war verblüfft. »Was geschafft?«
»Der Götterstein, Sir. Die Privilegierten und Knochenaugen sagen, sie haben ihn gelöst.«
Es dauerte ein paar Augenblicke, bis er den Gedanken zu fassen bekam. »Sie sind sich sicher? Sie haben die Versiegelungen meiner Enkelin durchbrochen?«
»Ja, Großer Ka. Mit absoluter Sicherheit.«
Sedial spürte, wie sich ein Grinsen auf seinem Gesicht ausbreitete. Er stieß einen erleichterten Seufzer aus und nickte dem Boten kurz zu, bevor er die Tür schloss und zurück zum Schreibtisch humpelte. »Wir haben es geschafft, Noren«, hauchte er.
»Herzlichen Glückwunsch, Großer Ka«, sagte Ji-noren warm.
Sedial griff unter das Schreibpult und holte eine kleine Zigarrenkiste mit dem Wappen seines Hauses hervor. Sie pulsierte vor Magie, als seine Fingerspitzen sie berührten, und wurde immer wärmer, bis es ihm gelang, sich in den Finger zu stechen und das Blut auf einen speziellen Knoten am Boden der Schachtel zu drücken. Die Schachtel sprang auf und enthüllte mehrere Dutzend vorbereitete Umschläge, die mit verschiedensten Schutzzaubern versehen waren. Er zog sie fast ehrfürchtig heraus und reichte sie an Ji-noren. »Schick sie sofort zurück nach Dynize.«
»Sind wir sicher, dass wir dafür bereit sind?«, fragte Ji-noren mit einiger Überraschung.
»Es ist Zeit, zuzuschlagen. Beginnt mit der Säuberung.«
»Was ist mit dem Kaiser?«
»Der Kaiser ist nur eine weitere Marionette. Er wird denken, dass die Säuberungen in seinem Namen durchgeführt werden.«
Ji-noren blickte auf die Befehle hinunter. Einen Moment lang glaubte Sedial, ein Zögern aufflackern zu sehen. Das war natürlich verständlich. Nach einem so langen und blutigen Bürgerkrieg waren die meisten Dynize stark abgeneigt, das Blut ihres Volkes zu vergießen. Doch es war unvermeidlich. Feinde mussten vernichtet werden, sowohl ausländische als auch inländische.
»Kann ich dir vertrauen, dass du an meiner Seite stehst, mein Freund?«, fragte Sedial.
Ji-norens Blick verhärtete sich. »Bis in den Tod.«
»Gut.«
»So beginnt es also.«
»Nein«, korrigierte Sedial sanft. »Es hat vor Jahrzehnten angefangen. So endet es.«
KAPITEL 1
Michel Bravis stand in der Tür einer kleinen kressianischen Kapelle und nippte an einem kalten Morgenkaffee. Er beobachtete die Palo-Fischer, die auf der Straße an ihm vorbeizogen und lange Stangen auf ihren Schultern balancierten, an denen ihr früher Fang aufgehängt war. Er musterte jeden Mann und jede Frau genau und hakte sie im Geiste ab, während er nach neuen Gesichtern, verdächtigen Blicken oder irgendeiner Art von Neugier in seine Richtung Ausschau hielt. Sie prahlten voreinander mit ihrem Fang oder liefen in mürrischem, erfolglosem Schweigen nebeneinander her, aber kein Einziger von ihnen würdigte Michel eines zweiten Blickes.
Er hatte sich im letzten Monat die blonde Farbe aus den Haaren geschoren und verbrachte jeden Tag viel Zeit in der Sonne, damit das natürliche Erdbeerrot in seinen Haaren und in seinem Bart zum Vorschein kam. Eine Hungerkur hatte ihm geholfen, über zwölf Kilo abzunehmen, und jede Spiegelung in den Schaufenstern erinnerte ihn daran, dass er sein Aussehen seit seiner Abreise aus Landfall so weit wie möglich verändert hatte.
Für die Einwohner des Palo-Fischerdorfes, das etwa zwanzig Meilen von Landfall entfernt lag, war Michel nichts weiter als ein weiterer Palo-Vagabund, der durch die Dynize-Invasion aus seiner Heimat vertrieben worden war. Seine Vormittage verbrachte er auf der Kapellentreppe, nachmittags putzte er Fisch in der einzigen Verarbeitungsfabrik, und abends saß er in einer der vielen Kneipen und hörte sich den Klatsch und Tratsch der Dynize-Soldaten an, mit denen er hin und wieder Karten spielte. Er sammelte Informationen, hielt sich bedeckt und wartete vor allem darauf, dass sich eine Gelegenheit ergab, die es ihm und Ichtracia erlaubte, diesen Ort zu verlassen und ins Landesinnere zu gehen, um Ka-poel zu finden.
Michel trank seinen Kaffee aus, kippte den Kaffeesatz in die Gosse und steckte seine Blechtasse weg, bevor er ins Innere der Kapelle ging. Er lauschte dem Knall der großen Kapellentür, die hinter ihm ins Schloss fiel, und versuchte, nicht an dem immer noch schmerzenden Stummel des Fingers herumzufummeln, den Sedial ihm abgeschnitten hatte und der unter einem Verband und einer falschen Schiene verborgen war. Er atmete tief durch und ging den Mittelgang der Kapelle hinauf.
Ichtracia sah allem Anschein nach aus wie eine trauernde Witwe. Sie trug einen schwarzen Schal und einen Schleier und saß zusammengekauert, als würde sie beten, in der zweiten Bankreihe. Michel schaute sich in der leeren Kapelle um, stellte sich dann neben sie und richtete seinen Blick auf Kresimirs Seil, das über dem Altar hing. Er bemerkte, dass jemand »Kresimir ist tot« unter eines der Buntglasfenster des Kirchenschiffs geschrieben hatte. Die trinkfeste Fischerin, die als die Pfarrerin des Ortes fungierte, hatte sich nicht die Mühe gemacht, es wegzuwischen.
»Sind alle kressianischen Kirchen so?«, fragte Ichtracia, ohne ihren Kopf zu heben.
»So … was?«
»Langweilig.«
Michel dachte über die Frage nach. »Die Kathedralen sind beeindruckender.«
»Ich habe die Kathedrale in Landfall besichtigt. Sie war wirklich groß.« Sie klang nicht beeindruckt.
»Gibt es in Dynize keine Kirchen?« Es war ihm nie vorher in den Sinn gekommen, das zu fragen.
»Nicht wirklich, es ist nicht dasselbe. Wir sollen den Kaiser auf dem Marktplatz anbeten, aber das macht niemand so wirklich, außer an Feiertagen.«
Das hörte sich sehr ähnlich an wie Michels eigene Beziehung zur Religion. Als Junge hatte er sich nie damit beschäftigt, und als Erwachsener hatte er genau gewusst, dass Kresimir tatsächlich tot war. Schließlich arbeitete er für die beiden, die den kressianischen Gott getötet hatten. »So bist du wenigstens nicht den ganzen Tag in unserem Zimmer eingesperrt«, regte Michel an.
»Diese Kirchenbank wird mich noch umbringen.« Ichtracia stand plötzlich auf, hob ihren Schleier und streckte sich mit einem ziemlich unfrommen Gähnen.
Seit sie sich aus Landfall hinausgeschlichen hatten, hatte sie sich als die Witwe seines Bruders ausgegeben. Zumindest war das ihre Geschichte. Bisher hatte sich noch niemand die Mühe gemacht, sie zu fragen. Die Dynize waren hier nicht sehr präsent, abgesehen von vereinzelten vorbeiziehenden Trupps, und die Palo interessierten sich einfach nicht dafür.
Aber das war Michels Erfahrung mit Deckgeschichten – sie kamen einem unnötig vor, bis sie einem plötzlich das Leben retteten.
Sie fuhr fort. »Hast du schon herausgefunden, wie wir hier wegkommen?«
Michel zog eine Grimasse. Bis jetzt hatte Ichtracia ihre missliche Lage ganz gut verkraftet. Es schien ihr sogar Spaß zu machen, die Rolle der anonymen Witwe zu spielen, und sie genoss jeden Blick, der an ihr vorbeiwanderte, ohne sie zu erkennen. Aber der Anblick der zusammengestülpten Leiche des Leibwächters ihres Großvaters war Michel noch frisch im Gedächtnis, ebenso wie ihre Forderung, sie zu ihrer Schwester zu bringen. Er war sich der ungleichen Machtverhältnisse zwischen ihnen stark bewusst und fürchtete den Moment, in dem ihre Geduld ein Ende fand.
»Das habe ich nicht«, antwortete er ihr. Hinter ihren Augen spielte sich etwas ab, das ihm ein Kribbeln im Nacken verursachte. Er schenkte ihr sein charmantestes Lächeln. »Ich versuche mein Bestes.«
»Da bin ich mir sicher.« Sie klang nicht überzeugt. »Gibt es Neuigkeiten vom Krieg?«
Michel kam herum und ließ sich auf die Bank fallen. Er wartete, bis sie sich wieder gesetzt hatte, bevor er sagte: »Es gibt jede Menge Gerüchte. Lindet hat den Hammer zurückerobert und stößt in den Osten von Fatrasta vor. Ihre Armee ist riesig, besteht aber größtenteils aus Wehrpflichtigen, und die Dynize versammeln ihre Feldarmeen, um sie niederzuschlagen.« Er runzelte die Stirn. »Es gibt viele widersprüchliche Berichte aus dem Norden – eine ganze Feldarmee der Dynize ist verschwunden. Eine andere Armee belagert Neu-Adopest und soll die Stadt bis Ende nächster Woche einnehmen und nach Süden kommen.« Um ehrlich zu sein, machte er sich Sorgen um diese Armee. Wenn sie sich an die Küste hielten, könnten sie direkt an dieser kleinen Stadt vorbeimarschieren. Michel war nicht begeistert von der Vorstellung, dass dreißigtausend Dynize oder mehr, zusammen mit Privilegierten und Knochenaugen, in der Nähe ihr Lager aufschlugen. Ichtracia behauptete, sie könne sich vor jeder Magie verstecken, aber er wollte es lieber nicht drauf ankommen lassen.
»Irgendwas Neues aus Landfall?«
»Nur Truppenkonsolidierung. Sedial baut eine Festung um den Götterstein und nutzt dafür fatrastanische Arbeitskräfte. Niemand weiß, wie viele Kressianer und Palo er angeheuert hat, aber man munkelt, dass sie gut bezahlt und gefüttert werden, also gibt es nicht viel zu meckern.«
Ichtracia schniefte. »Du wirkst überrascht davon, dass die Palo gut behandelt werden.«
»Wir waren schon immer bestenfalls Bürger zweiter Klasse«, antwortete Michel. »Schlimmstenfalls Sklaven und Untermenschen.« Ihm lag noch etwas auf der Zunge – das gehütete Geheimnis, das ihm der Blackhat je Tura kurz vor seinem Tod verraten hatte. Schon seit Wochen wollte er Ichtracia fragen, was sie über die Versuche ihres Großvaters wusste, den Götterstein zu aktivieren, und seit Wochen hatte er diesen Drang unterdrückt. Er war sich nicht sicher, ob er sich Sorgen machte, dass sie keine neuen Informationen für ihn haben würde – oder ob er befürchtete, dass sie alles darüber wusste.
»Die Palo sind Cousins der Dynize«, sagte Ichtracia. »Natürlich wird er sie nicht so gut behandeln wie unsere eigenen Leute, aber sie sind auch nicht gerade Fremde.« Sie runzelte die Stirn. »Eine Festung um den Götterstein. Ich frage mich, ob er sich wirklich Sorgen um Lindet und ihre Armeen von Wehrpflichtigen macht. Oder ob er etwas anderes im Schilde führt.«
»Keine Ahnung«, antwortete Michel und beobachtete Ichtracias Gesicht.
Wusste sie es? Log sie ihn in diesem Moment an? Sie waren schon seit einiger Zeit ein Paar, aber es gab immer noch viele Mauern zwischen ihnen – und das aus gutem Grund. Er versuchte, es abzutun. Es spielte keine Rolle. Seine einzige Aufgabe war es jetzt, einen Weg zu finden, wie er sie aus der Stadt und auf die andere Seite des Kontinents bringen konnte. Sobald er sie wieder mit Ka-poel zusammengebracht hatte, konnte er nach Landfall zurückkehren und versuchen, die Wahrheit herauszufinden.
Das Knarren der Kapellentür ließ Michel ein wenig zusammenzucken, und er widerstand dem Drang, über seine Schulter zu schauen, als Ichtracia sich nach vorne lehnte und wieder die Rolle der betenden Witwe einnahm. Michel berührte ihre Schulter, als wolle er sie trösten, dann stand er auf. Wenn er jetzt ginge, hätte er noch ein paar Stunden Zeit, um sich in der Kneipe Gerüchte anzuhören, bevor er seine Nachmittagsschicht antreten musste.
Er erstarrte beim Anblick des Mannes, der direkt vor der Tür der Kapelle stand, und blinzelte mehrmals, um sicherzugehen, dass er sich nicht täuschte. »Taniel?«, stieß er hervor.
Taniel Zwei-Schuss sah aus, als sei er in den wenigen Monaten, seit sie das letzte Mal miteinander gesprochen hatten, um ein Jahrzehnt gealtert. Seine Reitkleidung war schmutzig, seine Schultern hingen schlaff herunter, und sein Gesicht wirkte länger und ausgezehrt. An seinen Schläfen war ein silberner Streifen von Haaren aufgetaucht, und er schenkte Michel ein müdes Lächeln.
»Hallo, Michel.« Er fuhr sich mit einer Hand durch die Haare. »Du bist wirklich ein verdammtes Chamäleon. Ich wäre hier wieder rausgegangen, ohne dich erkannt zu haben, wenn du nicht gerade meinen Namen gesagt hättest.«
»Was zur Grube ist mit dir passiert?«, fragte Michel und schlüpfte an Ichtracia vorbei in den Gang.
»Ich habe gegen ein paar Dynize-Brigaden gekämpft«, sagte Taniel. Es klang wie ein Scherz, aber er lächelte nicht. »Ich habe es vielleicht ein bisschen übertrieben.« Sein Blick wanderte zu Ichtracia und dann wieder zu Michel.
Ichtracia hatte sich aufgerichtet und starrte Taniel nun so an, wie Michel eine durch die Tür schlüpfende Kreuzotter beäugt hätte. Ihre Finger zuckten, als wolle sie nach den Privilegiertenhandschuhen in ihrer Tasche greifen. Ein unsicherer Ausdruck huschte über ihr Gesicht. Michel räusperte sich. »Taniel, Ichtracia. Ichtracia, Taniel.«
»Ichtracia«, sagte Taniel langsam. »Das ist unser Maulwurf?«
»Ich bin deine Schwägerin, so wie ich das verstehe«, sagte Ichtracia tonlos.
Taniel warf ihr einen kurzen Blick zu. »Ich dachte, du heißt Mara.«
»Ein Spitzname«, erklärte Michel. »Es war mühsam, sie zu finden, aber ich habe es geschafft. Warum hast du mir nicht gesagt, dass sie Ka-poels Schwester ist?« Er hatte nicht vorgehabt, das zu fragen – Taniel gegenüber einen anklagenden Ton anzuschlagen, war nie eine gute Idee. Aber es war ihm einfach so rausgerutscht.
Taniel blickte kurz finster drein, bevor er einen müden Seufzer ausstieß. »Ich hatte nicht gedacht, dass du das wissen müsstest.«
»Das hätte die Suche vielleicht etwas eingegrenzt.« Michel hörte, wie sein eigener Tonfall lauter wurde. Der ganze Ärger, den er über die Geheimhaltung empfunden hatte, egal ob sie wichtig gewesen war oder nicht, brach langsam durch. »Du hättest mir auch sagen können, dass sie eine Privilegierte ist.«
»Das stimmt.« Taniel legte den Kopf schief, als lausche er auf ein entferntes Geräusch. »Du versteckst es sehr gut. Ich habe nichts gespürt, als ich durch die Tür gekommen bin.«
»Ich habe viel Übung«, sagte Ichtracia. Ihr Tonfall war jetzt nicht mehr tonlos, sondern genervt. »Du bist also der Gottesmörder?«
Taniels Gesichtsausdruck wurde ernst. »Was hast du ihr erzählt?«, fragte er Michel.
Michel warf die Hände in die Luft, aber Ichtracia antwortete, bevor er es konnte. »Er hat mir gar nichts erzählt. Die Dynize haben überall auf der Welt Spione. Du bist angeblich schon vor zehn Jahren gestorben. Als Michel mir erzählt hat, für wen er arbeitet – und mit wem meine Schwester verheiratet ist –, konnte ich nicht anders, als anzunehmen, dass du zu Ende bringen konntest, was du mit Kresimir angefangen hast.«
Taniel schnaubte, ging zur letzten Bank im hinteren Teil der Kapelle und ließ sich dort nieder. »Es gibt viele Gerüchte«, sagte er müde. »Tut mir leid, dass ich dich in die Irre geführt habe, Michel. Pole und ich haben gemeinsam beschlossen, dass es das Beste ist, wenn du selbst herausfindest, wer und was Mar… Ichtracia ist. Wir hatten nur den Namen Mara als Anhaltspunkt. Ein Spitzname, hast du gesagt?«
»So hat unser Großvater uns beide als Kinder genannt«, sagte Ichtracia. »Es bedeutet, dass wir seine kleinen Opfergaben waren.«
Taniels entschuldigendes Lächeln wechselte von Michel zu Ichtracia. »Ich verstehe. Danke, dass du mit Michel mitgekommen bist. Ich kann mir vorstellen, dass wir einander viel zu erzählen haben. Und dass du deine Schwester sehen willst.«
»Wo ist sie?« In Ichtracias Stimme schwang ein Hauch von Ungeduld mit.
Taniel zögerte. »Im Westen. Ich bin auf dem Weg, um sie zu suchen.«
Michel beobachtete Ichtracia. Er wollte ihr sagen, dass sie sich in der Gegenwart eines großen Mannes befand. Dass sie ein wenig Respekt zeigen sollte. Aber er war verärgert genug über Taniel, um seinen Mund zu halten. Außerdem hatte Ichtracia auch einiges auf dem Kasten. »Apropos suchen«, sagte er. »Wie hast du uns gefunden?«
»Ich bin zuerst nach Landfall gegangen«, antwortete Taniel. »Ich habe Smaragd getroffen, und er hat mir gesagt, dass du deine Mission erfüllt hast und wie ich hierherkomme. Es hat … ein paar Wochen gedauert.«
Michel runzelte die Stirn. »Wir haben versucht, einen Weg durch die Straßensperren der Dynize zu finden, seit wir losgezogen sind. Wie konntest du einfach so nach Landfall reiten?«
»Einer von Smaragds Leuten hat nördlich der Stadt mit gefälschten Papieren auf mich gewartet.« Taniel tätschelte seine Brusttasche. »Niemand sucht nach einem einzelnen kressianischen Reiter, und in den Papieren steht, dass ich ein Spion für die Dynize bin. Es gab ein paar unangenehme Fragen, aber damit bin ich klargekommen.«
Michel stieß ein frustriertes Geräusch aus. Wenn es für ihn und Ichtracia nur so einfach gewesen wäre, wären sie jetzt schon auf der anderen Seite des Kontinents, anstatt in diesem kleinen Fischerdorf auf eine Gelegenheit zu warten, sich davonzumachen. »Du bist also hier, um Ichtracia zu Pole zu bringen?«
Taniel warf einen langen Blick auf Ichtracia. »Das bin ich.«
»Warte«, sagte Ichtracia und sah Michel verwirrt an. »Du kommst doch mit uns, oder?«
»Du bist mehr als willkommen«, fügte Taniel hinzu.
Michel schenkte den beiden ein festes Lächeln. »Ich sollte mitkommen. Aber ich muss zurück in die Stadt.«
»Du bist doch verrückt!«, rief Ichtracia. Sie tauschte einen Blick mit Taniel aus und fuhr dann fort: »Du weißt, dass Sedial die ganze Stadt nach dir durchsuchen lässt, oder? Sobald dich jemand erkennt, wirst du gefangen genommen, gefoltert und getötet werden.«
Michel starrte einen Moment lang auf seine Hände und dachte über seine Worte nach.
»Michel?«, drängte Taniel.
»Ich habe noch etwas zu erledigen.«
»Was denn zu erledigen?«, fragte Taniel.
Michel wich Ichtracias Blick aus. Er wählte seine Worte mit Bedacht. »Als ich da war, habe ich den Dynize geholfen, die letzten Blackhats in der Stadt zur Strecke zu bringen.«
»Das hat mir Smaragd erzählt«, antwortete Taniel.
»Ich habe Val je Tura gefunden und getötet.«
»Die Goldrose mit dem Bastardschwert?«
»Genau. Bevor er gestorben ist, hat er mir etwas erzählt.« Michel zögerte wieder und schaute Ichtracia von der Seite an. »Er hat mir erzählt, dass die Dynize Palo zusammentreiben und sie in einem Blutritual opfern, um den Götterstein zu aktivieren.« In dem Moment, als das letzte Wort aus seinem Mund kam, wusste er, dass er sich in Ichtracia getäuscht hatte – und dass er es ihr schon vor Wochen hätte sagen sollen. Das Blut wich aus ihrem Gesicht, und ihre Augen weiteten sich. Er erwartete, dass sie überrascht sein oder alles abstreiten würde oder … irgendetwas. Stattdessen klappte ihr der Kiefer zu.
»Grube«, murmelte Taniel.
»Ich muss zurück in die Stadt, um herauszufinden, ob es wahr ist, und versuchen, etwas dagegen zu tun.«
»Das ist doch Selbstmord«, sagte Ichtracia. Ihre Worte überschlugen sich förmlich.
Michel schenkte ihr ein strenges Lächeln. »Taniel, worauf habe ich die ganze Zeit hingearbeitet?«
»Die Unabhängigkeit der Palo«, antwortete Taniel automatisch.
Ichtracia wirkte verblüfft. »Ich dachte, du wolltest dich gegen meinen Großvater stellen, um zu verhindern, dass er die Göttersteine benutzt.«
»Das … das ist Taniels und Ka-poels Kampf«, sagte Michel. »Letzten Endes habe ich nur ein Ziel: die Palo von denen zu befreien, die sie unterjochen, versklaven und gängeln. Dabei ist mir egal, ob es die Kressianer, die Fatrastaner oder die Dynize sind. Ich muss mich mit den Feinden meines Volkes anlegen. Es nützt nichts, mit dir und Taniel mitzugehen. Ich muss zurück nach Landfall.«
»Ich dachte, du hast gesagt, dass die Palo unter den Dynize besser behandelt werden?« In ihrem Tonfall schwang etwas mit, das Michel nicht ganz zuordnen konnte. Es klang wie Verzweiflung.
»Ich weiß es nicht«, sagte Michel schulterzuckend. »Vielleicht. Oder es könnte Propaganda sein. Was auch immer es ist, ich muss zurück nach Landfall und die Wahrheit herausfinden.«
Das Schweigen zwischen ihnen allen wurde ohrenbetäubend. Ichtracia starrte die Wand an. Taniel starrte Michel an. Michel musterte beide Gesichter und versuchte, etwas in ihnen zu lesen. Schließlich räusperte sich Taniel. »Ka-poel ist auf dem Weg nach Dynize.«
»Was?« Das Wort entriss sich aus Ichtracias Kehle, als sie zu ihm herumwirbelte.
»Sie ist auf der Suche nach dem dritten Götterstein. Ich bin auf dem Weg, um sie zu begleiten.«
»Das ist auch reiner Selbstmord! Warum seid ihr alle lebensmüde?« Irgendetwas in Taniels Gesichtsausdruck musste sie verwirrt haben, denn sie hielt inne und holte scharf Luft. »Ihr wisst es nicht?«
»Wir wissen was nicht?«
»Wir haben den dritten Götterstein schon. Er ist in Dynize und ist gut geschützt.«
Taniel murmelte etwas vor sich hin. »Gut, dass sie einen Leibwächter hat, nehme ich an. Wenn das wahr ist, habe ich keine Zeit zu verlieren. Ich muss den Kontinent überqueren, ein Schiff nehmen und mich nach Dynize schleichen. Es wird Monate dauern, bis ich sie einhole.«
Michel schnaubte. Taniels Tonfall war optimistisch, als würde er auf eine Vergnügungsreise gehen. Aber in ein paar Monaten konnte alles passieren, vor allem, wenn Ka-poel blind nach Dynize fuhr. Fast hätte Michel Taniel gebeten, diese Idee zu vergessen und mit ihm nach Landfall zu kommen. Aber das war aussichtslos. Taniel würde dorthin gehen, wo Ka-poel war.
»Kommst du mit?«, fragte Taniel Ichtracia unverblümt. Michel konnte in seinen Augen sehen, dass er das Gespräch bereits hinter sich gelassen hatte und bereit war, loszurennen, wie ein Rennpferd, das auf den Startschuss wartet.
»Nein.«
Michel drehte sich zu ihr um. »Was soll das heißen, ›Nein‹?«
»Ich komme mit dir mit.« Ichtracias Gesicht hatte etwas von seiner Farbe zurückgewonnen. Sie hatte jetzt einen sturen Gesichtsausdruck.
»Du kannst nicht zurück nach Landfall gehen«, protestierte Michel. »Du wärst in Gefahr.«
»Nicht mehr als du«, entgegnete sie. Ihr linkes Auge und ihre Wange zuckten, und eine Kaskade von Emotionen durchlief ihr Gesicht innerhalb eines Augenblicks.
»Deine Schwester …«
»Ich kann sie treffen, wenn das hier vorbei ist!«, sagte sie energisch. Leiser, zu sich selbst, wiederholte sie: »Wenn das alles vorbei ist. Gibt es eine Möglichkeit, wieder nach Landfall zu kommen?«, fragte sie Taniel.
»Smaragd hat ein paar Dynize-Pässe für euch beide geschickt«, sagte Taniel. »Sie waren für euch gedacht, um mich durch das Land zu begleiten, aber ich nehme an, dass ihr damit problemlos nach Landfall zurückkehren könnt.«
Michel schluckte. Er war lange genug mit Ichtracia zusammen, um zu wissen, dass sie kein Nein als Antwort akzeptierte. Seine Erwähnung der Blutopfer hatte etwas in ihr ausgelöst. Er hatte das Gefühl, dass er wissen sollte, was es war, aber er war zu sehr mit seinen eigenen Plänen beschäftigt, um den Grund für ihre Verzweiflung zu erkennen. Er änderte sofort seine Denkweise und verwarf alle Ideen, die er für eine Ein-Mann-Operation hatte. Er musste sie so anpassen, dass sie für zwei funktionierten.
»Wir nehmen die Pässe«, sagte Ichtracia.
»Ich denke …«, setzte Michel an.
»Denk nicht«, schnauzte sie ihn an. »Du hättest mir von deinen Absichten erzählen sollen. Du hättest mir von den Opfern erzählen sollen. Mara!« Sie schlug sich gegen die Brust. »Mara! Opfergabe. Dieses Blut hätte meines sein sollen! Stattdessen tötet er Tausende von unschuldigen Menschen, um seine Arbeit zu erledigen. Ich gehe mit dir, und das ist mein letztes Wort.«
KAPITEL 2
Ben Styke ruhte sich auf dem Vorderdeck eines kleinen Transportschiffs namens Seaward aus, sein großes Boz-Messer in der einen und einen Schleifstein in der anderen Hand. Er lauschte dem Rauschen des Meeres und den Rufen der Möwen, die vom gelegentlichen langsamen Raspeln unterbrochen wurden, wenn er seine Klinge schärfte. Er trug einen großen Schlapphut, um die Sonne von seinem Gesicht fernzuhalten, obwohl Celine ihm schon mehrmals gesagt hatte, dass er damit lächerlich aussah.
Er bemerkte, wie einer der Matrosen in seine Richtung starrte, und fragte sich, ob es nur an dem Hut lag oder an ihm. Nach zwei Wochen auf See schien es den Matrosen immer noch unangenehm zu sein, zwanzig Wilde Ulanen und Ben Styke in ihrem Laderaum schlafen zu sehen. Diese Angst kam Styke sehr gelegen – wenn sie bedeutete, dass jemand sprang, wenn er den Befehl dazu gab, machte sie sein Leben einfacher. Er fragte sich, was sie wohl denken würden, wenn er ihnen von der waschechten Dynize-Bluthexe erzählte, die die Kajüte des Ersten Offiziers in Beschlag genommen hatte.
Bei dem Gedanken hob Styke den Kopf und ließ seinen Blick über das Deck nach Ka-poel schweifen. Seit sie in See gestochen waren, hatte er nicht mehr viel von ihr gesehen. Seit der Schlacht bei Neu-Starlight sah sie erschöpft aus und hatte nicht weniger als vierzehn Stunden pro Tag geschlafen. Er vermutete, dass der magische Machtkampf, den sie mit ihrem Großvater geführt hatte, ihr mehr Schaden zugefügt hatte, als sie zugeben wollte. Er überlegte, ob er sie direkt fragen sollte – er brauchte sie in ihrer besten Form für diese Mission –, verwarf den Gedanken aber sofort wieder. Sie war noch am Leben, bewegte sich noch und hatte noch genug Energie, um leise über seinen Hut zu kichern.
Sie würde schon klarkommen. Das musste sie auch.
Styke hob seinen Blick weiter nach oben, zum Großmast, wo er Celine entdeckte, wie sie gerade von der Takelage sprang und zum Ende des Holms lief – nein, rannte. Er schluckte den Kloß im Hals und den Drang zu schreien herunter und erinnerte sich daran, dass er in diesem Alter zwischen galoppierenden Pferden herumgehüpft war. Mit zusammengekniffenen Augen beobachtete er, wie sie geschickt einen Knoten löste, eines der Segel etwas lockerte, es dann wieder festband und in die Takelage zurückkehrte, wo drei Matrosen ihr stolz zujubelten. Er musste zugeben, dass sie in den letzten zwei Wochen erstaunlich gut mit der Takelage, den Segeln und den Knoten auf dem Schiff zurechtgekommen war.
Er hatte nicht vor, ihr von dem Gespräch zu erzählen, das er mit dem Ersten Offizier geführt hatte, um sicherzustellen, dass die Matrosen nichts von ihr verlangten, was über ihre Größe oder Kraft hinausging.
Styke richtete seinen Blick wieder auf sein Messer, zog es noch ein paarmal über den Schleifstein und versuchte, nicht nach Steuerbord zu schauen, wo die felsige, zypressenbewachsene Küste von Dynize den Horizont beherrschte. Ihr Anblick würde ihn nur frustrieren: Sie war so nah, dass er sie fast berühren konnte, und doch war er seinem Ziel nicht näher gekommen.
Vor vier Tagen, gerade als sie sich Dynize genähert hatten, hatte ein gewaltiger Sturm seine Flotte auseinandergetrieben. Dutzende von Transportschiffen und ihre schwer bewaffnete Eskorte waren in den Sturm geraten. Als er sich schließlich gelegt hatte, war die Seaward ganz allein gewesen und ein paar Hundert Meilen nördlich ihres Treffpunkts an der Küste von Dynize. Styke konnte nicht wissen, wie viele Schiffe verloren gegangen waren oder wie stark sie verstreut waren. Er wusste nicht, ob die Hälfte seiner Ulanen ertrunken oder an der Küste zerschmettert worden war, oder ob seine gesamte Armee von zweitausendfünfhundert Reitern bereits gelandet war und ungeduldig auf seine Ankunft wartete.
Unabhängig davon segelte die Seaward mit hoher Geschwindigkeit nach Süden, in der Hoffnung, die verlorene Zeit wieder aufzuholen und keinen Kriegsschiffen der Dynize über den Weg zu laufen.
Ein Schrei lenkte seine Aufmerksamkeit zurück auf den Hauptmast, wo ein Junge im Krähennest verzweifelt in Richtung Heck winkte. Plötzlich gab es einen Aufruhr, und die Matrosen schickten Celine die Takelage hinunter, ihr Spaß war plötzlich durch einen Anflug von Ernsthaftigkeit ersetzt. Der Wachmann rief noch einmal und deutete auf den südlichen Horizont, aber das Geräusch ging im Wind unter.
Styke legte Messer und Wetzstein weg, stand widerwillig auf und ging über das Vorschiff, auf das Hauptdeck hinunter und hinauf zum Hinterschiff, wo Captain Bonnie nachdenklich durch ihr Fernrohr nach Südosten blickte. Bonnie war ein alter Seebär; ein Stück Schuhleder in einer zerschlissenen Hose und einem Dreispitz, ihre Haut war so dunkel von der Sonne, dass sie auch Deliv hätte sein können. Er stellte sich neben sie und wartete auf ihren Bericht. Bald stießen auch Schakal und Celine zu ihnen. Der Palo-Ulan strich Celine durch die Haare und bekam dafür einen Stoß in die Rippen, dann nickte er Styke ernst zu.
»Hast du etwas Neues von deinen Geistern herausgefunden?«, fragte Styke gerade laut genug, um über den Wind von ihm gehört zu werden.
»Nein«, meldete Schakal und blickte hinunter zur Kajüte des Ersten Maats unter ihnen, wo Ka-poel sich ausruhte. »Sie wollen immer noch nicht in die Nähe des Schiffes kommen, nicht, solange sie hier rumhängt. Gestern hätte ich fast einen zu mir gelockt – die Geister der Dynize-Matrosen sind so nah am Ufer, und sie scheinen weniger Angst vor ihr zu haben, aber …« Er brach mit einem Schulterzucken ab.
Styke öffnete den Mund, um zu antworten, wurde aber von Bonnie unterbrochen. »Hier«, sagte sie und drückte ihm das Fernrohr in die Hand. »Direkt südöstlich vor uns siehst du einen Punkt am Horizont.«
Er setzte das Fernrohr an sein Auge. Es dauerte nicht lange, bis er den Punkt fand, von dem sie sprach. Eigentlich waren es drei Punkte, drei Segel, alle schwarz mit einem Bogen aus roten Sternen in der Mitte. »Dynize-Schiffe«, sagte er.
»Sehr scharfsinnig«, antwortete Bonnie mit einem Schnauben. »Hast du eine Ahnung, was das ist?« Er warf ihr einen ausdruckslosen Blick zu, bis sie sich räusperte und fortfuhr. »Zwei Fregatten, die eines dieser großen Ungetüme eskortieren, die die Dynize Linienschiff nennen. Trios wie diese suchen das Meer ab, seit die Dynize eingefallen sind. Wir nennen sie die dreiköpfige Schlange.«
»Haben sie uns gesehen?«
»Sie haben viel höhere Masten als die Seaward, also wäre ich schockiert, wenn sie uns nicht gesehen hätten – und wenn nicht, werden sie es jeden Moment tun.«
Styke spürte, wie sich sein Magen zusammenzog, als er über ihre Möglichkeiten nachdachte. Ihr kleines Transportschiff war kaum bewaffnet. Er hatte es nicht wegen seiner Größe oder Stärke für sein eigenes Schiff ausgewählt, sondern weil Bonnie der erfahrenste Captain der requirierten Flotte war und das Ufer von Dynize besser kannte als jeder andere. »Scheiße«, sagte er.
»Da sagst du was.« Sie hielt das Fernrohr noch ein paar Augenblicke lang an ihr Auge. »Sie sind bereits auf dem Weg in diese Richtung.« Sie hielt inne und runzelte die Stirn. »Ah. Die Fregatten beginnen, auszuschwärmen. Sie haben uns definitiv gesehen und bereiten sich bereits darauf vor, ein weites Netz zu ziehen. Wahrscheinlich hoffen sie, weit auf unserer Backbordseite zu sein, bevor wir sie bemerken.« Sie drehte sich halb zum Ersten Offizier um und bellte laut: »Hart auf Steuerbord!«
Die Matrosen eilten los, um die Segel zu raffen, und es entstand ein hektisches Durcheinander. Styke spürte eine wachsende Unruhe. »Wenden wir?«, fragte er.
»Ja, wir wenden«, antwortete Bonnie säuerlich. »Und versuch nicht, mir mit dem Messer vor der Nase herumzufuchteln, denn das wird nichts bringen. Du magst der Wilde Ben Styke sein, aber ich bin die Völlig Zurechnungsfähige Bonnie. Ich kann diese Fregatten ohne Probleme abhängen, aber wenn ich versuche, an ihnen vorbeizukommen, verarbeiten sie uns zu Treibholz.«
Styke fragte sich, ob sie diese Rede für genau so eine Gelegenheit geprobt hatte. Er blickte nach Süden und stellte in seinem Kopf Berechnungen an.
»Und dein Plan ist …?«
»Mein Plan ist, nach Norden zu fliehen, bis sie uns nicht mehr sehen können. Dann drehen wir weit, weit nach Osten ab und kehren zum Treffpunkt zurück. Mit etwas Glück nehmen sie an, dass sie uns verjagt haben, und patrouillieren weiter an der Küste.«
»Und wie lange wird das dauern?«
Bonnie zuckte mit den Schultern. »Das kommt auf den Wind und das Wetter an und darauf, ob wir auf weitere Patrouillen stoßen. Fünfzehn Tage? Zehn, wenn wir Glück haben. Wenn nicht, zwanzig oder dreißig oder mehr. Vielleicht müssen wir sogar in Starlight neue Vorräte besorgen.«
Styke biss die Zähne zusammen und warf Schakal einen langen Blick zu. Noch zwanzig Tage, bis sie wieder auf Ibana und die anderen trafen. Zwanzig Tage hinter dem Zeitplan. Was für eine gottverdammte Katastrophe. Er überlegte kurz, wie schlecht es wäre, wenn er Bonnie tatsächlich mit seinem Messer unter der Nase herumfuchteln würde. Er mochte zwar einen Ruf haben, aber ihre Matrosen waren seinen Ulanen drei zu eins überlegen, und er brauchte diese Matrosen, um sie an Land zu bringen. Das Letzte, was er gebrauchen konnte, war, eine Meuterei gegen seine Befehlsgewalt auszulösen.
Das Schiff knarrte, als es wendete und die Dynize-Schiffe hinter sich und das Ufer an der Backbordseite ließ. Die Matrosen riefen und liefen herum und schafften das Manöver in beeindruckend kurzer Zeit.
Stykes Gedanken sprangen zu den alten Karten in Bonnies Kabine. Es waren die aktuellsten Karten von Dynize, was bedeutete, dass die Küstenlinien alle korrekt waren, aber das Landesinnere hatte seit über hundert Jahren niemand mehr gesehen. Das sollte aber keinen Unterschied machen, nicht für seine Zwecke. »Such uns einen Platz zum Anlegen«, sagte er.
»Wie bitte?« Bonnie drehte den Kopf ruckartig zu ihm, ihr Gesicht war ungläubig.
»Du hast mich verstanden. Bring uns so nah wie möglich an die Küste und wirf Anker. Ich will, dass du deine beiden Kräne aufstellst und meine Pferde ins Meer setzt. Gib uns drei Langboote und all unsere Vorräte, dann kannst du nach Herzenslust vor den Fregatten abhauen und direkt zurück nach Starlight fahren.«
»Du bist wahnsinnig.«
Styke tippte auf sein Messer. »Finde uns einen Strand, an dem ich mit fünfundzwanzig Pferden an Land schwimmen kann, ohne dass sie alle umkommen.«
»Brauchst du uns nicht, um zurück nach Fatrasta zu kommen?«
»Nicht, wenn ich den Rest der Flotte treffen kann.«
»Und das willst du auf dem Landweg machen?«
Styke grinste sie an.
Zögernd blickte Bonnie zum Ufer und stieß einen müden Seufzer aus. »Ich denke, wir könnten in der Nähe eines Ortes sein. Ich werde den Befehl geben. Sag deinen Männern, sie sollen in einer Stunde bereit sein. Das wird die schnellste Landung, die ihr je erlebt habt.« Bonnie entfernte sich und bellte Befehle, während Styke sich wieder an Schakal wandte.
»Bist du sicher, dass das eine gute Idee ist?«, fragte Schakal.
»Nicht im Geringsten«, antwortete Styke. »Aber ich würde lieber hundert Meilen durch die sumpfige Wildnis stapfen, als weitere drei Wochen auf diesem verdammten Schiff zu sitzen, während Ibana Däumchen dreht.«
»Und wenn Ibana es nicht bis zum Treffpunkt geschafft hat?«
»Dann wird das hier die kleinste Invasion aller Zeiten.« Styke kniete sich hin und legte seinen Arm um Celine. »Wie gut erinnerst du dich an den ganzen Scheiß, den dir dein Vater beigebracht hat?«
Celine warf ihm einen misstrauischen Blick zu. »Ich dachte, du hättest gesagt, dass ich nie wieder stehlen muss.«
»Willst du das nicht?«
»Das habe ich nicht gesagt.«
»Gut. Denn ich brauche dich, um alle Karten von Dynize zu stehlen, die Bonnie hat.«
Celine runzelte die Stirn. »Wenn sie mich erwischt, wirft sie mich über die Reling.«
»Wir sind dabei, etwas wirklich Dummes zu tun, und diese Karten sind die einzige Möglichkeit, das zu erreichen. Außerdem gehen wir sowieso alle von Bord.«
Celine überlegte einen Moment und schenkte ihm dann ein verruchtes Grinsen, von dem er schwor, dass sie es sich von Ka-poel abgeschaut hatte. »Okay, ich werde es tun. Aber erst, wenn wir bereit sind, in die Langboote zu springen. Das ist der beste Weg, um sich aus dem Staub zu machen.«
»Kluges Mädchen. Jetzt geh und weck Ka-poel auf. Sag ihr, dass sie zu Hause ist.«
Styke stand auf einem Felsvorsprung und beobachtete, wie die Seaward um eine nahe gelegene Bucht verschwand und mit vollen Segeln nach Norden fuhr, gerade außerhalb der Schussweite der beiden verfolgenden Fregatten der Dynize.
Es würde knapp werden, aber Captain Bonnie war zuversichtlich, dass sie immer noch eine saubere Flucht hinlegen konnte. Die Dynize-Fregatte feuerte einen einzigen Schuss aus einer kleinen Bugkanone ab, aber Styke sah, wie dieser weit vor dem Ziel ins Meer platschte. Er wartete, bis die Seaward außer Sichtweite war, kletterte von seinem Vorsprung hinunter und machte sich auf den Weg zur Flussmündung, wo seine Männer die Langboote entluden.
»Bericht«, sagte er zu Schakal, hüpfte mit einem Platschen ins Wasser und beäugte einen langschnäuzigen Sumpfdrachen, der ein Stück flussaufwärts halb untergetaucht lungerte.
»Alle haben es sicher an Land geschafft«, antwortete Schakal. Er saugte vorsichtig an seinen Zähnen. »Eines der Ersatzpferde hat sich bei der Umrundung des Riffs ein Bein gebrochen. Ich musste es erschießen lassen.«
»Nur das eine?« Styke hatte die Schreie des Tieres und den Schuss gehört, der es von seinem Elend erlöst hatte.
»Nur das eine«, bestätigte Schakal.
»Das ist besser, als ich erwartet habe.« Er stöhnte innerlich auf. Sie hatten fünf Ersatzpferde und mehr als hundert Meilen Wildnis zu durchqueren. Angesichts des schwierigen Geländes, der Sumpfdrachen, der großen Schlangen und was auch immer sonst ihnen dieser verfluchte Kontinent entgegensetzen würde, rechnete er damit, dass sie noch viel mehr verlieren würden, bevor sie Ibana treffen konnten. Aber es war ein gutes Gefühl, wieder festen Boden unter den Füßen zu haben. Wenigstens hatte er sein Schicksal wieder selbst in der Hand. »Haben alle ihre Rüstung?«
»Ja, haben sie. Markus hat Amrec beladen. Sunin hilft Celine, Margo zu satteln.«
»Sind die Sättel trocken geblieben?« Ein Nicken. »Sunin hat ihren Karabiner fallen lassen. Ich musste ihr einen der Ersatzkarabiner geben.«
Styke verdrehte die Augen. »Warum ist sie so alt?«
»Ich glaube …«
»Das war eine rhetorische Frage.« Er schaute sich um, bis er Ka-poel und Celine am gegenüberliegenden Ufer der Bucht sitzen sah, und watete zu ihnen hinüber. Selbst nach zwei Wochen Ruhezeit sah Ka-poel mager und erschöpft aus, aber ihre Augen waren wach. Sie zeigte eine Reihe von Zeichen, von denen Styke die meisten verstand. Er ließ Celine trotzdem übersetzen.
Das sieht aus wie das Tristanmoor.
»Nicht wahr?« Styke spürte, wie ihm etwas in den Mund flog, und spuckte es schnell wieder aus. »Dieselben beschissenen Bäume und Käfer und Schlangen und …« Er brach ab, als er die Augen eines anderen Sumpfdrachen entdeckte, der sie fünfzehn Meter flussaufwärts beobachtete. »Die Sumpfdrachen sehen aber ein bisschen anders aus. Halte die Augen nach ihnen offen. Einige der Größeren zögern nicht, nach einem Menschen zu schnappen, und fallen vielleicht sogar über ein Pferd her.«
Ka-poel rollte mit den Augen. Ich weiß, übersetzte Celine die nächste Geste.
»Stimmt ja. Du bist in diesem Drecksloch aufgewachsen, nicht wahr?« Styke warf einen Blick auf das umliegende Terrain. Trotz der Ähnlichkeiten war es ganz anders als das Tristanmoor drüben in Fatrasta. Während das Moor sehr flach war und eine dichte, fast unpassierbare Flora aufwies, war dieser Sumpf mit Felsen übersät, die von kaum meterhohen Felsbrocken bis hin zu gewaltigen Felssäulen reichten, die die mächtigen Zypressen überragten. Sie hatten ihre Reise ins Landesinnere noch nicht einmal begonnen, aber er konnte schon sagen, dass die Flüsse tiefer, die Ebenen unberechenbar und das Gelände für Pferde schwierig sein würde. »Haltet einfach Ausschau nach Sumpfdrachen«, wiederholte er, bevor er sich umdrehte und zu den Langbooten watete.
Er räusperte sich laut und forderte die Männer auf, sich zu versammeln. Er warf ihnen einen langen, strengen Blick zu, als sie ihre Pferde sicherten, die Ausrüstung beiseitelegten und sich zu ihm gesellten. Er atmete tief durch. Zwanzig Männer. Über hundert Meilen unvorhersehbarer Sumpf. Das würde furchtbar werden.
»Also gut, hier ist der Plan. Einige von euch haben es vielleicht schon gehört – wir sind hier gelandet, weil unsere Alternative wäre, mit Captain Bonnie den ganzen Weg zurück nach Neu-Starlight zu fahren und von dort aus zu versuchen, sich mit Ibana zu treffen.« Er gestikulierte zu Celine. »Bring mir die Karten«, und sprach dann weiter zu den Ulanen: »Dadurch, dass wir hier gelandet sind, haben wir die Chance, das Landesinnere verdammt viel schneller zu durchqueren als in drei Wochen.«
Jemand hustete.
»Wer war das?«, fragte Styke. »Zak? Hast du was zu sagen?«
Zak hustete wieder und schaute sich verlegen um. Der Späher versuchte, von seinem Bruder irgendeine Unterstützung zu bekommen, aber Markus schüttelte nur den Kopf. »Äh, Ben«, sagte Zak schließlich. »Sieht die ganze Wildnis so aus?«
»Soweit ich weiß, ja.«
»Dann werden wir die hundert Meilen auf keinen verdammten Fall schneller als in zwanzig Tagen schaffen, nicht in diesem Gelände.«
Styke nahm das gewachste lederne Kartenrohr, das Celine von Captain Bonnie gestohlen hatte, öffnete den Deckel und wühlte sich durch die Karten, bis er die fand, die er suchte. Er breitete sie vorsichtig auf dem Rand des Langbootes aus, und alle drängten sich um ihn herum. Es war eine Karte von einer Region im Nordosten von Dynize, dem Zerklüfteten Moor. »Wir sind hier«, sagte er und deutete auf eine unscheinbare kleine Bucht. »Der Treffpunkt ist hier.« Er tippte auf eine andere Stelle. Auf der Karte schien die Entfernung unbedeutend, aber Zak hatte recht: Unter diesen geografischen Bedingungen wäre es unmöglich. »Seht ihr das?«
Ein paar der Männer beugten sich vor und schielten auf das Papier. »Ist das eine Straße?« fragte Markus.
»Das ist eine Küstenstraße, die durch das Moor führt.«
»Diese Karte ist ein Jahrhundert alt«, sagte Schakal leise. »Ist die Straße überhaupt noch da?«
Besser wäre das, dachte Styke. An Bord der Seaward hatte dieser Plan in seinem Kopf weniger verrückt geklungen. Laut sagte er: »Ich wüsste nicht, warum nicht. Wir sind nur ein paar Meilen weiter östlich. Ich denke, wir können es bis zum Morgen dorthin schaffen. Sobald wir auf festem Boden sind, können wir schnell reiten, um den Rest der Ulanen zu treffen. Zwischen uns und ihnen liegen eine Handvoll kleiner Städte. Im schlimmsten Fall ziehen wir unsere Rüstung an und reiten durch.«
Die kleine Gruppe murmelte nachdenklich vor sich hin, und er sah, wie sich die Idee durchsetzte. Er selbst war nicht so überzeugt. Er begann sogar zu glauben, dass dies eine seiner dümmeren Ideen sein könnte. Aber das Wichtigste war, den Ulanen ein Ziel zu geben und sie in Bewegung zu setzen. Um Komplikationen konnte er sich kümmern, sobald sie auftauchten.
Styke rollte die Karte wieder ein und gab Celine das Kartenrohr zurück. »Pass gut darauf auf«, sagte er ihr. »Und der Rest von euch macht die Inventur fertig und sattelt eure Pferde, damit wir losreiten können. Ich will so schnell wie möglich von der Küste weg sein.«
Die Gruppe machte sich an die Arbeit, und Styke ging los, um Amrec zu begutachten, bevor er sich vergewisserte, dass die Pferde von Celine und Ka-poel fit und reitbereit waren. Es verging weniger als eine halbe Stunde, bis er sehen konnte, dass die Soldaten abmarschbereit waren. Er wies sie an, die Langboote weiter flussaufwärts zu ziehen, und drehte sich um, als er eine Stimme hörte, die seinen Namen rief. Es war Celine, die auf dem Aussichtspunkt stand, von dem aus er die Seaward beim Wegfahren beobachtet hatte.
Styke kletterte zu ihr hinauf und sah sofort, was das Problem war. Nicht weit vom Ufer entfernt, genau dort, wo die Seaward sie abgesetzt hatte, hatte das große Linienschiff der Dynize angelandet und seinen Anker geworfen. Auf dem riesigen Deck wimmelte es von Matrosen und Soldaten, die sich reihenweise in die Langboote stürzten. Das erste Boot fiel ins Wasser, während Styke zusah. Dann das zweite, dann das dritte.
Er hatte erwartet, dass eine der Fregatten einen kleinen Landungstrupp schicken würde, um zu sehen, was sie vorhatten. Aber dieses große Linienschiff schickte mindestens sechzig Marineinfanteristen. Zu viele, um sie in einem einzigen, heftigen Hinterhalt zu erledigen, und wahrscheinlich besser ausgebildet als normale Seeleute. Die Wilden Ulanen mussten sofort von dieser Küste verschwinden.
»Ist das schlimm?«, fragte Celine.
Styke schob sie sanft zu den wartenden Ulanen. »Ja«, sagte er. »Das ist sehr schlimm.«
KAPITEL 3
Vlora stand mit dem Rücken zum Eingang ihres Zeltes und blätterte abwesend in einem alten Tagebuch, das sie vor wenigen Momenten vom Boden ihrer Reisetasche geholt hatte. Früher war es mit einem ziemlich kunstvollen Schloss verziert gewesen, aber das hatte sich durch die Stöße und Erschütterungen von zehntausend Meilen langen Reisen gelöst. Der schwarze Ledereinband war stark abgenutzt, die Seiten vergilbt vom Alter und von der Feuchtigkeit, und in der Mitte des Einbands war der aufgenähte Adronische Tropfen kaum noch zu erkennen.
Es war Tamas’ Tagebuch, ein Sammelsurium von Notizen und Erinnerungen aus fast zwei Jahrzehnten. Die Seiten waren gefüllt mit alten Briefen an und von seiner längst verstorbenen Frau. Vlora ging behutsam mit den Seiten um und warf einen Blick auf einige der Daten und Briefe, von denen die meisten vor ihrer Geburt geschrieben worden waren.
Jemand räusperte sich hinter ihr, als sie ihr Zelt durchquerte, um das Tagebuch auf ihrem Feldbett abzulegen, und als sie sich umdrehte, sah sie die kleine Gruppe, die sich auf ihre Bitte hin versammelt hatte. Jede Bewegung tat ihr weh, und sie ging mit sich selbst fast so behutsam um wie mit dem Tagebuch, um nicht zu zeigen, wie sehr ihr Körper durch den Fleischwolf gedreht worden war. Sie lachte fast über die Anstrengung. Hier war sie mit ihren engsten Freunden und vertrauten Gefährten, und sie wollte ihnen ihren Schmerz nicht zeigen. Nun, das spielte keine Rolle. Sie würden noch früh genug etwas davon mitbekommen.
Borbador saß mit überschlagenen Beinen auf einem Hocker in der Ecke des Zeltes und trommelte mit den Fingern auf sein falsches Bein, während er lässig an einer obszön großen Pfeife paffte, die er mit einer Hand stützen musste, um sie im Mund zu behalten. Sein Gesicht war ausdruckslos, aber seine Augen hatten diesen nachdenklichen, amüsierten Ausdruck, als hätte er sich gerade an etwas Lustiges erinnert. Seit Vlora ihn das letzte Mal gesehen hatte, hatte er seinen rötlichen Bart sprießen lassen, und sie beschloss, dass es gut an ihm aussah.
Die Privilegierte Nila stand hinter Bo an seine Schulter gelehnt, spielte mit einer Strähne seines Haares und schaute etwas verärgert drein. Ihr Haar war über beiden Schultern eng geflochten, und sie trug eines der karmesinroten Kleider, die sie so sehr mochte. Plötzlich sah sie auf und begegnete Vloras Blick, woraufhin Vlora ihren eigenen Blick abwandte.
Der Rest der Gruppe bestand aus Vloras drei Pulvermagiern: dem dunkelhaarigen Davd, der routinierten Norrine und dem ruhigen Kez, dem Ex-Adligen Buden je Parst. Vlora stellte fest, dass es Bo gewesen war, der sich geräuspert hatte, und ließ ihren Blick einen langen Moment auf ihm ruhen, bevor sie ihn wieder zu den anderen schweifen ließ.
»Deine Genesung scheint gut voranzugehen«, bemerkte Nila, bevor Vlora etwas sagen konnte.
»Du siehst … besser aus«, ergänzte Davd.
Norrine sah von der Reinigung ihrer Pistole auf. »Wir haben uns Sorgen um dich gemacht.«
Vlora winkte die Ermutigung ab und verkniff sich, das Gesicht zu verziehen, als sie ein Stechen in ihrem Arm spürte. Sie sah aus wie eine verdammte Flickenpuppe. Ihr ganzer Körper war mit Narben übersät von der Schlacht an der Furche vor über fünf Wochen. Einige von ihnen, die kleineren, heilten zügig. Der Rest … nicht so gut. Weder Bo noch Nila waren auf heilende Magie spezialisiert, obwohl sie sie beide gründlich studiert hatten. Sie hatten vier Tage gebraucht, um Vlora vor dem Tod zu bewahren, und weitere fünf, bis sie transportiert werden konnte, während die Armee marschierte. Dann war noch einmal eine ganze Woche vergangen, bis Vlora wieder von alleine hatte laufen können.
Heute war der erste Tag, an dem sie ihre Pulvermagier zur Besprechung einbestellt hatte; der erste Tag, an dem sie etwas anderes tat, als Marschbefehle zu erteilen, in einer überdachten Trage mitzureiten oder in der feuchten Hitze ihres Zeltes zu schmoren. Sie schluckte die Galle hinunter und ballte die Fäuste hinter dem Rücken.
»Danke für die netten Worte«, sagte sie leise. »Aber ich habe etwas Wichtiges mit euch fünf zu besprechen. Bo weiß es bereits.«
Nila blickte scharf auf und dann mit einer hochgezogenen Augenbraue zu Bo hinunter. »Was denn?«
Vlora schaute in die Runde, schluckte erneut, räusperte sich und stellte fest, dass sie nicht in der Lage war, das auszusprechen, was sie seit der Sekunde, in der sie wieder zu Bewusstsein gekommen war, verfolgte. Sie hustete, versuchte, ihren Untergebenen in die Augen zu blicken, und scheiterte. Nach ein paar Augenblicken zwang sie sich, Norrine anzusehen – schließlich war sie die erfahrenste ihrer Magierinnen. Sie würde die meiste Arbeit übernehmen müssen.
»Sie kann ihre Magie nicht mehr benutzen«, verkündete Bo. Vlora warf ihm einen bösen Blick zu, aber er fuhr fort. »Die Anstrengung an der Furche hat sie ausgebrannt, sie ist pulverblind.«
Alle drei von Vloras Magiern starrten sie an. An ihrer Miene konnte sie erkennen, dass Norrine nicht überrascht war – sie hatte es wohl erwartet, nachdem sie das Gemetzel gesehen hatte –, aber die beiden anderen waren eindeutig überrumpelt. Davd machte einen Schritt zurück und blinzelte ungläubig. Buden runzelte die Stirn. Bevor sie Fragen stellen konnten, machte Vlora dort weiter, wo Bo aufgehört hatte.
»Es könnte dauerhaft sein, muss es aber nicht.« Wem wollte sie etwas vormachen? Es war möglich, sich von der Pulverblindheit zu erholen, aber es brauchte Zeit. »Ihr alle kennt die Geschichten und die Aufzeichnungen, die Tamas über seine Schüler gemacht hat.« Sie hielt inne, blinzelte ein paar Tränen weg und atmete tief durch. »Das Wichtigste ist jetzt, dass wir so weitermachen wie bisher. Niemand außerhalb dieses Zeltes darf davon erfahren. Habt ihr das verstanden?«
Stumpfes Nicken.
»Das gilt auch für euch beide«, sagte Vlora zu Bo und Nila.
»Ach, komm schon«, protestierte Bo.
»Du bist schon eine kleine Tratschtante, Schatz«, sagte Nila bedächtig zu Bo und musterte Vlora dann mit einer Intensität, die Vlora nicht gefiel. »Natürlich«, sagte Nila. »Wir werden kein Wort sagen.«
»Ja, ja«, stimmte Bo zu. Er schaute auf seine Pfeife, klopfte sie dann gegen sein falsches Bein und verstaute sie in seiner Jackentasche. »Seit du aufgewacht bist, lässt du uns nach Süden marschieren. Ich nehme an, das heißt, du hast ein Ziel und einen Plan, was wir als Nächstes tun sollen?«
Direkt weiter mit der nächsten Sache. Das war typisch Bo, und Vlora war dankbar dafür. Sie hatte keinen Zweifel daran, dass sie von jetzt an bis zu ihrem Tod jede freie Minute dem Verlust ihrer Magie nachhängen würde. Im Moment war jede Ablenkung willkommen. »Natürlich. Dank euch habe ich das Kommando über die größte Armee des Kontinents. Ich habe vor, sie nach Landfall zu führen, wo wir den Dynize ihren Götterstein abnehmen und ihn zerstören werden.«
Norrine nickte zustimmend, als hätte sie genau das erwartet. Die anderen beiden Pulvermagier schienen immer noch zu geschockt zu sein, um zu antworten. Bo hob seine Hand wie ein Schulkind.
»Ja?«, fragte Vlora.
»Ich habe dir eine sehr schöne Armee übergeben, aber sie ist immer noch die mit Abstand kleinste Streitmacht. Die Dynize und die Fatrastaner sind uns zahlenmäßig mindestens fünf zu eins überlegen. Die Dynize wollen dich töten. Die Fatrastaner wollen dich festnehmen. Willst du gegen sie beide kämpfen?«
»Wenn es nötig ist.«
»Was soll das denn heißen?«, fragte Bo.
Vlora war sich selbst nicht ganz sicher. Die Dynize waren im Moment der Feind Nummer eins – sie waren gefährlich nah dran gewesen, sie und ihre Söldnerkompanie zu töten. Aber Fatrasta? Lindets Verrat in Landfall saß noch immer tief. Vlora wollte – konnte – den Fatrastanern nicht trauen. Sie befand sich also auf einem fremden Kontinent, auf dem es vor feindlichen Armeen nur so wimmelte.
»Das bedeutet, dass die Zerstörung des Göttersteins unser einziges Ziel ist. Um dieses Ziel zu erreichen, nehmen wir es mit jedem auf, mit dem wir es aufnehmen müssen.«
Bo tauschte einen Blick mit Nila. Nach einigen Sekunden, die für Vloras Geschmack zu lang waren, sagte er: »Na gut.«