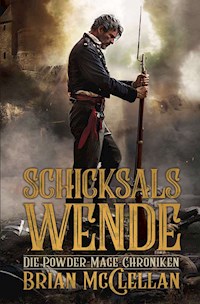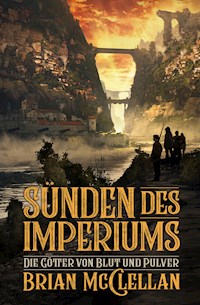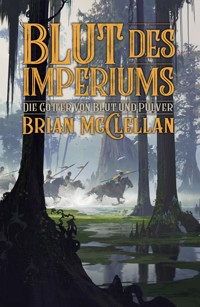Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Cross Cult
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Im zweiten Buch von Brian McClellans epischer Fantasy-Geschichte über Magie und Schießpulver liefern sich beide Seiten ein Rennen, um das eine Ding zu finden, das das Blatt zu ihren Gunsten wenden könnte – einen Stein, der die Macht hat, Menschen in Götter zu verwandeln. Das Land befindet sich in Aufruhr. Die Hauptstadt ist besetzt, und eine halbe Million Flüchtlinge, begleitet von Lady Flints Soldaten, sind unterwegs, um an der Grenze Schutz zu suchen. Aber es ist nie leicht, dem Krieg zu entkommen, und schon bald könnte die Schlacht sie finden, ob sie darauf vorbereitet sind oder nicht. In der Hauptstadt schmuggelt Michel Bravis noch mehr Flüchtlinge aus der Stadt. Doch interne Kräfte arbeiten gegen ihn. Von Feinden umgeben könnte Michel gezwungen sein, sich Hilfe bei den Besatzern zu suchen, die er zu untergraben versucht. Währenddessen baut Ben Styke seine eigene Armee auf. Er und seine verrückten Lanzenreiter versammeln jeden fähigen Mann, den sie finden können, und suchen nach einem uralten Artefakt, das die Macht haben könnte, das Blatt des Krieges zu ihren Gunsten zu wenden. Aber was sie finden, ist vielleicht nicht das, wonach sie suchen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 994
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ins Deutsche übersetzt vonJohannes Neubert
Die deutsche Ausgabe von
DIE GÖTTER VON BLUT UND PULVER: ZORN DES IMPERIUMS
wird herausgegeben von Cross Cult, Teinacher Straße 72, 71634 Ludwigsburg.
Herausgeber: Andreas Mergenthaler, Übersetzung: Johannes Neubert; verantwortlicher Redakteur und Lektorat: Markus Rohde; Lektorat: André Piotrowski; Korrektorat: Peter Schild; Satz: Rowan Rüster; Cover-Illustration: Thom Tenery; Karten und Symbole: Isaac Stewart; Printausgabe gedruckt von CPI Moravia Books s.r.o., CZ-69123 Pohořelice. Printed in the EU.
Titel der Originalausgabe:
GODS OF BLOOD AND POWDER: WRATH OF EMPIRE
Copyright © All material contained within copyright © Brian McClellan, 2017. All rights reserved.
Published by Arrangement with Brian McClellan
German translation copyright © 2022, by Cross Cult.
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover.
Print ISBN 978-3-96658-911-6 (Oktober 2022)
E-Book ISBN 978-3-96658-912-3 (Oktober 2022)
WWW.CROSS-CULT.DE
Für Zina Petersen und Grant »The Boz« Boswell,meine beiden Lieblingsprofessoren am College,die es beide geschafft haben, stressfreie,aber interessante Kurse zu geben über Themen,die mich zehn Jahre später immer noch beschäftigen.
INHALT
PROLOG
KAPITEL 1
KAPITEL 2
KAPITEL 3
KAPITEL 4
KAPITEL 5
KAPITEL 6
KAPITEL 7
KAPITEL 8
KAPITEL 9
KAPITEL 10
KAPITEL 11
KAPITEL 12
KAPITEL 13
KAPITEL 14
KAPITEL 15
KAPITEL 16
KAPITEL 17
KAPITEL 18
KAPITEL 19
KAPITEL 20
KAPITEL 21
KAPITEL 22
KAPITEL 23
KAPITEL 24
KAPITEL 25
KAPITEL 26
KAPITEL 27
KAPITEL 28
KAPITEL 29
KAPITEL 30
KAPITEL 31
KAPITEL 32
KAPITEL 33
KAPITEL 34
KAPITEL 35
KAPITEL 36
KAPITEL 37
KAPITEL 38
KAPITEL 39
KAPITEL 40
KAPITEL 41
KAPITEL 42
KAPITEL 43
KAPITEL 44
KAPITEL 45
KAPITEL 46
KAPITEL 47
KAPITEL 48
KAPITEL 49
KAPITEL 50
KAPITEL 51
KAPITEL 52
KAPITEL 53
KAPITEL 54
KAPITEL 55
KAPITEL 56
KAPITEL 57
KAPITEL 58
KAPITEL 59
KAPITEL 60
KAPITEL 61
KAPITEL 62
KAPITEL 63
KAPITEL 64
KAPITEL 65
KAPITEL 66
KAPITEL 67
KAPITEL 68
KAPITEL 69
EPILOG
DANKSAGUNGEN
PROLOG
Orz stand unten an der schmalen Treppe und neigte seinen Kopf nach oben zu dem Licht, das durch die offene Luke über ihm hereinschien. Er konnte Möwen über ihm schreien hören und das sanfte Wogen des Schiffes spüren, das im Hafen lag. Beides war in den letzten paar Monaten allgegenwärtig geworden.
»Na los«, sagte eine Stimme.
Orz warf einen Blick über die Schulter zu dem Soldaten mit dem Morion auf dem Kopf, der direkt hinter ihm stand. Der Soldat hatte eine kurze Pike in der Hand, eine Zeremonienwaffe, die manche Leibwächter der Knochenaugen trugen. Orz fragte sich, wo sie waren – in welchem Hafen das schwimmende Gefängnis diesmal angelegt hatte. Und noch mehr fragte er sich, welches Knochenauge diesmal gekommen war, um ihn zu begaffen.
Knochenaugen waren Privilegierten nicht unähnlich; ihre gewaltige Macht lebte in zerbrechlichen, menschlichen Körpern, die sich genauso leicht zerschmettern ließen wie eine Porzellanvase. Knochenaugen konnten sterben. Dieser Leibwächter konnte sterben. Orz stellte sich vor, wie er sich durch das Schiff schlich und jeden in seinem Weg ermordete, bevor er an Land schwamm und untertauchte.
»Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit«, sagte der Soldat hinter ihm und drückte Orz die Klinge seiner Pike in den Rücken. »Beweg dich.«
Orz schnaubte und machte vorsichtig den ersten, schwerfälligen Schritt, damit er durch das Gewicht seiner Ketten nicht das Gleichgewicht verlor und rückwärts in die Klinge des Soldaten taumelte. Seine Ketten klirrten mit jeder Stufe und schabten an seiner nackten Haut, und innerhalb weniger Momente trat er zum ersten Mal seit Monaten hinaus ins Tageslicht.
Er blinzelte, damit sich seine Augen an das Licht gewöhnen konnten, aber wurde vor dem Soldaten hergeschoben. Weitere Wachen kamen dazu und bildeten ein Spalier um ihn herum. Sie schoben und schubsten ihn halb blind über das Deck und eine weitere Treppe hinauf zum Vorschiff.
Orz spürte eine Hand auf seiner Schulter und drehte sich ruckartig weg, hin zur Reling, wo er durch das schmerzvolle Licht einen Blick auf eine ihm unbekannte Küste warf. Eine Stadt erhob sich vor ihm, hoch oben auf einer gewaltigen Hochebene voller seltsamer Gebäude. Er spürte, wie ihm der Atem stockte; während der langen, einsamen Reise hatte er gedacht, dass sie ihn in ein neues Gefängnis irgendwo in Dynize bringen würden.
Das hier war nicht Dynize. Diese Stadt, diese Hochebene – er kannte aus den Geschichtsbüchern nur einen Ort wie diesen: Landfall.
Es war ihm nicht vergönnt, länger darüber nachzudenken. Hände griffen nach seinen Ketten und zerrten ihn vorwärts, brachten ihn zum anderen Ende des Vorschiffs, wo er mit einem Tritt in die Knie gezwungen wurde. Er ignoriert den Schmerz, wie es ihm beigebracht worden war, und fiel, ohne ein Geräusch von sich zu geben. Stattdessen erhob er seinen Blick zu dem Knochenauge, von dem er schon erwartet hatte, dass er derjenige war, der nach ihm verlangt hatte.
Orz war dem alten Mann, der mit geradem Rücken auf einem Hocker saß und aus einer winzigen Porzellantasse trank, nie begegnet, aber er kannte die Beschreibungen und seinen Ruf. Ka-sedial war der Cousin zweiten Grades des Kaisers und sein oberster Berater, und die meisten Leute in Dynize wussten, dass er die wahre Macht hinter der Krone war. Er war ein Knochenauge, das auf einer Welle aus Blut an die Macht gekommen war und für sich beanspruchte, den Bürgerkrieg der Dynize beendet zu haben.
Orz war nicht beeindruckt. Als Drachenmann gab es nicht viel, was ihn beeindruckte.
Ka-sedial trank seinen Tee aus und gab seine Tasse einem Diener, dann legte er seine Hände mit den Handflächen nach unten auf seine Knie und starrte hinaus aufs Meer. Orz dachte schon, dass er absichtlich ignoriert wurde, als er einen Tumult hinter sich hörte: Eine weitere Person, die mit ähnlichen Ketten gefesselt war wie Orz, wurde aufs Vorschiff gezerrt und in die Knie gezwungen.
Dann wurde eine weitere Person hochgebracht und dann noch eine weitere, bis sechs Männer und Frauen vor Ka-sedial knieten. Orz musterte seine Mitgefangenen. Er erkannte nur zwei von ihnen, aber alle fünf waren übersät mit tintenschwarzen Tattoos und hatten Körper so hart wie Granit. Sie waren wie er.
Sechs Drachenmänner, alle an einem Ort.
»Was für eine verheißungsvolle Zusammenkunft«, sagte Orz leise.
Endlich drehte Ka-sedial den Kopf und ließ seinen Blick über die Gefangenen schweifen. Als er sprach, war seine Stimme sanft, sodass Orz gezwungen war, genau hinzuhören, um ihn über das Knarren des Schiffs und das Kreischen der Möwen zu verstehen. »Wisst ihr, was ihr alle gemeinsam habt?«
Sie waren alle Drachenmänner, aber Orz vermutete, dass das nicht die Antwort war, nach der Ka-sedial suchte. Orz schaute erst zur einen, dann zur anderen Seite auf seine Mitgefangenen. Die Frau zu seiner Rechten hatte, langes, schmutziges rotes Haar, das den Großteil ihres Gesichts verdeckte, aber er erinnerte sich an die Narbe, die sich über ihr linkes Auge zog. Sie hieß Ji-karnari, und vor sieben Jahren hatte sie einen Knochenaugen-Tempel entweiht aus Gründen, die er nie in Erfahrung bringen konnte. Der Mann zu seiner Rechten, gertenschlank und mit kleiner Statur, hieß Ji-matle. Vor neun Jahren war er der Leibwächter einer Cousine des Kaisers gewesen, mit der er geschlafen hatte.
Niemand sagte etwas, also räusperte sich Orz. »Wir haben alle in den Augen des Kaisers Schande über uns gebracht.«
»Sehr gut.« Ka-sedial stand auf, und Orz konnte nicht anders als darüber zu schmunzeln, wie alt und fragil er aussah. Wenn er nicht in diesen Ketten gewesen wäre, hätte er Ka-sedial wie einen Ast zerbrechen können. Ka-sedial bemerkte sein Schmunzeln und runzelte die Stirn. Er trat an Orz heran. »Sag mir, Ji-orz, was war dein Verbrechen?«
Orz schloss die Augen und dachte an die letzten Jahre, die er in verschiedenen Kerkern verbracht hatte, in denen jede seiner Bewegungen eingeschränkt gewesen und er ständig beobachtet worden war, wie ein kostbarer Hund, der tollwütig geworden war, aber dessen Herren es nicht übers Herz brachten, ihn einzuschläfern. »Ich habe mich bei einer Audienz mit dem Kaiser nicht verbeugt.«
»Und warum hast du dich nicht verbeugt?«
»Weil er nicht mein Kaiser ist.«
Ka-sedial stieß einen fast großväterlichen Seufzer aus und wies mit einer Geste zur Küste und der Stadt auf der Hochebene. »Der Bürgerkrieg ist vorbei. Dein falscher Kaiser ist tot, und die Regierungen beider Seiten haben Frieden geschlossen. Wir haben unsere Kriege nach außen getragen – so wie es sich gehört – und sind nach Fatrasta gekommen, um Land zurückzufordern, das uns einst gehört hat. Wir sind gekommen, um unseren Gott zu finden, und wir sind gemeinsam gekommen. Vereinigt.« Er seufzte erneut und schüttelte den Kopf wie ein enttäuschter Lehrer. Orz spürte, dass es ihn ärgerte, dass nach allem, was er und seinen Mitgefangenen durchgemacht hatten, Ka-sedial sie wie Kinder behandelte.
»Warum sind wir hier?«, fragte Orz.
Ka-sedial schaute zu ihm herunter mit einem Funken von Abscheu in seinen Augen, dann hob er seine Hände in Richtung der gefesselten Drachenmänner. »Ihr alle habt in den Augen des Kaisers Schande über euch gebracht, und eure Stellung als Drachenmänner verbietet es uns, euer Blut zu vergießen. Jeder Einzelne von euch wird ein langes Leben in Finsternis führen, bis ihr verrottet.«
»Oder?«, fragte Orz. Er konnte es jetzt riechen – die Gelegenheit, einen Ausweg angeboten zu bekommen. Er versuchte, sich in Erinnerung zu rufen, was er über Ka-sedial wusste. Der Ka war ein zielstrebiger, getriebener Mann, kalt und kalkulierend, aber hin und wieder gab er sich seiner Wut hin. Er hatte seine Macht aufgebaut, indem er alle, die sich ihm entgegengestellt hatten, vernichtet oder unterworfen hatte. Er war ein Mann, der kein Nein akzeptierte und nicht ruhte, bis seine Feinde ausgelöscht waren.
Als Orz ihn unterbrach, huschte ein Anflug von Verärgerung über Ka-sedials Züge. Er senkte seine Hände. »Oder ihr wascht eure Namen wieder rein. Meine Armeen haben Landfall eingenommen. Fatrasta wird in Kürze folgen. In der Zwischenzeit gibt es eine Aufgabe zu erledigen, und ich kann keinen der Drachenmänner, Privilegierten oder Knochenaugen in meiner Armee erübrigen.«
Die Invasion von Fatrasta war seit fast einem Jahrzehnt geplant, aber Orz war trotzdem überrascht, dass sie tatsächlich stattgefunden hatte – dass der Pakt zwischen den beiden Fraktionen des Bürgerkriegs lange genug gehalten hatte, dass sie stattfinden konnte. Er brauchte mehr Informationen über die Invasion – was für ein Volk sie in Fatrasta vorgefunden hatten, was sie für Waffen und Krieger hatten. Aber dafür würde später Zeit sein, da war er sich sicher.
Ji-karnari, die Frau mit der Narbe neben Orz, hob endlich den Kopf. Orz konnte die Begierde in ihren Augen sehen und konnte nicht anders, als sie dafür zu verurteilen. Drachenmänner sollten ihre Emotionen besser verbergen.
»Um was für eine Aufgabe handelt es sich, Großer Ka?«, fragte Ji-karnari. »Wie können wir unsere Namen reinwaschen?«
Ka-sedial streckte die Hand aus und strich Ji-karnari mit den Fingerspitzen über die Stirn. Sie erzitterte bei der Berührung. »Es gab … Demütigungen bei der Eroberung von Landfall«, sagte er. »Demütigungen der Armee und Demütigungen der Drachenmänner. Ich habe bereits Soldaten ausgesandt, die sich um Ersteres kümmern, aber Letzteres …« Er verstummte und lächelte kalt. »Einer aus eurem Orden – einer der allerbesten Drachenmänner mit dem Namen Ji-kushel – wurde in Landfall von einem gewöhnlichen Soldaten ermordet.«
»Und?«, fragte Orz. Er wurde mutiger. Es gab jetzt einen Ausweg, und Ka-sedial würde ihn ihnen bieten. Aber er traute Ka-sedial nicht, und er würde Fragen stellen. »Viele gewöhnliche Soldaten haben Drachenmänner getötet. In gewaltiger Überzahl oder durch einen Glückstreffer oder …«
»Im Einzelkampf«, unterbrach ihn Ka-sedial.
Orz hörte, wie seine Zähne aufeinanderklapperten, als er schnell den Mund zumachte. Die Härchen in seinem Nacken stellten sich auf. Er hatte Gerüchte über Pulvermagier gehört, Magier, die mithilfe ihrer Magie die Schnelligkeit und Stärke haben könnten, einen Drachenmann zu töten. Aber Ka-sedial hätte es erwähnt, wenn es einer gewesen wäre. Ein gewöhnlicher Soldat, der einen Drachenmann im Einzelkampf tötete? Das war eine Demütigung.
Ka-sedial schaute wieder zum Land, wobei eine seiner Hände zuckte, als würde er ungeduldig. »Ich werde eine solche Demütigung nicht stehen lassen. Dieser Soldat ist ein alter Krieger, und wenn er genug Zeit erhält, wird er möglicherweise ein Gefolge anlocken. Möglicherweise wird er noch gefährlicher werden, als er jetzt schon ist. Ich befreie euch. Alle sechs von euch. Ich will, dass ihr zusammenarbeitet, wobei Ji-karnari das Kommando erhält.«
Ji-karnari huschte ein Lächeln über das Gesicht. Orz widerstand dem Drang, die Augen zu verdrehen. Ein kleiner Teil von ihm wollte Ka-sedial vor die Füße spucken und ihm sagen, dass er ihn mal konnte, aber ein viel größerer Teil von ihm hatte kein Interesse daran, den Rest seines Lebens in Ketten zu verbringen. Er würde Ka-sedials Aufgabe erledigen und dann seine Freiheit genießen.
»Wer ist dieser Soldat?«, fragte Orz.
»Ein Lanzenreiter namens Ben Styke«, antwortete Ka-sedial. »Findet ihn und bringt mir seinen Kopf.«
KAPITEL 1
Schon als Kind hatte General Vlora Flint Geschichten über Flüchtlingslager gehört, die während der Gurlisch-Kriege entstanden waren. Ganze Städte waren vertrieben worden, eine Million Menschen war auf der Flucht vor den feindlichen Armeen gewesen oder sogar von ihren eigenen Soldaten aus ihren Häusern gezwungen worden. Die Lager, so hatte man ihr erzählt, waren Orte unsagbaren Leids und Elends gewesen. Krankheiten und Hunger grassierten, Leichen wurden nicht begraben, und die Menschen lebten in ständiger Angst vor der nächsten Armee, die über sie herfiel.
Vlora hatte sich in all ihren Albträumen nie vorstellen können, dass sie mal de facto die Anführerin eines solchen Lagers sein würde.
Sie stand auf einer kleinen Anhöhe mit Blick auf das Hadshaw-Flusstal und überblickte die lange, gewundene Kette von Wagen, Zelten und Kochfeuern, die sich in die Ferne erstreckte. Es war früher Morgen, die Luft war stickig und feucht, und alles, woran sie denken konnte, waren die Zahlen, die ihre Quartiermeister ihr vor einer Stunde gebracht hatten. Sie hatten ihre Zählungen abgeschlossen und schätzten, dass über dreihunderttausend Menschen aus Landfall geflohen waren – knapp mehr als ein Drittel der Stadt – und dass davon etwa zweihundertzwanzigtausend diesem Flusstal in Richtung Redstone folgten.
Ihre eigenen Männer, einschließlich der Wilden Ulanen und der Garnison von Landfall, hatten bei der Verteidigung der Stadt schwere Verluste erlitten. Sie hatte weniger als zehntausend Mann unter ihrem Kommando, nur ein Soldat auf zweiundzwanzig Menschen.
Wie in Adoms Namen sollte sie bloß dieses Chaos organisieren, geschweige denn beschützen?
Sie riss sich aus ihren eigenen Gedanken los und warf einen Blick auf das Lager unter ihr. Sie konnte ihre Soldaten ausmachen, die den Fluss auf und ab liefen, um die Leute zu wecken und ihnen zu sagen, dass es Zeit war aufzubrechen. Drei Wochen waren seit der Schlacht von Landfall vergangen, und schon breiteten sich Krankheiten aus; viele ihrer eigenen Soldaten waren an der Ruhr erkrankt. Nahrung und Medizin waren knapp. Die meisten Menschen hatten die Stadt in Panik verlassen, eher Wertsachen als das Nötigste mitgenommen und waren ohne Plan oder Ziel geflohen.
Sie neigte ihren Kopf leicht zu dem Mann, der geduldig neben ihr wartete. Olem war von mittlerer Größe, ein paar Zentimeter größer als sie, mit rotblondem Haar und einem ergrauten Bart. Er hinkte leicht, und sein rechter Arm steckte noch in einer Schlinge von einer Schusswunde aus Landfall. Er war ein Begabter – er besaß eine einzigartige magische Fähigkeit, durch die er keinen Schlaf brauchte –, aber auch er sah hundemüde aus, mit Krähenfüßen in den Augenwinkeln und einem von Sorgen zerfressenen Gesicht. Sie wollte ihm befehlen, sich auszuruhen, aber sie wusste, dass er sie ignorieren würde.
Sie war sich nicht ganz sicher, was sie ohne ihn tun würde.
»Irgendwelche Anzeichen von den Dynize?«, fragte sie und wandte sich von den Flüchtlingen ab, um den Fluss hinunter in die Richtung zu schauen, aus der sie gekommen waren. Landfall lag etwa sechzig Meilen südöstlich von ihnen, und die Straße in diese Richtung war mit Nachzüglern übersät. Ihre eigene Armee hatte hier ihr Lager aufgeschlagen und bewachte den hinteren Teil des Flüchtlingskonvois.
Olem zog an einer Zigarette, wobei Rauch aus seinen Nasenlöchern quoll, bevor er eine bedächtige Antwort gab. »Spähtrupps«, sagte er. »Sie beobachten uns. Aber ich nehme an, dass sie zu sehr damit beschäftigt sind, ihre Stellung in Landfall zu festigen, als dass sie sich die Mühe machen werden, uns zu verfolgen. Für den Moment.«
»Weißt du«, sagte Vlora und warf ihm einen säuerlichen Blick zu, »das ›für den Moment‹ hättest du auch weglassen können. Es klingt einfach nur bedrohlich.«
»Ich versuche, dir immer nur die Fakten zu geben«, antwortete Olem mit ernstem Gesicht. »Und Fakt ist, dass sie uns in Ruhe lassen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das ewig so bleiben wird. Ich habe Dragoner nach hinten ausgesandt, um einen dieser Spähtrupps zu erwischen, aber bisher haben sie nichts gefunden.«
Vlora fluchte innerlich. Sie musste wissen, wie es um die Stadt stand. Sie und ihre Männer hatten die Schlacht von Landfall gewonnen, nur um dann gezwungen zu sein, die Stadt aufzugeben, als sie erfahren hatte, dass eine noch größere Dynize-Armee auf dem Weg war. Ihr letzter Stand war, dass diese Armee begonnen hatte, in der Nähe der Stadt anzulanden, und seitdem hatte sie keine Informationen mehr. Wie groß war diese Armee? Drängte sie aggressiv vor? Ließen sie sich Zeit, um die Stadt zu befestigen? Hatten sie noch mehr Privilegierte und Knochenaugen?
Nach Lebensmitteln und Vorräten für so viele Menschen waren Informationen das zweitwichtigste Gut. Sie musste wissen, ob die Dynize ihr dicht auf den Fersen waren. Sie musste auch wissen, ob die fatrastanische Armee in diese Richtung unterwegs war, denn das würde eine Reihe von Komplikationen mit sich bringen. »Gibt es Neuigkeiten von Lindet?«
Olem schürzte seine Lippen. »Nichts Offizielles. Wir haben fast zweitausend Blackhats aufgenommen. Keiner von ihnen scheint Befehle zu haben oder von dem Streit zwischen dir und der Kanzlerin zu wissen. Ich habe sie als Ordnungshüter unter den Flüchtlingen eingesetzt.«
Olems Fähigkeit, selbst die größte Armee zu beschäftigen und organisiert zu halten, erstaunte sie immer wieder. »Du bist ein Heiliger, aber behalte diese Blackhats genau im Auge. Jeder von ihnen könnte ein Spion von Lindet sein. Sie mag die Stadt kurz vor uns verlassen haben, aber wenn sie keine Augen und Ohren zurückgelassen hat, um mir nachzuspionieren, dann fresse ich meinen Hut.«
»Und ich meinen«, stimmte Olem zu. »Aber ich habe meine eigenen Leute unter den Blackhats. Ich werde für Ordnung sorgen, so gut ich kann. Wusstest du, dass Styke ganz offen bei den Blackhats rekrutiert, um die Reihen seiner Ulanen aufzufüllen?«
Vlora schnaubte. »Mit Erfolg?«
»Mehr, als ich erwartet hatte. Er zwingt sie, ihre Loyalität gegenüber der Kanzlerin abzuschwören, bevor sie sich ihm anschließen können. Die Blackhats sind verdammt wütend darüber, dass sie so viele von ihnen ohne Befehl im Stich gelassen hat. Er hat schon über hundert.«
»Und möge Adom jedem Spion helfen, den er erwischt!«, sagte Vlora. Sie zögerte, als ihr Blick auf eine Reihe von Reitern fiel, die in Einzelreihe auf der anderen Seite des Flusses ritten. Sie gehörten zu ihrer Kompanie, trugen hohe Dragonerhelme und blutrote Uniformen mit blauen Verzierungen und hatten Degen und Karabiner an den Sätteln befestigt. »Habe ich einen Fehler gemacht, Styke das Kommando über meine Kavallerie zu geben?«
»Das glaube ich nicht«, antwortete Olem.
»Du hast gezögert.«
»Habe ich das?«
Vlora verschränkte die Hände hinter dem Rücken, um nicht an ihrem Revers herumzufummeln. »Lindet hat mir gesagt, er sei ein unkontrollierbares Monster.«
»Ich habe das Gefühl«, erwiderte Olem, ließ seine Zigarettenkippe fallen und zertrat sie unter dem Absatz seines Stiefels, »dass Lindet die Wahrheit so darstellt, wie es ihr gerade passt. Außerdem ist er im Moment unser Monster.«
»Auch das ist nicht gerade beruhigend.« Vlora versuchte, ihre Gedanken zu ordnen. Sie war unkonzentriert, zerstreut, und die schiere Anzahl der Ungewissheiten, die ihr durch den Kopf gingen, machte sie verrückt. Es gab so viel, um das sie sich in ihrer eigenen Armee kümmern musste – Blackhat-Nachzügler, die Stadtgarnison, die Wilden Ulanen und der Kern der Söldnerbrigade, die sie aus Adro mitgebracht hatte. Sie hatte über fünftausend ausgewählte Männer, viele von ihnen verwundet, die eine halbe Welt von ihrer Heimat entfernt waren, und sie hatten keinen Arbeitgeber. Ein verzweifeltes Lachen entrang sich ihren Lippen, und Olem warf ihr einen besorgten Blick zu.
»Geht es dir gut?«, fragte er mit leiser Stimme.
»Es geht mir gut«, versichert sie ihm. »Es ist nur … eine Menge zu verarbeiten.«
»Du weißt, dass du für diese Flüchtlinge nicht verantwortlich bist«, sagte Olem, nicht zum ersten Mal.
»Doch, das bin ich.«
»Warum?«
Vlora versuchte, eine befriedigende Antwort zu finden. Sie fragte sich, was Feldmarschall Tamas in einer solchen Situation getan hätte, und ihr wurde klar, dass er in die nächste unbesetzte Stadt marschiert wäre und für seine Truppen die Heimreise gebucht hätte, sobald sein Vertrag hinfällig geworden war. Aber sie war nicht Tamas. Außerdem gab es mehr Gründe, in diesem Land zu bleiben, als eine Viertelmillion Flüchtlinge. »Weil«, antwortete sie schließlich, »sich sonst niemand um sie kümmert.«
»Die Männer fangen an sich zu fragen, wo ihr nächster Stapel Krana herkommen soll.«
Eine weitere von tausend Sorgen. Ein kleiner, verbitterter Teil von ihr wollte den Männern sagen, dass sie sich mehr Sorgen machen sollten, lebend aus Fatrasta herauszukommen, als um ihre nächste Bezahlung, aber sie konnte nicht zu hart mit ihnen sein. Immerhin waren sie Söldner. »Gib ihnen Schuldscheine gegen meine eigenen Besitztümer.«
»Das habe ich bereits getan.«
»Ohne mich zu fragen?«
Olem schenkte ihr ein kleines Lächeln und kramte in seiner Tasche nach einem Beutel mit Tabak und ein paar Blättchen. »Ich dachte mir, du würdest schon irgendwann den Befehl dazu geben. Aber nicht einmal du kannst sie auf unbestimmte Zeit bezahlen.«
»Ich lasse mir etwas einfallen.« Vlora winkte ab, als ob sie sich keine Sorgen machen würde, aber es war eine Sorge, die sie nachts wach hielt. Plötzlich kam ihr ein Gedanke, und sie blinzelte hinunter ins Lager. »Weißt du, ich habe Taniel und Ka-poel schon eine ganze Weile nicht mehr gesehen. Wo zur Grube sind sie?«
»Sie sind in der Stadt geblieben, als wir geflohen sind.«
Vlora runzelte die Stirn. »Und du hast nicht daran gedacht, mir das zu sagen?«
»Doch, habe ich. Zweimal. Beide Male hast du mir versichert, dass du jedes Wort gehört hast, das ich gesagt habe.«
»Ich habe gelogen.« Vlora spürte einen plötzlichen Anflug von Verzweiflung. Trotz ihrer holprigen Vergangenheit war Taniel jemand, den man gerne dabeihatte, und das nicht nur, weil er eine Ein-Mann-Armee war. »Warum wollten sie in der Stadt bleiben? Um Informationen zu sammeln?«
Olem zuckte mit den Schultern und zögerte. »Ich weiß, dass du und Taniel euch schon lange kennt«, sagte er dann. »Aber vergiss nicht, dass die beiden ihre eigenen Pläne haben.«
Das war keine Erinnerung, die Vlora brauchte – oder wollte. Taniel war mehr als ein alter Liebhaber; er war ihr Adoptivbruder und ein Freund aus Kindertagen. Ihr Instinkt sagte ihr, dass sie ihm vertrauen sollte, aber Jahre an militärischer und politischer Ausbildung erinnerten sie daran, dass ihre gemeinsame Geschichte lange her war. Es hatte sich so viel verändert.
Bei allem, was im Moment los war, war sein Verschwinden die geringste ihrer Sorgen. Sie fuhr sich mit den Fingern durch ihr verfilztes Haar und fragte sich, wie lange es her war, dass sie ein richtiges Bad genommen hatte. Sie verdrängte ihr Unbehagen. »Ich brauche Informationen«, sagte sie.
»Nun, vielleicht haben wir da etwas.« Olem deutete auf einen uniformierten Boten, der den Hügel hinauf zu ihnen eilte.
»Das wird wieder nichts Nützliches sein«, erwiderte Vlora verstimmt. »Das wird irgendein Arschloch von Stadtkommissar sein, der mich wegen irgendwelcher Vorräte schikanieren will, die wir seiner Meinung nach von den Flüchtlingen horten. Schon wieder.«
»Ich wette, es ist etwas Wichtiges.«
»Ich wette dagegen.«
»Ich wette um den Ersatzbeutel Tabak, den du im linken Ärmelaufschlag deiner Jacke hast«, sagte Olem.
»Abgemacht«, sagte Vlora und beobachtete den Boten, der sich näherte. Es war eine junge Frau mit dem Abzeichen einer Gefreiten am Revers, und sie salutierte höflich, als sie vor ihnen zum Stehen kam.
»Ma’am«, sagte die Frau, »ich habe eine Nachricht von Captain Davd.«
Vlora warf Olem einen Blick zu. »Ist es wichtig?«
»Ja, Ma’am. Er sagt, er habe eine Verfolgungstruppe der Dynize gesichtet.«
Vlora nahm einen tiefen, zittrigen Atemzug, als eine Welle der Beklemmung über sie hereinbrach. Das würde eine Schlacht bedeuten. Das würde Tote bedeuten, und das Leben all dieser Flüchtlinge würde auf dem Spiel stehen. Aber wenigstens würden sie endlich ihren Feind sehen.
Sie kramte in ihrem Ärmel und zog ihren Beutel Notfalltabak heraus, den sie Olem reichte, ohne ihn anzusehen. Selbstgefälliger Mistkerl. »Bring mich zu Captain Davd.«
Das Hadshaw-Flusstal sah viel Verkehr, und die alten Wälder, die sich einst über diesen Teil von Fatrasta erstreckt hatten, waren in den letzten paar Hundert Jahren abgeholzt worden. Das Land war felsig und unnachgiebig, ganz anders als die Auen in der Nähe der Stadt oder die Plantagen im Westen. In der hügeligen Landschaft waren von Mauern umgebene Gehöfte verteilt, deren Steine die Bauern auf ihren Feldern ausgegraben hatten.
Gelegentlich wuchsen auf den Felshängen Büsche von dürrem Honigdorn, und an einem solchen Aussichtspunkt entdeckte sie zwei ihrer Soldaten, die auf den Knien zwischen den Felsbrocken kauerten.
Captain Davd war Anfang zwanzig, hatte schwarzes Haar und ein weiches, bartloses Gesicht. Er klopfte mit seinen pulverbefleckten Fingernägeln auf den Schaft einer alten Donnerbüchse und nickte, als Vlora neben ihn schlich.
Seine Begleiterin war eine ältere Frau mit grauem, schmutzigblondem Haar. Norrine lag mit dem Kopf auf einem Stein, ihr Gewehr auf einen Ast gestützt, und visierte ein Ziel an, das nur sie sehen konnte.
Jeder andere würde es vielleicht seltsam finden, dass zwei Captains auf einer Aufklärungsmission waren, aber Vlora wunderte sich nicht. Wie sie waren sie beide Pulvermagier. Durch die Einnahme von etwas Schwarzpulver konnten sie schneller laufen, weiter sehen und besser hören als jeder normale Soldat. Das machte sie zu idealen Spähern für eine Armee auf der Flucht. Sie hatte sich ein Beispiel an ihrem Mentor genommen und den Pulvermagiern unter ihrem Kommando einen mittleren Rang und eine unterstützende Rolle zugewiesen. Sie unterstanden ausschließlich ihr.
Sie waren nicht nur hervorragende Kundschafter, sondern konnten auch mithilfe ihrer Magie eine Muskete oder ein Gewehr über riesige Entfernungen abfeuern und so die wichtigsten Ziele ausschalten.
»Norrine hat einen Offizier im Visier«, flüsterte Davd aufgeregt. »Gib den Befehl, und schon haben sie einen ranghohen Metallkopf weniger.«
Vlora schnaubte. Ihre Männer hatten damit angefangen, die Soldaten der Dynize wegen ihrer kegelförmigen Helme als »Metallköpfe« zu bezeichnen. Sie legte Norrine sanft eine Hand auf die Schulter. »Wie wäre es, wenn ihr mich erst aufklären würdet, bevor ihr anfangt, Leute umzubringen?«
Davd wirkte niedergeschlagen. Norrine gab Vlora einen Daumen hoch und behielt ihr Ziel im Auge.
»Also?«, drängte Vlora Davd.
Davd machte Platz für Vlora, die sich zwischen ihm und Norrine gegen die Felswand kauerte. Sie kroch neben ihnen her, spähte über den Rand ihres Aussichtspunktes hinaus und fischte eine Pulverladung aus ihrer Brusttasche. Sie schnitt das Papier mit dem Daumennagel durch, hielt es an ihr rechtes Nasenloch und schnupfte etwas.
Ihre Sinne flackerten auf, und sofort überkam sie ein Hochgefühl, als die Geräusche, Farben und Gerüche heller wurden. Die Welt wurde klarer, und sie schielte die Landstraße entlang des Hadshaws hinunter zu einer kleinen Gruppe von Soldaten in der Ferne. Die Pulvertrance ermöglichte es ihr, Details zu erkennen, als wäre sie nur fünfzig Meter entfernt, und sie nahm eine schnelle Bestandsaufnahme des Feindes vor. Aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung schätzte sie die Zahl der Soldaten auf etwa fünfhundert, die sich in einer Entfernung von etwa zwei Meilen befanden. Sie trugen die silbernen Brustpanzer und leuchtend blauen Uniformen der Dynize-Soldaten. Etwa die Hälfte von ihnen ritt auf Pferden, was für Vlora neu war – die Dynize, die Landfall angegriffen hatten, hatten keine Kavallerie dabeigehabt.
Die Truppe war in Bewegung, die Pferde trabten, während die Soldaten mit doppelter Geschwindigkeit marschierten. Hin und wieder gesellte sich ein Reiter zu ihnen, der von Osten her über den Kamm kam oder von Westen her den Fluss überquerte. Es wurden Nachrichten ausgetauscht, und dann wurde eine Meldung nach Süden geschickt.
»Es ist eine Vorhut«, stellte Vlora fest.
»Sie erstatten regelmäßig Bericht«, fügte Davd hinzu. »Ich würde wetten, dass sie der Hauptarmee nicht mehr als ein paar Meilen voraus sind. Sie sondieren die Lage und versuchen, unsere Nachhut herauszulocken.«
»Für eine Vorhut sind sie furchtbar schnell unterwegs.«
»Hm«, kommentierte Davd. »Das stimmt wohl.«
Vlora nahm einen zittrigen Atemzug. Ihre Armee – und die Flüchtlinge, die sie beschützten – waren weniger als fünf Meilen von den verfolgenden Dynize entfernt. Wenn die Armee so schnell unterwegs war wie die Vorhut, konnten sie noch vor Einbruch der Nacht eine Schlacht erzwingen. Wenn sie sich Zeit ließen, hatte Vlora vielleicht zwei Tage Zeit, sich vorzubereiten. Sie überlegte, ob sie versuchen sollte, vor Einbruch der Nacht noch ein paar Meilen zu gewinnen und die Flüchtlinge vor sich herzutreiben, oder ob sie sofort eine defensive Position einnehmen sollten. »Ihr zwei besorgt mir Informationen. Ich will wissen, wo die feindliche Armee ist. Ich will wissen, wie stark sie ist und wie schnell sie sich bewegt. Keine Waffen, und lasst euch nicht sehen.«
Sie kroch aus dem Dickicht des Honigdorns und kehrte zu dem Boten zurück, der ihr den Weg gezeigt hatte. »Wir haben Feindkontakt. Jemand soll meine Gewehre vorbereiten, dann eine Nachricht zu Major Gustar bringen. Er und Oberst Styke haben eine feindliche Vorhut zu zerschlagen.«
KAPITEL 2
Ben Styke saß auf dem Kamm eines Hügels, sein vernarbtes Gesicht der Morgensonne zugewandt, der Boden unter ihm feucht und kühl. Er lehnte sich gegen seinen Sattel, während sein Schlachtross Amrec in der Nähe graste. Die Sonne wärmte Stykes Knochen und erlaubte ihm, die Grenzen auszutesten, die die alten Wunden ihm auferlegt hatten. Er drückte eine Handvoll Kieselsteine zusammen, um die Sehnen in seinem Arm zu stärken, die einst durchtrennt und dann magisch geheilt worden waren.
Ein kleines Mädchen, Celine, spielte auf einer bröckelnden Trockenmauer. Sie hüpfte von Stein zu Stein und schien kaum auf ihre Umgebung zu achten, bis ein Stein unter ihr wegrutschte und sie geschickt den Fuß wechselte, um Halt zu finden, bevor sie fallen konnte. Sie lief etwa hundert Meter die Mauer hinunter, drehte sich um und verdoppelte ihr Tempo für den Rückweg.
Irgendwo hinter den nahe gelegenen Hügeln befand sich Lady Vlora Flint – Stykes neue Befehlshaberin – mit ihrer kleinen Söldnerarmee und Hunderttausenden von Flüchtlingen aus Landfall. Styke hielt seine eigenen Männer von der Kolonne fern und zog es vor, an den Flanken der Flüchtlinge zu bleiben und das Kundschaften zu übernehmen. Die Flüchtlinge waren nicht sein Problem. Das Töten – wenn es denn getan werden musste – schon.
Styke drückte die Kieselsteine zusammen, bis ihm eine Schweißperle über die Stirn lief. Er kramte in seinem Hinterkopf nach seinem Geburtstag – eines der vielen Dinge, die er nach so langer Zeit im Arbeitslager vergessen hatte – und stellte fest, dass er nur noch wenige Monate von seinem sechsundvierzigsten entfernt war. Fast alt genug, um Celines Großvater zu sein. Sicherlich alt genug, um ihr richtiger Vater zu sein, wenn er einen späten Start gehabt hatte.
Celine erreichte das Ende der nahe gelegenen Mauer und sprang auf das Gras. Sie trug keine Schuhe, obwohl sie zwei neue Paar besaß, und ihre Jacke und ihre weite Hose waren schlammig von den drei Wochen auf der Straße. Sie hatte langes Mädchenhaar und ein sanftes Gesicht, aber durch ihre Körperhaltung wurde sie öfters für einen Jungen gehalten. Sie war zugleich nervös und selbstbewusst, die Tochter eines Diebes und abgehärtet durch Jahre im Arbeitslager.
Sie packte Amrec furchtlos am Zaumzeug und streichelte seine Nase. Er schnaubte sie an, aber er stampfte sie nicht in Grund und Boden, wie er es bei jedem anderen getan hätte, der so kühn war.
Styke warf die Kieselsteine weg und wischte sich den Splitt von den Händen. Das Nachlassen des Drucks auf seine Sehnen ließ ihn ein Keuchen unterdrücken, und er atmete einmal durch, bevor er Celine zurief.
»Wie entscheidest du, auf welchen Stein du trittst?«, fragte er sie.
Celine schien von der Frage überrascht zu sein. Sie verließ Amrec und kam zu Styke, wobei sie sich mit der spöttischen Übertreibung eines müden Soldaten gegen den Sattel fallen ließ. Sie verbrachte, so entschied Styke, zu viel Zeit mit den Ulanen. Nicht dass sich das in nächster Zeit ändern würde.
»Ich steige einfach auf den, der sicher aussieht.«
»Und woher weißt du, welcher sicher ist?«
»Ich weiß es einfach«, sagte Celine mit einem leichten Schulterzucken.
»Hmm. Denk nach, Mädchen«, erwiderte Styke. »Denk mal nach, woher du das weißt.«
Celine öffnete ihren Mund, schloss ihn wieder und runzelte die Stirn. »Ich trete nicht auf die flachen. Die sind am schlimmsten, weil sie wackeln. Die, die geformt sind wie …« Sie formte ein Dreieck mit ihren Händen.
»Wie ein Keil?«, schlug Styke vor.
Ihr Gesicht hellte sich auf. »Ja, wie ein Keil. Die sind am stärksten, weil sie auf zwei anderen Steinen ruhen.«
»Sehr gut.« Styke suchte in seiner Satteltasche und fand eine Tüte mit eingepackten Karamellbonbons, die er entdeckt hatte, als er vor der Abreise aus Landfall ein Vorratsdepot der Blackhats geplündert hatte. Er drückte Celine eines davon in die Hand.
Celine betrachtete das Bonbon ernst, bevor sie zu Styke aufsah. »Warum ist das wichtig? Hast du mir nicht gesagt, dass der Instinkt die beste Waffe eines Ulanen ist? Das ist es doch, was ich benutze, um die Steine zu finden, nicht wahr?«
Styke dachte über seine Antwort nach und blickte den Hügel hinunter. Weit unter ihnen übten sich mehrere Hundert Ulanen auf ihren Pferden und ritten in dem kleinen Tal hin und her, bis es nur noch eine schlammige Kloake war. Er lauschte den Rufen seiner Offiziere, die Korrekturen und Befehle bellten. »Instinkt ist nur ein Wort, das wir benutzen, um all die kleinen Informationen zu beschreiben, die unsere Sinne sammeln und wie unser Gehirn sie interpretiert. Instinkte können verbessert werden.«
»Also, wenn du mich dazu bringst, meine Instinkte zu inter… inter…«
»Interpretieren.«
»Meine Instinkte zu interpretieren, trainierst du damit also mein Gehirn? So wie das, was du mit deinen Handgelenken machst?«
Styke grunzte und unterdrückte ein Grinsen. »Du bist ein cleverer kleiner Scheißer, weißt du das?«
»Ibana sagt, dass du mich deshalb magst«, antwortete Celine und reckte ihr Kinn in die Luft.
»Ibana sagt eine Menge Dinge. Die meisten davon sind Blödsinn.« Styke erhob sich, beugte sich hinunter, um Celines Haar zu streicheln, und warf dann einen kritischen Blick auf die Ulanen, die unten übten. Die Übungen dauerte jeden Tag Stunden, wobei Ibana alte Ulanen und neue Rekruten gleichermaßen in Form brachte. Sowohl Männer als auch Pferde mussten trainiert werden, und Styke kannte keine andere Armee auf diesem Kontinent, die so hart trainierte wie die Wilden Ulanen.
Aber genau das machte sie zu den Besten.
Styke spürte einen Schmerz tief in seinem Rücken, in seinen Oberschenkeln und in seinen Schultern. Er atmete ein paarmal durch und streckte sich. Es hatte mal eine Zeit gegeben, in der er knapp zwei Meter zehn groß gewesen war und kein Mann in Fatrasta ihm in die Augen gesehen hätte. Er war der Größte, Stärkste und Gemeinste gewesen – ein Held der fatrastanischen Revolution, der in jeder Stadt zwischen den Küsten eine Liebhaberin gehabt hatte.
Jetzt war er ein kaputter Mann, und obwohl er magisch geheilt worden war, war er immer noch krumm von den Jahren im Arbeitslager und vernarbt von den Wunden, die das Erschießungskommando hinterlassen hatte.
»Ich bin immer noch Ben Styke«, flüsterte er vor sich hin. Er dachte darüber nach, hinunterzugehen und an den Übungen teilzunehmen. Er war selbst aus der Übung, und Amrec hatte er noch nicht einmal einen Monat. Ein Schlachtross, das groß genug war, um Styke zu tragen, würde viel Zeit brauchen, um die Manöver eines Ulanenbataillons zu lernen. Aber das konnte warten. Die Hälfte der Ulanen waren alte Kameraden aus Landfall, bevor die Stadt in die Hände der Dynize gefallen war. Die andere Hälfte waren frische Rekruten. Es war das Beste, sich von ihnen fernzuhalten und sie von Ibana im Schatten der Legende des Wilden Ben Styke ausbilden zu lassen, anstatt dass sie die gebrochene Seele sahen, die er geworden war.
Als er sich umdrehte, starrte Celine seitlich auf sein Gesicht – auf die Narbe an der Stelle, wo vor einem Jahrzehnt eine Kugel von seinem Wangenknochen abgeprallt war. Celine war mutiger geworden, seit sie das Arbeitslager an seiner Seite verlassen hatte. Sie war größer, stärker und reagierte gut auf eine gesunde Ernährung. In zehn Jahren würde sie eine kräftige Frau mit eisernen Fäusten sein und Styke bedauerte die Männer, die sie für eine leichte Beute halten würden.
»Ibana sagt, dass du dich nicht so selbst bemitleiden sollst.«
Styke schielte zu Celine. »Was soll das denn heißen?«
»Sie sagt, du bist nicht mehr so stark wie früher, und sie erwischt dich dabei, wie du ständig auf deine Hände starrst. Sie sagt, Selbstmitleid macht dich zu einem Hund, und sie will, dass du ein Mann bist.«
Warum zur Grube erzählte Ibana das alles einem kleinen Mädchen? Und ausgerechnet Stykes kleinem Mädchen? »Ibana sollte ihre verdammte Klappe halten.«
Celine streckte sich an Amrecs Sattel aus und starrte in den Himmel. »Die Jungs haben mir Geschichten über dich aus dem Krieg erzählt.«
»Scheiße!« Styke seufzte. Sosehr er auch versuchte, es zu vermeiden, Celine war zu einer Art Liebling des Lagers geworden. Jeder, der während des Krieges eine Tochter, eine Cousine oder eine Schwester verloren hatte, wollte ihr Geschichten erzählen und sie »richtig erziehen«. Ob er sich fernhalten wollte oder nicht, Styke würde damit anfangen müssen, ein paar Köpfe zu knacken.
»Hast du wirklich einen Hüter mit bloßen Händen getötet?«
Styke schnaubte. »Ich habe dir diese Geschichte erzählt.«
»Ja, aber ich habe es vorher nicht geglaubt. Ich habe gedacht, du würdest dir etwas ausdenken. Mein Vater hat sich auch immer etwas ausgedacht, damit seine Freunde gedacht haben, er sei stark. Aber Schakal hat gesagt, du hättest tatsächlich einen Hüter getötet. Stimmt das?«
»Das stimmt. Ich habe ihm das Rückgrat gebrochen und dann die Kehle durchgeschnitten.«
Celine nickte ernst, als ob sie diese Antwort erwartet hätte. »Dann hat Ibana recht. Du solltest dich nicht selbst bemitleiden. Du bist zu stark, um dich selbst zu bemitleiden.«
»Okay«, sagte Styke und schob sie mit einer Zehe vom Sattel. »Das reicht. Ich werde dich keine Zeit mehr mit Ibana verbringen lassen. Oder mit Schakal. Oder Sunin. Ich will nicht, dass alle denken, sie könnten mich heilen. Mir geht es gut.« Seine letzte Beteuerung klang selbst in seinen Ohren etwas zu forciert. »Das ist über zehn Jahre her. Damals warst du noch nicht mal ein Funkeln in den Augen deines Vaters. Ich bin nicht mehr stark genug, um einen Hüter zu töten. Menschen verändern sich. Das ist die Natur des Lebens.«
»Du hast einen Drachenmann getötet. Ich habe die Leiche danach gesehen.«
Styke schaute auf seine Hände hinunter. Wenn er sich stark konzentrierte, konnte er das glitschige, warme Blut noch immer bis zu den Ellbogen spüren, die Gehirnreste zwischen den Knöcheln. »Ja«, sagte er unsicher. Die Erinnerung fühlte sich wie ein Traum an. »Das habe ich, was?« Er schüttelte den Kopf. »Also gut, genug davon. Hilf mir, Amrec den Sattel aufzusetzen. Er und ich müssen noch ein paar Übungen machen, bevor Ibana alle für heute entlässt.«
Styke war gerade dabei, den Sattel festzuschnallen, während Celine Amrec mit einem Apfel fütterte, als er das Geräusch sich nähernder Hufe hörte. Er sah auf und entdeckte Major Gustar, den Kommandeur von Lady Flints Kürassier- und Dragonerkompanien. Gustar ritt mit der bequemen Haltung von jemandem, in dessen Natur es lag, im Sattel zu sitzen, und warf einen anerkennenden Blick auf Amrec, als er sein eigenes Pferd zügelte. »Guten Tag, Oberst!«
Gustar war ein großer Mann, schlank und krummbeinig, mit den Schultern eines säbelschwingenden Kürassiers. Er hatte braunes Haar, perfekt gestutzte Koteletten und ein glatt rasiertes Gesicht. Er wirkte auf Styke wie ein Mann, der der Kavallerie beigetreten war, um Frauen zu beeindrucken, und er war überrascht gewesen, als er sich als fähiger Offizier herausgestellt hatte.
»Gustar. Hast du etwas von Lady Flint gehört?«
»In der Tat. Wir haben eine Vorhut der Dynize gesichtet.«
»Wie groß?«
»Fünfhundert. Pferde und Infanterie.«
»Irgendeine Ahnung, wie groß die Armee hinter ihnen ist?«
»Ja. Fünf Infanteriebrigaden, und sie marschieren waghalsig schnell. Flint rechnet damit, dass sie heute Abend angreifen.«
Styke spielte mit seinem großen Ulanenring und blickte auf die exerzierenden Ulanen hinunter. Die Worte einer alten Ulanenhymne kamen ihm in den Sinn, und er sang leise vor sich hin: »Reitet, Ulanen, reitet, durch die Felder, gegen den Strom. Lasst die Hufe klingen, den Stahl singen; brecht eure Lanzen, brecht ihre Knochen, brecht ihren Geist entzwei.« Er nahm einen tiefen Atemzug. »Wie lauten unsere Befehle?«
»Du hast wieder das Kommando über mich und meine Kavallerie. Lady Flint bereitet einen gebührenden Empfang für die Dynize vor. Wir sollen ihre Vorhut vernichten und dann ihre östliche Flanke absichern, damit die Dynize-Späher unsere Vorbereitungen nicht bemerken.«
»Kavallerie?«
»Nicht dass wir wüssten. Wir vermuten, dass ihre Pferde nur das sind, was sie in Landfall ergattern konnten.«
Styke grinste. »Wir haben alle guten Pferde mitgenommen, als wir gegangen sind. Sie werden nur viertklassige Reittiere haben. Du sagst, sie werden heute Abend hier sein?«
»Genau das erwarten wir.«
Styke schaute auf. Es war noch früh am Morgen, aber er wusste, dass es ein angenehmer Tag werden würde. Es war heiß, aber nicht zu heiß, und die Luftfeuchtigkeit war erträglich. Ein idealer Tag zum Töten. »Reitet, Ulanen, reitet«, sang er vor sich hin. Lauter sagte er zu Gustar: »Gib die Befehle an Ibana weiter. Wir brechen innerhalb einer Stunde auf.«
Styke und Celine beobachteten die Ankunft der Kavallerie der Riflejacks – eine Streitmacht von über tausend Mann, darunter einige Hundert Kürassiere mit ihren stählernen Brustpanzern und Bärenfellmützen sowie ein größeres Kontingent an Dragonern, die alle unter der Flagge der Riflejacks, einem Tschako über gekreuzten Gewehren, ritten. Styke wartete, bis sie ins Lager der Wilden Ulanen geströmt waren, und ritt dann zu ihnen hinunter.
Er fand seine Stellvertreterin Ibana ja Fles neben einem behelfsmäßigen Hauptquartier stehen – einem Zelt mit dem Totenkopf und der Lanze der Wilden Ulanen –, wo sie Befehle erteilte und die Inventurberichte prüfte. Major Gustar stand in der Nähe, die Jacke locker über die Schultern gelegt, die Hand auf dem Säbelkolben, und beobachtete seine Männer schweigend. Styke ließ Celine aus dem Sattel und folgte ihr nach unten. Er band Amrec an einem Pfosten fest, bevor er zu den Offizieren ging.
Ibana hatte einen Stapel Berichte zu Ende gelesen und gab sie an einen Soldaten weiter. »Flint hat keine Ahnung, wie groß die Armee der Dynize ist, und sie bereitet sich trotzdem darauf vor, sich einzugraben und zu kämpfen.«
»Ich glaube nicht, dass sie eine Wahl hat«, antwortete Styke und nickte Gustar zu. »Sie kann sich zurückziehen und den Gegner die Flüchtlinge aufreiben lassen, oder sie kann sich ihr Schlachtfeld aussuchen.« Er fragte Gustar: »Was ist das für eine Überraschung, die sie vorbereitet?«
»Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass wir verhindern müssen, dass die Dynize einen Blick auf unsere Formationen werfen können.«
»Haben sie außer der Vorhut noch Kavallerie?«
Gustar breitete seine Hände aus. »Tut mir leid.«
»Zur Grube! Wir brauchen bessere Informationen.«
Ibana schnaubte. »Tja, nun. Dieses ganze Unterfangen war deine Idee. Was sollen wir also tun?«
»Wie steht es mit den neuen Rekruten?«, antwortete Styke mit einer eigenen Frage.
»Sie werden reichen müssen.« Ibana saugte an ihren Zähnen. »Ich hätte gerne noch drei Monate Zeit, um sie auszubilden, aber daraus wird wohl nichts.«
Gustar gestikulierte zu ihr. »Geht mir genauso. Wir haben versucht, unsere Reihen mit Adronern und pensionierten Kavallerieoffizieren unter den Flüchtlingen aufzufüllen. Sie sind ein williger Haufen, aber sehr eingerostet.«
Wie Ibana schon sagte, sie würden reichen müssen. Fast ein Drittel von ihnen waren unerfahrene oder ungeübte Reiter, die erst ein paar Wochen Training hinter sich hatten. »Führ ein Partnersystem ein«, sagte er.
»Ein was?«, erwiderte Ibana.
»Ein Partnersystem.« Styke lächelte grimmig. »Das haben sie früher im Arbeitslager gemacht, wenn eine neue Gruppe von Gefangenen reinkam. Man teilt einen der Neuen mit zwei oder drei alten Hasen ein. Die alten Häftlinge waren für die neuen verantwortlich – sie haben ihnen beigebracht, was sie wissen mussten, die Signale der Wachen und den Zeitplan.
»Und das hat funktioniert?«, fragte Ibana zweifelnd.
»Schien ganz so. Ich habe die Quartiermeisterin des Lagers gekannt, und sie hat gesagt, dass das Partnersystem die Lebenserwartung verlängert und Verletzungen reduziert hat.« Nachdenklich tippte er mit dem Finger auf die Seite seines Beins und fummelte an seinem großen Ulanenring herum. »Natürlich haben die alten Sträflinge den neuen ab und zu wegen seiner Schuhe umgebracht.«
»Das«, sagte Major Gustar, »ist nicht gerade beruhigend.«
Styke ignorierte ihn. »Wir tun, was uns befohlen wurde. Wir zerschlagen die Vorhut und machen uns dann auf die Suche nach Ärger.« Er zeichnete im Geiste eine Karte der Gegend und dachte dabei an die Flüchtlinge, den Fluss und Flints Streitkräfte. »Der Fluss ist zu tief, als dass sie uns flankieren könnten, aber sie könnten Späher aussenden. Gustar, ich möchte, dass du mit einhundertfünfzig deiner Dragoner das Westufer absuchst. Lass Flint nicht aus den Augen.«
»Jawohl, Sir.«
Styke krümmte seine Finger und spürte das Stechen in seinem Handgelenk. Er war nicht mehr der junge, stramme Kavallerieoffizier, der er einmal gewesen war. Aber er war der beste, den Flint bekommen würde. »Ibana, du bringst den Rest der Riflejacks die Straße runter. Ich werde mit den Ulanen ausschwärmen, und wir werden die Vorhut angreifen, bevor sie merken, was los ist.«
Styke ging nach einer kurzen, blutigen Schlacht zwischen den Toten am Ufer des Hadshaws umher. Die Dynize-Vorhut hatte versucht, sich zurückzuziehen, als sie die Riflejacks auf sich zukommen sah, und war direkt in die Ulanen gelaufen. Einige waren geflohen, andere hatten gekämpft, aber er hatte sie alle mit seiner Zangenbewegung erwischt und sie in einem entsetzlichen Gemetzel in den Boden geritten.
Er suchte die Leichen ab, bis er seine Lanze fand, die in der Brust eines Dynize-Spähers steckte. Die Späherin war eine Frau mittleren Alters, und ihre Augen schossen auf, als Styke den Griff seiner Lanze packte. Sie gab einen tiefen, saugenden Laut von sich, aus ihrem Mund sprudelte Blut. Sie versuchte, nach ihm zu greifen. Er zog sein Boz-Messer und beendete ihr Leiden mit einem einzigen Hieb, bevor er seine Lanze herauszog, und ließ die Leiche an Ort und Stelle liegen.
Er wischte die Blutspuren von der Spitze und untersuchte die Leichen der Dynize-Vorhut. Die Reiter trugen türkisfarbene Uniformen und leichte Ausrüstung mit nichts weiter als einem Messer und einem veralteten Karabiner zur Verteidigung. Die Infanteristen trugen immer noch die gleichen kurzen Bajonette, die sie beim Angriff auf Landfall benutzt hatten, und waren auf ein Flankierungsmanöver durch Kavallerie nicht vorbereitet gewesen. Styke war nicht überrascht, dass er nur ein paar Leichen von Riflejack-Dragonern sah und keine von seinen Ulanen.
Ibana näherte sich auf ihrem Pferd, und ihr Rotschimmel wühlte sich mit einer fast zärtlichen Zuneigung durch die Leichen. »Wir haben sie alle erwischt«, berichtete sie. »Die Hauptarmee der Dynize wird ein paar Stunden brauchen, um herauszufinden, dass etwas nicht stimmt. Ich habe überall an der Straße Jungs aufgestellt, die den Boten, die nach der Vorhut suchen, auflauern sollen.«
Styke hob den Blick von seiner Lanze und schaute auf die andere Seite des Flusses, wo Gustar und seine Dragoner das Ufer entlangritten und die Handvoll Dynize aufräumten, die sich in die Tiefen des Flusses geflüchtet hatten. Er klopfte mit seinem Ring gegen die Lanze und runzelte die Stirn. »Warum habe ich ein ungutes Gefühl?«
»Der Kampf war zu einfach?«, schlug Ibana vor. »Sie haben sich kaum gewehrt.«
Styke grunzte zur Antwort, warf sich die Lanze über die Schulter und ging zurück zu Amrec, der am Flussufer Gras knabberte. Er tätschelte Amrecs Nase und sprach über seine Schulter. »Sammelt die Pferde ein. Schickt alle Gefangenen zu Flint. Sie wird sie verhören wollen. Ich glaube, dass …« Er brach ab und drehte sich um, um das Schlachtfeld zu betrachten.
Die Toten lagen in einem Radius von etwa neunzig Metern verstreut. Die reiterlosen Pferde waren bereits von aufmerksamen Ulanen eingefangen worden, aber einige waren in dem Durcheinander geflohen.
Ibana schien zu spüren, dass etwas nicht stimmte. »Was ist los?«
Styke stieg in Amrecs Sattel und suchte unter seinen eigenen Männern, bis er Sunintiel fand – eine uralte Frau, die aussah, als würde sie vom nächsten Windhauch vom Pferd gerissen werden. Celine saß hinter Sunin im Sattel und winkte, als Styke sie zu einem gefangenen Dynize-Pferd hinüberwies.
»Sag mir, was mit diesem Pferd los ist«, sagte Styke, als die beiden sich näherten. Sunin öffnete ihren Mund, aber Styke brachte sie mit einer Bewegung zum Schweigen. »Celine.«
Das Mädchen legte die Stirn in Falten. »Es ist alles in Ordnung damit«, sagte sie.
»Seine Gesundheit ist in Ordnung, sicher«, sagte Styke. »Aber was ist an ihm nicht in Ordnung?«
Inzwischen waren mehrere seiner Offiziere eingetroffen. Auf ihren Gesichtern zeichnete sich langsam Verständnis ab. Sie blieben still. Celine blickte sich nervös um. Styke beobachtete sie dabei, wie sie versuchte, eine Lösung zu finden. »Denk gar nicht an sie. Denk an das Pferd. Was kannst du mir darüber sagen?«
»Es ist klein«, sagte sie. »Wahrscheinlich ziemlich schnell. Nicht besonders stark. Es wurde durch den Kampf aufgeschreckt. Anhand der Hinterhand würde ich sagen, dass es eher auf Ausdauer als auf andere Eigenschaften gezüchtet wurde.«
Stolzes Grinsen machte sich unter den Offizieren breit, und Styke hatte keinen Zweifel daran, dass jeder von ihnen den Ruhm dafür einheimsen wollte, Celine etwas über Pferde beigebracht zu haben. Aber er wusste, wo sie es wirklich gelernt hatte, und unterdrückte sein eigenes Lächeln. »Was für ein Pferd ist es?«
»Es könnte …« Sie zögerte. »Es könnte ein Unice-Wüstenrenner sein. Aber ich habe noch nie ein Pferd mit dieser Zeichnung gesehen.«
»Ich auch nicht«, sagte Styke. »Keiner von uns hat das.« Er schwang sich von Amrec herunter und ging kurz um das gefangene Pferd herum, flüsterte ihm zu und berührte es leicht, um seine Nerven zu beruhigen. »Ich verwette meinen Sattel, dass das ein Dynisier ist.« Ein Murmeln folgte auf diese Aussage.
»Davon habe ich noch nie gehört«, sagte Celine.
»Das liegt daran, dass die Dynize sich seit über hundert Jahren abgeschottet haben, und davor waren sie auch nicht gerade freundlich gesinnt.« Styke durchforstete sein Gedächtnis. »Man nimmt an, dass Dynisier auf Ausdauer gezüchtet wurden. Sie sind Allzweckpferde, die gutmütig, gehorsam und leicht austauschbar sein sollen. So gut wie jede fatrastanische Rasse hat einen Anteil Dynisier, das geht auf die Zeit zurück, als die Dynize diesen verdammten Ort noch beherrscht haben.«
»Und was ist das Besondere an diesem hier?«, fragte Celine.
»Nicht mehr als bei den anderen«, sagte Styke und deutete auf eine Gruppe von Ulanen, die versuchten, reiterlose Pferde auf dem Bergkamm einzufangen.
Ibana schnaubte. »Wir haben keine Zeit für so etwas, Ben. Sag dem Mädchen, worauf du hinauswillst.«
»Schon gut, schon gut«, sagte Styke. Er streckte seine Finger aus und richtete seine Lanze, bevor er wieder in Amrecs Sattel stieg. »Ein Dynisier hier bedeutet, dass die Dynize Kavallerie haben – sie benutzen nicht nur viertklassige fatrastanische Pferde, die sie irgendwo aufgetrieben haben.« Er dachte einen Moment lang über die Implikationen nach. »Wir suchen jetzt nicht nur nach Spähern. Wir sind auf der Suche nach einer feindlichen Kavallerieeinheit, und wir haben keine Ahnung, wie groß sie ist.« Er schaute sich bei seinen Offizieren um. »Nehmt alles Brauchbare von den Leichen.«
Innerhalb von fünfzehn Minuten waren sie wieder in Bewegung. Gefangene Pferde zogen hinter ihrer Kolonne her, und Styke stellte sicher, dass sein »Partnersystem« noch funktionierte. Während des kurzen Gefechts hatten sie mehr Verletzungen durch unerfahrene Reiter erlitten, die sich in ihren Zügeln verheddert hatten, als durch feindliche Kämpfer, und er musste dafür sorgen, dass diese Art von Unfällen auf ein Minimum beschränkt blieb.
Sie zogen in östlicher Richtung vom Fluss weg und bogen dann nach Süden ab, um sich ihm wieder von der Seite zu nähern, wobei sie darauf achteten, immer mindestens zwei Hügel zwischen sich und dem Flusstal zu lassen. Seine eigenen Spähtrupps schwärmten aus, um nach Kontakt mit der feindlichen Armee Ausschau zu halten.
Styke konnte sich eines unguten Gefühls nicht erwehren. Es sollte ihn nicht überraschen, dass die Dynize Kavallerie dabeihatten, nicht wirklich. Die Ulanen würden mit jeder Truppe auf Dynisiern kurzen Prozess machen. Was beunruhigte ihn also? Die Aussicht auf eine größere Unterzahl? Die Enttäuschung darüber, dass er sich um mehr zu sorgen hatte, als die feindliche Infanterie zu flankieren?
Er grübelte noch immer über diese Frage nach, als Ibana fast eine Stunde später im Galopp zu ihm stieß.
»Wir haben Feindkontakt!«, rief sie.
Styke wurde aus seiner Tagträumerei gerissen. »Wo? Im Westen? Vom Fluss aus?«
»Nein, aus dem Süden. Direkt aus dem Süden!« Ibanas Gesicht war rot, und sie begann sofort, Befehle zu bellen.
Styke wollte gerade nach einer Erklärung fragen, als er auf eine kleine Anhöhe in der Landschaft ritt und scharf einatmete. Direkt vor ihnen ritt eine breite Kolonne Dynize-Kavallerie in ihre Richtung. Brustpanzer glänzten in der Abendsonne, und auf eine halbe Meile Entfernung konnte er erkennen, dass sie mit Säbeln und Pistolen bewaffnet waren. Die Kolonne war weit gefächert und bewegte sich im Schritt ohne wirklichen Zusammenhalt, und er konnte sehen, wie plötzlich eine Welle der Aufregung durch die Reihen ging.
Ibana hob kurz ihr Fernrohr an ihr Auge und verstaute es dann wieder fluchend in ihrem Rucksack. »Sie sind genauso überrascht wie wir. Verdammt, wir müssen die Späher des jeweils anderen ausgeschaltet haben!«
Man musste kein Genie sein, um zu erkennen, warum sie hier waren. Die Dynize-Kavallerie wollte das Gleiche versuchen wie die Ulanen – den Feind flankieren. Aber statt einer Handvoll schlecht ausgerüsteter Reiter auf viertklassigen Pferden waren das Dynize-Kürassiere, und es schienen fast zweitausend von ihnen zu sein.
»Befehle, Sir?«, fragte Ibana. »Wir sind in der Unterzahl und haben kein Überraschungsmoment. Wenn wir sonst keinen Vorteil haben, haben sie uns.«
Styke wippte in seinen Steigbügeln hin und her. Unter ihm begann Amrec zu stampfen und scharrte erwartungsvoll mit den Füßen auf dem Boden. Styke musste schnell denken. Sie konnten die schwächeren Dynisier-Pferde abhängen. Aber ein Rückzug würde den Dynize nur zusätzlichen Boden und Zeit verschaffen, um Stykes Kräfte einzuschätzen. Im besten Fall lockten sie sie den ganzen Weg zurück zur Riflejack-Infanterie und legten einen Hinterhalt. Aber Flint konnte es sich nicht leisten, dass sich ihre Männer mit der Dynize-Kavallerie auseinandersetzen mussten. Er musste die Sache selbst in die Hand nehmen.
»Befehle!«, schnauzte Ibana.
»Schick einen Boten zu Flint. Sag ihr, dass wir auf eine überlegene Streitmacht gestoßen sind.«
»Und?«
»Und dass wir sie angegriffen haben. Teilt die Kolonne. Pfeilformation. Die Ulanen bilden die Spitze, die Riflejack-Kürassiere direkt dahinter. Schickt unsere Dragoner in zwei Kolonnen, um ihre Flanken zu bedrängen, aber lasst sie nicht im Nahkampf kämpfen.« Styke wünschte sich langsam, er hätte Gustar und die hundertfünfzig zusätzlichen Pferde nicht über den Fluss geschickt.
»Du willst, dass wir uns in drei Gruppen aufteilen und gegen eine überlegene Streitmacht kämpfen? Bist du wild geworden?«
»Meinst du die Frage ernst? Gib jetzt den Befehl, Major Fles, oder ich werde es selbst tun.«
Ibana wetterte einige Augenblicke lang. »Kein Rückzug?«
»Nein.« Styke löste seinen Karabiner und trieb Amrec vorwärts. »Wir schlagen jetzt zu, und zwar hart, bevor sie sich ordentlich in Formation bringen können.« Er warf einen Blick über die Schulter zu Schakal, der das Banner der Wilden Ulanen über sich wehen ließ. »Mir nach!«, brüllte er.
Die Befehle wurden schnell weitergeleitet, und die ganze Gruppe sprang vorwärts und stürmte auf die erschreckend nahen Dynize zu. Styke trieb Amrec schneller und schneller an. Schon bald konnte er die verwirrten Gesichter der Feinde sehen, die sich zweifellos fragten, warum sie von einer kleineren Truppe angegriffen wurden.
Er kannte diese Verwirrung und er kannte die Zweifel, die sie säen würde. Werden wir gerade flankiert?, würde sich der Feind fragen. Fällt gleich eine große Streitmacht von der anderen Seite des Bergrückens über uns her? Wo sind unsere Spähberichte?
Styke hatte kein Interesse daran, ihnen die Chance zur Erholung zu geben. Er atmete tief durch, streckte seine Sinne aus und konnte keinen Hauch von Magie im Wind wahrnehmen. Gut.
Auf vierzig Meter Entfernung feuerte er seinen Karabiner ab und steckte ihn in sein Holster. Pulverrauch strömte hinter seiner ganzen pfeilförmigen Kompanie auf, und dann senkten sich Hunderte von weißen Lanzen auf den Feind. Die verwirrte feindliche Vorhut antwortete mit einer Reihe von Pistolenschüssen, bevor sie ihre Säbel zog und versuchte, den Angriff zu erwidern.
Die Erschütterung, als die beiden Linien aufeinanderprallten, war hörbar, und Styke war bald mitten in der feindlichen Streitmacht. Das Klirren von Stahl umgab ihn, Pulverrauch erfüllte seine Nasenlöcher. Nicht einmal Kürassiere konnten einen Sturmangriff der Wilden Ulanen brechen, und ihr Schwung trug sie bis ins Herz der Dynize-Truppe, ehe Styke ein Nachlassen ihr Geschwindigkeit bemerkte. Er brüllte los und trieb sie weiter an, als er spürte, wie seine Lanze etwas anderes als Fleisch traf.
Die Spitze blieb an der Rille eines Dynize-Brustpanzers hängen, ohne ihn zu durchschlagen. Der Dynize-Kavallerist wurde aus dem Sattel gerissen, aber er hatte seine Zügel um sein Handgelenk gewickelt, und sein Pferd galoppierte weiter an Styke vorbei und zog seinen Reiter – und die Spitze von Stykes Lanze – mit sich.
Styke spürte die Bewegung, aber seine zittrige Hand reagierte nicht schnell genug, um die Lanze fallen zu lassen. Er wurde aus dem Sattel gerissen, wirbelte durch die Luft und konnte nichts anderes tun, als den Kopf einzuziehen, während die Erde auf ihn zustürzte.
KAPITEL 3
»Warum wurde mir das nicht sofort gebracht?«, verlangte Vlora zu wissen.
Sie stand im zertrampelten Gras des Flusstals, ihre Jacke war schweißgetränkt nach dem Nachmittag, den sie damit verbracht hatte, durch das Tal zu reiten und sich zu vergewissern, dass ihre Verteidigungslinie gut vorbereitet war. Es war fast sechs Uhr abends. Hinter ihr warteten etwa zweitausend Männer hinter einem schmalen Streifen aufgeschütteter Erde, den sie den ganzen Nachmittag über errichtet hatten. Sie kauerten sich gegen den schlammigen Erdwall und warteten auf ihre Befehle.
Ein Bote stand vor Vlora. Er trug eine schwarze Jacke mit einem gelben Schal, was darauf hindeutete, dass er einer der Blackhats war, die die Wilden Ulanen rekrutiert hatten. Sie konnte den Whiskey in seinem Atem riechen.
»Kommt da bald eine Antwort, Soldat?«, fragte Vlora in leisem Ton.
Der Blackhat öffnete seinen Mund, schloss ihn und öffnete ihn wieder. Hinter ihm stand Olem mit einer Hand an seiner Pistole, das Gesicht grimmig, den Kopf zum südlichen Horizont gerichtet.
Vlora hielt eine Nachricht zwischen ihren Fingern. Hastig hingekritzelt stand da nur: Sind auf überlegene Streitkräfte getroffen. Greifen an. Sie war mit einem Totenkopf und einer Lanze versehen und zeigte das Datum und die Uhrzeit. Vor fast fünf Stunden. Vloras Hand begann vor Wut zu zittern. »Wenn du mich noch einmal wie ein Fisch anschnaufst, werfe ich dich eigenhändig mit einer Kanonenkugel am Knöchel in diesen verdammten Fluss.«
»General«, sagte Olem leise.
»Ich … ich … ich …«, stotterte der Bote.
»Du hast was? Du hast eine äußerst wichtige Nachricht von einem Oberst meiner Armee mitgenommen und bist damit zurück ins Lager geeilt? Du warst in einem solchen Zustand, dass du gedacht hast, du solltest noch etwas trinken, um deine Nerven zu beruhigen, bevor du mir die Nachricht überbringst? Und dann hast du noch mehr getrunken, obwohl du eine verdammt dringende Militärkorrespondenz in der Tasche hattest?«
Der Bote nickte zittrig.
Vlora zog eine Pulverladung aus ihrer Tasche und zerschnitt das Papier mit ihrem Daumen. Sie hielt es an ein Nasenloch und schnupfte einmal, dann machte sie dasselbe mit dem anderen Nasenloch. Ihre Wut wurde entfernter, kontrollierter, wie das Rauschen eines weit entfernten Flusses, und nach ein paar tiefen Atemzügen beschloss sie, dass sie nicht jemanden vor den Augen ihrer Infanterie töten würde. Ihre Sicht und ihr Hörsinn wurden schärfer. Die Welt ergab mehr Sinn.
»General«, wiederholte Olem in einem sanften, aber festen Ton.
»Mir geht es gut«, sagte sie ruhig. »Sag mir«, fragte sie den Boten, »weißt du, was du getan hast?«
Wieder ein zittriges Nicken.
»Weißt du es wirklich? Kennst du das Ausmaß hiervon?«
»Ich … ich glaube schon.« Der Schweiß rann dem Mann über Gesicht und Hals.
Sie beugte sich vor, bis sich ihre Gesichter fast berührten. »Ich töte keine Männer wegen Unfähigkeit, auch nicht, wenn ich möchte. Auch nicht, wenn sie es verdient haben. Auch nicht, wenn sie uns gerade eine bevorstehende Schlacht verloren haben. Wenn der Feind kommt, erwarte ich, dass du an vorderster Front kämpfst wie ein Besessener. Und jetzt geh mir aus den Augen.«
Der Bote drehte sich um und floh.