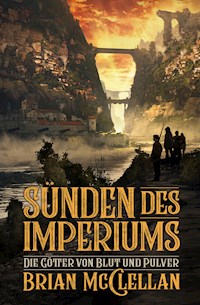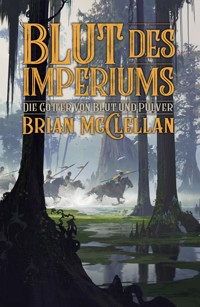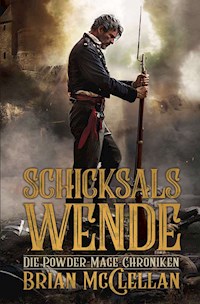
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Cross Cult
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Powder-Mage-Chroniken
- Sprache: Deutsch
Feldmarschall Tamas' Invasion endete in einer Katastrophe. Gestrandet hinter feindlichen Linien und gnadenlos gejagt, muss Tamas seine verbliebenen Männer auf einem waghalsigen Rückzug durch das nördliche Kez führen. In Adro will Inspektor Adamat nur seine Frau retten. Um das zu erreichen, muss er den rätselhaften Lord Vetus aufspüren – doch die Wahrheit, die er erfährt, ist düsterer als alles, was er sich hat vorstellen können. Der Gott Kresimir will den Kopf von Tamas' Sohn Taniel – jenes Mannes, der ihm ins Auge schoss. Da Tamas und seine Pulvermagier für tot gehalten werden, kann allein Taniel den Angriff des rachsüchtigen Gottes und seiner eindringenden Armee abwehren. Die fantastische Romansaga wird derzeit als TV-Serie umgesetzt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 956
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
SCHICKSALSWENDE
DIE POWDER-MAGE-CHRONIKEN
BRIAN MCCLELLAN
Ins Deutsche übersetzt vonJohannes Neubert
Die deutsche Ausgabe von DIE POWDER-MAGE-CHRONIKEN 2: SCHICKSALSWENDE wird herausgegeben von Amigo Grafik, Teinacher Straße 72, 71634 Ludwigsburg.
Herausgeber: Andreas Mergenthaler und Hardy Hellstern,Übersetzung: Johannes Neubert; verantwortlicher Redakteur und Lektorat: Markus Rohde;Lektorat: Jana Karsch; Korrektorat: André Piotrowski; Satz: Rowan Rüster/Amigo Grafik;Cover-Illustration: Gene Mollica und Michael Frost; Printausgabe gedruckt von CPI MoraviaBooks s.r.o., CZ-69123 Pohořelice. Printed in the Czech Republic.
Titel der Originalausgabe:
THE POWDER MAGE TRILOGY, BOOK 2: THE CRIMSON CAMPAIGN
Copyright © 2014 by Brian McClellan
Cover © 2014 Hachette Book Group, Inc
German translation copyright © 2019, by Amigo Grafik GbR.
Print ISBN 978-3-95981-726-4 (Februar 2019)
E-Book ISBN 978-3-95981-727-1 (Februar 2019)
WWW.CROSS-CULT.DE
Für Michele,mein Ein und Alles,meine Freundin, meine rechte Handund meine Geliebte.
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Epilog
Danksagungen
Adamat stand vollkommen still inmitten einer dichten Hecke vor seinem Sommerhaus und starrte durch das Fenster auf die Männer im Esszimmer. Das zweistöckige Haus mit drei Schlafzimmern lag abgelegen im Wald am Ende eines Trampelpfades. Von hier aus brauchte man zu Fuß zwanzig Minuten bis in die Stadt. Unwahrscheinlich, dass jemand Schüsse hören würde.
Oder Schreie.
Vier von Lord Vetas’ Männern hielten sich im Esszimmer auf, tranken und spielten Karten. Zwei von ihnen waren so groß und muskelbepackt wie Zugpferde. Ein dritter war mittelgroß, hatte einen buschigen schwarzen Bart und einen dicken Bauch, der aus seinem Hemd heraushing.
Der letzte Mann war der einzige, den Adamat wiedererkannte. Sein Gesicht war kantig, und sein Kopf wirkte im Vergleich zum Rest seines Körpers beinahe lächerlich klein. Sein Name war Roja der Fuchs, und er war der kleinste Boxer in der Faustkampfarena, die vom Patron in Adopest betrieben wurde. Er war (notwendigerweise) flinker als die meisten Boxer, allerdings erfreute er sich beim Publikum nicht allzu großer Beliebtheit und nahm nicht an vielen Kämpfen teil. Adamat hatte keine Ahnung, was Roja hier zu suchen hatte.
Eines lag jedoch klar auf der Hand: Angesichts dieser Bande von Halunken musste er sich ernsthafte Sorgen um die Sicherheit seiner Kinder machen – insbesondere um die seiner Töchter.
»Sergeant«, flüsterte Adamat.
Die Hecke raschelte, und Adamat erhaschte einen Blick auf das Gesicht von Sergeant Oldrich. Er besaß eine kantige Kieferpartie, und im trüben Mondschein konnte Adamat die Ausbeulung in seiner Wange erkennen, die von einem Klumpen Tabak herrührte. »Meine Männer sind in Position«, antwortete Oldrich. »Sind sie alle im Esszimmer?«
»Ja.« Adamat hatte das Haus jetzt drei Tage lang beobachtet. Die ganze Zeit über hatte er draußen gestanden und diesen Männern dabei zugesehen, wie sie in seinem Haus seine Kinder anbrüllten und Zigarren rauchten, wobei sie Fayes gutes Tischtuch mit Asche und Bier besudelten. Er kannte ihre Gewohnheiten.
Er wusste, dass der fette Bärtige im oberen Stockwerk blieb und den ganzen Tag lang auf die Kinder aufpasste. Er wusste, dass die beiden Riesen die Kinder zum Klohäuschen eskortierten, während Roja der Fuchs Wache hielt. Er wusste, dass die vier Männer die Kinder bis zum Anbruch der Dunkelheit nicht aus den Augen lassen würden, bis sie ihr nächtliches Kartenspiel auf dem Esszimmertisch vorbereiteten.
Er wusste auch, dass er in den vergangenen drei Tagen kein Anzeichen von seiner Frau oder seinem ältesten Sohn gesehen hatte.
Sergeant Oldrich drückte Adamat eine geladene Pistole in die Hand. »Sind Sie sich sicher, dass Sie die Führung übernehmen wollen? Meine Männer sind gut. Sie können die Kinder unversehrt da rausholen.«
»Ich bin mir sicher«, sagte Adamat. »Es geht um meine Familie. Meine Verantwortung.«
»Zögern Sie nicht abzudrücken, falls einer von ihnen Richtung Treppe läuft«, sagte Oldrich. »Wir wollen nicht, dass sie Geiseln nehmen.«
»Die Kinder sind bereits Geiseln«, wollte Adamat sagen. Er verkniff sich die Antwort und strich die Vorderseite seines Mantels mit einer Hand glatt. Der Himmel war bewölkt, und nun, da die Sonne untergegangen war, gab es hier draußen so wenig Licht, dass seine Anwesenheit den Männern im Haus verborgen bleiben würde. Er machte einen Schritt aus der Hecke und wurde plötzlich an die Nacht erinnert, in der er zum Skyline-Palast bestellt worden war. Es war die Nacht gewesen, als alles seinen Anfang genommen hatte: der Putsch, dann der Verräter, dann Lord Vetas. Stumm verfluchte er Feldmarschall Tamas dafür, dass er ihn und seine Familie in diese Sache hineingezogen hatte.
Sergeant Oldrichs Soldaten schlichen zusammen mit Adamat über den Trampelpfad zur Vorderseite des Hauses. Adamat wusste, dass sich acht weitere Soldaten hinter dem Haus befanden. Sechzehn Mann insgesamt. Sie waren in der Überzahl. Sie hatten das Überraschungsmoment.
Lord Vetas’ Schläger hatten Adamats Kinder.
Adamat hielt an der Haustür inne. Die adronischen Soldaten, mit ihren dunkelblauen Uniformen in der Dunkelheit beinahe unsichtbar, nahmen ihre Position unterhalb des Esszimmerfensters ein, die Musketen im Anschlag. Adamat musterte die Tür. Statt eines in der Nähe der Stadt zu wählen, hatte Faye sich für dieses Haus entschieden, und zwar zum Teil wegen dieser Tür. Sie bestand aus robusten Eichenbrettern und hatte stabile Türangeln aus Eisen. Faye war davon überzeugt, dass eine solide Tür mehr Sicherheit für ihre Familie bedeutete.
Er hatte es nie übers Herz gebracht, ihr zu sagen, dass der Türrahmen von Termiten befallen war. Tatsächlich hatte Adamat schon lange vorgehabt, ihn ersetzen zu lassen.
Adamat machte einen Schritt zurück und setzte zum Tritt an, direkt neben dem Türknauf.
Das morsche Holz explodierte unter der Wucht des Aufpralls. Adamat duckte sich in den Flur und hob seine Pistole, während er um die Ecke kam.
Alle vier Ganoven sprangen gleichzeitig auf. Einer der beiden Riesen eilte in Richtung Hintertür, die zum Treppenaufgang führte. Adamat zielte mit seiner Pistole und feuerte, und der Mann brach zusammen.
»Keine Bewegung«, rief Adamat, »ihr seid umzingelt!«
Die drei verbliebenen Ganoven starrten ihn an, während sie dastanden, als wären sie an Ort und Stelle festgefroren. Er sah, wie ihre Augen zu seiner abgeschossenen Pistole wanderten, dann stürzten sie sich gemeinsam auf ihn.
Der Kugelhagel aus den Musketen der Soldaten zerschmetterte das Fenster und erfüllte die Luft mit Glassplittern. Die verbliebenen Ganoven sackten zusammen, abgesehen von Roja dem Fuchs. Er wankte mit gezücktem Messer in Richtung Adamat, ein Ärmel bereits durchtränkt von Blut.
Adamat fasste seine Pistole am Lauf und schlug mit dem Kolben auf Rojas Kopf.
Und dann war alles vorbei – so schnell, wie es begonnen hatte.
Nach und nach strömten die Soldaten ins Esszimmer. Adamat drückte sich an ihnen vorbei und raste die Treppe hoch. Zuerst warf er einen Blick in jedes der Kinderzimmer: alle leer. Schließlich blieb nur noch sein Schlafzimmer. Er riss die Tür mit solcher Wucht auf, dass sie beinahe aus den Angeln flog.
Die Kinder hatten sich in dem schmalen Spalt zwischen Bett und Wand zusammengekauert. Die älteren Geschwister hielten die jüngeren im Arm und versuchten sie, so gut es ging, zu schützen. Sieben verängstigte Gesichter starrten nun zu Adamat hoch. Einer der Zwillinge weinte, zweifellos wegen der lauten Musketenschüsse. Stumme Tränen tropften an seinen Pausbäckchen herab. Der andere streckte vorsichtig seinen Kopf unter dem Bett hervor, wo er sich versteckt gehalten hatte.
Adamat atmete erleichtert auf und sank auf die Knie. Sie waren am Leben. Seine Kinder. Ungebeten kamen ihm die Tränen, als sieben kleine Körper über ihn herfielen. Winzige Hände reckten sich ihm entgegen, um sein Gesicht zu berühren. Er breitete die Arme aus, so weit er konnte, griff nach so vielen Kindern wie möglich und zog sie an sich.
Adamat wischte sich die Tränen von den Wangen. Es gehörte sich nicht, vor den Kinder zu weinen. Er atmete einmal tief ein, um die Fassung zurückzugewinnen, und sagte: »Ich bin hier. Ihr seid in Sicherheit. Ich bin mit den Männern von Feldmarschall Tamas hier.«
Es folgte eine weitere Runde von Freudentränen und Umarmungen, bevor Adamat die Ordnung wiederherstellen konnte.
»Wo ist eure Mutter? Wo ist Josep?«
Fanish, seine Zweitälteste, half ihm, die anderen Kinder zu beruhigen. »Sie haben Astrit vor ein paar Wochen mitgenommen«, berichtete sie, während sie mit zitternden Fingern über ihren Zopf strich. »Und letzte Woche kamen sie und haben Mama und Josep mitgenommen.«
»Astrit ist in Sicherheit«, sagte Adamat, »Keine Bange. Haben sie gesagt, wohin sie Mama und Josep bringen wollten?«
Fanish schüttelte den Kopf.
Adamat spürte, wie ihm das Herz in die Hose rutschte, aber er ließ sich nichts anmerken. »Haben sie euch etwas angetan? Irgendjemandem von euch?« Am meisten sorgte er sich um Fanish. Sie war vierzehn, fast schon eine Frau. Ihre Schultern schauten unter ihrem dünnen Nachthemd hervor. Adamat suchte nach blauen Flecken und atmete erleichtert auf, als er keine finden konnte.
»Nein, Papa«, sagte Fanish. »Ich habe die Männer belauscht. Sie wollten zwar, aber…«
»Aber was?«
»Ein Mann kam vorbei, als sie Mama und Josep geholt haben. Ich habe seinen Namen nicht gehört, aber er war wie ein feiner Herr gekleidet, und er hat sehr leise geredet. Er hat ihnen gesagt, wenn sie uns anfassen, bevor er ihnen die Erlaubnis gibt, würde er …« Sie beendete den Satz nicht und wurde blass im Gesicht.
Adamat tätschelte ihre Wange. »Du warst sehr tapfer«, versicherte er ihr mit sanfter Stimme. Innerlich kochte Adamat vor Wut. Sobald Adamat ihm nicht länger von Nutzen gewesen wäre, hätte Vetas zweifellos seine Schläger auf die Kinder losgelassen, ohne auch nur einen weiteren Gedanken daran zu verschwenden.
»Ich werde sie finden«, sagte er. Er strich Fanish noch einmal liebevoll über die Wange und stand auf. Einer der Zwillinge griff nach seiner Hand.
»Geh nicht!«, bettelte er.
Adamat wischte dem Kleinen die Tränen aus dem Gesicht. »Ich bin gleich wieder da. Bleib bei Fanish.« Adamat riss sich los. Nun galt es, ein weiteres Kind und seine Frau zu retten – weitere Schlachten mussten geschlagen werden, bevor sie alle wieder glücklich vereint sein würden. Sergeant Oldrich stand direkt vor der Tür zum Schlafzimmer, mit seinem Hut in der Hand, und wartete respektvoll.
»Sie haben Faye und meinen ältesten Sohn«, berichtete Adamat. »Die anderen Kinder sind in Sicherheit. Ist irgendeiner dieser Mistkerle noch am Leben?«
Oldrich sprach mit gedämpfter Stimme, damit die Kinder nicht mithören konnten. »Einer wurde von einer Kugel ins Auge getroffen. Ein anderer ins Herz. Echte Glückstreffer.« Er kratzte sich am Kopf. Oldrich war nicht besonders alt, aber seine Haare fingen bereits an, über den Ohren zu ergrauen. Seine Wangen waren von der Hitze des kurzen Gefechts gerötet. Doch seine Stimme klang fest und ebenmäßig.
»Verdammtes Glück!«, meinte Adamat. »Ich hätte einen von ihnen lebendig gebraucht.«
»Einer lebt noch«, sagte Oldrich.
Als Adamat die Küche betrat, saß Roja bereits gefesselt auf einem Stuhl, die Hände hinter dem Rücken, und blutete aus Schusswunden in der Schulter und Hüfte.
Adamat zog einen Gehstock aus dem Regenschirmständer neben der Haustür.
Roja starrte finster zu Boden. Er war ein Boxer, ein Kämpfer. Es kam nicht oft vor, dass er einen seiner Kämpfe gewann, doch er war verbissen und gab sich niemals leicht geschlagen.
»Du hast Glück, Roja«, sagte Adamat und deutete mit der Spitze des Gehstocks auf die Schusswunden. »Gut möglich, dass du das überlebst. Falls du rechtzeitig medizinische Hilfe bekommst.«
»Kenn ich dich?«, grunzte Roja. Sein dreckiges Leinenhemd war mit Blut besprenkelt.
»Nein, tust du nicht. Aber ich kenne dich. Ich habe dich kämpfen sehen. Wo ist Vetas?«
Roja wiegte den Kopf von links nach rechts und ließ seine Nackenwirbel knacken. Dabei schaute er Adamat herausfordernd in die Augen. »Vetas? Kenn ich nicht.«
Adamat meinte, hinter der gespielten Unwissenheit einen Funken des Wiedererkennens in der Stimme des Boxers zu erahnen.
Adamat drückte die Spitze seines Gehstocks gegen Rojas Schulter, direkt neben die Schusswunde. »Dein Auftraggeber.«
»Friss Scheiße!«, spie Roja ihm entgegen.
Adamat legte etwas mehr Gewicht auf den Stock. Er konnte fühlen, dass die Kugel noch im Fleisch steckte, direkt am Knochen. Roja wand sich, schaffte es aber, keinen Laut von sich zu geben. Jeder Faustkämpfer, der etwas auf sich hielt, lernte irgendwann, den Schmerz zu ertragen.
»Wo ist Vetas?«
Roja gab keine Antwort. Adamat trat näher an ihn heran. »Willst du die Nacht überleben oder nicht?«
»Er würde mir Schlimmeres antun, als du jemals könntest«, sagte Roja, »und außerdem weiß ich von rein gar nichts.«
Adamat machte einen Schritt zurück und drehte Roja den Rücken zu. Er konnte hören, wie Oldrich vortrat, gefolgt von dem dumpfen Einschlag eines Gewehrkolbens, der in Rojas Magengrube gerammt wurde. Adamat ließ Oldrich einige Momente lang so weitermachen, bevor er sich wieder umdrehte und Oldrich ein Zeichen gab, von Roja abzulassen.
Rojas Gesicht sah aus, als wäre er mit SouSmith in den Ring gestiegen.
Er krümmte sich nach vorne und spuckte Blut.
»Wohin haben sie Faye gebracht?« Sag’s mir, flehte Adamat innerlich. Das wäre für uns alle das Beste: für dich, für sie und für mich. Sag mir einfach, wo sie ist. »Der Junge, Josep? Wo ist er?«
Roja spuckte auf den Boden. »Du bist es, oder? Der Vater von diesen blöden Gören?« Er wartete keine Antwort ab. »Wir wollten sie alle ordentlich durchnehmen. Angefangen mit den Kleinen. Vetas hat uns nicht gelassen. Aber deine Frau …« Roja leckte sich über die aufgeplatzten Lippen. »Die war willig. Hat wohl gedacht, dass wir die Kleinen in Ruhe lassen, wenn wir uns alle an ihr austoben können.«
Oldrich war zur Stelle und rammte Roja den Gewehrkolben ins Gesicht. Roja kippte zur Seite und stöhnte auf.
Adamat spürte, wie sein ganzer Körper vor Wut zitterte. Nicht Faye. Nicht seine wunderschöne Frau, seine Partnerin und beste Freundin, seine Vertraute und die Mutter seiner Kinder. Er hob eine Hand, gerade als Oldrich ausholte, um Roja noch einmal ins Gesicht zu schlagen.
»Nein«, sagte Adamat, »das ist doch Alltag für ihn. Bringen Sie mir eine Laterne.«
Er packte Roja am Nacken, riss ihn vom Stuhl hoch und schleifte ihn durch die Hintertür nach draußen, wo er ihm einen Stoß gab. Roja stolperte und fiel in einen riesigen Rosenbusch, der begonnen hatte, den im Garten zu überwuchern. Adamat zog ihn wieder hoch, wobei er mit voller Absicht die verwundete Schulter packte, und schubste ihn unsanft weiter – in Richtung Klohäuschen.
»Passen Sie auf, dass die Kinder drinnen bleiben«, sagte Adamat zu Oldrich, »und bringen Sie ein paar Männer mit.«
Das Klohäuschen war breit genug für zwei Sitze; absolut notwendig bei einem Haushalt mit neun Kindern. Adamat öffnete die Tür, während zwei von Oldrichs Männern Roja auf den Beinen hielten. Adamat nahm die Laterne von Oldrich entgegen und erleuchtete das Innere des Klohäuschens, damit Roja etwas sehen konnte.
Adamat griff nach dem Brett, das die Sickergrube bedeckte, und warf es auf den Boden. Der Gestank war ekelerregend. Selbst nach Sonnenuntergang waren die Wände mit Fliegen übersät.
»Ich habe das Loch selbst ausgehoben«, erklärte Adamat in gespielt beiläufigem Tonfall. »Es ist zweieinhalb Meter tief. Ich hätte schon vor Jahren ein neues Loch ausheben sollen, und es wurde in letzter Zeit von meiner Familie viel benutzt. Sie waren den ganzen Sommer über hier.« Er leuchtete mit der Laterne in das Loch und schnüffelte theatralisch. »Fast voll«, sagte er. »Wo ist Vetas? Wohin haben sie Faye gebracht?«
Roja bleckte die Zähne. »Fahr zur Grube!«, sagte er zu Adamat.
»Da sind wir schon«, sagte Adamat. Er packte Roja am Nacken und bugsierte ihn in das Klohäuschen. Der Platz darin reichte kaum für die beiden. Roja wehrte sich, aber Adamats Zorn verlieh ihm Kraft. Er trat Roja in die Kniekehlen und brachte ihn so zu Boden, dann drückte er den Kopf des Boxers in das Loch.
»Sag mir, wo er ist«, zischte Adamat.
Roja gab keine Antwort.
»Sag es mir!«
»Nein!« Rojas Stimme hallte in der hölzernen Kiste wider, die den Toilettensitz bildete.
Adamat drückte Rojas Hinterkopf weiter nach unten. Ein paar Zentimeter mehr, und Roja würde eine volle Ladung Fäkalien ins Gesicht bekommen. Adamat musste seinen eigenen Ekel unterdrücken. Das hier war grausam. Unmenschlich. Doch seine Frau und Kinder als Geiseln zu nehmen, war genauso unmenschlich.
Rojas Stirn berührte die Oberfläche der stinkenden Masse, und er stieß ein Schluchzen aus.
»Wo ist Vetas? Ich werde nicht noch einmal fragen!«
»Ich weiß es nicht! Er hat mir nichts erzählt. Er hat mich nur dafür bezahlt, hier auf die Kinder aufzupassen.«
»Wie wurdest du bezahlt?« Adamat konnte hören, dass Roja würgen musste. Der Boxer zitterte am ganzen Körper.
»In Krana-Noten.«
»Du boxt für den Patron«, sagte Adamat. »Weiß er irgendwas von dieser Sache?«
»Vetas hat gesagt, wir wurden ihm empfohlen. Niemand gibt uns einen Auftrag, ohne dass der Patron sein Einverständnis gibt.«
Adamat knirschte mit den Zähnen. Der Patron. Das Oberhaupt der adronischen Unterwelt und Mitglied in Tamas’ Rat. Er war einer der mächtigsten Männer in ganz Adro. Wenn er von Lord Vetas wusste, könnte das bedeuten, dass er die ganze Zeit über ein Verräter gewesen war.
»Was weißt du sonst noch?«
»Ich hab kaum mehr als zwanzig Worte mit dem Kerl gewechselt«, brachte Roja hervor. Seine Worte waren unterbrochen von Japsen und Keuchen, als ihn ein Heulkrampf schüttelte. »Das ist alles, was ich weiß!«
Adamat schlug Roja auf den Hinterkopf. Er sackte zusammen, war aber nicht bewusstlos. Adamat hob ihn am Gürtel hoch und drückte sein Gesicht tief in die Grube. Ein weiterer Ruck beförderte ihn noch tiefer hinein. Roja schlug wild um sich und strampelte mit den Beinen, während er trotz der widerwärtigen Suppe aus Pisse und Scheiße um Atem rang. Adamat packte den Boxer bei den Fußknöcheln und stopfte ihn in das Loch.
Adamat machte kehrt und verließ das Klohäuschen. Vor lauter Wut konnte er keinen klaren Gedanken fassen. Er würde Vetas vernichten für das, was er seiner Frau und seinen Kindern angetan hatte.
Oldrich und seine Männer standen daneben und sahen zu, wie Roja in der Kloake allmählich ertrank. Im schummrigen Laternenlicht machte einer von ihnen den Eindruck, als würde er sich gleich übergeben müssen. Ein anderer nickte zustimmend. Stille senkte sich über die Nacht herab, und Adamat konnte die Grillen im Wald zirpen hören.
»Wollen Sie ihn nicht weiter befragen?«, sagte Oldrich.
»Er hat selbst gesagt, dass das alles ist, was er weiß.« Adamat spürte, wie sich ihm der Magen umdrehte, und er schaute zurück auf Rojas strampelnde Beine. Die Vorstellung, wie Roja sich über Faye hermachte, hätte Adamat beinahe dazu gebracht, einfach schweigend davonzugehen. Doch stattdessen sagte er zu Oldrich: »Ziehen Sie ihn raus, bevor er stirbt. Und dann schicken Sie ihn zur tiefsten Kohlengrube, die Sie bei der Bergwacht finden können.«
Adamat schwor, dass er Vetas weitaus Schlimmeres antun würde, sobald er ihn in die Finger bekam.
Feldmarschall Tamas stand auf der Mauer über dem südlichen Tor von Budwiel und betrachtete die Kez-Armee. Die Stadtmauer markierte den südlichsten Punkt von Adro. Auf der anderen Seite lag Kez, und hätte Tamas einen Stein hinabgeworfen, so wäre dieser womöglich die Große Nordstraße entlanggerollt, bis er vor den Feldposten der Kez am Rande ihrer Armee zum Liegen käme.
Rechts und links von Tamas erhoben sich die Tore von Wasal gen Himmel, zwei Felswände, jeweils über einhundertfünfzig Meter hoch, die seit Jahrtausenden durch das Wasser aus der Adsee voneinander getrennt waren, das sich seinen Weg durch Surkov Alley bahnte und die Kornfelder in den Bernstein-Ebenen im nördlichen Kez versorgte.
Die Kez-Armee hatte die schwelenden Ruinen des Vulkans South Pike vor gerade einmal drei Wochen verlassen. Die offiziellen Berichte schätzten die Größe der Armee, die Shouldercrown belagert hatte, auf zweihunderttausend Mann – gefolgt von einem Begleittross, der diese Anzahl fast auf eine dreiviertel Million ansteigen ließ. Seine Späher berichteten ihm, dass die Gesamtzahl inzwischen eine Million überstieg. Bei einer solchen Summe lief Tamas ein kleiner Schauer den Nacken herunter. Die Welt hatte keine Armee dieser Stärke mehr gesehen, seit vor mehr als vierzehnhundert Jahren die Verödungskriege stattgefunden hatten. Und nun stand sie hier vor seiner Haustür und versuchte, sein Land zu erobern.
Tamas konnte die frischen Soldaten auf den Mauern daran erkennen, wie laut sie nach Luft schnappten, sobald sie die Kez-Armee zu sehen bekamen. Er konnte die Angst seiner eigenen Männer förmlich riechen. Die Anspannung. Die Furcht. Sie waren hier nicht in Shouldercrown, einer Festung, die ohne Weiteres von wenigen Kompanien gehalten werden konnte. Sie befanden sich in Budwiel, einer Handelsstadt mit etwa hunderttausend Einwohnern. Die Stadtmauern waren baufällig und die Tore zu zahlreich und zu breit.
Tamas selbst ließ sich diese Angst nicht anmerken. Er wagte es nicht. Stattdessen verbarg er seine taktischen Bedenken; die schreckliche Angst, die er spürte, weil sein einziger Sohn in Adopest tief im Koma lag; den Schmerz in seinem Bein, der ihn trotz der Heilkräfte eines Gottes nach wie vor plagte. Nichts davon spiegelte sich auf seiner Miene wider, abgesehen von der Verachtung für die Unverfrorenheit der Kez-Befehlshaber.
Feste Schritte ertönten auf der Steintreppe hinter Tamas, und General Hilanska, Kommandant von Budwiels Artillerie und der zweiten Brigade, gesellte sich zu Tamas.
Hilanska war ein etwa vierzig Jahre alter, sehr beleibter Mann, Witwer seit zehn Jahren und ein Veteran der Gurlischen Kriege. Ihm fehlte der linke Arm, der ihm vor zwanzig Jahren, als Hilanska noch nicht mal Captain gewesen war, von einer Kanonenkugel knapp unter der Schulter abgetrennt worden war. Er ließ sich weder von seinem fehlenden Arm noch seinem Gewicht auf dem Schlachtfeld beeinträchtigen, und allein dafür respektierte Tamas ihn. Ganz zu schweigen von dem Umstand, dass Hilanskas Artilleriemannschaft auf siebenhundertfünfzig Meter Entfernung den Kopf eines anstürmenden Kavalleristen treffen konnte.
Unter den Mitgliedern von Tamas’ Generalstab, die größtenteils nach ihrem Können und nicht nach ihrer Persönlichkeit ausgewählt worden waren, war Hilanska für ihn noch am ehesten so etwas wie ein Freund.
»Wir beobachten sie jetzt schon seit Wochen dabei, wie sie sich da unten sammeln, aber es beeindruckt mich immer wieder«, sagte Hilanska.
»Ihre Anzahl?«, fragte Tamas.
Hilanska lehnte sich über den Rand der Mauer und spuckte. »Ihre Disziplin.« Er nahm ein Fernrohr von seinem Gürtel und sorgte mit einem geübten Ruck seiner verbliebenen Hand dafür, dass es zu voller Länge ausfuhr, bevor er hindurchblickte. »All diese verdammten schneeweißen Zelte, hübsch aufgestellt in Reih und Glied, so weit das Auge reicht. Wie aus dem Modellbaukasten.«
»Eine halbe Million Zelte sauber aufstellen zu können, bedeutet noch lange nicht, dass eine Armee diszipliniert ist«, sagte Tamas. »Ich habe früher mit Kez-Kommandanten zusammengearbeitet. In Gurla. Sie benutzen Angst, um dafür zu sorgen, dass keiner ihrer Männer aus der Reihe tanzt. So bleiben zwar die Lager sauber und ordentlich, aber wenn die Armeen aufeinandertreffen, fehlt den Truppen das Rückgrat. Sie brechen spätestens bei der dritten Salve ein.« Im Gegensatz zu meinen Männern, dachte er. Im Gegensatz zu den adronischen Brigaden.
»Ich hoffe, dass du recht hast«, sagte Hilanska.
Tamas sah zu, wie die Wachmänner der Kez eine halbe Meile entfernt ihre Runden drehten – deutlich in Reichweite von Hilanskas Artillerie, doch sie waren die Munition nicht wert. Der Hauptteil der Armee lagerte beinahe zwei Meilen entfernt; die Offiziere hatten mehr Angst vor Tamas’ Pulvermagiern als vor Hilanskas Kanonen.
Tamas umklammerte den Vorsprung der Steinmauer und öffnete sein drittes Auge. Ein kurzer Schwindelanfall überkam ihn, bevor er klar und deutlich ins Els blicken konnte. Die Welt wurde von einem pastellfarbenen Leuchten erfüllt. In der Ferne zeichneten sich Lichter ab, die wie die Feuer einer feindlichen Nachtpatrouille schimmerten – das Leuchten von Kez-Privilegierten und -Hütern. Er schloss sein drittes Auge wieder und rieb sich die Schläfe.
»Du denkst immer noch darüber nach, nicht wahr?«, fragte Hilanska.
»Worüber?«
»Eine Invasion.«
»Eine Invasion?«, spottete Tamas. »Ich müsste verrückt sein, um eine Armee anzugreifen, die zehnmal so groß ist wie unsere.«
»Ich kann’s an deiner Haltung ablesen, Tamas«, sagte Hilanska. »Du siehst aus wie ein Hund, der an seiner Kette zerrt. Ich kenne dich schon zu lange. Du hast bisher keinen Hehl daraus gemacht, dass du vorhast, in Kez einzufallen, sobald sich die Chance bietet.«
Tamas musterte die Feldposten. Die Kez-Armee lagerte so weit zurück, dass es nahezu unmöglich war, sie zu überraschen. Das Gelände bot keine gute Deckung für eine nächtliche Attacke.
»Wenn ich die Siebte und die Neunte da runterkriegen könnte, mit dem Überraschungsmoment auf unserer Seite, könnte ich mich durch das Zentrum ihrer Armee pflügen und wieder zurück in Budwiel sein, bevor sie wüssten, wie ihnen geschieht«, meinte Tamas leise. Bei dem Gedanken daran begann sein Herz, vor Aufregung schneller zu schlagen. Die Kez waren in der Überzahl und nicht zu unterschätzen. Außerdem waren ihnen immer noch einige Privilegierte geblieben, selbst nach der Schlacht von Shouldercrown.
Aber Tamas wusste, wozu seine besten Brigaden fähig waren. Er kannte die Strategien der Kez und er kannte ihre Schwächen. Die Kez-Soldaten waren Bauern, eingezogen aus der enorm großen Landbevölkerung. Ihre Offiziere waren Adelige, die sich ihren Rang erkauft hatten. Ganz im Gegensatz dazu waren seine Männer Patrioten, Männer aus Stahl und Eisen.
»Ein paar meiner Jungs haben sich ein wenig umgesehen«, sagte Hilanska.
»Ach ja?« Tamas unterdrückte seine Verärgerung, dass der General ihn aus seinen Überlegungen gerissen hatte.
»Weißt du von den Katakomben unter Budwiel?«
Tamas brummte zustimmend. Die Katakomben erstreckten sich unterhalb der Westlichen Säule, einem der beiden Berge, die die Tore von Wasal bildeten. Sie waren ein Netzwerk von teils natürlichen, teils künstlich geschaffenen Höhlen, die dazu genutzt worden, Budwiels Tote zu bestatten.
»Der Zutritt ist für Soldaten verboten«, sagte Tamas mit vorwurfsvoller Stimme.
»Ich kümmere mich um meine Jungs, aber ich denke, du wirst dir sicher anhören wollen, was sie zu sagen haben, bevor wir sie auspeitschen lassen.«
»Wenn sie nicht zufällig auf einen Spionagering der Kez gestoßen sind, bezweifle ich, dass es relevant ist.«
»Noch besser«, sagte Hilanska, »Sie haben einen Weg gefunden, wie du deine Männer nach Kez schmuggeln kannst.«
Tamas spürte, wie sein Herz einen Satz machte. »Bring mich zu ihnen.«
Taniel starrte an die Decke, die sich kaum mehr als dreißig Zentimeter über ihm befand, und zählte jedes Mal mit, wenn seine Hängematte aus Hanfseil von einer Seite zur anderen schaukelte, während eine gurlische Flöte den Raum mit ihrer sanften Melodie erfüllte.
Er hasste diese Musik. Sie schien in seinen Ohren widerzuhallen, zu leise, um sie richtig zu hören, aber gleichzeitig so laut, dass sich ihm die Zehennägel aufrollten. Als er mit dem Zählen bei zehn ankam, verzählte er sich und atmete aus. Warmer Rauch stieg von seinen Lippen empor und kräuselte sich unter dem bröckelnden Mörtel der Decke. Er schaute zu, wie der Rauch dort oben entlangkroch und sich schließlich von seiner Nische aus in die Mitte der Malahöhle verzog.
Es gab Dutzende dieser Nischen im Raum. Zwei davon waren belegt. In den vergangenen zwei Tagen, die er hier verbracht hatte, hatte Taniel nicht beobachten können, dass einer der anderen beiden Besucher aufgestanden wäre, um zu essen oder pinkeln zu gehen oder überhaupt etwas anderes zu tun, als an seiner langstieligen Malapfeife zu nuckeln oder den Besitzer der Malahöhle herbeizuwinken, damit er die Pfeife nachfüllte.
Er lehnte sich zur Seite und streckte die Hand aus, um seine eigene Malapfeife aufzufüllen. Auf dem Tisch neben seiner Hängematte stand ein Teller mit ein paar dunklen Malaresten, daneben lagen ein leerer Geldbeutel und eine Pistole. Er hatte keinen blassen Schimmer, woher die Pistole kam.
Taniel formte die restlichen Stückchen Mala zu einem kleinen, klebrigen Ball und steckte ihn in den Pfeifenkopf. Der Ball flammte sofort auf, und Taniel sog den Rauch tief in seine Lunge.
»Mehr?«
Der Besitzer der Malahöhle kam herangehuscht und stellte sich vor Taniels Hängematte. Er war ein braunhäutiger Gurlaner, allerdings nicht so dunkel wie ein Deliv, mit helleren Tönen unter seinen Augen und an den Handflächen. Er war groß, wie die meisten Gurlaner, und dünn, doch sein Rücken war gebeugt vom jahrelangen Bücken, um die Nischen seiner Malahöhle zu säubern oder um einem Abhängigen die Pfeife anzustecken. Er hieß Kin.
Taniel streckte die Finger nach seinem Geldbeutel aus und tastete ein wenig darin herum, bevor ihm einfiel, dass der Beutel leer war. »Kein Geld«, sagte er. Seine Stimme klang rau und krächzend in seinen Ohren.
Wie lange war er jetzt schon hier? Zwei Wochen, entschied Taniel, nachdem er ein wenig über die Frage nachgedacht hatte. Viel wichtiger war, wie war er hierhergelangt?
Nicht hierher in diese Malahöhle, sondern hier, nach Adopest. Taniel erinnerte sich an die Schlacht auf dem Dach von Kresimirs Palast, wo Ka-poel den Kez-Kabal vernichtet hatte, und er erinnerte sich daran, dass er den Abzug seines Gewehrs betätigt und dabei zugesehen hatte, wie eine Kugel den Gott Kresimir mitten ins Auge traf.
Der Rest war Dunkelheit, bis er schweißgebadet in den Armen von Ka-poel wieder aufgewacht war, frisches Blut an ihren Händen. Er erinnerte sich an die Leichen im Hotelkorridor – die Soldaten seines Vaters, mit unbekannten Insignien an der Jacke. Er hatte das Hotel verlassen und war dann taumelnd bis hierher gelaufen, in der Hoffnung, das Ganze zu vergessen.
Wenn er sich an all dies noch erinnern konnte, leistete das Mala allerdings schlechte Arbeit.
»Armeejacke«, sagte Kin und fingerte an Taniels Revers herum. »Ihre Knöpfe.«
Taniel blickte auf die Jacke herab, die er trug. Sie war im dunklen Blau der adronischen Armee gehalten, mit silbernen Zierstreifen und Knöpfen. Er hatte sie aus dem Hotel. Es war nicht seine – zu groß für ihn. Ein Abzeichen der Pulvermagier – ein silbernes Pulverfass – war am Revers befestigt. Vielleicht war es doch seine. Hatte er Gewicht verloren?
Die Jacke war vor zwei Tagen noch sauber gewesen. Das wusste er. Jetzt war sie mit Speichelflecken, Essensresten und kleinen Brandspuren von der Malaglut besudelt. Wann zur Grube hatte er etwas gegessen?
Taniel zog sein Messer aus dem Gürtel und nahm einen der Knöpfe zwischen die Finger. Er hielt inne. Kins Tochter wanderte durch den Raum. Sie trug ein verblasstes weißes Kleid, das trotz des erbärmlichen Zustands der Malahöhle sauber war. Sie schien ein paar Jahre älter zu sein als Taniel, dennoch hingen ihr keine Kinder am Rockzipfel.
»Gefällt Ihnen meine Tochter?«, fragte Kin. »Sie tanzt für Sie. Zwei Knöpfe!« Er hielt zwei Finger in die Luft, um seinen Worten Nachdruck zu verleihen. »Viel hübscher als die fatrastanische Hexe.«
Kins Frau, die in der Ecke saß und die gurlische Flöte spielte, hielt lange genug inne, um etwas zu Kin zu sagen. Sie wechselten ein paar Worte auf Gurlisch, dann drehte sich Kin wieder zu Taniel um. »Zwei Knöpfe!«, wiederholte er.
Taniel schnitt sich einen Knopf vom Revers und legte ihn in Kins Hand. Tanzen, soso. Taniel fragte sich, ob Kin Adronisch gut genug beherrschte, um Euphemismen zu benutzen, oder ob sie tatsächlich nur tanzen würde.
»Später vielleicht«, sagte Taniel und lehnte sich mit einem frischen Ballen Mala, so groß wie die Faust eines Kindes, in der Hängematte zurück. »Ka-poel ist keine Hexe, sie ist…« Er zögerte und überlegte angestrengt, wie er sie einem Gurlaner am besten beschreiben konnte. Sein Hirn, träge vom Mala, arbeitete furchtbar langsam. »Na gut, sie ist eine Hexe.«
Taniel füllte seine Malapfeife wieder auf. Kins Tochter sah ihm dabei zu. Er begegnete ihren wachen Augen mit glasigem Blick. Sie war hübsch, nach gewissen Maßstäben. Eindeutig zu groß für Taniels Geschmack und viel zu mager – so wie die meisten Gurlaner. Sie stand einfach nur da, mit einem Wäschekorb auf der Hüfte, und rührte sich nicht von der Stelle, bis ihr Vater sie hinausscheuchte.
Wann hatte er zum letzten Mal eine Frau gehabt?
Eine Frau? Er musste lachen, sodass ihm der Rauch aus der Nase quoll, doch sein Lachen endete rasch in einem Husten, was ihm lediglich einen neugierigen Blick von Kin einbrachte. Nein, nicht irgendeine Frau. Die Frau. Vlora. Wie lange war das jetzt her? Zweieinhalb Jahre? Drei?
Er setzte sich wieder auf und kramte in seiner Tasche nach einer Pulverladung, während er sich fragte, wo Vlora jetzt wohl sein mochte. Wahrscheinlich immer noch bei Tamas und dem Rest des Pulverkabals.
Tamas würde Taniel sicherlich zurück an die Front schicken.
Zur Grube damit! Sollte Tamas doch nach Adopest kommen und Taniel suchen. Der letzte Ort, an dem er nachsehen würde, wäre eine Malahöhle.
Taniel konnte keine einzige Pulverladung in seinen Taschen finden. Ka-poel hatte ihn gefilzt. Er hatte keinen einzigen Krümel Pulver geschnupft, seit sie ihn aus diesem gottverdammten Koma geholt hatte. Nicht mal seine Pistole war geladen. Er könnte losgehen und welches besorgen. Er müsste nur eine Kaserne finden und ihnen sein Pulvermagierabzeichen zeigen.
Der bloße Gedanke daran, die Hängematte zu verlassen, machte ihn schwindelig. Taniel war gerade im Begriff einzudösen, als Ka-poel die Treppen der Malahöhle herunterkam. Er hielt seine Augen beinahe vollständig geschlossen, während der Rauch seine Lippen umspielte. Sie hielt inne und betrachtete ihn.
Sie war klein und zierlich. Ihre helle Haut war mit aschgrauen Sommersprossen übersät, und ihr rotes Haar war kaum länger als zwei bis drei Zentimeter. Ihre kurze Frisur gefiel ihm nicht, zu burschikos für seinen Geschmack. Nicht, dass man sie für einen Jungen hält, dachte Taniel, als sie ihren langen schwarzen Mantel abwarf. Darunter trug sie ein weißes ärmelloses Hemd, das sie irgendwoher stibitzt hatte, sowie eine eng anliegende schwarze Hose.
Ka-poel berührte Taniel an der Schulter. Er ignorierte sie. Sollte sie doch denken, dass er schlief oder zu tief in einer Malatrance steckte, um sie zu bemerken. Umso besser.
Sie streckte eine Hand aus und hielt ihm die Nase zu, während sie die andere Hand auf seinen Mund presste.
Er fuhr hoch und schnappte nach Luft, als sie losließ. »Was zur Grube, Pole? Willst du mich umbringen?«
Sie lächelte. Es war nicht das erste Mal, dass er, vom Mala benebelt, in diese glasklaren grünen Augen starrte und ihn dabei ziemlich unreine Gedanken überkamen. Er schüttelte den Kopf, um die ungebetenen Bilder zu vertreiben. Sie war sein Mündel. Er war ihr Beschützer. Oder war es andersherum? Sie war diejenige, die oben auf dem South Pike das Beschützen übernommen hatte.
Taniel sank zurück in die Hängematte. »Was willst du?«
Sie hielt ein dickes, in Leder gebundenes Heft hoch. Ein Skizzenbuch. Um jenes zu ersetzen, das er auf dem Berg South Pike verloren hatte. Beim Gedanken daran spürte er einen plötzlichen Stich. Skizzen, die er über acht Jahre seines Lebens angefertigt hatte. Menschen, die er gekannt hatte, viele schon lange tot. Einige waren Freunde, einige Feinde. Der Verlust dieses Buches tat fast so sehr weh wie der Verlust seines echten Hrusch-Gewehrs.
Fast so sehr wie …
Er steckte sich das Mundstück seiner Malapfeife zwischen die Zähne und nahm einen tiefen Zug. Er schauderte, als der Rauch in seinem Rachen und seiner Lunge brannte, sich in seinem Körper ausbreitete und die Erinnerungen abtötete.
Seine Hand zitterte, als er sie nach dem Skizzenbuch ausstreckte. Rasch zog er sie wieder zurück.
Ka-poel kniff die Augen zusammen. Sie legte ihm das Skizzenbuch auf den Bauch und ließ eine Packung Kohlestifte folgen. Besseres Material, als er in Fatrasta jemals besessen hatte. Sie zeigte auf die Kohlestifte und machte eine Geste, die ihn beim Skizzieren nachahmte. Taniel ballte die rechte Hand zur Faust. Er wollte nicht, dass sie sah, wie sehr seine Finger zitterten. »Ich … nicht jetzt, Pole.«
Sie zeigte wieder auf die Stifte, diesmal mit mehr Nachdruck.
Taniel nahm noch einen tiefen Zug von der Pfeife und schloss die Augen. Er spürte, wie Tränen seine Wangen herunterliefen. Einen Moment später spürte er, wie sie das Buch und die Stifte von seiner Brust nahm. Er hörte, wie der Tisch bewegt wurde. Er erwartete einen Vorwurf. Einen Schlag ins Gesicht. Irgendetwas. Als er die Augen wieder öffnete, sah er, wie ihre nackten Füße die Treppe der Malahöhle hocheilten, und dann war sie verschwunden. Er nahm noch einen tiefen Zug von dem Mala und wischte sich die Tränen aus dem Gesicht.
Der Raum fing an, zusammen mit seinen Erinnerungen im Malanebel zu verschwinden; all die Menschen, die er getötet hatte, all die Freunde, die er hatte sterben sehen. Der Gott, den er mit eigenen Augen gesehen hatte und den er mit einer verzauberten Kugel getroffen hatte. An nichts davon wollte er sich erinnern.
Nur noch ein paar mehr Tage in der Malahöhle, und es würde ihm wieder gut gehen. Dann würde er wieder ganz der Alte sein. Er würde Tamas Rapport erstatten und damit weitermachen, was er beherrschte: Kez töten.
Nur wenige Stunden nachdem er die Mauern von Budwiel hinter sich gelassen hatte, befand sich Tamas eine Viertelmeile unterhalb von mehreren Tausend Tonnen Felsgestein. Seine Fackel flackerte unstet in der Dunkelheit, sodass Licht und Schatten über die unzähligen Reihen der in die Höhlenwände eingelassenen Gräber tanzten. Hunderte von Schädeln hingen als grausiger Tribut an die Toten von der Decke, und Tamas fragte sich, ob der Weg ins Jenseits in etwa so aussehen mochte.
Mehr Feuer, malte er sich aus.
Er bezwang seine anfängliche Klaustrophobie, indem er sich ins Bewusstsein rief, dass diese Katakomben seit gut eintausend Jahren in Benutzung waren. Es war eher unwahrscheinlich, dass sie in absehbarer Zeit einstürzen würden.
Er war überrascht von der Größe des unterirdischen Korridors. An manchen Stellen führte er durch Kammern, die genug Platz für einige Hundert Mann geboten hätten. Und selbst an den engsten Stellen hätte noch eine Kutsche hindurchgepasst, ohne die Wände zu berühren.
Die beiden Artilleristen, von denen Hilanska gesprochen hatte, gingen voran. Sie hatten ihre eigenen Fackeln dabei und unterhielten sich aufgeregt miteinander. Ihre Stimmen wurden vom Echo zurückgeworfen, während sie die verschiedenen Kammern durchquerten. An Tamas’ Seite folgte Olem, der eine Hand auf seine Pistole gelegt hatte und die beiden Soldaten vor ihnen ständig im Auge behielt. Die Nachhut bildeten zwei von Tamas’ besten Pulvermagiern: Vlora und Andriya.
»Diese Höhlen«, sagte Olem, während er mit seinen Fingern an den steinernen Wänden entlangfuhr, »wurden künstlich erweitert. Aber schauen Sie sich die Decke an.« Er zeigte nach oben. »Keinerlei Spuren von Werkzeug.«
»Der Fels hier wurde vom Wasser ausgehöhlt«, sagte Tamas. »Wahrscheinlich vor Tausenden von Jahren.« Seine Augen wanderten über die Decke und dann runter auf den Boden. Der Weg führte in sanfter Neigung stetig bergab, hier und da gab es Treppenstufen, die in den Fels gehauen waren. Die Füße Tausender Pilger, Familien und Priester, die jedes Jahr hier hinabstiegen, hatten ihn zu einem ebenmäßigen, ausgetretenen Pfad werden lassen. Abgesehen von diesen Gebrauchsspuren gab es in den Katakomben kein Anzeichen von Leben – die Priester hatten jegliche Begräbnisse hier unten vorläufig ausgesetzt, aus Sorge, während der Belagerung könnte es dazu kommen, dass einige der Höhlen durch Artilleriefeuer zum Einsturz gebracht wurden.
Tamas hatte früher in solchen Höhlen gespielt, wenn sein Vater, ein Apotheker, während des Sommers die Berge nach seltenen Blüten und Pilzen abgesucht hatte. Einige dieser Höhlensysteme führten unfassbar tief ins Herz des Berges hinein. Andere endeten abrupt, wenn es gerade anfing, interessant zu werden.
Der steinerne Korridor mündete in einer weitläufigen Kammer. Das Licht der Fackeln tanzte nicht mehr an der Decke und den Höhlenwänden, sondern wurde von der Dunkelheit über ihnen verschluckt. Sie standen am Rande eines Sees, dessen stilles Wasser dunkler dalag als eine sternlose Nacht. Ihre Stimmen hallten gespenstisch in dem großen, leeren Raum wider.
Tamas kam neben den beiden wartenden Artilleristen zum Stehen. Er zerdrückte eine Pulverladung zwischen seinen Fingern und streute sie sich auf die Zunge. Die Trance erfasste ihn und brachte gleichermaßen Schwindel und Klarheit mit sich. Der Schmerz in seinem Bein war von einer Sekunde auf die andere verschwunden, und das schwache Licht der Fackeln reichte auf einmal vollkommen dazu aus, dass er die Höhle in ihrer Gesamtheit wahrnehmen konnte.
Die Wände waren voll von steinernen Sarkophagen, die ohne erkennbares System etwa zehn, zwölf Meter hoch aufeinandergestapelt worden waren. Das Geräusch tropfenden Wassers hallte durch die Kammer: die Quelle des unterirdischen Sees. Tamas konnte keinen Ausgang erkennen, abgesehen von dem, durch den sie gekommen waren.
»Sir?«, fragte einer der Artilleristen. Er hieß Ludik und hielt seine Fackel über den See, anscheinend um herauszufinden, wie tief er war.
»Wir sind hier Hunderte von Metern unterhalb der Westlichen Säule«, sagte Tamas, »aber keinen Schritt näher an Kez. Ich mag es nicht, an seltsame Orte geführt zu werden.«
Ein scharfer Laut durchbrach die Stille der Höhle, als Olem den Hahn seiner Pistole spannte. Vlora und Andriya hatten sich hinter Tamas in Stellung gebracht, die Gewehre im Anschlag. Ludik schluckte hörbar und wechselte einen nervösen Blick mit seinem Kameraden.
»Es sieht nur so aus, als würde das Höhlensystem hier enden«, erklärte Ludik und zeigte mit seiner Fackel über den See, »aber das tut es nicht. Es geht weiter und führt direkt nach Kez.«
»Woher wollen Sie das wissen?«, wollte Tamas erfahren.
Ludik zögerte, in der Erwartung, gerügt zu werden. »Weil wir dem Weg gefolgt sind, Sir. Bis ans Ende.«
»Zeigen Sie es mir.«
Sie umrundeten den See, bis sie die gegenüberliegende Seite erreicht hatten, gingen an zwei Sarkophagen vorbei und duckten sich unter einem Vorsprung hindurch, der sich als tiefer erwies, als er aussah. Wenige Momente später stand Tamas auf der anderen Seite. Die Höhle weitete sich wieder und führte hinab in die Dunkelheit.
Tamas wandte sich seinem Leibwächter zu, der dicht neben ihm stand. »Versuchen Sie, niemanden zu erschießen, solange ich nicht den Befehl dazu gebe.«
Olem strich sich über den Bart, während er weiterhin die Artilleristen beäugte. »Selbstverständlich, Sir.« Seine Hand ruhte nach wie vor auf dem Griff seiner Pistole. In letzter Zeit war Olem noch deutlich misstrauischer als sonst.
Eine Stunde später hatte Tamas das Ende der Höhle erreicht und kletterte durch Gebüsch und Geröll ans Tageslicht. Die Sonne hatte die Berge im Osten bereits überschritten, und das Tal lag im Schatten.
»Die Luft ist rein, Sir«, sagte Olem, während er Tamas dabei half, weiter nach oben zu klettern, wo der Boden festeren Halt bot.
Tamas kontrollierte seine Pistole, bevor er sich gedankenverloren den Inhalt einer weiteren Pulverladung auf die Zunge träufelte. Sie befanden sich in einem Tal mit steilen Hängen in den südlichen Ausläufern des Adro-Gebirges. Er schätzte, dass sie weniger als zwei Meilen von Budwiel entfernt waren. Falls er recht hatte, befanden sie sich damit in optimaler Position, um die Kez-Armee zu flankieren.
»Ein altes Flussbett, Sir«, sagte Vlora, während sie sich zwischen kleinen Felsbrocken hindurch ihren Weg zu ihm bahnte. »Es führt erst Richtung Westen, dann scharf Richtung Süden. Die Talebene wird von einem kleinen Hügel verborgen. Wir sind gerade mal eine halbe Meile von den Kez entfernt, aber es sieht nicht danach aus, als hätten sie sich die Mühe gemacht, dieses Tal auszukundschaften.«
»Sir!«, ertönte eine Stimme aus der Höhle.
Tamas wirbelte herum. Vlora, Olem und Andriya hoben alle ihre Gewehre und zielten in die Dunkelheit.
Kurz darauf erschien ein adronischer Soldat. An seiner Schulter prangte ein Rangabzeichen mit einem Pulverhorn darunter. Er war ein Obergefreiter in Olems neuer Kompanie von Elitesoldaten, den Riflejacks.
»Leise, Sie Idiot!«, zischte Olem. »Wollen Sie, dass ganz Kez uns hört?«
Der Bote wischte sich den Schweiß von der Stirn und blinzelte im hellen Tageslicht. »Bitte um Verzeihung, Sir«, sagte er zu Tamas. »Ich habe mich im Berg verirrt. General Hilanska hat mich Ihnen hinterhergeschickt, kurz nachdem Sie weg waren.«
»Was gibt es, Soldat?«, forderte Tamas. Boten, die außer Atem waren, waren niemals ein gutes Zeichen. Boten waren niemals in Eile, es sei denn, es ging um etwas von höchster Wichtigkeit.
»Die Kez, Sir«, sagte der Bote. »Unsere Spione berichten, dass sie übermorgen einen massiven Angriff starten werden. General Hilanska bittet darum, dass Sie unverzüglich zurückkommen.«
Tamas betrachtete das Tal, in dem sie sich befanden. »Was meinen Sie, wie viele Männer könnten wir innerhalb von zwei Tagen hier durchbringen?«
»Tausende«, sagte Vlora.
»Zehntausend«, fügte Olem hinzu.
»Zwei Brigaden bilden den Hammer«, sagte Tamas, »und Budwiel ist der Amboss.«
Vlora wirkte skeptisch. »Das ist ein ziemlich kleiner Hammer, Sir, verglichen mit der riesigen Armee da drüben.«
»Und genau deshalb werden wir schnell und hart zuschlagen müssen.« Noch einmal ließ Tamas den Blick durch das Tal schweifen. »Wir kehren um. Sorgen Sie dafür, dass die Ingenieure damit anfangen, den Tunnel zu verbreitern. Bringen Sie ein paar Männer hier hoch, um dieses Geröll abzusichern, damit die Truppen beim Aufstieg keinen unnötigen Lärm machen. Wenn die Kez angreifen, werden wir sie an den Toren von Budwiel zerschmettern.«
Es gab nur wenige Dinge auf der Welt, die langweiliger waren, als darauf zu warten, dass Wasser anfängt zu kochen, dachte Nila bei sich, während sie auf dem Küchenboden saß und den Flammen dabei zusah, wie sie den Boden des massiven Eisentopfs umspielten, der über dem Feuer hing.
In den meisten Herrenhäusern wäre um diese Uhrzeit längst Ruhe eingekehrt. Sie hatte die Stille immer genossen – die friedliche Nachtluft, die ihr einen willkommenen Kontrast bot zum chaotischen Leben einer Bediensteten, wenn der Herr und die Herrin im Haus waren und überall Hektik herrschte. Noch vor wenigen Monaten – es fühlte sich mehr nach einigen Jahren an – hatte Nila kein anderes Leben gekannt als jenes, in dem sie jede Woche Wasser gekocht und sich um die Wäsche der Familie von Herzog Eldaminse und der übrigen Bediensteten gekümmert hatte.
Doch Herzog Eldaminse war tot, seine Bediensteten in alle Winde verstreut und sein Anwesen niedergebrannt. Alles, was Nila jemals gekannt hatte, gab es nicht mehr.
Hier, in Lord Vetas’ Stadthaus in einer Seitenstraße im Zentrum von Adopest, kehrte niemals Ruhe ein.
Das Gebrüll eines Mannes ertönte irgendwo in dem riesigen Gebäude. Nila konnte zwar die Worte nicht verstehen, aber der Tonfall klang eindeutig wütend. Wahrscheinlich war es Dourford, der Privilegierte. Er war einer von Lord Vetas’ Leutnants und besaß ein derart reizbares Temperament, wie Nila es noch nie erlebt hatte. Er hatte die Angewohnheit, die Köche zu verprügeln. Jeder im Haus hatte Angst vor ihm, sogar die wuchtigen Leibwächter, die Lord Vetas begleiteten, wenn er geschäftlich unterwegs war.
Alle hatten Angst vor ihm, abgesehen von Lord Vetas natürlich.
Soweit Nila das beurteilen konnte, fürchtete Lord Vetas sich vor gar nichts.
»Jakob«, sagte Nila zu dem sechsjährigen Jungen, der neben ihr auf dem Küchenboden saß, »reich mir die Lauge.«
Jakob stand auf, zögerte und runzelte die Stirn. »Wo denn?«, fragte er.
»Unter dem Waschbecken«, sagte Nila. »Das Glasgefäß.«
Jakob wühlte unter dem Waschbecken herum, bis er das Gefäß gefunden hatte.
Er fasste es beim Deckel und zog daran.
»Vorsicht!«, rief Nila. Sie reagierte schnell und war rechtzeitig bei ihm, um ihn aufzufangen, als er mit dem Gefäß in der Hand nach hinten stolperte. Sie legte eine Hand unter das Glas. »Hab dich«, sagte sie und nahm das Gefäß an sich. Es war nicht besonders schwer, aber Jakob war nie ein sonderlich starkes Kind gewesen.
Sie schraubte den Deckel ab und maß die richtige Menge für die Wäsche mit einem Löffel ab.
»Nein«, sagte sie, als Jakob die Hand nach dem offenen Gefäß ausstreckte. »Fass das lieber nicht an. Das ist sehr giftig. Das frisst sich mitten durch deine rosa Fingerchen.« Sie schnappte sich seine Hand und tat so, als würde sie ihm in die Finger beißen. »So wie ein wütender Hund!«
Jakob kicherte und zog sich auf die andere Seite der Küche zurück. Nila stellte das Glas mit der Lauge ganz oben auf eines der Regale. Solche Sachen sollte man nicht in der Reichweite von Kindern aufbewahren.
Selbst wenn Jakob das einzige Kind im Haus war.
Nila fragte sich, wie ihr Leben wohl aussehen würde, wenn sie immer noch im Eldaminse-Anwesen wäre. Dann hätte zu Jakobs sechstem Geburtstag vor zwei Wochen eine Geburtstagsfeier stattgefunden. Das Personal hätte einen Bonus und einen freien Nachmittag bekommen. Herzog Eldaminse hätte wahrscheinlich wieder einmal (oder zweimal oder dreimal …) versucht, sich an Nila ranzumachen, und die Herzogin hätte mit dem Gedanken gespielt, Nila auf die Straße zu setzen.
Nila vermisste die ruhigen Nächte, in denen sie die Wäsche für die Eldaminses wusch. Was sie nicht vermisste, waren das Geläster und die Eifersucht unter den Bediensteten oder die Fummelei des Herzogs. Aber sie hatte all das gegen etwas viel Schlimmeres eingetauscht.
Das Anwesen von Lord Vetas.
Von irgendwoher, wahrscheinlich aus dem Keller, war ein Schrei zu hören, dort, wo Lord Vetas sein … Zimmer hatte.
»Zur Grube!«, sagte Nila leise zu sich selbst, die Augen wieder auf das Küchenfeuer gerichtet.
»Eine Dame flucht nicht.«
Nila spürte, wie sich ihr die Nackenhaare aufstellten. Die Stimme war leise, ruhig. So trügerisch sanft wie die Oberfläche des Meeres, unter der sich die wartenden Haie tummeln.
»Lord Vetas.« Sie drehte sich um und machte einen Knicks vor dem Mann, der in der Küchentür stand.
Vetas war ein Rosveleaner mit fader, gelblicher Haut. Er hielt den Rücken gerade und hatte eine Hand in die Westentasche gesteckt, während die andere mit lässiger Gewohnheit sein allabendliches Glas Rotwein hielt. Wäre man ihm auf der Straße begegnet, hätte man ihn leicht für einen wohlgekleideten Kaufmann oder Händler halten können mit seinem weißen Hemd, der dunkelblauen Weste und seiner schwarzen Hose, die sie selbst sorgfältig gebügelt hatte.
Nila wusste, dass es ein tödlicher Fehler war, irgendwelche Mutmaßungen über Vetas anzustellen oder sich von seinem Auftreten täuschen zu lassen. Er war ein Killer. Sie hatte seine Hände an ihrer Kehle gespürt. Sie hatte in seine Augen geblickt – Augen, die alles gleichzeitig wahrzunehmen schienen – und hatte die vollkommene Gleichgültigkeit gesehen, mit der er alles Lebendige betrachtete.
»Ich bin keine Dame, mein Herr«, sagte Nila.
Vetas musterte sie mit kalten Augen von oben bis unten. Nila fühlte sich nackt unter seinem Blick. Sie fühlte sich wie ein Stück Fleisch auf der Schlachtbank. Es machte ihr Angst.
Und es machte sie wütend. Einen Moment lang fragte sie sich, ob Lord Vetas auch noch im Sarg so ruhig und gefasst wirken würde.
»Weißt du, warum du hier bist?«, sagte Vetas.
»Um auf Jakob aufzupassen.« Sie warf einen Blick auf den Jungen. Jakob betrachtete Vetas mit offensichtlicher Neugier.
»Das stimmt.« Ein Lächeln spaltete plötzlich Vetas’ Gesicht; sein Ausdruck war voller Wärme, die aber nicht seine Augen erreichte. »Komm her, Junge«, sagte Vetas und kniete sich hin. »Ist schon in Ordnung, Jakob. Hab keine Angst.«
Jakobs Erziehung als Sohn eines Adligen ließ ihm keine andere Wahl, als zu gehorchen. Er bewegte sich auf Vetas zu und schaute dabei fragend in Nilas Richtung.
Nila fühlte, wie ihr Herz gefror. Sie wollte sich zwischen die beiden werfen, sich ein heißes Eisen aus dem Feuer greifen und Vetas damit zurückdrängen. Das falsche Lächeln in seinem Gesicht jagte ihr weitaus mehr Angst ein als seine übliche stoische Miene.
»Geh ruhig«, hörte sie sich selbst mit leiser Stimme sagen.
»Ich habe dir etwas Süßes mitgebracht.« Vetas drückte Jakob eine in buntes Papier eingewickelte Süßigkeit in die Hand.
»Nein, Jakob …«, fing Nila an.
Vetas heftete seinen Blick auf sie. Es lag keine Drohung in seinen Augen, keinerlei Emotion. Einfach nur ein kalter Blick.
»Du kannst es haben«, sagte Nila, »aber hebe es dir bitte für morgen auf, für nach dem Frühstück.«
Vetas gab Jakob die Süßigkeit und wuschelte ihm durch die Haare.
Fass ihn nicht an!, schrie Nila innerlich. Sie zwang sich dazu, Vetas anzulächeln.
»Warum ist Jakob hier, mein Herr?« Nila schluckte ihre Angst herunter, um die Frage zu stellen.
Vetas erhob sich. »Das geht dich nichts an. Weißt du, wie man sich wie eine Dame benimmt, Nila?«, fragte er.
»Ich … ich denke schon. Doch ich bin nur eine einfache Wäscherin.«
»Ich glaube, du bist mehr als das«, sagte Vetas. »Jeder hat die Fähigkeit, etwas aus sich zu machen. Du hast die Barrikaden der Royalisten überlebt und anschließend das Hauptquartier von Feldmarschall Tamas infiltriert in der Absicht, unseren kleinen Jakob hier zu retten. Und du bist hübsch. Niemand ist immun gegen Schönheit, wenn man sie richtig präsentiert.«
Nila fragte sich, woher in aller Welt Vetas davon wusste, dass sie bei den Barrikaden gewesen war. Sie hatte ihm von Tamas’ Hauptquartier erzählt, aber … was meinte er damit, niemand sei immun gegen Schönheit?
»Vielleicht habe ich noch mehr Verwendung für dich als nur …«, er machte eine Geste in die Richtung von Jakob und der Wäsche, »das hier.«
Jakob war zu beschäftigt damit, so unauffällig wie möglich an seiner Süßigkeit zu naschen, um die Verachtung in Vetas’ Stimme zu bemerken. Doch Nila konnte sie klar und deutlich heraushören. Und sie fürchtete sich davor, was er wohl mit ›mehr Verwendung‹ meinen könnte.
»Mein Herr.« Sie machte einen weiteren Knicks und gab sich Mühe, ihren Hass zu verbergen, damit er sich nicht in ihrem Gesicht widerspiegelte. Vielleicht würde sich ihr ja eine Gelegenheit bieten, ihn in der Badewanne umzubringen. So wie in den Kriminalromanen, die sie sich vom Sohn des Butlers im Eldaminse-Anwesen ausgeliehen hatte.
»In der Zwischenzeit gibt es noch eine andere Angelegenheit«, sagte Vetas. Er trat in den Flur vor der Küche und hielt die Tür mit einem Fuß offen. »Bringt sie hier rein«, rief er.
Jemand fluchte. Eine Frau stieß einen wütenden Schrei aus – wie das Kreischen einer wütenden Wildkatze. Es gab ein Gerangel im Flur, dann zerrten zwei von Vetas’ Leibwächtern eine Frau in die Küche. Sie war etwa vierzig, ihr Körper wirkte längst nicht mehr jung und zeigte deutlich, dass sie bereits eine Menge Kinder zur Welt gebracht hatte. Ihre Haut war zwar runzelig von der Arbeit, doch weder sonnengebräunt noch wettergegerbt. Sie trug ihr schwarzes, lockiges Haar zu einem Knoten am Hinterkopf hochgesteckt, und ihre dunklen Augenringe zeugten von zu wenig Schlaf.
Die Frau hielt inne, als sie Nila und Jakob erblickte.
»Wo ist mein Sohn?«, fauchte sie Vetas an.
»Im Keller«, sagte Vetas. »Ihm wird nichts geschehen, solange du kooperierst.«
»Lügner!«
Ein herablassendes Lächeln umspielte Vetas’ Lippen. »Nila, Jakob. Das ist Faye. Sie fühlt sich nicht gut und braucht jemanden, der unentwegt auf sie achtgibt, um sie davor zu bewahren, dass sie sich etwas antut. Sie wird sich mit dir das Zimmer teilen, Jakob. Hilfst du mit, auf sie aufzupassen, mein Junge?«
Jakob nickte feierlich.
»Guter Junge.«
»Ich bring dich um«, sagte Faye zu Vetas.
Vetas trat dicht an Faye heran und flüsterte ihr etwas ins Ohr. Sie versteifte sich, und jegliche Farbe wich aus ihrem Gesicht.
»Nun denn«, sagte Vetas. »Faye wird deine Aufgaben übernehmen, Nila. Sie macht die Wäsche und hilft dabei, sich um Jakob zu kümmern.«
Nila wechselte einen Blick mit der Frau. Die Angst, die sie in ihrem Magen spürte, spiegelte sich auf Fayes Gesicht wider.
»Und was wird aus mir?« Nila wusste, was Vetas mit denjenigen machte, die ihm nicht länger von Nutzen waren. Sie erinnerte sich noch allzu gut an Jakobs totes Kindermädchen – jene Frau, die sich geweigert hatte, bei Vetas’ Plänen mitzumachen.
Unvermittelt durchquerte Vetas den Raum und kam auf sie zu. Er fasste Nila am Kinn und wendete ihr Gesicht erst auf die eine, dann auf die andere Seite. Er schob ihr seinen Daumen gewaltsam in den Mund, um ihre Zähne zu untersuchen, und sie musste sich dazu zwingen, ihm nicht den Daumen abzubeißen. Genauso plötzlich trat er wieder zurück und wischte sich die Hände an einem Küchentuch ab, so als hätte er gerade ein Tier auf einem Viehmarkt inspiziert.
»Deine Hände tragen kaum Spuren vom Waschen. Erstaunlich wenig, um ehrlich zu sein. Morgen bekommst du etwas Balsam, den du stündlich auftragen wirst. Deine Hände werden im Nu so weich aussehen wie die einer echten Dame.« Er tätschelte ihr die Wange.
Nila unterdrückte das Verlangen, ihm ins Gesicht zu spucken.
Vetas lehnte sich nach vorne und sprach so leise, dass Jakob ihn nicht hören konnte.
»Diese Frau«, sagte er und zeigte auf Faye, »ist ab jetzt deine Verantwortung, Nila. Wenn sie mich verärgert, werde ich dich dafür leiden lassen. Ich werde Jakob dafür leiden lassen. Und glaube mir, ich weiß, wie man jemanden leiden lässt.«
Vetas wich einen Schritt zurück und schenkte Jakob ein Lächeln. Laut sagte er: »Ich finde, du brauchst ein paar neue Anziehsachen, Jakob. Würde dir das gefallen?«
»Ja sehr, Sir«, sagte Jakob.
»Dann werden wir dir morgen welche kaufen. Und ein paar neue Spielzeuge.«
Vetas warf Nila einen Blick zu, eine stille Warnung, bevor er und seine Leibwächter die Küche verließen.
Faye richtete ihr Kleid und atmete tief ein. Ihre Augen wanderten durch das Zimmer. Auf ihrem Gesicht zeichnete sich eine ganze Reihe von Emotionen ab: Wut, Panik und Angst. Einen Moment lang dachte Nila, sie würde sich eine Bratpfanne schnappen und auf sie losgehen.
Nila fragte sich, wer sie wohl war. Warum war sie hier? Offensichtlich eine weitere Gefangene. Eine weitere Figur in Vetas’ Plänen. Konnte Nila ihr vertrauen?
»Ich heiße Nila«, sagte sie, »und das ist Jakob.«
Fayes Augen fixierten Nila und sie nickte mit finsterem Blick. »Ich bin Faye. Und ich werde diesen Mistkerl umbringen!«
Adamat schlüpfte durch die Seitentür eines der baufälligen Gebäude im Hafenbezirk von Adopest. Er bewegte sich durch die Korridore, an Sekretärinnen und Buchmachern vorbei, und hielt dabei die Augen stur geradeaus gerichtet. Seiner Erfahrung nach kam es selten vor, dass jemand es wagte, einen zielstrebigen Mann aufzuhalten.
Adamat wusste, dass Lord Vetas nach ihm suchte.
Die Schlussfolgerung lag auf Hand. Vetas hatte Faye noch immer in seiner Gewalt und verfügte damit über ein Druckmittel. Außerdem gab es keinen Zweifel daran, dass er Adamat entweder tot sehen oder ihn unter seine Kontrolle bringen wollte.
Also hielt sich Adamat bedeckt. Feldmarschall Tamas’ Soldaten beschützten seine Familie – das war Teil der Abmachung, die er mit dem Feldmarschall getroffen hatte, um seinen Hals vor der Guillotine zu retten. Ab jetzt musste Adamat verdeckt ermitteln, Lord Vetas ausfindig machen, seine Pläne aufdecken und Faye befreien, bevor ihr noch mehr zustoßen konnte. Falls sie überhaupt noch am Leben war. Alleine würde er das alles nicht schaffen können.
Das Hauptquartier der Edlen Krieger der Arbeit war ein breites, ausnehmend hässliches Gebäude in der Nähe der Hafenanlage von Adopest. Es mochte unscheinbar wirken, aber in seinem Inneren waren die Büros der größten Gewerkschaft in allen Neun untergebracht. Alle Unterabteilungen der Krieger kamen hier zusammen: Bankiers, Stahlarbeiter, Minenarbeiter, Bäcker, Müller und viele weitere.
Aber es gab nur einen Mann, mit dem Adamat sprechen musste, und er hatte nicht vor, auf dem Weg zu ihm bemerkt zu werden. Er ging einen Korridor mit niedriger Decke im dritten Stock entlang und hielt vor einer Bürotür an. Drinnen waren deutlich Stimmen zu hören.
»Es ist mir egal, was du von der Idee hältst«, ertönte die Stimme von Ricard Tumblar, dem Chef der gesamten Gewerkschaft. »Ich werde ihn finden und überzeugen. Er ist der beste Mann für den Job.«
»Der beste Mann?«, erwiderte eine Frau. »Du denkst also nicht, dass eine Frau dazu in der Lage wäre?«
»Fang gar nicht erst so an, Cheris«, sagte Ricard. »Das war bloß eine Redewendung. Und tu jetzt nicht so, als ginge es hier um Männer und Frauen. Dir gefällt es nur nicht, weil er ein Soldat ist.«
»Und du weißt verdammt genau, warum.«
Adamat bekam Ricards Erwiderung nicht mehr mit, da er in dem Moment die Dielen hinter sich knarren hörte. Als er sich umdrehte, stand eine Frau hinter ihm.
Sie sah aus wie Mitte dreißig und hatte ihr glattes, blondes Haar zu einem Pferdeschwanz gebunden. Sie trug eine weiße Uniform, die aus einer weiten Hose und einem weißen Rüschenhemd bestand, von der Art, wie sie auch von Bediensteten getragen wurde. Sie hatte die Arme hinter dem Rücken verschränkt.
Eine Sekretärin. Das Letzte, was Adamat jetzt gebrauchen konnte.
»Kann ich Ihnen helfen, Sir?«, fragte sie. Ihr Ton war schroff, und sie ließ Adamats Gesicht keine Sekunde aus den Augen.
»Ach herrje!«, sagte Adamat. »Es ist nicht, wonach es aussieht. Ich hatte nicht vor zu lauschen, ich muss nur mit Ricard sprechen.«
Ihre Stimme verriet, dass sie ihm das keine Sekunde lang glaubte. »Die Sekretärin hätte Sie im Wartezimmer warten lassen sollen.«
»Ich bin durch die Seitentür gekommen«, gab Adamat zu. Also war sie nicht die Sekretärin?
»Folgen Sie mir in den Empfangsbereich, und wir vereinbaren einen Termin«, sagte die Frau. »Herr Tumblar ist leider sehr beschäftigt.«
Adamat machte eine kleine Verbeugung. »Es wäre mir lieber, keinen Termin zu machen. Ich muss einfach nur kurz mit Ricard sprechen. Es geht um eine außerordentlich dringliche Angelegenheit.«
»Ich muss Sie bitten, Sir.«
»Ich muss wirklich nur einen Moment lang mit Ricard sprechen.«
Sie senkte leicht die Stimme und wurde augenblicklich drohender. »Wenn Sie nicht mit mir mitkommen, werde ich Sie wegen Hausfriedensbruch der Polizei übergeben.«
»Jetzt hören Sie mal zu!« Adamat hob die Stimme. Aufsehen zu erregen, war das Letzte, was er wollte, aber er brauchte jetzt dringend Ricards Aufmerksamkeit.