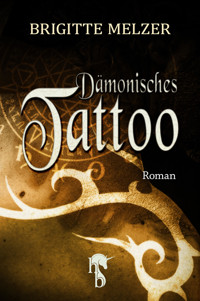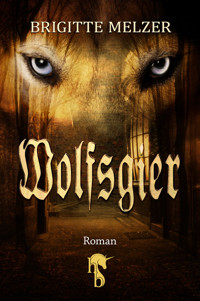4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: hockebooks
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Nach einem Unfall hat Cait ihr Gedächtnis verloren. In der Hoffnung, etwas über ihre Vergangenheit zu erfahren, folgt sie dem grimmigen Krieger Daith zu dessen Auftraggeber – ohne zu ahnen, dass Daith in ihr die Mörderin seines Vaters erkannt hat. Doch jemand will verhindern, dass sie ihr Ziel erreichen. Verfolgt von Na’Darrach, Wesen der Finsternis, die durch Magie in menschliche Gestalt gezwängt werden, sind Cait und Daith gezwungen, einander zu vertrauen. Auf der Suche nach der Wahrheit über Caits Vergangenheit werden sie von ihren eigenen Gefühlen füreinander überrascht und kommen den finsteren Plänen eines Mannes auf die Spur, der vor nichts zurückschreckt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 480
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Brigitte Melzer
Im Schatten des Dämons
Roman
Prolog
Aus zusammengekniffenen Augen blickte der Krieger auf das nächtliche Tal hinab. Wie ein schwarzes Band wand sich ein Fluss durch die geschwungene Landschaft. In Ufernähe ragten dunkle Schilfhalme aus dem Wasser, schwarz und stumm, wie die Schlachtreihen einer entfernten Armee. Sein Blick blieb an einem Lagerfeuer hängen. Funken stoben auf und trieben durch die Dunkelheit. Winzige glühende Punkte, die gleich darauf zu Hunderten erloschen. Vor dem Feuer kauerte eine zierliche Gestalt, einen Umhang schützend um die Schultern geschlungen. Er hatte sie gefunden. Endlich. Er kannte ihren Namen nicht. Nur ihr Verbrechen. Sie hatte seinen Vater ermordet. Dafür würde sie bezahlen.
Das Heulen eines Wolfes erweckte die Nacht zum Leben. Sein Pferd zerrte unruhig am Zügel. Er packte das Zaumzeug fester. Augenblicklich beruhigte sich das Tier. Er zog die Kapuze tief ins Gesicht, schwang sich in den Sattel und ritt den Hügel hinab. Die junge Frau hob den Kopf. Als sie ihn erblickte, schnellte sie hoch und begann um ihr Leben zu laufen. Bereits nach wenigen Metern erkannte sie, dass es kein Entkommen gab. Sie schlug einen Haken und flüchtete ins Wasser. Ohne Hast glitt er aus dem Sattel. Ein geflüsterter Befehl, dann trabte sein Pferd zu den nahen Bäumen davon.
Er wollte nach seinem Schwert greifen, überlegte es sich jedoch anders. Sein Vater war durch die Klinge eines Dolches gestorben. Ein Dolch sollte jetzt auch ihrem Leben ein Ende setzen. Entschlossen zückte er die Waffe und folgte ihr ins Wasser. Er holte sie ein, packte sie am Arm und riss sie herum. Sie schrie um Hilfe und versuchte an Land zu gelangen, doch er versperrte ihr den Weg und trieb sie zurück ins Wasser. Er hätte ihr die Klinge in die Brust treiben können, doch das wollte er nicht.
Sie sollte langsam sterben.
Qualvoll, wie sein Vater.
Er holte aus und drosch ihr die Faust ins Gesicht. Ungläubigkeit zeigte sich in ihrer Miene. Ihr Blick trübte sich. Sein nächster Schlag raubte ihr das Bewusstsein. Ehe sie im Wasser versank, griff er nach ihr und verhinderte, dass die Strömung sie davontragen konnte.
Noch vor einem Augenblick war die Nacht voller Leben gewesen, erfüllt von den Schreien des Mädchens. Jetzt war es still. Nur das leise Plätschern des Wassers und seine eigenen Atemzüge waren noch zu vernehmen. Die Stille des herannahenden Todes hatte sich über das Land gesenkt. Er war der Tod.
Vom Ufer wurden plötzlich Stimmen laut. Wie riesige Glühwürmchen tanzte der Lichtschein von Laternen und Fackeln durch die Nacht. Menschen kamen näher, lachend und schwatzend. Fahrendes Volk. Ihm blieb keine Zeit, wenn er nicht gesehen werden wollte. Er zog sie heran und setzte die Klinge an ihren Hals. Als er die Schneide über ihre Kehle ziehen wollte, erfasste die Strömung ihren Körper und entriss sie seinem Griff. Er unternahm keinen Versuch, sie zu fassen zu bekommen. Sie würde ertrunken sein, lange bevor die Gaukler sie aus dem Wasser fischen konnten. Sofern sie sie überhaupt fanden.
Lautlos tauchte er in die Fluten und ließ sich mit der Strömung davontreiben. Obwohl seine Rache vollendet war, fühlte er sich noch immer tot und leer.
1
Ein Blitz fuhr vom Himmel und tauchte die Kammer in kaltes Licht. Lange genug, um die Konturen der schlanken Gestalt vor dem Kamin für einen Augenblick der Dunkelheit zu entreißen. Mit aufeinandergepressten Lippen starrte er auf die flammenlosen Kerzen, die auf dem Kaminsims aufgereiht standen. Einundzwanzig Kerzen, die ihn endlich ans Ziel bringen sollten. Ein Ziel, das er längst erreicht zu haben geglaubt hatte. Bei dem Gedanken, dass er die letzten Monate in dem Irrglauben verbracht hatte, das Mädchen sei tot, verzog er das Gesicht. Dieses Mal werde ich sichergehen. Er reckte die Arme in die Luft und stimmte einen leisen Gesang an. Der Wind strich heulend ums Gemäuer, drang durch Fenster- und Türritzen und zerrte an seiner Robe. Er beendete seinen Gesang und nahm eine Holzschale zur Hand. Beschwörende Worte intonierend verteilte er das darin befindliche Pulver über den Kerzen.
Hört meine Stimme, die euch den Weg leitet; eure Seele nicht auf die Andere Seite entgleitet; mir zu gefallen und zu dienen seid ihr bereit; erst wenn die Flamme erlischt, seid ihr befreit.
Draußen erreichte das Gewitter seinen Höhepunkt. In immer kürzeren Abständen erhellten grelle Blitze den Raum, gefolgt von Donnergrollen.
»Erscheinet!«
Kleine Flammen züngelten aus den Dochten empor, als sich einer nach dem anderen entzündete. Ein Lufthauch fegte durch die Fensterritzen über die Flammen hinweg, ohne ihnen etwas anhaben zu können. Keine Kraft dieser Welt vermochte es, diese Flammen zu berühren. Sie waren zu einem Symbol des Seins geworden. Einundzwanzig Kerzen. Einundzwanzig Wesen. Er spürte ihre Anwesenheit. Na’Darrach – Wesen der Finsternis, die in der Dunkelheit hinter ihm lauerten. Einzig ihre Vernichtung konnte die Kerzen jetzt noch löschen.
Langsam wandte er sich um. Seine Augen wirkten farblos im flackernden Kerzenschein. Das schwache Licht drängte die Dunkelheit in die Ecken zurück, wo sich schwarze Schatten auftürmten, wabernd und ineinander verschwimmend. Und in den Schatten verbarg sich, was er gerufen hatte. Er verspürte die Bösartigkeit dieser Wesen bis in die letzte Faser seines Körpers. Ein Lächeln huschte über seine Züge. Endlich war der Augenblick gekommen. »So blickt in meinen Geist und seht, welche Pflicht ich euch auferlege!«
2
Seit Einbruch der Dämmerung saß Daith Landévennec im Lachenden Kobold und beobachtete das Mädchen. Er trank und hoffte, der starke Wein würde ihm helfen, eine Entscheidung zu treffen.
Er interessierte sich nicht für die lachenden und schwatzenden Männer und Frauen. Nicht, nachdem sie hier war. Sie war jung, vielleicht siebzehn Sommer. Üppige Locken fielen ungebändigt über ihre Schultern, rotgolden wie Herbstlaub. Das Kaminfeuer spiegelte sich in ihren Augen wider, sodass er ihre Farbe – wie schon in jener Nacht am Fluss – nicht erkennen konnte. Vermutlich sind sie so schwarz wie ihre Seele.
Sie saß vor dem Feuer, umringt von Menschen, die nicht müde wurden sie zu bitten immer neue Melodien auf ihrer Flöte zu spielen und neue Geschichten zum Besten zu geben. Diese Narren. Daith hatte noch nie etwas für Geschichten übrig gehabt. Geschichten waren für Schwächlinge, die mit ihrem eigenen Leben nicht zurechtkamen. Daith hatte gelernt, mit dem Schmerz zu leben, den die Erinnerung an die Vergangenheit und die Erwartung der Zukunft mit sich brachten. Er füllte seinen Becher, leerte ihn in einem Zug und füllte ihn erneut. Aus zusammengekniffenen Augen starrte er sie an, als hoffte er in ihrem Gesicht Antworten zu finden. Wollte er seinem Herzen folgen, musste er sie töten und endlich sühnen, was sie ihm angetan hatte. Seine Pflicht war eine andere.
Während er noch immer auf das Mädchen starrte, verschwamm die Wirklichkeit vor seinen Augen. Seine Gedanken kehrten zu dem Tag zurück, dessen Ereignisse ihn in den Lachenden Kobold geführt hatten. Wie jeden Tag hatte er im Salon seines Ziehvaters gesessen, nicht weit von der Stelle entfernt, an der dieser Monate zuvor gestorben war. Schwere Vorhänge sperrten die Nachmittagssonne aus und überließen ihn der Illusion einer dunklen Nacht. Seine Gedanken kreisten um Myles Landévennec, den Mann, der ihn wie seinen eigenen Sohn aufgezogen hatte. An seinen leiblichen Vater hatte Daith keine Erinnerung. Er war wenige Monate nach seiner Geburt gestorben. Auch Daith’ Mutter war längst tot. Der Einzige, der ihm geblieben war, war Myles. Seine Ermordung hatte eine schmerzhafte Lücke hinterlassen, die er immer öfter mit Wein zu füllen suchte. Die Todessehnsucht, die ihn während der letzten Jahre von Gefecht zu Gefecht getrieben hatte, war noch immer vorhanden. Einzig zum Kämpfen fehlte ihm die Kraft. So trank er und wartete auf den Morgen, an dem er nicht mehr erwachen würde. Er war allein in dem riesigen Haus. Die letzten Dienstboten hatte er vor Monaten entlassen. Die Möbel waren abgedeckt, der Salon in der ersten Etage und eine Schlafkammer die einzigen Räume, die er noch benutzte.
Er saß da, einen Weinkelch in der Hand, und starrte ins Nichts, als ein lautes Pochen an der Eingangstür die Stille durchbrach. Er rührte sich nicht. Erst als die Tür zum Salon geöffnet wurde, sah er auf. Zu seiner Überraschung stand Aladar auf der Schwelle. Insgeheim hatte Daith damit gerechnet, dass eines Tages jemand kommen würde, um ihn an seine Pflichten zu erinnern. Ein Bote oder ein Adept. Mit dem Obersten Herrn der Seáthrun hatte er nicht gerechnet.
Der Gelehrte rümpfte die Nase und ging kopfschüttelnd zum Fenster. Die dunkelrote Robe umflatterte seine hagere Gestalt wie ein Stück Stoff, das man zum Trocknen in den Wind gehängt hatte. Mit einem energischen Ruck riss er die Vorhänge zur Seite und stieß das Fenster auf. Ein Schwall frischer Luft fuhr in den Raum und wirbelte kalte Asche im Kamin auf. Blinzelnd begegnete Daith der plötzlichen Helligkeit. Er kniff die Augen zusammen und ließ seinen Blick zwischen Aladar und der Tür hin und her schweifen. »Wo sind Eure Männer?«
»Niemand weiß, wo ich bin.« Erst da bemerkte Daith, dass der alte Mann abgehetzt wirkte. Schweiß hatte sich in den tiefen Furchen auf seiner Stirn gesammelt. »Ich habe einen Auftrag für dich, Daith.«
»Ich habe den Dienst quittiert.«
Aladar musterte ihn mit kritischer Miene. »Du siehst verlottert aus.« Er sog prüfend die Luft ein. »Und du stinkst! Myles ist seit drei Monaten tot und noch immer verkriechst du dich und gibst dich mehr und mehr dem Suff hin.«
»Ich glaube nicht, dass Euch das etwas angeht.«
Aladar seufzte. »Ich mag dich, das weißt du. Es fällt mir schwer, zuzusehen, wie du dein Leben ruinierst. Doch das ist nicht der einzige Grund für mein Hiersein. Ich brauche deine Hilfe, Daith. Du bist der Einzige, dem ich vertrauen kann.«
Was konnte derart heikel sein, dass Aladar glaubte, seinen eigenen Kriegern nicht vertrauen zu können? Männern, deren einzige Aufgabe es war, den Gelehrten der Seáthrun zu dienen. Männer, die jahrelang Seite an Seite mit mir gekämpft haben.
»Erinnerst du dich an das rothaarige Mädchen?«, fuhr Aladar ohne Unterbrechung fort.
Als ob ich sie je vergessen könnte. Ihretwegen ist von mir nicht mehr als eine leere Hülle geblieben.
Aladars Augen hefteten sich auf ihn. »Du musst sie zu mir bringen.«
»Sie ist tot.«
»Woher willst du das wissen?«
»Meine Hand führte die Klinge, die ihr das Leben nahm«, offenbarte er das Geheimnis, das er viele Monate bewahrt hatte.
Aladar starrte ihn an, sichtlich bestürzt. Seine Hände wanderten hin und her, strichen über den Stoff seiner Robe, zogen ihn glatt, als gäbe es im Augenblick nichts Wichtigeres. »Den Göttern sei Dank, ist sie am Leben.« Kein Wort darüber, was Daith getan hatte.
Daith sprang auf. »Wie kann sie am Leben sein! Ich selbst habe …« Ich habe mich nie vergewissert, dass sie tot ist.
»Du musst sie finden und beschützen.«
»Beschützen?«, brauste er auf. Der Gedanke, dass sie am Leben war, weckte in ihm tatsächlich den Wunsch, sie zu suchen. Allerdings nicht, um sie zu beschützen. »Sie ist eine Mörderin!«
Aladar blieb ruhig. »Du hast gesehen, wie sie Myles’ Haus verließ. Du hast niemals gesehen, dass sie eine Waffe gegen ihn erhoben hat!« In diesem Moment wirkte er zum ersten Mal alt. »Manchmal sind die Dinge nicht, wie sie scheinen. Ich kann dir nicht mehr sagen – nicht im Augenblick. Dieses Mädchen – Cait – kennt Antworten, die ich dringend benötige. Antworten, von denen der Feind will, dass sie auf immer verborgen bleiben. Sie ist in großer Gefahr. Ohne unsere Hilfe ist sie verloren.«
»Ich werde nicht …«
Die donnernde Stimme des Obersten Seáthrun ließ ihn schlagartig verstummen. »Du bist mir zu Gehorsam verpflichtet, vergiss das nicht!«
»Das bin ich schon lange nicht mehr!« Nur mit Mühe gelang es ihm, seinen Zorn zu zügeln.
»Du warst es immer und du wirst es immer sein.«
»Für mich gibt es keine Verpflichtungen mehr.«
»Ein Mensch mag einen Ort verlassen, doch sein Herz verlässt den Platz, an den es gehört, niemals, Daith. Du magst versuchen es zu vergessen, doch du kannst nicht verleugnen, wohin du gehörst.« Aladar legte ihm eine Hand auf den Arm und fuhr mit ruhiger Stimme fort: »Du hast mir immer vertraut. Du musst es auch jetzt. Du würdest dich wundern, wenn du wüsstest, wie viel Mut und Opferbereitschaft in diesem Mädchen stecken. Sie hat große Dinge getan.«
Er schnaubte. »Welche großen Dinge sollen das gewesen sein? Der Mord an Myles?«
»Ich war immer aufrichtig zu dir. Wenn Cait in Sicherheit ist, werde ich dir alles erklären. Für den Augenblick muss es genügen, wenn du weißt, es hängt viel davon ab, dass sie am Leben bleibt. Sehr viel.«
Schließlich hatte Daith sich seinem Wunsch gebeugt. Der Gelehrte hatte ihn stets gerecht behandelt. Manchmal war ihm, als hätte Aladar sich mehr für ihn eingesetzt, als er verdient hatte. Daith hatte stets alles getan, um sich des Vertrauens würdig zu erweisen, das der Oberste Seáthrun in ihn setzte. Er hatte härter gearbeitet als jeder andere. Tag für Tag hatte er sich im Schwertkampf geübt. Selbst wenn seine Kameraden längst geschlafen hatten, war er nicht müde geworden, wieder und wieder die gleichen Attacken und Paraden auszuführen. Das hatte er getan, um auf diesen einen Tag vorbereitet zu sein. Den Tag, an dem er Aladar seine Freundlichkeit und Güte vergelten konnte. Das Mädchen zu ihm zu bringen war die größte Herausforderung, der er sich stellen konnte. Und zugleich das Mindeste, was er tun konnte. Tatsächlich keimte in ihm der Wunsch, sein Leben erneut in Aladars Dienst zu stellen und seinem Dasein auf diese Weise wenigstens einen Sinn, wenn schon keine Erfüllung oder Freude, zu geben.
Er war nach wie vor überzeugt, dass sie Myles’ Mörderin war. Während der Reise nach Kilshannon hatte er nicht daran gezweifelt, dass Aladar dennoch gute Gründe für sein Handeln hatte. Der Oberste Seáthrun hatte sein Vertrauen noch nie enttäuscht. Dieser Gedanke hatte ihn letztendlich zu der Überzeugung gebracht, dass er in der Lage war, den Auftrag auszuführen. Jetzt jedoch, da er sie vor sich sah, war er nicht mehr sicher, ob er wirklich tun konnte, was Aladar verlangte. Ihr Anblick erweckte das Gespenst der Erinnerung zum Leben.
Lauter Beifall riss ihn aus seinen Gedanken. Sie hatte ihre Geschichte beendet. Einmal mehr leerte Daith seinen Becher und noch immer hoffte er, der Alkohol würde ihn seine Befehle vergessen lassen. Wie konnte er jemanden schützen, dessen Tod er sich wünschte? Mit wachsender Abscheu beobachtete er, wie sie sich vor ihrem Publikum verneigte, nach ihrem Umhang griff und die Schenke verließ. Er ließ einige Augenblicke verstreichen, dann folgte er ihr.
Kalter Frühlingsregen schlug ihm entgegen. Mit einer unwilligen Geste zog er die Kapuze ins Gesicht. Sein Blick wanderte die Straße entlang. Das Kopfsteinpflaster glänzte feucht im Regen und spiegelte das fahle Licht des Halbmondes wider. Sie war nirgendwo zu sehen. Verfluchtes Gör, du bist schnell wie eine Katze und scheinst ebenso viele Leben zu haben! Er hatte gehofft, sie in einer der Gassen zu fassen zu bekommen. Und dann? Dann hätte ich ihr von meinem Auftrag erzählt und sie zu Aladar gebracht. Er war nicht sicher, ob er das wirklich vorhatte. Warum in einer dunklen Gasse? Wenn ich meinen Auftrag ausführen will, hätte ich sie ebenso gut in der Schenke ansprechen können. In der Dunkelheit jedoch … Es war zu spät, sich über verpasste Gelegenheiten den Kopf zu zerbrechen. Er musste sie erst einmal finden. Wenn die Informationen zutrafen, die er heute Nachmittag von einem der Marktweiber bekommen hatte, wohnte sie in einer kleinen Herberge, ein Stück hinter dem Marktplatz. Dort würde er sie aufsuchen. Er rückte seinen Waffengürtel zurecht und setzte sich in Bewegung. Mit grimmiger Miene folgte er der Hauptstraße. Hin und wieder begegneten ihm vereinzelte Passanten. Manche angetrunken und singend, andere mit eingezogenem Kopf, um dem Regen zu entgehen.
Er passierte eine schmale Seitengasse, als ihn ein Geräusch innehalten ließ. Vorsichtig trat er näher, eine Hand am Schwert. In der Gasse war es finster. Einzig in der Mitte drang ein schmaler Streifen Mondlicht bis auf den Boden. Wieder ein Geräusch. Dieses Mal war er sicher, dass es ein Schrei war. Er zückte sein Schwert und trat in die Gasse, darauf gefasst, mitten in einen Überfall zu geraten. Rotgoldenes Haar schimmerte im Mondlicht. Das Mädchen lag auf dem Boden. Wild um sich schlagend und tretend versuchte sie die schattenhafte Gestalt abzuschütteln, die sich über sie beugte und sie zu erdrücken schien.
Daith machte einen Schritt nach vorne. Warte! Du willst sie doch gar nicht retten. Er zögerte. Das war seine Gelegenheit. Er müsste sich nicht einmal die Hände schmutzig machen. Aladar würde es nie erfahren. Ein Überfall.Ich kam zu spät. Ihre Gegenwehr erlahmte. Ihre Arme glitten zu Boden. Daith erwachte aus seiner Teilnahmslosigkeit. Nein! Wenn sie stirbt, dann durch meine Hand!
Er sprang vor und stieß zu. Seine silberne Klinge durchbohrte den Angreifer. Der erwartete Todesschrei blieb aus, stattdessen erfüllte ein ohrenbetäubendes Kreischen die Luft. Die Gestalt fuhr herum. Kein Räuber – nicht einmal ein Mensch. Fassungslos starrte Daith auf die Kreatur. Die Essenz einer toten Seele, gehüllt in einen Kapuzenumhang, durch Zauberwerk in menschliche Gestalt gezwängt. Er hatte nie zuvor einem Na’Darrach gegenübergestanden, dennoch wusste er sofort, womit er es zu tun hatte. Finstere Magie. Aladar hatte ihn gut ausgebildet. Obwohl Daith kein Gelehrter war, wusste er einiges über die dunklen Künste und ihre Auswüchse. Sichtlich hat Aladar vergessen, einige Details dieses Auftrags zu erwähnen. Der Na’Darrach war noch nicht zu voller Macht und Größe gelangt, sodass es Daith nicht schwerfiel, sich zu behaupten. Noch ehe die Kreatur angreifen konnte, schlug er ein weiteres Mal zu. Die Klinge traf ihr Ziel und vernichtete es. Mit einem wütenden Kreischen verblasste der Na’Darrach zu einer Erinnerung.
Mit dem Schwert in der Hand wandte sich Daith dem Mädchen zu. Die Bewusstlosigkeit hatte die Anspannung aus ihren Zügen schwinden lassen. Ihr Haar und ihre Gewänder waren nass vom Regen. Winzige Tropfen sammelten sich auf ihren Wangen und rannen wie Tränen über ihr Gesicht. Ihr Brustkorb hob und senkte sich unter regelmäßigen Atemzügen. Während er sie betrachtete, drängte sich die Erinnerung an Myles’ letzte Augenblicke in seinen Geist. Einmal mehr sah er ihn vor sich, wie er um jeden weiteren Atemzug gerungen hatte, während das Leben seinem Körper entströmte. An seinem eigenen Blut erstickend hatte er die wenigen Worte hervorgepresst, die Daith veranlasst hatten das Mädchen zu jagen. Blinzelnd verdrängte er die Bilder. Der Schleier der Vergangenheit lichtete sich und eröffnete ihm erneut den Blick auf das bewusstlose Mädchen.
Schwer wog das Schwert in seiner Hand. Ein rascher Hieb … Er setzte ihr die Klinge an die Kehle. Nur ein einziger, kraftvoller Stoß. Das Mädchen regte sich. Er zog die Klinge ein Stück zurück. Tu es, verdammter Narr! Jetzt! Doch er zögerte. Sie schlug die Augen auf und starrte auf die Schwertspitze, die über ihr hing. Eine Mischung aus Furcht und Verwirrung zeichnete ihre Züge. Da wurde ihm bewusst, dass sie ihn für den Angreifer halten musste. »Er ist weg.« Es gelang ihm nicht, die Abscheu aus seiner Stimme zu bannen.
Ihr Blick wanderte die Klinge entlang zu seinem Gesicht. Mit der freien Hand zog er die Kapuze zurück. Sie sollte sehen, mit wem sie es zu tun hatte. In ihren Augen zeigte sich nicht das geringste Anzeichen von Erkennen. Erneut heftete sich ihr Blick auf die Spitze seines Schwertes. »Hast du vor mich abzustechen oder nimmst du das Ding da weg?« Sie gab sich alle Mühe, furchtlos und trotzig zu klingen. Ohne ihn aus den Augen zu lassen, erhob sie sich. Ihre Miene mochte unbewegt und ruhig wirken, doch das Zittern ihrer Hände strafte ihre zur Schau gestellte Gelassenheit Lügen. Als sie seinen Blick bemerkte, verschränkte sie hastig die Arme vor der Brust. »Was ist geschehen?«
Der Augenblick des Hasses war endgültig verflogen. Die Zeit seiner Rache würde kommen. Jetzt hatte er einen Auftrag zu erfüllen. Er zog die Waffe zurück. »Du wurdest angegriffen.«
»Ist er geflohen?«
»Tot.«
Misstrauen flackerte in ihren Augen. »Ich sehe keine Leiche.«
»Es gibt keine«, entgegnete er knapp. »Komm, ich bringe dich in Sicherheit.«
Sie wich einen Schritt zurück.
Er ist tot und es gibt keine Leiche! Er unterdrückte einen Fluch. Mit einer derartigen Glanzleistung werde ich sie sicher dazu bewegen, mir zu folgen.
»Womöglich hast du mich überfallen und suchst jetzt nach einem Vorwand …«
»Ich brauche keinen Vorwand. Ich habe ein Schwert. Jetzt komm endlich. Es werden bald weitere kommen.« Ehe er die Worte ausgesprochen hatte, war es ihm nicht bewusst gewesen. Jetzt wusste er mit Sicherheit, dass dieser Angriff nicht der einzige bleiben würde. Jemand hatte es auf das Leben des Mädchens abgesehen. Jemand, der nicht davor zurückschreckte, sich finsterer Magie zu bedienen. Warum sollte er sich mit einem einzigen Na’Darrach zufriedengeben?
Ihr Blick glitt über seine Schulter, ihre Augen weiteten sich. »Da ist er wieder!«
Daith fuhr herum und spähte in die Dunkelheit. Von ein paar Schatten abgesehen gab es dort nichts. Angestrengt starrte er in die Gasse. Nachdem er endgültig überzeugt war, dass sie sich geirrt haben musste, wandte er sich ihr wieder zu. »Da ist nie…« Das Mädchen war verschwunden. »Verdammte Kröte!«
*
Sobald sie um die Ecke war, begann Cait zu rennen. Nachdem sie den Marktplatz weit hinter sich gelassen hatte, verbarg sie sich in einer dunklen Nische. Zitternd vor Angst und Kälte presste sie sich an die Wand und wartete.
Sie war nicht gänzlich überzeugt, dass der Kerl mit dem Schwert sie überfallen hatte. Sie hatte das Gesicht des Räubers nicht gesehen. Sie erinnerte sich, dass sie mit jemandem zusammengeprallt war. Im nächsten Augenblick hatte sie sich auf dem Boden wiedergefunden und mit einem Angreifer gerungen. Es war kalt geworden und dann war da dieses seltsame Gefühl gewesen. Als hätte der Angriff mir alle Kraft geraubt.
Womöglich hatte dieser Kerl sie nicht überfallen. Das war noch lange kein Grund, ihm zu vertrauen. »Ich bringe dich in Sicherheit«, hatte er gesagt. In Sicherheit wovor? Je länger sie darüber nachdachte, desto mehr gelangte sie zu der Überzeugung, dass sie ihn schon einmal gesehen hatte – im Lachenden Kobold. Er hatte sie beobachtet und getrunken. Selbst im Regen hatte sie den Geruch von Alkohol deutlich wahrgenommen.
Sie beugte sich vor und riskierte einen Blick in die Gasse. Niemand war zu sehen. Allmählich fiel die Anspannung von ihr ab. Es war spät geworden. Sie war müde und erschöpft. Der Gedanke an ihre trockene Kammer und ein warmes Nachtlager trieb sie schließlich aus ihrem Versteck. Als sie wenig später die Gasse erreichte, in der sich ihre Herberge befand, hielt sie an einer Hausecke inne und sah sich um. Alles war, wie es sein sollte: ruhig und verlassen. Erleichtert schlüpfte sie durch die Tür in die Dunkelheit der leeren Gaststube. Mit sicheren Schritten durchquerte sie den Raum und stieg die knarrenden Stufen nach oben. Dort war es kalt. Durch ein kleines Fenster fiel ein schmaler Streifen Mondlicht auf den Gang. Dunkle Schatten duckten sich in den Ecken. Für einen Moment schien es, als würden sie sich bewegen. Sie schalt sich selbst eine Närrin. Nachdem ihr dieser Trunkenbold einen derartigen Schrecken eingejagt hatte, war es nicht verwunderlich, dass sie nervös war. Dennoch konnte sie sich des Eindrucks nicht erwehren, dass dort in der Dunkelheit etwas lauerte. Die Schatten schienen zu wachsen und näher zu kommen. Zoll um Zoll fraßen sie das Licht und krochen unter der Decke und an den Wänden entlang. Blinzelnd starrte sie in die Ecken. Nein, die Schatten bewegten sich nicht. Sie war müde. Ihre Augen hatten ihr einen Streich gespielt.
Es werden bald weitere kommen.
Womöglich war es ein Fehler gewesen davonzulaufen, ohne zu wissen, wovon er sprach. Unsinn! Entschlossen straffte sie die Schultern und ging weiter, doch die Unruhe blieb und sie beschleunigte ihre Schritte. Endlich an ihrer Kammer angekommen, öffnete sie die Tür. Ein kühler Luftzug schlug ihr entgegen. Der Anblick des offenen Fensters ließ sie auf der Schwelle erstarren. Sie hatte es geschlossen, ehe sie gegangen war.
Habe ich das wirklich?
Sie wusste, dass sie es getan hatte. Es hatte geregnet.
Das Gefühl, nicht allein zu sein, kehrte mit aller Macht zurück. Womöglich hatte sie sich eingebildet, dass etwas in den Schatten lauern mochte. Ganz sicher war jemand in ihrer Kammer.
Ich muss von hier fort. Der Gedanke an die Schatten auf dem Gang ließ sie zögern. Eine Hand schoss aus der Dunkelheit ihrer Kammer hervor, legte sich fest über ihren Mund und erstickte den entsetzten Schrei, der über ihre Lippen kroch. Ein zweiter Arm schlang sich um ihre Taille und zerrte sie in den Raum. Die Tür wurde zugestoßen. Strampelnd versuchte sie sich zu befreien, doch der Griff schnürte ihr die Luft ab und verdammte sie zur Reglosigkeit. Der Geruch von Alkohol stieg ihr in die Nase. »Sei still!«, zischte er und presste sie an sich, bis sie sich kaum mehr bewegen konnte. »Sie sind hier!«
Sie wusste nicht, was sie glauben sollte. War er nun der Räuber aus der Gasse, der versuchte sie mit einem Trick zum Schweigen zu bringen, oder lauerte dort draußen wirklich etwas in den Schatten?
»Spürst du nicht, dass wir nicht allein sind?« Sein Mund war dicht neben ihrem Ohr, dennoch sprach er so leise, dass sie Mühe hatte, ihn zu verstehen. »Ich werde dich jetzt loslassen. Mach keine Dummheiten, sonst sind wir tot. Dieser hier ist größer als der Letzte.«
Die Schatten. Als er sie freigab, schrie sie weder um Hilfe noch versuchte sie zu fliehen.
Er verriegelte die Tür und deutete auf das Fenster. »Verschwinden wir.«
Ein lautes Krachen riss sie aus ihrer Erstarrung. Etwas schlug gegen die Tür – wieder und wieder. Das Holz erzitterte unter dem mächtigen Ansturm. Cait lief zum Fenster, schwang die Beine hinaus und reichte ihm die Hände. Er beugte sich weit nach vorne und ließ sie Stück für Stück hinunter. Ohne Vorwarnung ließ er los. Sie landete unsanft in der Gasse, tat einen taumelnden Schritt zur Seite und prallte mit der Schulter gegen eine Mauer. Gerade als sie sich fragte, ob sie davonlaufen sollte, landete er neben ihr auf dem Pflaster. Mühelos federte er ab und stand sofort sicher auf den Beinen. Er schob sie um die Ecke, zu einem Pferd. Wortlos saß er auf, packte sie beim Arm und zog sie vor sich in den Sattel. Oben, in ihrer Kammer, zerbarst krachend die Tür.
Er trat das Tier in die Flanken. Der schwarze Hengst preschte los. Hufgeklapper, dröhnend von den Wänden zurückgeworfen, begleitete sie auf ihrer Flucht durch die nächtlichen Gassen. Sie verließen die Stadt durch ein Tor in der Nähe des Hafens. Er jagte das Pferd über den Strand, bis sie einen Abhang erreichten, der sie auf die Straße führte. Felder, Wiesen und Wälder flogen an ihnen vorüber. Der Wind trieb ihr den Regen ins Gesicht, winzigen, spitzen Nadeln gleich. Bald kehrte die Müdigkeit zurück. Ihre Finger krallten sich in die Mähne, während sie sich bemühte, die Augen offen zu halten.
Schließlich zügelte er den Hengst und sprang ab. »Wir übernachten hier.«
Erst da sah sie den Unterstand am Wegesrand. Ein windschiefes Dach auf Stützpfeilern, darunter ein Haufen Stroh. Erleichtert, dem Regen wenigstens für eine Weile zu entkommen, trat sie unter das Dach. Er führte seinen Hengst ins Trockene, öffnete eine Satteltasche und zog eine Decke hervor. Der Anblick weckte in ihr die Sehnsucht nach Wärme. Sie konnte es kaum erwarten, sich in den groben Stoff zu hüllen, um die Kälte aus ihren Gliedern zu vertreiben. Statt ihr jedoch die Decke zu geben, warf er seinen nassen Umhang zur Seite und wickelte sich selbst darin ein. Nass und frierend kroch sie ins Heu, so erschöpft, dass sie trotz der Kälte sofort einschlief.
3
Der Morgen graute bereits, als er sie mit der Stiefelspitze in die Seite stieß. »Steh auf! Wir müssen weiter!«
Kaum war sie wach, ging er zu seinem Pferd. Bei Licht betrachtet wirkte er nicht mehr wie ein Trunkenbold. Wenngleich er sich die lange Narbe, die sich über seine linke Wange zog, durchaus im Suff zugezogen haben konnte. Entgegen ihrer Erwartungen war seine Kleidung sauber und ordentlich. Er trug schwarze Lederhosen und hohe Reitstiefel. Ein weißes Hemd unter einer schwarzen Weste, darüber einen Waffengürtel mit Schwert und Dolch. Beides in einer mit silbernen Ornamenten verzierten Lederscheide. Er war nicht schön, nicht einmal gut aussehend. Womöglich wäre er ihr anders erschienen, hätte er sie in diesem Moment nicht angesehen. Die herablassende Arroganz in seinem Blick verlieh ihm etwas Lebloses und Grausames. Diese kalten, grauen Augen. Die Vorstellung, länger als nötig in der Nähe dieses Mannes zu bleiben, behagte ihr nicht.
Der Regen hatte nicht nachgelassen. Ein steter Wasserstrom rann über die Dachkante und sammelte sich in großen Pfützen auf dem Boden. Ihre Gewänder waren klamm und kalt. Frierend erhob sie sich. »Es ist besser, wenn wir uns trennen«, sagte sie mit aller Entschlossenheit, die sie aufbringen konnte. »Danke für deine Hilfe.« Sie machte kehrt.
»Willst du noch weiteren von denen begegnen?«
Sie wandte sich noch einmal um. »Nein, das will ich nicht. Allerdings ist mir auch nicht nach der Gesellschaft eines Fremden.«
»Ich bin Daith Landévennec.«
»Cait.« Erst da bemerkte sie seinen Blick. Als erwartete er eine bestimmte Reaktion von mir. Sie runzelte die Stirn. »Warum siehst du mich so an?«
»Was meinst du?«
»Ich weiß nicht«, sie zuckte die Schultern. »Als würdest du erwarten, dass ich dich kennen müsste.«
»Und? Kennst du mich?«
Der Unterton ließ sie aufhorchen. Sie hatte ihn nie zuvor gesehen, dennoch erklang jetzt eine warnende Stimme in ihrem Inneren. Es gab ein Leben, das weiter zurücklag als die vergangenen Monate. Was, wenn sie ihn aus jener Zeit kennen müsste? Einer Zeit, an die sie nicht die geringste Erinnerung hatte. Ihr Leben hatte vor vier Monaten am Ufer eines Flusses begonnen, als sie von ein paar Gauklern bewusstlos aus dem Wasser gezogen wurde. Ohne die Hilfe dieser Menschen hätte sie ihr Leben verloren. In gewisser Weise hatte sie das auch, denn sie konnte sich an nichts erinnern, was davor geschehen war. Sie wusste weder, wer sie war, noch woher sie kam. Sie wusste nicht einmal, ob Cait ihr richtiger Name war. Als man sie fand, hatte sie einen Ring am Finger getragen. Ein kostbares, silbernes Stück, auf dessen Innenseite sich eine Inschrift befand: Cait. Da sie den Gauklern keinen Namen nennen konnte, hatten sie sie nach der Inschrift benannt. Sie bezweifelte, dass der Ring tatsächlich ihr gehörte. Ihre zerschlissenen Gewänder mochten so gar nicht zu dem kostbaren Schmuckstück passen. Dennoch trug sie ihn immer bei sich, denn er war die einzige Verbindung zu ihrer Vergangenheit. Abgesehen von den Narben. Große hässliche Narben, die ihren Rücken entstellten und von denen sie nicht wusste, woher sie stammten.
Sie hatte versucht etwas über sich selbst zu erfahren, hatte jeden in der Nähe des Flusses befragt, war jeder Spur gefolgt, so klein und unbedeutend sie auch erscheinen mochte. Ihre Vergangenheit blieb hinter einem weißen Nebel verborgen. Es war, als hätte sie vor jener Nacht niemand gesehen. Als hätte mich der Fluss erst in die Welt gespuckt.
»Nein«, sagte sie nach einer langen Pause. »Ich kenne dich nicht. Sagst du mir jetzt, was dieser merkwürdige Blick zu bedeuten hat?«
»Deine Augen. Sie sind blau«, sagte er. »Gestern Nacht dachte ich, sie wären schwarz.«
»Nachdem das geklärt ist – leb wohl.«
Er hielt sie unsanft am Arm zurück. Sie entzog sich ihm mit einem Ruck. »Wir müssen nach Cor Amánthor.«
Wo, zum Henker, ist Cor Amánthor? Sie verzog keine Miene. »Was soll ich dort?«
»Es gibt jemanden, der mit dir sprechen will.«
Ihr Herz raste vor Aufregung, als ihr die Bedeutung seiner Worte bewusst wurde. Wo immer dieses Cor Amánthor sein mochte, dort gab es jemanden, der ihr sagen konnte, wer sie war. Jemanden, der die Antworten auf all ihre Fragen kannte. »Sag mir seinen Namen«, verlangte sie in gezwungener Ruhe.
Er schüttelte den Kopf. »Es ist mein Auftrag, dich zu ihm zu bringen.«
Auftrag? »Du bist Söldner.«
Daith zog eine Augenbraue in die Höhe. Eine gefährlich ruhige Geste, die ihn nur bedrohlicher erscheinen ließ. »Und?«
Einem Söldner vertraut man noch weniger als einem Trinker. Um ein Haar hätte sie es ausgesprochen. »Ich kann dich nicht bezahlen.«
»Ich werde bezahlt«, entgegnete er. »Viel größer sollte die Sorge um deine Sicherheit sein.«
Das ist sie. Glaub mir, das ist sie. Sie sah die Entschlossenheit in seinen Zügen und wusste, dass es nichts mehr zu sagen gab. Er würde sie nicht ziehen lassen. Und wohin hätte sie gehen sollen? Solange er ihr nicht den Namen seines Auftraggebers verriet, war sie an ihn gebunden – auch wenn es ihr nicht behagte. Daith Landévennec hatte etwas an sich, das ihr nicht gefiel. Allein seine Blicke weckten ihren Zorn. Von seinem Ton und der Tatsache, dass er sie wie ein Tier mit einem Tritt geweckt hatte, ganz zu schweigen.
Endlich stellte sie die Frage, deren Antwort sie fürchtete. »Wer hat mich angegriffen?«
»Götter, wie naiv bist du eigentlich! Erkennst du nicht, dass es kein Wer, sondern ein Etwas war?« Er blickte aus zusammengekniffenen Augen auf sie herab. »Du elende Kröte hast keine Ahnung!« Er klang beinahe erstaunt.
Elende Kröte? »Wenn ich es wüsste, würde ich kaum fragen! So sehr bist du mir nun auch nicht ans Herz gewachsen, dass ich nicht bestens ohne dein unfreundliches Gebell auskommen könnte!«
»Hüte deine Zunge!«
Sie begegnete seinem finsteren Blick ungerührt. Sein Auftreten ließ keinen Zweifel daran, dass er es nicht gewohnt war, dass ihm jemand die Stirn bot.
»Es mag mein Auftrag sein, dich nach Cor Amánthor zu bringen. Niemand hat behauptet, dass ich das gerne tue. Wenn du also eine halbwegs angenehme Reise haben möchtest, hältst du dich besser zurück!« Seine Hand schnellte vor. Seine Finger gruben sich in ihren Arm. »Wenn du mir Ärger machst, wirst du dir bald wünschen tot zu sein!«
Sie sah ihn noch immer mit unbewegter Miene an. »Verrätst du mir jetzt, was mich verfolgt?«
Es kostete ihn einen Augenblick, seine Wut zu überwinden. »Man nennt sie Na’Darrach – Nachtschatten, denn genau das sind sie: nicht mehr als ein Schatten ihres einstigen Seins und doch gefährlicher, als du dir vorzustellen vermagst«, erklärte er nach einer Weile und zog seine Hand zurück. »Ihre Berührung ist kühl und raubt dir das Bewusstsein. Sie saugen dir das Leben aus dem Leib und ziehen ihre Macht daraus.« Ein eisiger Schauder kroch ihr Rückgrat hinab. War es nicht genau das, was sie verspürt hatte, ehe sie das Bewusstsein verloren hatte – eine kühle Berührung?
Daith fuhr fort: »Sie sind die Seelen Toter, denen der Weg auf die Andere Seite durch finsteres Zauberwerk verwehrt bleibt – gebunden an jenen, der sie rief, bis ihr Auftrag erfüllt oder ihre Existenz vernichtet ist.«
Ihr Interesse, Daith zu provozieren, war schlagartig verflogen. »Du meinst, es gibt jemanden, der mächtig genug ist, die Pforten zur Anderen Seite verschlossen zu halten? Wer sollte so etwas tun?« Unzählige Fragen stürzten auf sie herein. Alles was sie hervorbrachte, war: »Warum ich? Warum verfolgen sie mich?«
»Wenn du das nicht weißt, wer sollte es dann wissen?«
Sie fühlte sich, als hätte ihr jemand den Boden unter den Füßen weggezogen. »Ich … gibt es noch mehr über diese Kreaturen zu wissen?«
»Sie können unterschiedlich stark sein. Der Na’Darrach, der dich in der Gasse überfallen hat, war nicht groß. Es war nicht schwer, mit ihm fertigzuwerden. Die Großen sind in der Lage, Waffen zu führen.«
»Ich dachte, sie wollen meine Lebenskraft. Was sollen sie da mit einer Waffe?«
»Wenn so eine Kreatur angreift, verlierst du schnell das Bewusstsein. Lebenskraft auszusaugen dauert länger«, erklärte er ungeduldig. »Wenn es ihr Auftrag ist, dich zu töten, werden sie einen schnelleren Weg suchen.«
Sein Gerede über Na’Darrach erschreckte sie so sehr, dass sie sich nicht länger widersetzte, als er schließlich zum Aufbruch mahnte.
Bleigraue Wolken verdunkelten den Himmel und spuckten dicke Regentropfen. Ein kalter Wind fegte zwischen den Bäumen hindurch. Der Regen hatte die Straße so sehr aufgeweicht, dass sie gezwungen waren das Pferd zu führen. Schlamm saugte sich schmatzend unter ihren Sohlen fest und spritzte bei jedem Schritt auf. Schon bald waren ihre Stiefel und der Saum ihres Kleides mit einer dicken Kruste überzogen.
»Hat dein Pferd einen Namen?«
»Was geht dich das an!«
Sie verdrehte die Augen. »Sag nicht, dass dich noch nie einer nach dem Namen deines Pferdes gefragt hat.«
Daith’ Aufmerksamkeit galt der Straße. Im trüben Tageslicht wirkte seine Miene steinern. »Ich begegne nicht vielen Menschen.«
Das glaub ich dir sofort. »Erzähl mir nicht, dass du keine Freunde in Cor Amánthor hast.« Sie konnte sich kaum vorstellen, dass er irgendwo Freunde haben könnte. Sie wollte das Gespräch lediglich auf Cor Amánthor lenken.
Er sah sie kurz an, ehe er den Blick sofort wieder auf den Weg richtete. »Kümmere dich um deine eigenen Angelegenheiten, verdammte Kröte!«
Glaube mir, das ist meine Angelegenheit. Sie änderte ihre Vorgehensweise. »Wie lange werden wir unterwegs sein?«
»Vier Wochen, wenn wir schnell sind.«
Um ein Haar hätte sie einen Schrei ausgestoßen. Der Gedanke, mehrere Wochen in Daith Landévennecs Gesellschaft zu reisen, ließ ihren Mut schlagartig sinken. »Eine lange Zeit«, bemerkte sie vorsichtig, nachdem sie ihren Schrecken ein wenig überwunden hatte. »Ich wüsste gerne, wer Interesse daran haben sollte, mit mir zu sprechen.« Als sie seinen bohrenden Blick bemerkte, beschloss sie, dass es besser war, den Verlust ihrer Erinnerung vorerst für sich zu behalten. Hastig fügte sie hinzu: »Ich meine, es gibt da ein paar Leute, die in Frage kämen …«
Sie fragte sich, wie viel Daith über seinen Auftraggeber wusste. Vielleicht kaum mehr als seinen Namen. Er wirkte nicht, als kenne er die Hintergründe seines Auftrages.
Eine Weile gingen sie schweigend nebeneinander her. »Parlan«, sagte er und riss sie aus ihren Gedanken. Sie blickte ihn verwirrt an. »Das Pferd.«
Es erstaunte sie, dass er sich zu einer Antwort hatte hinreißen lassen. Das war ein Anfang. Womöglich war es an der Zeit, ihm die Hand zu reichen. »Warum schließen wir nicht Frieden? Ich höre auf, dich zu provozieren, und du benimmst dich ein wenig freundlicher. Es wäre ein Anfang, wenn du aufhörst, mich anzublaffen oder wach zu treten. Und nenn mich nicht Kröte! Mein Name ist Cait.« Sie sah ihn an. »Was hältst du davon?«
»Nichts.«
»Warum benimmst du dich, als würdest du mich für etwas bestrafen wollen? Du kennst mich nicht einmal!« Seine Miene verfinsterte sich, doch sie war nicht bereit aufzugeben. »Findest du nicht, dass du mir eine Antwort schuldig bist?«
»Ich bin dir überhaupt nichts schuldig!«
Sein Blick hielt sie davon ab, weitere Fragen zu stellen. Sie verstand sein Verhalten nicht. Sie verstand ihn nicht. Zweifelsohne hatten sie einander nicht ins Herz geschlossen. Was sie jedoch in der kalten Glut seiner Augen sah, ging über bloße Ablehnung hinaus. Es war blanker Hass.
Als sie am Abend eine Schenke erreichten, war sie müde und durchgefroren. Im Gastraum war es heiß und stickig. Der Geruch von Eintopf hing in der Luft und mischte sich mit den Ausdünstungen von Ale und Schweiß. Daith bahnte sich einen Weg zu einem freien Tisch und ließ sich nieder. Cait setzte sich ihm gegenüber. Sie saßen kaum, da erschien der Wirt. Die Lippen zu einem Lächeln verzogen wandte er sich an Daith. »Was kann ich Euch und Eurer Dame bringen?«
»Ale und Eintopf.«
Der Wirt nickte. »Ich habe Euch hier noch nie gesehen.«
»Nur Ale und Eintopf«, sagte Daith. »Wenn ich eine Unterhaltung will, werde ich eine bestellen.«
Mit einem Kopfschütteln schlurfte der Wirt davon, nur um kurz darauf mit zwei Humpen Ale zurückzukehren. Sein Blick blieb an Daith’ Waffengürtel hängen. »Ein schönes Schwert tragt Ihr da, Herr. Sicher sehr kostbar. Es …« Daith’ Blick ließ ihn verstummen. Hastig machte er kehrt, holte den Eintopf und verschwand sogleich wieder. Daith griff nach dem Löffel und begann zu essen.
Cait warf einen Blick auf ihr Ale. Sie war nicht durstig genug, als dass sie es über sich gebracht hätte, aus dem schmutzigen Humpen zu trinken. »Ich weiß, dass du mich nicht ausstehen kannst«, meinte sie nach einer Weile. »Ich frage mich allerdings, warum du andere Menschen ebenso unfreundlich behandelst wie mich.«
Er ließ den Löffel sinken und sah sie an. »Ich werde mit dir nicht über mein Benehmen diskutieren. Ich werde überhaupt nichts mit dir diskutieren, Kröte. Ich treffe die Entscheidungen. Du wirst tun, was ich sage, sonst …«
»Sonst was? Lässt du mich allein weiterreisen? Nur zu! Ich kann mich nicht erinnern, um deine Begleitung gebeten zu haben!« Daith richtete seine Aufmerksamkeit wieder auf seinen Eintopf und aß ohne ein Wort weiter. »Du bist mit Sicherheit der sturste Kerl, dem ich je begegnet bin«, knurrte sie über den Tisch hinweg.
Als der Wirt später kam, um abzuräumen, fragte Daith nach einem Zimmer für die Nacht. Der Wirt führte sie zum Fuß der Treppe und deutete nach oben. »Folgt dem Gang. Dort oben befindet sich die Dachkammer, mein Spezialgemach für Pärchen wie euch«, meinte er zwinkernd.
Seine Bemerkung ignorierend setzte Daith einen Fuß auf die erste Stufe. Der Wirt vertrat ihm den Weg. »Bezahlung im Voraus.«
Cait erwartete, dass Daith sich weigern würde. Doch statt den Mund zu öffnen, öffnete er seine Börse und drückte dem Wirt ein paar Münzen in die Hand. Ohne ein weiteres Wort ging er nach oben. Cait wollte ihm folgen. Dabei streifte sie den Wirt am Arm. Die Bilder schlugen wie eine Flutwelle über ihr zusammen und rissen die Wirklichkeit fort. Mit einem Mal waren der Schankraum und die Treppe verschwunden, als wären sie ausgelöscht. Sie sah eine kleine Kammer, gerade hell genug, um einige Umrisse zu erkennen. Daith lag auf einem Strohlager und schlief. Als die Tür geöffnet wurde, fiel der unstete Schein eines Nachtlichts in den Raum. Vier Gestalten huschten herein. Schatten wuchsen zur Decke, als einer ausholte und mit seinem Knüppel auf Daith eindrosch. Daith’ Kopf fiel zur Seite. Er regte sich nicht mehr. Einer griff nach Daith’ Waffen und seiner Börse. Ein anderer durchwühlte seinen Rucksack. Da sah sie sich selbst. Aufgeschreckt vom Knarren der Dielen setzte sie sich auf. Einer fuhr herum. Eine Dolchklinge blitzte auf, kurz bevor er ihr die Waffe in die Brust stieß. Mit einem Aufschrei fuhr sie zurück.
»Ist mit Euch alles in Ordnung?« Blinzelnd sah sie sich um. Langsam lichtete sich der Schleier vor ihren Augen. Vor ihr stand der Wirt, eine Hand auf ihrem Arm. »Geht es Euch gut?« Er beäugte sie argwöhnisch.
Wenn wir hier bleiben, werden wir sterben. »Müde«, stammelte sie. »Ich bin nur müde.« Sie streifte seine Hand ab und floh nach oben. Sie musste die Kammer nicht betreten, um zu wissen, wie sie aussah. Das Nachtlicht auf dem Gang, die kleine Dachluke, die beiden Strohlager auf dem Boden. Innerhalb dieser Wände wartete der Tod. Sie blieb auf der Schwelle stehen. »Hier können wir nicht bleiben!« Die Angst schnürte ihr die Kehle zu. »Wir werden sterben, wenn wir hier bleiben.«
Daith schob sie in den Raum und schloss die Tür. »Erinnere mich daran, dass ich dich kein Ale mehr trinken lasse.«
»Ich habe nichts getrunken.« Sie trat einen Schritt auf ihn zu. »Ich weiß, wie sich das anhören muss, doch es ist wahr. Ich habe es gesehen. Wir werden sterben.«
»Werde ich dir den Hals umdrehen und mich dann aus Scham in mein Schwert stürzen?«
»Sie werden dich im Schlaf erschlagen. Ich erwache. Einer der Männer wird mich erdolchen.«
»Eine nette Schauergeschichte, Erzählerin. Nur verfehlt sie ihre Wirkung auf mich.«
Ihr Blick glitt zur Tür.
»Denk nicht einmal daran!« Sie fuhr zusammen, als Daith sie am Handgelenk packte. »Oder willst du die Nacht gefesselt verbringen?«
Sie schüttelte hastig den Kopf. »Bitte, Daith, du musst auf mich hören! Wir sind in großer Gefahr!«
Er stieß sie zu einem der Strohlager. Jenem Lager, das sie nicht mehr lebend verlassen würde. »Ich will nichts mehr davon hören! Leg dich hin und schlaf oder halte zumindest den Mund!«
»Daith, bitte! Die Vision …«
»Bist du taub?«, bellte er.
Fest entschlossen nicht einzuschlafen sank sie auf die Matratze. Ich habe dich gewarnt, Landévennec.
*
Spät in der Nacht lag Daith noch wach und starrte an die dunkle Zimmerdecke. Warum war sie nicht imstande, ihr vorlautes Mundwerk in Zaum zu halten? Ständig versuchte sie ihn in eine Unterhaltung zu drängen. Jetzt behauptete sie auch noch, Visionen der Zukunft zu haben. Lächerlich! So konnte sich nur eine Geschichtenerzählerin benehmen. Die Theatralik, die sie an den Tag legte, war nur noch durch einen Barden zu überbieten. Dennoch … Sie scheint zu glauben, was sie sagt. Er hatte ihren Blick gesehen. Sie hatte Angst.
Er hörte, wie sie sich unruhig hin und her wälzte. Wenn das alles nur ein übler Streich ist, mit dem du mich um meine Nachtruhe bringen willst, wirst du dafür bezahlen. Er verzog das Gesicht. Ist das nicht, was ich will? Sie bezahlen zu lassen? Er hatte von Anfang an gewusst, dass es nicht leicht werden würde, ihre Nähe zu ertragen. Sie nur anzusehen riss kaum geheilte Wunden erneut auf. Einzig Aladars Worte hielten ihn davon ab, sie zu töten. Du hast niemals gesehen, ob sie eine Waffe gegen ihn erhoben hat! Du würdest dich wundern, wenn du wüsstest, wie viel Mut und Opferbereitschaft in ihr stecken. Einem stillen Gebet gleich rief er sich diese Worte immer wieder ins Gedächtnis. Warum war sie für Aladar so wichtig? Was schert es mich, welche Bedeutung sie für ihn hat! Wenn er mit ihr fertig ist, gehört sie mir. Dann wird mich nichts mehr daran hindern, meine Rache zu Ende zu bringen.
Sie hatte ihn nicht erkannt, was nicht weiter verwunderlich war, denn in jener Nacht am Fluss hatte er eine Kapuze getragen, und davor – an Myles’ Todestag – hatte sie ihn nur für wenige Augenblicke in einem schattigen Gang zu Gesicht bekommen. Dennoch war etwas an ihrem Auftreten seltsam. Wie misstrauisch sie ihn beäugte – auch wenn sie sich bemühte, es zu verbergen. Als würde sie sich ständig fragen, ob sie mich kennen müsste. Sie schien nicht zu wissen, wo Cor Amánthor lag oder wer mit ihr sprechen wollte. Immer wieder versuchte sie ihn auszufragen. Sie lauerte darauf, dass er Aladars Namen preisgab. Und sobald ich das tue, wird sie sich aus dem Staub machen.
Draußen knarzte eine Diele. Sofort schlossen sich seine Finger um den Griff seines Schwertes. Lautlos kam er auf die Beine. Neben ihm setzte sich Cait auf. Im Mondlicht sah er die Erleichterung in ihren Zügen, als sie bemerkte, dass er wach war. Er wies mit der freien Hand auf das Fenster und bedeutete ihr, auf das Dach hinauszuklettern. Sie reagierte sofort. Einen Augenblick später vernahm er einen gedämpften Fluch. »Zugenagelt!«
Das also meinte der Wirt, als er von seinem Spezialgemach sprach. Daith packte sie am Arm und zog sie mit sich hinter die Tür. Leise schwang die Tür auf. Er wartete, bis der Letzte der vier Männer in den Raum trat. Dann löste er sich aus den Schatten. Er versetzte dem, der ihm am nächsten war, einen kräftigen Stoß mit dem Schwertgriff. Taumelnd prallte er gegen seine Kameraden und brachte sie zu Fall. Dilettanten! Daith’ Angriff hatte die Männer überrumpelt. Hilflos stolperten sie übereinander. Knüppel und Dolche fielen zu Boden. Legt euch besser nicht mit jemandem an, der den Tod nicht fürchtet.
»Hol das Pferd!«, befahl er dem Mädchen.
Sie schoss an ihm vorbei, den Gang entlang. Daith trat aus der Kammer, warf die Tür zu und schob eine Kommode davor. Das würde sie für eine Weile aufhalten. Wenn sie mir einen Vorsprung lassen, retten sie ihr Leben. Er machte kehrt und stürmte die Treppen hinunter. Die letzten Stufen überwand er mit einem Satz, durchquerte den Schankraum und stürmte auf den Hof. Im Mondlicht erkannte er zwei Männer, die versuchten Cait in die Enge zu treiben. Mit Knüppeln bewaffnet drängten sie sie immer weiter zurück.
Daith stieß einen schrillen Pfiff aus. Kurz darauf galoppierte Parlan heran – abgesattelt. Daith steckte sein Schwert weg, griff in die Mähne und schwang sich auf den Pferderücken. Ein sanfter Druck, schon schoss der Hengst über den Hof auf die Scheune zu. Daith sprengte zwischen den Männern hindurch. Einer brachte sich mit einem Sprung in Sicherheit. Den anderen trat er im Vorüberreiten nieder, riss das Pferd herum und trieb es zurück. Er beugte sich zur Seite und reckte Cait die Hand entgegen. Ihre Finger schlossen sich um sein Handgelenk. Er nahm die andere Hand zu Hilfe, bekam sie zu fassen und setzte sie vor sich aufs Pferd.
»Festhalten!« Er trat Parlan in die Flanken und jagte ihn über den Hof. Die Männer fluchten und riefen durcheinander, doch keiner folgte ihnen.
Als die Schenke weit genug hinter ihnen lag, zügelte er Parlan und führte ihn von der Straße. Es war zu gefährlich, im Dunkeln weiterzureiten. »Wir lagern hier.« Er sprang ab, ging zu einem Baum und ließ sich nieder. Cait setzte sich neben ihn.
»Diese Kerle gehörten nicht zu dem, der die Na’Darrach gesandt hat. Dazu waren sie zu schwach. Ich frage mich, was sie wollten«, sagte er mehr zu sich selbst.
Sie sah auf. Belustigung blitzte in ihren hellen Augen. »Was sie wollten? Ist das so schwer zu erraten? Du hast doch gehört, wie der Wirt dein Schwert bewunderte. Glaubst du etwa, es war Zufall, dass das Fenster vernagelt war?« Sie schüttelte den Kopf. »Das waren gewöhnliche Räuber, sonst nichts.«
»Sonst nichts?« Er runzelte die Stirn. »Solltest du dich nicht fürchten?«
»In deiner Begleitung?« Im ersten Augenblick glaubte er, sie würde ihn verhöhnen, doch ihre Stimme war frei von Spott. Eine Weile saßen sie schweigend da. Sein Blick ruhte auf ihr. Im fahlen Mondlicht sah er, wie ihre Mundwinkel zuckten. Ihre Schultern bebten. Sie bemühte sich krampfhaft, ein Lachen zu unterdrücken.
Er starrte sie an. »Du findest das komisch?«
»Du hättest dein Gesicht sehen sollen!«, platzte es aus ihr heraus. »Was hat dich mehr entsetzt? Die Tatsache, dass wir überfallen wurden oder dass ich es vorhergesehen habe?«
Für eine Weile hatte er ihre Warnung vergessen. Jetzt erinnerte er sich wieder. Ich habe es gesehen. Wir werden sterben. Er konnte nicht verhindern, dass ihm ein Schauer über den Rücken kroch. »Schlaf jetzt«, sagte er barsch und wandte sich ab. »Wir reiten im Morgengrauen weiter.« Er lehnte sich an den Baumstamm und schloss die Augen.
»Warum kannst du mich nicht leiden, Daith?« Ihre geflüsterten Worte trieben durch die Dunkelheit an sein Ohr.
Überrascht öffnete er die Augen. Lange Zeit konnte er nicht antworten. »Ich werde dafür bezahlt, dich nach Cor Amánthor zu bringen. Dich zu mögen ist nicht Teil meines Auftrags.«
»Ich frage lieber nicht, wie hoch der Aufpreis für Freundschaft ist.« Ein wenig leiser fügte sie hinzu: »Hoffentlich kostet es zumindest deine Freunde nichts.«
Sie bezahlen den höchsten Preis. Dafür hatte sein leiblicher Vater gesorgt. Das Vermächtnis dieses unbekannten Mannes lag wie ein dunkler Schatten über seinem Leben. Die Menschen, die um seine Abstammung wussten, hassten ihn. Sie behaupteten, auf ihm lastete ein Fluch, den sein Vater vor seinem Tode über sich und die Seinen gebracht hatte. Die Taten dieses Mannes beherrschten von jeher sein Leben. Beinahe, als hätte ich selbst es getan. Daith ballte die Hände zu Fäusten. Ein Mann, an dessen Gesicht er sich nicht einmal erinnern konnte, hatte ihn zu dem gemacht, der er heute war. Und es gab nichts, das dies ändern konnte. Er hatte es versucht. Er hätte den Tod willkommen geheißen. Suchte ihn sogar. Doch der Tod verschmähte ihn.
4
Cait erwachte mit den ersten Sonnenstrahlen. Überrascht stellte sie fest, dass sie nicht fror. Sie lag dicht an Daith gedrängt. Sein Arm ruhte über ihren Schultern. Selbst im Schlaf wirkten seine Züge verkniffen. Er war nicht der erste Söldner, dem sie begegnet war, ganz sicher aber der ungewöhnlichste. Sie hatte noch nie einen gedungenen Krieger gesehen, der über derart kostbare Waffen verfügte. Abgesehen davon entsprach seine Art zu sprechen nicht dem üblichen rauen Ton, wenngleich er sich Mühe gab, das zu verbergen. Obwohl er sie unfreundlich behandelte, drückte er sich überraschend gewählt aus. Beinahe wie ein Adliger. Welcher Abstammung Daith Landévennec auch sein mochte, ganz sicher war er der geborene Krieger. Sein Auftreten strotzte vor Selbstsicherheit und Gewandtheit. Seine Haltung kündete von Stärke, sowohl geistig als auch körperlich. Jede seiner Gesten und Bewegungen schien zu sagen: Die Welt hat sich meinem Willen zu beugen.
Die Welt mochte das tun, Cait hatte damit ihre Schwierigkeiten. Sie war nicht bereit seine Unfreundlichkeit einfach so hinzunehmen. Seine finsteren Blicke, wenn sie sich nur in Kleinigkeiten gegen ihn auflehnte, entschädigten sie dafür, seine Gesellschaft ertragen zu müssen.
Vorsichtig schob sie seinen Arm zur Seite und erhob sich. Augenblicklich öffnete er die Augen. »Guten Morgen«, sagte sie, als er sich aufsetzte.
Er nickte knapp und sagte: »Wir brauchen neue Ausrüstung.«
»Dann zähl mal deine Barschaft. Ich musste nämlich bereits Kilshannon verlassen, ohne dass mir die Gelegenheit blieb, irgendetwas mitzunehmen.«
»Wir werden zurechtkommen.« Für einen Augenblick betrachtete er sie beinahe nachdenklich. »Woher wusstest du …?«
Sie hatte noch nie zuvor über die Visionen gesprochen. Es fiel ihr schwer genug, sie zu akzeptieren.
Das erste Mal war es geschehen, kurz nachdem sie von ihren Verletzungen genesen war. Sie hatte von einem Händler ein paar Einkäufe entgegengenommen und dabei zufällig seine Hand gestreift, als sich der Anblick einer übel zugerichteten Frauenleiche vehement in ihren Geist drängte. Sie wusste nicht, was die Bilder zu bedeuten hatten. Die Vision erschreckte sie so sehr, dass sie die Flucht ergriff, ohne noch einen Gedanken an ihre Einkäufe zu verschwenden. Ein paar Tage später verbreitete sich die Kunde, der Händler sei eingekerkert worden. Man munkelte, er habe seine Frau ermordet und sei dabei gewesen, ihren Leichnam zu verscharren, als ein Nachbar ihn entdeckt habe.
Nach diesem schrecklichen Erlebnis war es hin und wieder geschehen, dass sie bei einer flüchtigen Berührung vereinzelte Bilder oder Szenen gesehen hatte. Es war, als würden die Emotionen mancher Menschen auf sie überspringen. So wie die Gier des Wirtes oder die Schuldgefühle des Händlers.
»Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll.« Sie geriet ins Stocken und räusperte sich. »Manchmal sehe ich Bilder. Erinnerungen an vergangene Dinge oder – wie letzte Nacht – einen kurzen Blick in die Zukunft.« Und manchmal springen auch meine Emotionen auf jemanden über. »Ich kann es nicht steuern und ich weiß auch nicht, was es ist. Es passiert einfach.«
Die Erklärung schien ihm zu genügen. Er wandte sich ab und ging zu Parlan. Wenig später setzten sie ihren Ritt in Richtung Westen fort. Hatte er gestern zumindest ein paar Worte mit ihr gewechselt, so schien er jetzt jedes Interesse an einer Unterhaltung verloren zu haben. Was sie auch sagte, er hatte nicht mehr als ein übellauniges Brummen für sie übrig. Kopfschüttelnd betrachtete sie ihn. Als er ihren Blick bemerkte, runzelte er die Stirn. »Warum starrst du mich so an?«
»Ich habe mich nur gefragt, warum du bist, wie du bist.«
»Kümmere dich …«
»… um deine eigenen Angelegenheiten, Kröte«, beendete sie seinen Satz und seufzte. »Ich finde den Gedanken nicht sonderlich erhebend, wochenlang diese Art von Gespräch zu führen.«
»Wie wäre es dann mit keinem Gespräch?« Er richtete seinen Blick auf die Straße und schwieg.
Sie verzog das Gesicht und wechselte das Thema. »Glaubst du, wir werden noch einmal etwas wie letzte Nacht erleben?«
Er zuckte die Schultern.
»Nein, Cait«, antwortete sie an seiner Stelle mit tiefer Stimme. »Du musst dir keine Sorgen machen.«
»Danke, Daith. Das beruhigt mich.«
Wieder übernahm sie seinen Teil der Unterhaltung: »Gern geschehen, Cait. Ich …«
»Hör auf mit dem Unsinn!«, fuhr er sie an.
»Unsinn?« Sie schüttelte den Kopf. »Ich führe nur eine nette Unterhaltung.«
»Du führst ein verdammtes Selbstgespräch!«
»Ich antworte wenigstens auf meine Fragen«, entgegnete sie spitz.
Mit einem Ruck brachte er Parlan zum Halten. Seine Augen bohrten sich in ihre wie tausend spitze Nadeln. »Wir werden das jetzt ein für alle Mal klären!«, herrschte er sie an. »Du hast von mir weder Freundlichkeit noch Verständnis oder gar Mitgefühl und Zuneigung zu erwarten. Ich bin nicht an deinen Unterhaltungen interessiert. Ich will keine Geschichten und keine Lieder. Und ich will nicht dein Freund sein. Verdammt, ich kann dich nicht einmal leiden!« Er blickte sie an, finster und drohend. »Habe ich mich deutlich genug ausgedrückt?«
»Herzlichen Dank, ja.« Ihre Stimme klang dünn in ihren eigenen Ohren. Heiße Tränen brannten in ihren Augen. Tränen der Wut. Die Art, wie er sie behandelte, weckte ihren Zorn. Sie fürchtete die Beherrschung zu verlieren, wenn sie sich jetzt auf einen Streit einließ. Wenn ich nur den Namen seines Auftraggebers wüsste. Trotzig reckte sie das Kinn vor, schluckte die Tränen hinunter und richtete den Blick starr auf die Straße.
Gegen Mittag erreichten sie ein Dorf. Sie blieben lange genug, um die Vorräte aufzustocken und sich mit neuer Ausrüstung einzudecken. Am Abend schlugen sie ihr Lager in einem lichten Wäldchen auf. Zu ihrem Erstaunen hatte er nicht nur einen Umhang, sondern auch eine Decke für sie erstanden. Dinge, die sie gut gebrauchen konnte, da er sich entschieden hatte, kein Feuer zu entfachen.
Mit den letzten Sonnenstrahlen verschwand die Wärme. Fröstelnd wickelte sie sich in Umhang und Decke. Gerne hätte sie ihre Flöte genommen und ein wenig gespielt, doch ihre Finger waren kalt und steif. Abgesehen davon bezweifelte sie, dass Daith Gefallen daran finden würde. Als es kälter wurde, griff sie nach dem Weinschlauch, den er gekauft hatte, und nahm einen kräftigen Zug. Der Alkohol rann ihre Kehle hinab, in ihren Magen. Wärme breitete sich aus. Doch sie hielt nicht lange an. Sie nahm noch einen Schluck. Und dann noch einen. Daith packte den Proviant aus und hielt ihr Brot und Käse entgegen. Sie lehnte ab. Alles, was sie wollte, war die Wärme des Weins. Sie trank weiter. Das Gebräu stieg ihr zu Kopf und vernebelte ihre Sinne. Kein unangenehmes Gefühl, wie sie fand.
»Trink nicht so viel.«
»Sag du mir nicht, was ich zu tun habe!« Überrascht stellte sie fest, wie schwer sich ihre Zunge anfühlte. Ihre eigenen Worte erschienen ihr undeutlich. Deshalb betonte sie die nächsten umso mehr. »Immerhin spreche ich nicht mit dir. Das ist es doch, was du willst, oder?« Sie nahm einen weiteren Schluck. Seine Hand schoss vor. Sie dachte, er würde sie schlagen, und duckte sich. Stattdessen riss er ihr den Schlauch aus der Hand und warf ihn zu Boden. Der kostbare Wein lief aus und versickerte in einem dunklen Strom im Erdreich. Sie wollte danach greifen und retten, was noch zu retten war.
Da packte er sie am Handgelenk. »Ich sagte, es reicht!«