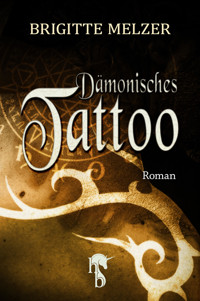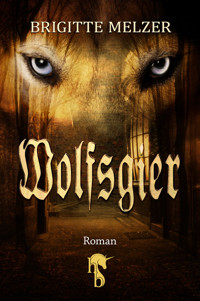
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: hockebooks
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
England 1886: Die junge Emma lebt bei ihrer Tante in London. Ihr wohlbehütetes Leben findet ein jähes Ende, als Albträume sie heimzusuchen beginnen. Nacht für Nacht verfolgt eine reißende Bestie sie in den Schlaf. Ihre Tante weiß sich keinen Rat und lässt Emma in eine Anstalt einweisen. Doch Emma ist davon überzeugt, dass der Auslöser für ihre Träume in ihrer Vergangenheit liegen muss. Wild entschlossen, die Wahrheit herauszufinden, flieht sie aus der Anstalt und kehrt in ihre Heimat, ein Dorf im nebligen Dartmoor zurück. Damit begibt sie sich in große Gefahr, denn die Bestie verfolgt sie längst nicht mehr nur in ihren Träumen …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 514
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Brigitte Melzer
Wolfsgier
Roman
Prolog
Grafschaft Dartmoor – Südengland August 1886
Dem Anlass angemessen war es eine ruhige Feier, und das, obwohl jeder Bewohner Cranmoors zugegen war. Seit den Morgenstunden war das kleine Haus der Harrisons erfüllt vom Summen unzähliger Stimmen. Es wurde gegessen, getrunken und viel geredet, doch nur wenig gelacht.
Menschen, die Millie Harrison schon ihr Leben lang kannte, zogen in einer nicht enden wollenden Prozession vorüber. Ein jeder beglückwünschte sie zu der Ehre, während man ihren Eltern für das Geschenk dankte, das sie dem Dorf machten.
Von Zeit zu Zeit wurde jemand auserwählt – ein Mädchen oder ein junger Mann –, dazu bestimmt, das Dorf zu verlassen, um seinen Bewohnern Glück zu bringen. Erwählt zu werden, war eine große Ehre! Doch Millie wusste es besser. Sie hatte gehört, wie in der Versammlung darüber gesprochen worden war. Es hatte nicht in ihrer Absicht gelegen, die Männer zu belauschen, und wenn sie jemand erwischt hätte, wäre ihr eine Tracht Prügel sicher gewesen. Niemand belauschte die Versammlung! Als Millie klar wurde, dass die Männer im Hinterzimmer des Cranmoor Inn zusammengekommen waren, wollte sie schnell an der Tür vorbei, ehe jemand ihre Anwesenheit bemerkte.
»Ihr habt Gordon gehört«, vernahm sie da Tucker Jenkins, den Wirt des Inns. »Das Tier muss besänftigt werden.«
Es waren nicht allein die Worte, die Millie innehalten ließen, sondern auch der Tonfall. Niemals zuvor hatte sie Mr Jenkins derart ernst erlebt. Erst da fiel ihr auf, wie still es im Raum war. Keine leise geführten Unterhaltungen, kein Gelächter und auch sonst kein Laut. Sie wusste, dass es sich nicht gehörte zu lauschen, dennoch konnte sie in diesem Moment nicht anders. Wann immer die Männer zusammenkamen, lag eine tiefe, beinahe greifbare Traurigkeit über dem gesamten Ort, doch niemand war je bereit gewesen, ihr den Grund dafür zu offenbaren. Wie hätte Millie da der Gelegenheit widerstehen können, endlich herauszufinden, was sich hinter dem geheimnisvollen Verhalten der Männer verbarg.
Nachdem sie jedoch mitangehört hatte, worüber sie sprachen, wünschte sich Millie, sie hätte dem Verlangen ihrer Beine nachgegeben und wäre davongelaufen. Nichts würde je wieder so sein, wie es einmal gewesen war. In jenen Minuten, die sie vor der Tür gestanden und gelauscht hatte, war die unbeschwerte Unschuld für immer von ihr gewichen und hatte einem Entsetzen Platz gemacht, das sich nur schwer verbergen ließ. Niemals würde sie die schwere und von Trauer erfüllte Stimme ihres Vaters vergessen, als die Wahl der Männer schließlich auf sie – Millicent Harrison – gefallen war.
»Du erfüllst uns alle mit Stolz.« Die alte Mrs Henderson tätschelte Millies Arm und riss sie von der Schwelle des Cranmoor Inn zurück in das Haus ihrer Eltern. Wie alle Worte nahm Millie auch diese schweigend und mit ausdrucksloser Miene entgegen.
Stolz.
Millie würde nicht zurückkehren. Keines der Mädchen und keiner der Jungen, die vor ihr gegangen waren, hatte das je getan. Auserwählt zu sein, war keine Ehre – es bedeutete den Tod.
Als ihr Vater sie am frühen Nachmittag in ihre Kammer schickte, zog sie sich widerspruchslos zurück. Millie hatte die Tür kaum hinter sich geschlossen, als Reverend Mason sie aufsuchte, um mit ihr gemeinsam zu beten. Klaglos ließ sie die Gebete und Segenswünsche des Priesters über sich ergehen. Es gelang ihr sogar, ihn mit einem Lächeln zu verabschieden. Erst nachdem er fort war, fiel die aufgesetzte Gelassenheit von ihr ab. Sie ließ sich auf den Stuhl vor der Frisierkommode sinken und starrte auf ihr Spiegelbild, das ihr hohläugig entgegenblickte.
Trotz des bunten Kranzes aus Sommerblumen sah ihr blondes Haar farb- und glanzlos aus. Die gebräunte Haut schien fahl und ihre sonst so strahlenden braunen Augen wirkten, als hätte der Tag bereits alles Leben aus ihrem Leib gesogen.
Sie hatte immer davon geträumt, Cranmoor eines Tages hinter sich zu lassen und nach Plymouth oder gar nach London zu gehen. Wie sehr hatte sie sich gewünscht, mehr von der Welt zu sehen, als die Grenzen ihres Heimatdorfes zu bieten hatten. Doch bald würde man ihr auch das nehmen.
Draußen ging der Nachmittag bereits in den Abend über. Dämmerung legte sich über die bleigrauen Gewitterwolken, die seit Tagen über Cranmoor hingen. Nicht mehr lange, dann würde das regnerische Grau dem Dunkel der Nacht weichen.
Das letzte Tageslicht, das ich jemals sehen werde.
»Du bist sechzehn Jahre alt«, flüsterte Millie ihrem Spiegelbild zu. Es gab noch so viel zu sehen und zu erleben. Und das alles sollte nun ein Ende finden?
Eine Ehre.
Millie schnaubte. Die Männer bezeichneten es so, um dem Verlust ihrer Liebsten zu etwas Bedeutsamen zu machen. Doch sie fühlte sich ganz und gar nicht bedeutsam. Sie würde zerfetzt werden, in Stücke gerissen von einer animalischen Bestie, deren Hunger nur durch ein Opfer besänftigt werden konnte. Ihr Opfer. Doch sie wollte nicht sterben – nicht für die Ehre und auch nicht für das Glück anderer.
Natürlich hatte man im Dorf schon immer hinter vorgehaltener Hand über die Bestie getuschelt, aber niemals wäre Millie auf den Gedanken gekommen, dass es mehr als eine Mähr sein könnte, mit der man Kinder erschreckte. Wie hätte sie annehmen können, dass diese Kreatur tatsächlich existierte? An jenem Tag jedoch, als sie die Versammlung der Männer im Cranmoor Inn belauscht hatte, war aus einem Ammenmärchen schreckliche Gewissheit geworden.
Millies Blick wanderte zum Fenster. Bei Anbruch der Nacht würden sie sie holen. Doch sie würde nicht warten, bis der Tod an ihre Tür klopfte. Wenn er kam, wollte sie nicht mehr hier sein.
Zu gerne hätte sie ein paar Dinge eingepackt, allerdings besaß sie keine Tasche, in der sie alles hätte verstauen können. Abgesehen davon blieb ihr nicht mehr genug Zeit, um zu packen. Millie schlüpfte in ihren Mantel und war schon auf dem Weg zur Tür, als ihr das Geld einfiel. Rasch kehrte sie zur Kommode zurück und holte einen kleinen Lederbeutel hervor. Ihre Ersparnisse. Mit ein wenig Glück würde es für die Zugfahrt nach London und eine Unterkunft reichen. Um alles andere wollte sie sich kümmern, sobald sie Arbeit hatte. Sie schob den Beutel in die Manteltasche und ging zur Tür. Von unten drang noch immer das gedämpfte Raunen unzähliger Unterhaltungen an ihr Ohr. Vorsichtig schlich Millie zur Treppe und spähte nach unten. Soweit sie es von ihrem Platz aus erkennen konnte, hielten sich die meisten Besucher im Salon und im Esszimmer auf. Vereinzelte Stimmen drangen aus der Küche an ihr Ohr. Millie hastete die Treppe hinab, über den kurzen, engen Gang, zur Tür.
Als sie auf die Straße trat, schlug ihr ein kühler Wind entgegen. Die Luft roch nach Regen und auf der Dorfstraße sammelte sich das Wasser der letzten Güsse in großen Pfützen und weichte das Erdreich auf. Das letzte Licht des Tages war noch nicht erloschen, doch über den Dächern der kurzen Reihe dicht gedrängter Fachwerkhäuser, die das Herz des Dorfes bildeten, erhob sich bereits das fahl schimmernde Rund des Vollmondes zwischen den näher rückenden Unwetterwolken.
Millie folgte der Straße mit schneller werdenden Schritten. Sie rannte an den Häusern vorüber, die nun in größeren Abständen zueinander gebaut waren. Abgesehen von einem kleinen Kern entlang der Hauptstraße, der Kirche und Thorne Manor, dem Anwesen Willard Thornes, das sich am Ende der Hauptstraße über dem Ort erhob, bestand Cranmoor lediglich aus einer Anzahl verstreuter Gehöfte im näheren Umland. Millie hatte die enge Gemeinschaft immer geliebt, heute jedoch drohte sie ihr zum Verhängnis zu werden.
Kurz nach dem Cranmoor Inn erreichte sie die Kreuzung am Ende der Hauptstraße. Vor ihr erhoben sich die dunklen Umrisse von Thorne Manor auf dem Hügel. Die linke Abzweigung führte nach Süden, in Richtung Princetown. Millie hielt sich links. Mit ein wenig Glück würde sie bis zum Morgen den Bahnhof in Princetown erreichen. Dann wäre sie in Sicherheit. Doch bis dahin lag noch ein weiter Weg vor ihr. Mittlerweile war es dunkel geworden.
Ich habe zu lange gewartet! Viel zu lange!
Als sie an der Kirche und am Friedhof vorübereilte, vernahm sie Stimmen. Sie sah sich um, blickte über den Friedhof hinweg in Richtung der Hauptstraße, wo sie schwachen Laternenschein zu erkennen glaubte.
Ihr Verschwinden war bemerkt worden!
Millie rannte weiter. Der Geruch von feuchter Erde stieg ihr in die Nase. Die Straße nach Princetown war nicht mehr als ein Weg aus festgestampftem Erdreich, gepflügt von den Rädern der Karren und Fuhrwerke, die im Laufe der Jahrhunderte darüber geholpert waren, und halb von Gras und Moos überwuchert. Wasser stand in der Fahrrinne und der Streifen Erde zwischen den beiden Spuren war aufgeweicht und rutschig. Millie hielt sich in der Mitte, konnte jedoch nicht verhindern, dass sie immer wieder ausrutschte und einen raschen Schritt zur Seite, ins Wasser, machen musste, um einen Sturz zu verhindern. Bald schon setzte der Regen wieder ein und durchnässte sie in kürzester Zeit bis auf die Haut.
Hinter sich konnte sie die Laternen ihrer Verfolger erkennen. Die Männer waren bereits auf der Straße und kamen näher. Natürlich wussten sie, wo Millie hinwollte, das wurde ihr schlagartig klar. Wohin sollte sie in dieser Gegend auch gehen! Sie würden sie einholen, lange bevor sie auch nur in die Nähe von Princetown gelangte. Hier, auf der Straße, gab es keine Hoffnung auf Entkommen. Ihr Blick schoss nach links, flog über eine Gruppe von Bäumen, hinter denen es tiefer ins Moor ging. Eine unwirtliche und gefährliche Gegend, die Millie immer gemieden hatte. Zu ihrer Rechten verlief das Land in sanft geschwungenen Hügeln. Wenn sie eine Stelle fand, an der sie den Fluss überqueren konnte, würde es ihr womöglich gelingen, die Männer in dem unübersichtlichen Gelände abzuhängen.
Der Vollmond hing wie eine bleiche Scheibe über dem Land und leuchtete Millie den Weg, als sie die Straße verließ und durch das hohe Gras weiterlief, den ersten Hügeln entgegen. Rufe drangen aus der Ferne an ihr Ohr. Zweifelsohne war ihren Verfolgern bewusst geworden, was sie vorhatte.
Der Regen schlug ihr ins Gesicht. Immer wieder musste sie sich das Wasser aus den Augen wischen, um zu sehen, wohin sie lief. In der Ferne erklang das Heulen eines Wolfes. Womöglich war es auch etwas anderes. Etwas, das auf sie wartete.
Millie kletterte einen Abhang hinauf und schlitterte auf der anderen Seite wieder herunter. Für einen Moment waren ihre Verfolger nicht mehr zu sehen. Bald jedoch würden sie auf der Hügelkuppe erscheinen. Von dem Gedanken angetrieben, mehr Abstand zwischen sich und die Männer zu bringen, sprang sie auf und lief weiter. Nach einiger Zeit wurde der weiche Rasenteppich von Felsen abgelöst, die blaugrau im Mondschein schimmerten. Hier war der Boden nicht mehr so aufgeweicht, sodass sie nun wieder schneller vorankam. Doch die Hügel wurden steiler und waren teilweise von Geröll überzogen. Dazwischen streiften bleiche Nebelschwaden hindurch und machten es schwer, sich zu orientieren. Millie kämpfte sich den nächsten Hang hinauf. Die Kuppe war noch ein ganzes Stück entfernt, trotzdem musste sie für einen Moment stehen bleiben, um wieder zu Atem zu kommen. Unten kamen die Männer näher. Der Wind trieb ihre Rufe an Millies Ohr.
»Millie! Bleib stehen!« Ihr Vater. »Bring keine Schande über uns!«
Schande! Wäre sie nicht so außer Atem und verzweifelt gewesen, hätte sie womöglich gelacht – oder geschrien. War es eine Schande, leben zu wollen?
Sie lehnte an der Felswand und starrte auf den wankenden Lichtschein, der über die Steine tanzte und dabei immer näher kam. Zum ersten Mal, seit sie das Haus ihrer Eltern verlassen hatte, bemerkte sie die Kälte. Der Wind strich über ihre schweißnasse Haut und ließ sie frösteln. Doch es war nicht der Wind allein, der ihr einen Schauder über den Rücken jagte, sondern auch der Gedanke, was sie erwartete, sobald die Männer sie einholten – und das Heulen des Wolfes, das erneut die Dunkelheit zerriss.
Zu ihrer Linken wand sich der Fluss zwischen den Hügeln hindurch. Sobald die Kuppe hinter ihr lag und sie sich auf der anderen Seite wieder an den Abstieg machte, musste sie sich in Richtung Süden halten. Andernfalls würden die Männer sie zu nahe an die Schlucht treiben.
Millie kletterte weiter nach oben. Immer wieder glitt sie auf dem rutschigen Boden aus und musste sich mit den Händen abstützen, um nicht der Länge nach hinzuschlagen. Unten holten die Männer weiter auf. Von Zeit zu Zeit verschwanden sie im Nebel, dann war nur noch das schwache Glimmen ihrer Laternen zu erkennen. Sobald sie jedoch aus dem Nebel heraustraten und Millie ihre Gesichter sehen konnte, wurde ihr schlagartig bewusst, wie nah sie bereits gekommen waren. Alle waren sie da; ihr Vater, ihr großer Bruder, Jenkins, der Wirt aus dem Cranmoor Inn, der Müller und all die anderen, die seit ihrer Geburt ein Teil ihres Lebens gewesen waren. Jenes Lebens, das sie ihr nun nehmen wollten. Menschen, in deren Nähe sie sich immer geborgen gefühlt hatte, waren plötzlich zu Feinden geworden. Das stechende Gefühl des Verlusts, das sie bei diesem Gedanken überkam, trieb ihr die Tränen in die Augen.
Niemand würde ihr helfen. Sie alle folgten den Regeln der Versammlung. Regeln, über die im Dorf nicht offen gesprochen wurde. Während die Tränen über ihre Wangen rannen, kletterte Millie weiter nach oben.
Als sie den Gipfel erreichte, stellte sie überrascht fest, wie weit sie bereits gelaufen war. Unmittelbar unter ihr lag die von Nebelschwaden durchzogene Klamm, durch deren Mitte der Crane floss – zu dieser Jahreszeit kaum mehr als ein dünnes Rinnsal in seinem rauen, felsigen Bett.
Erschrocken starrte Millie in die Tiefe. Hier führte kein Weg nach unten. Der Abhang des Hügels schloss nahtlos an die Steilwand an. Wenn sie sich nicht den Hals brechen wollte, musste sie an einer der Seiten wieder nach unten klettern – dort, wo ihre Verfolger sie sehen konnten.
Wie gelähmt stand sie da und starrte auf die Männer – allen voran ihr Vater und ihr Bruder –, die sich unten bereits an den Aufstieg machten. Ihr Vorsprung schmolz dahin wie Schnee unter der Sonne. Sie konnte ihnen nicht entkommen, das begriff sie nun.
Schluchzend sah sie nach unten und versuchte, hinter dem Tränenschleier das Gesicht ihres Vaters auszumachen. Starr und leer wirkten die vertrauten Züge. Dabei waren es gerade seine Wärme und die Güte, die Millie so sehr an ihm liebte. Als sie noch klein gewesen war, hatte er sie getröstet, wenn sie schlecht geträumt hatte, sich um sie gekümmert, wenn sie gestürzt war und sich das Knie aufgeschlagen hatte. Ihr Vater war ihr Ein und Alles! Wie konnte ausgerechnet er ihren Tod wollen?
Die bloße Vorstellung, bei lebendigem Leib zerrissen zu werden, ließ ihr Herz gefrieren. Nein, diese Männer würden den Zeitpunkt ihres Todes nicht bestimmen! Das würde sie allein entscheiden – kein wütender Mob und auch nicht die Bestie, die der heimliche Herr über diesen Teil des Moors zu sein schien!
Als Millie schließlich klar wurde, was ihr zu tun blieb, sah sie noch einmal zu ihrem Vater. »Leb wohl!«, formten ihre Lippen lautlos. Dann fuhr sie herum und stürzte sich in die Tiefe.
*
Schweigend waren die Männer in die Klamm hinabgestiegen, in die sich das Mädchen gestürzt hatte. Ebenso stumm standen sie nun um den Mann versammelt, der auf dem Felsen kauerte, den zerschmetterten Leichnam seiner ältesten Tochter in den Armen haltend.
Als James Harrison aufsah, schimmerten die Tränen eines trauernden Vaters in seinen Augen, dennoch hatte er nicht vergessen, was von ihm erwartet wurde.
Er nickte. »Bringen wir sie fort.« Die Worte drangen leise und brüchig aus seiner Kehle, doch in seinen Blick mischte sich zu der Trauer jetzt auch Entschlossenheit. »Ihr Opfer soll nicht umsonst gewesen sein!«
Die Männer wollten ihm helfen, ihm etwas von seinem Schmerz nehmen, doch James hielt sie mit einem Kopfschütteln davon ab. Mit starrer Miene richtete er sich auf, Millies reglosen Körper auf den Armen, und trug sie am Ufer des Crane entlang aus der Klamm.
Die anderen folgten ihm. Niemand sprach ein Wort und bald schon lag die Stille so drückend über ihnen wie der Nebel über dem Moor. James wusste, woran sie dachten. Wird die Bestie das Opfer akzeptieren? Er teilte die Sorge seiner Begleiter, dennoch wagte er nicht, daran zu denken, dass Millies Tod vergebens gewesen sein könnte.
Mit jedem Schritt, den sie dem See näher kamen, wog der Leichnam seiner Tochter schwerer auf seinen Armen. Längst hatte James aufgehört zu zählen, wie oft sie während der vergangenen Jahre hier gewesen waren, um der Bestie ein Opfer darzubringen. Es war nie leicht gewesen, doch niemals war es ihm so grausam erschienen wie heute Nacht.
Sein Blick wanderte über den See, den die Menschen hier nur den Nebelsee nannten. Auch jetzt waberten die milchigen Schwaden, denen das Gewässer seinen Namen zu verdanken hatte, dicht über der Wasseroberfläche dahin und reckten sich ihnen wie lange Finger entgegen. Hier am Ufer war es kälter. Womöglich war es auch nur die Angst, die ihn frösteln ließ.
In der Bucht roch es nach Tod.
Jenkins und Crofton zogen das Ruderboot näher ans Ufer, sodass James seine Tochter ins Boot legen und ihre verrenkten Glieder ausstrecken konnte. Millies Augen waren geöffnet und blickten starr gen Himmel, erfüllt von einer stummen Anklage, die niemals mehr den Weg über ihre Lippen finden würde. James strich mit der Hand über ihr Gesicht und schloss ihre Lider.
Wie oft hatten sie schon versucht, die Bestie zu stellen und ihr den Garaus zu machen? James erinnerte sich an unzählige Tage, an denen sie nach Spuren der Bestie gesucht oder auf der Lauer gelegen hatten. Nicht einmal zu Gesicht bekommen hatten sie die Kreatur!
Sein Blick fiel auf Millies bleiche Züge und wanderte dann zum Boot. Dies war der einzige Weg, unnötiges Blutvergießen zu verhindern.
Um ihn herum standen die Männer Cranmoors versammelt. Die Laternen wankten in ihren zitternden Händen und warfen ihren unsteten Schein auf das Boot, wo sich rostrote Spuren auf der rauen Holzoberfläche abzeichneten. Das Blut früherer Opfer. Sie alle waren noch am Leben gewesen, als man sie ins Boot gesetzt hatte. Gott allein wusste, was sie durchgemacht haben mochten – Gott und die Bestie. James war erleichtert, dass seiner Tochter ein derart grausames Ende erspart blieb. Doch die Erleichterung war nicht groß genug, um die Furcht zu vertreiben, dass es nicht genügen würde.
Mit einem Mal herrschte Totenstille. Selbst das Heulen der Wölfe war verstummt. Als James vom Boot zurücktrat und das Ufer des Nebelsees verließ, betete er, dass der leblose Leib seiner Tochter es vermochte, dem Dorf für einige Zeit Frieden zu erkaufen.
Erster Teil
London August 1886
1
Emma Gordons Welt war hinter dichtem Nebel verborgen. Kälte kroch aus dem Nichts empor, biss sich in ihre Fußsohlen und drang durch ihre Haut bis tief in die Knochen. Zwar gab es Momente, in denen sie sich ihres Ichs ebenso bewusst war wie der Welt hinter dem Nebel, doch wann immer sie zu fassen versuchte, wer sie war und was sie ausmachte, dauerte es nicht lange, bis sie einen Stich in ihrem Leib verspürte und alle ihre Bemühungen erneut ausgelöscht wurden.
Einzig ihr Name war geblieben, ihn hatte der Nebel nicht zu tilgen vermocht. Emma klammerte sich daran und wiederholte ihn wieder und wieder in ihren Gedanken.
Ich bin Emma Gordon.
Doch es war nur ein Name, eine leere Hülle, die nicht das Geringste über den Menschen aussagte, der dahinterstecken mochte. Aber womöglich war der Name der einzige Grund, warum sie dem Wahnsinn noch nicht anheim gefallen war. Zwei Worte, an die sie sich klammern konnte, während ihr Verstand haltlos durch den Nebel glitt.
Ich bin Emma Gordon.
Die Leere, die ihren Geist umgab, machte ihr Angst. Gerüche erschienen ihr fremd. Geräusche drangen nur gedämpft an ihr Ohr, während Worte verzerrt und unverständlich in ihrem Verstand widerhallten. Da war ein Grollen und Knurren, die einzigen beständigen Laute, die sie die ganze Zeit über begleiteten und sie bis in die Grundfesten ihrer Seele erzittern ließen. Emma wusste, dass sie einmal in der Lage gewesen war zu sagen, woher die Geräusche stammten, doch ihr Ursprung war längst in Vergessenheit geraten. Einzig die Angst davor, was hinter dem Grollen und Knurren lauerte, war geblieben.
Die Welt war zu einem kalten Ort geworden, erschreckend leer und tot und bedrohlich zugleich. Das Knurren wurde lauter. Deutlicher. Emma kroch zurück, bis sie einen Widerstand in ihrem Rücken spürte. Sie versuchte, ihn zu überwinden, kratzte daran und schlug dagegen, bis ihre Hände und Finger schmerzten. Als sie begriff, dass ihre Flucht hier zu Ende war, kauerte sie sich zusammen und wartete darauf, dass die Kreatur, die hier irgendwo im Nebel auf sie lauerte, angriff.
Jemand schrie. So laut und durchdringend, dass sich Emma die Ohren zuhielt, doch das Geschrei wollte kein Ende nehmen.
Etwas hielt ihre Arme fest und schüttelte sie.
»Halt endlich das Maul!« Scharfe Worte, die durch den Nebel schossen und sich in ihren Verstand bohrten. »Hör mit dem Gebrüll auf, sonst schlag ich dich nieder!«
Augenblicklich verstummten die Schreie. Einmal mehr drangen befremdliche Laute durch den Nebel an Emmas Verstand – und zum ersten Mal begriff sie, dass es ihr eigenes, angsterfülltes Wimmern war, das sie vernahm.
»Fang bloß nicht wieder mit dem Gebrüll an!«
Der schmerzhafte Griff verschwand von ihren Armen und Emma sackte zusammen. Sie zog die Knie an, schlang die Arme um den Oberkörper und machte sich so klein wie möglich, um ihrem Angreifer kein Ziel zu bieten. Doch es gab keine weiteren Attacken.
Emma wusste nicht, wie lange sie zusammengekauert und zitternd dagesessen hatte – es musste eine lange Zeit gewesen sein, denn ihre Gelenke schmerzten und ließen sich kaum mehr bewegen –, als der Nebel sich zu lichten begann. Die hellen Schwaden, die über allem gelegen hatten, zogen sich allmählich zurück und offenbarten Erinnerungen, die jetzt mit aller Macht an den letzten verbliebenen Mauern rüttelten, die ihren Geist noch gefangen hielten. Aus Furcht vor dem, was sie womöglich erwarten würde, wagte Emma nicht, die Augen zu öffnen.
Ich bin Emma Gordon.
Zum ersten Mal war der da mehr als nur der Name. Emma erinnerte sich an das Grollen und Knurren und an die Angst, die eines Tages urplötzlich über sie gekommen war, ohne dass sie imstande gewesen wäre zu sagen, woher sie rühren mochte. Das nächste Bild, das klar und deutlich in ihrer Erinnerung aufblitzte, war Tante Mabels sorgenvolle Miene. Einige Strähnen hatten sich aus ihrem aufgesteckten Haar gelöst, als sie auf Emma herabblickte. Neben Tante Mabel ein weiteres Gesicht – Doktor Fitzmorton. »Ich gebe Ihnen etwas zur Beruhigung, Miss Gordon«, hatte er gesagt und eine Spritze aus seiner ledernen Arzttasche genommen. Die Spritze war der Grund für den Nebel! Ein wenig Morphium wird Ihnen helfen, wieder zur Besinnung zu kommen. Sie erinnerte sich an den Stich der Nadel. Ein kurzer, heller Schmerz, den sie auch hinter dem Nebel des Öfteren zu verspüren geglaubt hatte.
Doch nicht einmal das Morphium hatte das Knurren verstummen lassen. Jetzt jedoch, da die Wirkung der Drogen nachzulassen begann, war es nicht länger eine kaum zu fassende Angst, sondern eine reale Bedrohung.
Sie war mit Tante Mabel bei der Schneiderin gewesen, um sich ein Kleid für einen Ball anpassen zu lassen. Den Ball, auf dem sie Winston Bell offiziell vorgestellt werden sollte, jenem Mann, von dem Tante Mabel hoffte, dass er bald um Emmas Hand anhalten würde – ein Ereignis, dem Emma mit gemischten Gefühlen entgegensah. Natürlich war sie Mr Bell bereits zu anderen Gelegenheiten begegnet. Mehr als eine höfliche Begrüßung hatte er bisher nicht für sie übrig gehabt, doch wenn ihre Tante recht behielt, war er durchaus gewillt, Emma zur Frau zu nehmen. Ein Umstand, der sie nicht mit der Freude erfüllte, die von ihr erwartet wurde. Mr Bell war ein einflussreicher und vor allem wohlsituierter Mann, der Emma ein sorgenfreies Leben im Kreise der feinen Gesellschaft ermöglichen würde. Im Gegenzug für den Wohlstand, den sie durch die Verbindung erlangte, war es ihre Pflicht, ihrem Mann ergeben zu sein und ihn in allen Belangen zu unterstützen. Natürlich hatte sich Emma gefragt, was passieren würde, wenn er herausfand, dass sie ihn nicht liebte – es nicht konnte –, doch Tante Mabel hatte nur den Kopf geschüttelt und gesagt: »Das musst du auch nicht, solange du deine Pflichten als Ehefrau erfüllst.«
Anfangs hatten die Worte Emma schockiert, dann war ihr bewusst geworden, dass diese Art von Pflichtgefühl von einer jungen Dame einfach erwartet wurde. Immerhin hätte es schlimmer kommen können. Einige ihrer Freundinnen waren Männern versprochen, die mehr als doppelt so alt waren wie sie selbst. Mr Bell hingegen schien nur wenige Jahre älter zu sein als Emma. Abgesehen davon erweckte er den Eindruck eines freundlichen Mannes, dem es nicht an Höflichkeit mangelte. Emma erwartete von ihrem zukünftigen Gemahl lediglich, dass er sie gut behandelte und für sie sorgte, alles andere war nicht von Belang. Sie erwartete keine Liebe, wie könnte sie, wenn sie selbst nicht imstande war, Liebe zu geben. Ihr Herz gehörte einem anderen, doch der hatte es nicht gewollt. Trotz des Schmerzes und der bitteren Enttäuschung konnte sie ihn nicht vergessen. Manchmal glaubte sie, noch immer seine Hände auf ihrer Haut zu spüren, seine Küsse, seinen gehauchten Antrag. Sie erinnerte sich an sein Lächeln und die Wärme in seinem Blick, als er ihr seine Liebe gestanden hatte.
Und trotzdem hast du mich gehen lassen, Gabriel. Er hatte nicht versucht, sie aufzuhalten, hatte sich nicht einmal von ihr verabschiedet und keinen der Briefe, die sie ihm während der vergangenen fünf Jahre geschickt hatte, beantwortet, doch noch immer hielt er ihr Herz in Händen und nur allzu oft war es ein schmerzhafter Griff.
Seit sie Gabriel verloren hatte, war es ihr nicht gelungen, Interesse für einen anderen Mann aufzubringen – sie hatte es wahrlich versucht, doch all die Bälle und Empfänge, auf denen Tante Mabel ihr unzählige junge Männer vorgestellt hatte, waren nicht in der Lage gewesen, sie Gabriel vergessen zu lassen. Er war in ihr, durchdrang ihr Sein bis in die letzte Faser und nichts hätte ihn aus ihrem Herzen reißen können. Schon lange gab Emma sich nicht mehr der Hoffnung hin, sie könne sich noch einmal verlieben, trotzdem fügte sie sich in die bevorstehende Verlobung. Womöglich waren Pflichtgefühl und Respekt eine bessere Basis für eine dauerhafte Verbindung als Liebe.
Ihr Leben war in geordneten Bahnen verlaufen – bis zu dem Augenblick, da sie den Laden der Schneiderin in der Oxford Street verließen. Es war bereits spät und wie beinahe jeden Tag lag dichter Nebel über der Stadt, ausgestoßen von den unzähligen Schornsteinen, die nur selten über der wabernden Brühe auszumachen waren. Im kalten Schein der Gaslaternen folgten sie der Straße, während sie nach einer Droschke Ausschau hielten, die sie nach Hause bringen konnte. Sie waren noch nicht weit gekommen, als die Hilferufe eines Kindes das milchige Halbdunkel durchdrangen. Emma sah sich um. Die Menschen hasteten mit starren Mienen an ihr und Tante Mabel vorüber und taten, als hätten sie nichts bemerkt. Doch sie mussten es gehört haben, denn die Schreie waren so durchdringend, dass Emma jedes Mal zusammenzuckte. Schließlich hatte sie es nicht länger ausgehalten, die Not dieses Kindes zu ignorieren. Mit schnellen Schritten eilte sie den Bürgersteig entlang, den Blick auf die Seitenstraßen gerichtet. Hinter ihr protestierte Tante Mabel vehement, doch Emma achtete nicht länger auf die Rufe ihrer Tante und rannte nun beinahe. Als sie die Einmündung erreichte, aus der die Schreie kamen, hielt sie inne und spähte hinein. Hohe Ziegelmauern tauchten den engen Durchlass in tiefe Schatten, die es Emma schwer machten, etwas zu erkennen. Vorsichtiger geworden, wagte sie sich einen Schritt in die Gasse. Die Hilferufe waren verstummt und Emma fürchtete schon, zu spät gekommen zu sein, als sie ein leises Wimmern vernahm. Einige Meter vor sich glaubte sie die Umrisse eines kleinen Mädchens auszumachen, das sich im Halbdunkel an die Wand drückte. Vor dem Kind ragte ein Schatten auf, bullig und beinahe so groß wie das Mädchen selbst, der Leib von struppigem Fell überzogen. Erst als Emma das Knurren vernahm, wurde ihr klar, dass es sich um einen Hund handeln musste.
»Bleib ganz ruhig stehen«, wies Emma das Mädchen an, selbst darum bemüht, keine hektischen Bewegungen zu machen, als sie langsam näher kam. An der Hauswand fand Emma zwei Steine, die sich aus dem Kopfsteinpflaster gelöst hatten, und hob sie auf. Die raue Oberfläche vermittelte ihr ein Gefühl von Sicherheit – wenngleich sie fürchtete, dass die Steine ihr im Ernstfall nicht viel helfen würden.
Emma wandte sich erneut an das Mädchen. »Wenn ich sage ›Lauf‹, dann renn, so schnell du kannst! Hast du mich verstanden?«
Das Mädchen nickte, eine winzige Bewegung, die das Vieh näher heranlockte. Emma hob die Hand mit dem Stein und warf. Das Tier heulte getroffen auf.
»Lauf!«, rief Emma.
Das Mädchen fuhr herum und floh in die Tiefe der Gasse. Der Hund jedoch blieb und wandte sich nun Emma zu, das räudige Fell im Nacken gesträubt. Emma hob die Hand und schleuderte den zweiten Stein, doch sie verfehlte.
Ein tiefes Knurren stieg aus der Kehle des Viehs auf, als es geduckt näher kam. Zu nah, als dass sie gewagt hätte, kehrt zu machen und davonzulaufen. Das Biest war mittlerweile so nah, dass Emma das Weiße in seinen Augen sah. Grollend zog es die Lefzen zurück und offenbarte den Blick auf seine tödlichen Fänge.
Es ist ein Hund!, versuchte sich Emma zu beruhigen. Vielleicht würde er sie beißen, doch ganz bestimmt nicht zerfleischen. Doch, das wird er! Du hast es schon einmal gesehen! Es wird wieder passieren!
Es musste die Panik sein, die derartige Gedanken in ihr auslöste. Anders konnte sich Emma ihre Reaktion auf das Vieh nicht erklären. Es war nur ein Hund. Ein großer Hund – ja. Aber doch keine reißende Bestie! Doch tief in ihrem Inneren hatte sich der Gedanke an ein monströses Wesen festgesetzt und wollte sich nicht mehr verscheuchen lassen.
Emma schüttelte den Kopf und richtete ihre Aufmerksamkeit wieder auf das Vieh vor sich. Geifer troff aus seinem Maul und die gefletschten Zähne schimmerten bedrohlich im schwachen Licht. Es waren jedoch weder das gesträubte Fell, noch die scharfen Zähne, die Emma Angst einjagten, sondern der Schaum, der sich um den Unterkiefer des Viehs sammelte.
Die Wutkrankheit, schoss es ihr durch den Kopf. Wenn das Biest sie biss, würde sie einen qualvollen Tod sterben! Obwohl die Erkenntnis ihre Beine zu lähmen drohte, schob sie sich langsam zurück.
Das Monstrum folgte jeder ihrer Bewegungen.
Mein Gott, das ist wie damals!
Sie hatte das alles schon einmal erlebt, dessen war sie sich mit einem Mal sicher, auch wenn sie nicht mehr zu sagen vermochte, wann und wo das gewesen sein sollte. Jeden Moment würde diese Bestie vorspringen und sie zerreißen!
Da erfüllte der scharfe Knall einer Peitsche die Luft. Der Lederriemen biss sich in das Fell des Viehs. Es heulte auf und fuhr zurück.
Noch einmal knallte die Peitsche. »Hau ab, verdammte Töle!«, erklang eine raue Männerstimme neben Emma. Aus dem Augenwinkel sah sie den Kutschermantel. Tante Mabel hatte eine Droschke gefunden – genau zur rechten Zeit. Laut schreiend schwang der Mann seine Peitsche, bis der Hund aufjaulte und die Flucht ergriff.
Plötzlich stand Tante Mabel neben Emma. »Himmel, ist dir etwas passiert?«, rief sie aufgeregt und vergaß dabei all ihre sonst so vornehme Zurückhaltung. »Bist du verletzt?«
Emma konnte nur den Kopf schütteln. Sie zitterte am ganzen Leib und starrte in die Schatten, in denen der Hund verschwunden war.
Tante Mabel seufzte. »Was hast du dir nur dabei gedacht?«, tadelte sie sanft und griff nach Emmas zitternden Arm, um sie zur Droschke zu führen, die tatsächlich am Eingang zur Gasse bereitstand.
Als sie die Karosse erreichten, hatte der Kutscher ihnen bereits den Verschlag geöffnet. Die Peitsche steckte wieder in der dafür vorgesehenen Halterung. Emma blieb kurz stehen und sah den Mann an, von dem sie im schwachen Schein der Kutschlaterne kaum mehr als einen Bart und ein Paar dunkel schimmernder Augen ausmachen konnte. »Ich danke Ihnen.«
Der Mann sagte etwas, doch die Worte waren in einem Dialekt gesprochen, den Emma nicht verstand. Mit einem unsicheren Lächeln stieg sie in das Gefährt. Die Arme um den Körper geschlungen wartete sie darauf, dass die Furcht von ihr abfiel, doch ihr Herzschlag beruhigte sich erst, als sie schon beinahe am Chester Square 13 in Belgravia angekommen waren.
Das stattliche Herrenhaus hatte einst Lord Melvin Bancroft, Tante Mabels Gemahl, gehört und war nach seinem Tod in den alleinigen Besitz seiner Witwe übergegangen. Emma liebte das Haus, das nun schon seit fünf Jahren ihr Heim war, ebenso wie sie Tante Mabel liebte, in deren Obhut sie lebte, seit ihr Vater sie nach London geschickt hatte. Heute jedoch fehlte das gewohnte Gefühl von Sicherheit, als sie aus der Droschke stieg und das Haus betrat. Der vertraute Geruch von frischen Blumengestecken, Bohnerwachs und der Duft der Rosinentörtchen von Mrs Hensley, der Haushälterin, schienen ausgelöscht. Selbst die Empfangshalle mit ihren getäfelten Decken und den geblümten Tapeten wirkte weniger heimelig und freundlich als sonst. Emma schob es auf die Nachwirkungen ihres Erlebnisses. Sie gab dem Butler ihren Mantel und folgte Tante Mabel in den Salon, um einen verspäteten Nachmittagstee zu trinken und anschließend das Abendessen zu sich zu nehmen.
Als Emma sich später verabschiedete, um zu Bett zu gehen, war ihr Erlebnis aus der Oxford Street nicht mehr, als eine scheußliche Erinnerung, die im Laufe der Zeit verblassen und bald völlig in Vergessenheit geraten würde.
Zumindest hatte sie das geglaubt.
Noch in derselben Nacht war Emma schreiend erwacht. Sie war wieder in der Gasse, doch vor ihr stand kein tollwütiger Hund, sondern eine gewaltige, wolfsähnliche Bestie mit glühenden Augen – bereit, ihre scharfen Fänge in Emmas Kehle zu schlagen.
Tante Mabel war im Morgenrock und mit Schlafhaube in ihr Zimmer gestürzt und hatte versucht, Emma zu beruhigen und ihr klar zu machen, dass es sich nur um einen Albtraum handelte, den sie schnell wieder vergessen haben würde.
Doch die Bilder verblassten nicht. Stattdessen wurden sie schlimmer, eindringlicher und beinahe greifbar in ihrer Bedrohlichkeit. Immer wieder wachte Emma während der folgenden Nächte schreiend auf.
Jeder Versuch, mit Tante Mabel über die Träume zu sprechen, endete auf ähnliche Weise. »Es war ein tollwütiger Hund – keine Bestie. Es gibt keine Bestien!«
»Nicht der Hund!«, hatte Emma einmal zu widersprechen versucht. »Das Monster!«
»Es gibt auch keine Monster, Liebes.« Tante Mabel hatte ihr ein aufmunterndes Lächeln geschenkt, doch Emma konnte darin nichts anderes finden als den Versuch, die Bedeutung ihrer Träume abzuschwächen.
Bald darauf kam das Fieber. Doktor Fitzmorton, den Tante Mabel zu Rate zog, verabreichte Emma Laudanum zur Beruhigung. Das Fieber, so meinte er, werde sinken, sobald sie ausreichend Schlaf finde. Doch das Mittel schickte sie nur noch tiefer in das Reich der Albträume, denen Emma so verzweifelt zu entfliehen versucht hatte. Und diesmal war es ihr nicht möglich, der Bestie zu entkommen und aufzuwachen, sobald das Vieh durch ihre Träume zu streifen begann. Das Laudanum hielt sie in den Klauen der Bestie gefangen.
Nach einer Woche, während der sich ihr Zustand immer weiter verschlimmerte, wusste sich selbst der Arzt nicht mehr zu helfen. Er hatte inzwischen begonnen, ihr zusätzlich Morphium zu verabreichen und sie damit noch tiefer in die Hölle ihrer Träume gestoßen.
Emma hörte, wie er mit Tante Mabel darüber sprach, dass es keine organische Ursache für ihren Zustand zu geben schien. »Hier kann ihr nicht geholfen werden, Lady Bancroft«, sagte der Mediziner. »Ich fürchte, wir kommen nicht umhin, sie in eine Einrichtung einzuweisen.« Dann waren die Stimmen der beiden leiser geworden und schließlich vollends verstummt, als sie den Raum verlassen und die Tür hinter sich zugezogen hatten.
Zum ersten Mal, seit sich der Schleier des Morphiums ein wenig gelichtet hatte, fragte sich Emma, wo sie war. Woher war die Stimme gekommen? Wer hatte sie vorhin beim Arm gepackt? Sie streckte die Hand zur Seite und tastete nach dem Untergrund. Was ihre Fingerspitzen fanden, war keine weiche Matratze, sondern harter, kalter Stein. Von der Erkenntnis erschrocken, dass sie sich nicht in einem Bett befand, öffnete Emma nun doch die Augen.
Sie kauerte auf dem Boden, dicht an eine dunkle Ziegelmauer gedrängt und lediglich mit einem schenkellangen, vergilbten Kittel bekleidet. Ihre nackten Füße waren taub vor Kälte.
Eine verdreckte Gaslampe unter der niedrigen Decke sandte ihren trüben bläulichen Schein aus und tauchte den Raum in gespenstisches Zwielicht. Entsetzt ließ Emma ihren Blick umherschweifen. Die Droge wütete noch immer in ihrem Körper, sodass sie ihre Umgebung nur verschwommen wahrnahm. Was sie jedoch sah, war verstörend genug. Auf dem Boden mischte sich Stroh mit Essensresten und Dingen, deren Herkunft sie sich lieber nicht vorstellen wollte. Es stank bestialisch nach Urin und Schweiß und es war laut. Da erst begriff sie, dass sie nicht allein war. Blinzelnd und immer noch gegen den Nebel ankämpfend, der über ihren Augen lag, richtete sie ihre Aufmerksamkeit auf den Raum. Um sich herum machte sie ein gutes Dutzend Frauen und sogar zwei Männer aus. Einige kauerten vor der Wand, die Arme um den Leib geschlungen, und wiegten sich im Takt einer Melodie, die nur sie allein zu hören vermochten. Andere lagen ausgestreckt im Dreck und zwei waren sogar an der Wand angekettet. Einer der beiden Männer stand unter der Lampe und starrte nach oben, als könne er das Licht durch seinen bloßen Blick aus dem Raum zwingen. Der andere lehnte an der Wand, den Körper in eine Zwangsjacke geschnallt, und starrte Emma aus fiebrig glänzenden Augen an. Einige sprachen leise mit sich selbst, andere schimpften und schrien, manche wirkten so abwesend, als würden sie nichts von ihrer Umwelt mitbekommen. Bei dem Anblick, der sich ihr bot, hätte sich Emma beinahe gewünscht, wieder hinter den Nebel zurückkehren zu können. Es bestand kein Zweifel daran, was für ein Ort das war. Noch mehr als die Tatsache, dass sie hier war, schockierte es sie jedoch, dass Tante Mabel ihre Zustimmung zu all dem gegeben haben musste.
War es wirklich so schlimm um sie bestellt? Wie sonst ließen sich die Albträume erklären, die aus dem Nichts gekommen waren und sie selbst im betäubten Zustand nicht hatten loslassen wollen? Selbst jetzt glaubte sie noch immer, das Knurren zu hören.
Ich bin doch nicht verrückt!
Etwas war bei der Begegnung mit dem Hund geschehen und sie musste herausfinden, was. Sie versuchte, sich zu erinnern, ob sie schon früher so etwas erlebt hatte, ihr wollten jedoch keine ähnlichen Begebenheiten einfallen. Womöglich musste sie erst die Nachwirkungen des Morphiums hinter sich lassen, um ihrem Erinnerungsvermögen wieder voll vertrauen zu können.
Als Erstes jedoch musste sie hier raus!
Eine Bewegung riss Emma aus ihren Gedanken und ließ sie aufsehen. Vor ihr kniete eine Frau und betrachtete sie in einer Mischung aus Neugierde und Abscheu. Dunkle Ringe lagen unter ihren Augen und das rotbraune Haar stand ihr in wirren, verfilzten Büscheln vom Kopf ab. Das Gesicht war von Kratzern übersät und als sie den Mund öffnete, sah Emma, dass ihr die Schneidezähne fehlten.
»Du bist wach!«, krächzte die Frau und tippte bei jedem Wort mit dem Finger gegen Emmas Arm. »Das ist gut. Dann hört endlich dein Geschrei auf.« Plötzlich kniff sie die Augen zusammen und starrte Emma an, als frage sie sich, warum sie überhaupt mit ihr sprach.
Obwohl alle dieselbe Art von Kittel trugen, fühlte sich Emma darin ausgeliefert. Sie zerrte an dem groben Leinen und versuchte, so viel wie möglich von ihrer bloßen Haut zu bedecken. Allein die Vorstellung, in diesem Aufzug mit fremden Männern eingeschlossen zu sein, versetzte sie in Panik. Während der vergangenen Jahre hatte Tante Mabel viel Zeit darauf verwandt, ihr Benehmen beizubringen. Wie konnte ausgerechnet diese Tante Mabel zulassen, dass man sie in eine derart kompromittierende Situation brachte?
»Wo sind wir hier?« Es fiel Emma schwer zu sprechen. Ihre Zunge klebte am Gaumen und fühlte sich eigenartig fremd an, als sei sie nicht länger ein Teil ihres Körpers.
Die Frau lachte schrill. »Das weißt du nicht?«, kicherte sie. »Dann wird’s dir die Rote Meg sagen, du naives Ding.«
»Die Rote Meg?«
Die Frau zupfte an ihrer wirren Mähne, dann griff sie nach Emmas Haaren. »Deine sind röter.«
Emma nickte. »Was ist das für ein Ort?«
»Die Hölle!« Meg lachte hysterisch, ehe sie sich nach vorne beugte. Je näher sie kam, desto weiter wich Emma an die Wand zurück. »Die Wärter hier«, verriet Meg ihr nun leiser, »nennen es Bedlam.«
Bedlam. Das Bethlem Royal Hospital. Londons verrufenste Irrenanstalt.
»Ich muss einen Arzt sprechen.« Emma sprang auf und geriet ins Wanken. Schnell stützte sie sich an der Wand ab. Wie lange war sie schon hier? Stunden? Tage? Wochen?
Ehe die Rote Meg noch etwas sagen konnte, erklang ein metallisches Rumpeln und die Tür wurde entriegelt und geöffnet. Ein bulliger, in schmutziges Weiß gekleideter Wärter erschien im Türrahmen und sah sich um, die Hand auf dem Schlagstock ruhend, der an einer Seite vom Gürtel hing.
Emma nahm die Hand von der Wand und wankte ihm entgegen. Als er sie bemerkte, richteten sich seine Augen auf sie.
»Ich muss mit meiner Tante sprechen!«
»Siehst du sie hier irgendwo?«
Unwillkürlich schoss Emmas Blick durch den Raum, ehe er sich wieder auf den Mann in Weiß richtete. Sie musste die Augen zusammenkneifen, um ihn zu fixieren. »Nein, aber –«
»Dann kannst du sie auch nicht sprechen.«
Emma weigerte sich, locker zu lassen. Ein irrationaler Teil von ihr fürchtete in Vergessenheit zu geraten, sobald der Wärter den Raum verließ. Sie würde auf ewig hier gefangen sein, ohne dass jemals jemand kam oder auch nur nach ihr fragte. »Sie müssen mich hier herauslassen«, versuchte sie es weiter. Als sie ihm noch näher kam, zog er seinen Knüppel und hob ihn drohend in die Höhe. Der bloße Anblick ließ Emma innehalten. Er musste doch sehen, dass sie hier nicht hergehörte! »Bitte! Ich bin nicht verrückt.«
»Sicher.« Er nickte und wies mit seinem Prügel in Richtung der anderen Insassen. »Du bist genauso normal wie deine Freunde hier.«
Dann wandte er sich ab, um die Kammer zu verlassen. Emma machte zwei Schritte auf ihn zu. »Warten Sie!«
Ehe sie nach seinem Arm greifen konnte, stieß er sie von sich. Sie fiel zu Boden. Hastig griff sie nach dem Bein des Mannes, um zu verhindern, dass er die Kammer verließ. Wenn er jetzt ging, saß sie hier fest, bis sich jemand ihrer erbarmen würde. »Lassen Sie mich mit meiner Tante sprechen!« Tante Mabel war ihr Vormund. Solange Emma noch keine einundzwanzig oder vermählt war, lag ihr Wohlergehen in ihren Händen.
»Nimm deine Pfoten weg!« Der zischende Ton des Wärters erschreckte Emma so sehr, dass sie die Hände zurückzog. Hilflos musste sie mitansehen, wie er zur Tür ging und sie öffnete. Statt jedoch die Kammer zu verlassen, rief er nach jemandem. Kurz darauf vernahm sie schnelle Schritte auf dem Gang. Zwei weitere Männer in Weiß kamen herein.
»Die da!«, sagte der Wärter, den Emma am Gehen hatte hindern wollen, und zeigte auf sie.
»Haltet sie fest!«, befahl einer der anderen.
Erst jetzt sah sie die vergilbte Zwangsjacke in seinen Händen. Emma wich zurück, doch sie war noch immer zu unsicher auf den Beinen, als dass es ihr hätte gelingen können, sich den Wärtern zu entziehen. Eiserne Finger schlossen sich um ihre Arme und zogen sie auf die Beine. Sie versuchte, sich loszureißen, doch ihr fehlte die nötige Kraft. Emma schrie und wand sich im Griff der Männer, als ihr einer von ihnen die Zwangsjacke überstreifte und die Schnallen auf ihrem Rücken so festzog, dass sie glaubte, unter dem schweren Stoff nicht länger atmen zu können. Keuchend rang sie um Worte, die in ihrer Kehle versickerten, da fixierte der Wärter auch noch ihre Arme.
»Ruf den Doc«, sagte er zu einem seiner Kollegen. Der nickte und ging nach draußen. Und an Emma gewandt: »Und du setz dich jetzt da hin und halt den Mund.« Er verpasste ihr einen Stoß, der sie zu Boden schickte. Diesmal stand sie nicht noch einmal auf. Stattdessen kroch sie zurück an die Wand, unfähig, mehr als ihre Beine zu bewegen.
Binnen weniger Augenblicke hatte sich der Raum für sie endgültig in eine Gefängniszelle verwandelt. Sie kämpfte gegen die aufsteigenden Tränen an und musste sich ihnen schließlich doch ergeben. Schluchzend und bebend vor Zorn und Hilflosigkeit starrte sie auf die beiden Wärter, die neben der Tür stehen geblieben waren und grimmig in den Raum blickten – zwei vage Schemen hinter dem Tränenschleier, der sich über ihre Augen gelegt hatte.
Mit jedem verstreichenden Augenblick lastete die Zwangsjacke schwerer auf ihr. Wenn sie zu atmen versuchte, hatte sie das Gefühl, jemand hätte eiserne Bänder um ihren Brustkorb gelegt. Ihre Arme schmerzten und sie glaubte, ersticken zu müssen, wenn es ihr nicht bald gelang, tief Luft zu holen.
Wie war sie nur in diese verfahrene Lage geraten?
Hatte wirklich alles mit dem tollwütigen Hund angefangen? War ihre Furcht vor dem Tier so groß gewesen, dass ihr Verstand sie nicht mehr verkraften konnte? So verschwommen die letzten Tage und Wochen in ihrer Erinnerung auch sein mochten, daran, was sie gedacht hatte, als sie dem Hund gegenüberstand, erinnerte sie sich noch immer: Du hast es schon einmal gesehen! Es wird wieder zuschlagen!
Sie verstand diese Gedanken selbst nicht und konnte sie nur damit erklären, dass sie schon einmal einem wilden Tier gegenüber gestanden hatte – vermutlich zu jener Zeit, als sie noch bei ihrem Vater gelebt hatte.
Während sie noch darüber sinnierte, betrat ein schlanker, älterer Mann die Zelle. Im Gegensatz zu den Wärtern, die in Hemd und Hosen gekleidet waren, trug er einen weißen Kittel. Das musste der Doktor sein. Emma versuchte, sich ein Stück aufzurichten. Vielleicht konnte sie den Arzt davon überzeugen, sie mit ihrer Tante sprechen zu lassen.
»Halten Sie sie fest, Wilkes«, sagte der Arzt an einen der Wärter gewandt.
Festhalten? Emma horchte auf. Was glaubte er, wie gut sie sich in dieser Zwangsjacke noch bewegen konnte? Er nahm doch nicht allen Ernstes an, sie wäre noch in der Lage, ihn anzugreifen!
»Bitte, Doktor«, presste sie atemlos hervor, als er näher kam. »Sie müssen mich anhören.«
»Alles zu seiner Zeit. Erst müssen Sie sich beruhigen, dann können wir über alles sprechen.«
Emma wollte ihm gerade sagen, dass sie ruhig war, da sah sie, wie er dem Wärter zunickte. Wilkes packte sie bei den Schultern und presste sie so fest gegen die Wand, dass sie sich nicht mehr bewegen konnte. Entsetzt sah Emma, wie der Doktor eine Spritze aus einer der großen Kitteltaschen zog.
»Das wird Ihnen helfen.« Die Nadel schimmerte kalt im Schein des Gaslichtes, als er die Spritze in die Höhe hielt.
Oh mein Gott! Noch mehr Morphium? Wie sollte sie je einen klaren Kopf bekommen, wenn man ihr immer wieder Drogen einflößte?
»Bitte nicht«, setzte sie an, doch er ließ sich von ihrem Flehen nicht beirren.
Als er nach ihrem Bein griff, begann sie um sich zu treten. Sofort war ein weiterer Wärter bei ihnen, packte ihre Beine und drückte sie zu Boden. Emma schrie und versuchte, den Arzt davon zu überzeugen, ihr keine Spritze zu geben, doch sie konnte sich nicht länger gegen ihn wehren. Er schob ihren Kittel nach oben und injizierte ihr das Serum in den Oberschenkel. Emma glaubte ein Brennen zu verspüren, als sich die Droge durch ihre Venen fraß. Die Wärter gaben sie frei und traten zurück.
»Warum kriegt die das gute Zeug?«, beschwerte sich die Rote Meg.
»Weil jemand dafür bezahlt.« Der Doktor erhob sich und verließ ohne ein weiteres Wort die Zelle.
Emma zerrte an der Zwangsjacke, kämpfte gegen den festen Stoff an, der sie gefangen hielt und zu erwürgen drohte. Sie wollte den Wärtern zurufen, dass sie sie daraus befreien sollten, doch das Morphium begann bereits, ihre Sinne zu vernebeln und brachte sie um die Fähigkeit, sich zu artikulieren. Ohne die Gurte und Schließen auch nur ein wenig gelockert zu haben, folgten die drei Männer dem Arzt nach draußen.
»Bitte«, keuchte Emma in der Hoffnung, jemand würde ihr helfen, sich aus der Zwangsjacke zu befreien, »… öffnen.«
Doch die Rote Meg schüttelte nur den Kopf und wich zurück. Es fiel Emma immer schwerer, ihre Umgebung zu erfassen. Soweit sie es durch den Nebel erkennen konnte, der mehr und mehr ihre Sicht verschleierte, schenkten ihr die meisten anderen Insassen nicht einmal Beachtung. Lediglich der Mann, der zuvor die Lampe angestarrt hatte, richtete den Blick nun auf sie.
»Dir wird niemand helfen«, sagte er kalt und richtete den Blick erneut auf die flimmernde Lampe über ihm. Ein Speichelfaden rann aus seinem Mundwinkel über sein Kinn. »Sie bestrafen uns, wenn wir das tun. Strafe ist nicht gut … Schmerzen … Dunkelheit …«
Er sagte noch mehr, doch das Morphium entfaltete nun seine volle Wirkung und riss Emma mit sich ins Nichts.
Die Zeit wurde zu einem gleichmäßig dahinfließenden Strom. Emma wusste zwar noch, wer sie war und wo sie sich befand, doch es interessierte sie ebenso wenig wie die regelmäßigen Besuche des Doktors, die jedes Mal mit einer weiteren Injektion endeten. Selbst die Zwangsjacke spürte sie nicht mehr. Sie fühlte sich leicht und frei und nicht länger von dieser Welt, lag einfach da und starrte in den Nebel, in dem die Bestie sie erwartete.
*
»Miss Gordon«, drang eine Stimme an ihr Ohr. »Sehen Sie mich an!«
Es fiel Emma schwer, der Aufforderung zu folgen. Schwach und ausgelaugt bedurfte es mehrerer Versuche, bis es ihr gelang, die Augen zu öffnen. Der Nebel hatte sich zurückgezogen. Über ihr schwebte das Gesicht des Arztes. Eine Weile lag sie nur da und starrte in die Augen des Mannes. Augen, die so kühl und desinteressiert dreinblickten, dass es sie fröstelte. Nur allmählich kehrte das Gefühl in ihren Körper zurück. Sie lag auf dem Boden, die steifen Glieder von sich gestreckt. Die Zwangsjacke war fort.
»Stehen Sie auf«, verlangte der Doktor.
Emma versuchte, sich zu bewegen, doch es wollte ihr nicht gelingen, sich aufzurichten. Schließlich griff er nach ihr und zog sie auf die Beine. Wankend kam Emma zu stehen, auf den Arm des Arztes gestützt. Ihr war schwindlig und übel und sie fühlte sich erschreckend müde und kraftlos. Ohne die Hilfe des Arztes wäre sie in die Knie gegangen.
»Bitte … keine Spritze«, flüsterte sie.
»Zumindest heute nicht«, stimmte der Arzt zu. »Sie haben Besuch.«
Besuch? Das Wort wollte ihr nicht über die trockenen Lippen kommen, trotzdem verstand er. »Ihre Tante ist hier.«
Erleichtert schloss Emma die Augen. Tante Mabel würde sie hier herausholen. Sie musste doch verstehen, dass sie nicht verrückt war! »Ich möchte mich anziehen.«
»Das ist nicht nötig.«
Natürlich war es das! Sie konnte wohl kaum in diesem Kittel nach Hause fahren. Das würde Tante Mabel nicht zulassen.
»Ihre Tante ist zu Besuch, Miss Gordon. Sie wird Sie nicht mitnehmen.«
»Was?« Unzählige Fragen schossen ihr gleichzeitig durch den Kopf, doch keine davon wollte sich artikulieren lassen. Sie konnte den Doktor nur anstarren.
»Sie sind krank«, fuhr er fort. »Ihre Tante weiß das und sie wird Sie nicht eher von hier fortholen, ehe es Ihnen nicht besser geht.«
»Aber –«
»Versuchen Sie nicht, mit mir zu diskutieren, oder soll ich Ihre Tante wieder fortschicken?«
Emma schüttelte hastig den Kopf. Sie musste dringend mit Tante Mabel sprechen und sie davon überzeugen, dass sie unmöglich hier bleiben konnte. Diese Möglichkeit durfte sie sich nicht durch störrisches Benehmen zerstören.
»Braves Mädchen.« Der Arzt übergab sie in die Obhut eines Wärters und ging ohne ein weiteres Wort davon.
Sie stützte sich auf den Arm des Wärters, als er sie aus der Zelle führte. Ihre Knie waren so weich, dass der Mann in Weiß sie mehr tragen musste, als dass sie aus eigener Kraft ging. Obwohl es erst August war und der Sommer kaum seinen Höhepunkt überschritten hatte, war es auf dem Gang kalt – weitaus kälter noch als in der Zelle. Ein gebeugter Mann tauchte einen Lappen in einen Eimer mit Wasser und machte sich daran, den Boden zu wischen. Von den nassen Stellen stieg der stechende Geruch von Ammoniak in die Luft und brachte Emma zum Husten. Der Wärter zog sie rasch weiter, führte sie einige fensterlose Gänge aus Ziegelstein entlang, die von flackernden Gaslampen in kaltes Licht getaucht wurden, das nie auszureichen schien, um die Dunkelheit wirklich zu vertreiben. Von Zeit zu Zeit kreuzten Männer oder Frauen im Anstaltskittel ihren Weg. Einige schritten zielstrebig voran, als seien sie auf dem Weg zu einer dringenden Verabredung, andere streiften durch die Gänge wie Geister, schwebten ziellos umher und sprachen mit sich selbst, mit Wänden oder zufällig vorübergehenden Personen. Der Wärter scheuchte jeden weiter, der ihn oder Emma anzusprechen versuchte. Dennoch erschrak Emma beim Anblick dieser zerlumpten Gestalten.
»Warum bin ich eingesperrt? Warum darf ich nicht herumwandern wie die?«, wisperte sie, um nicht die Aufmerksamkeit eines Mannes auf sich zu ziehen, der ihnen seit einigen Metern folgte, immer wieder an ihnen vorüberlief, sie umrundete und sich schließlich wieder an ihre Fersen heftete.
Der Wärter erwiderte nichts.
Zum wohl hundertsten Mal fragte sich Emma, wie es so weit gekommen war, dass sie hier geendet hatte. Konnte sie tatsächlich verrückt sein?
Vor einer Tür blieb der Wärter stehen. Er hob die Hand, um anzuklopfen. Als er jedoch aus dem Inneren Stimmen vernahm, ließ er sie wieder sinken.
»Der Doktor ist gerade bei Lady Bancroft. Wir warten hier, bis er fertig ist.«
Bereits der kurze Weg durch die Gänge war für Emma anstrengend gewesen. Ihre Beine zitterten und sie sehnte sich danach, sich setzen zu können. Da der Wärter ihren Arm nicht freigab, konnte sie nichts anderes tun, als sich neben der Tür an die Wand zu lehnen und die Augen zu schließen. Ihr war übel und schwindlig.
Dumpfe Stimmen trieben durch die Holztür an ihr Ohr, anfangs nicht mehr als unverständliche Laute, die sich jedoch – nachdem es ihr schließlich gelang, sich darauf zu konzentrieren – in Worte verwandelten.
»Wann kann ich sie mit nach Hause nehmen?« Tante Mabels Stimme zu hören, erfüllte Emma mit Erleichterung. Sie wird mich hier herausholen! Dann ist der Albtraum vorüber. Aber würde es wirklich genügen, Bedlam zu verlassen, um all das zu vergessen? War es nicht vielmehr so, dass sie sich auch draußen fragen würde, was der Auslöser dafür gewesen sein mochte, dass man sie hierher gebracht hatte?
»Ich fürchte, Sie werden noch eine geraume Zeit auf Ihre Nichte verzichten müssen, Lady Bancroft.«
Die Worte des Arztes zerschmetterten Emmas Hoffnungen.
Als ihre Tante zu einem Protest ansetzte, unterbrach er sie: »Dieses Mädchen ist eine Gefahr – für sich selbst und vielleicht auch für andere. Es wäre unverantwortlich, sie gehen zu lassen.«
Unverantwortlich! Wie sollte Emma herausfinden, was ihr fehlte, wenn nie jemand mit ihr sprach und ihr Verstand ständig betäubt war? Ganz gleich, was geschah, sie konnte unmöglich länger hierbleiben!
Drinnen verabschiedete sich der Doktor, dann wurde die Tür geöffnet und er trat auf den Gang. Ohne Emma oder dem Wärter Beachtung zu schenken, eilte er davon. Ein wenig zögernd trat Emma in das Zimmer. Sie hatte eine weitere karge Zelle erwartet. Stattdessen fand sie sich in einem geräumigen Arbeitszimmer wieder. Wände und Decke waren mit dunklem Holz getäfelt. Durch ein hohes Fenster strömte Sonnenlicht herein und überflutete den massiven Schreibtisch und den Ledersessel davor. Das Zentrum des Raumes wurde von einem großen Tisch aus glänzendem Eichenholz eingenommen, um den herum einige Stühle standen. An der gegenüberliegenden Wand drängten sich einige Bücherregale und ein gewaltiger Wandschrank. Ein dicker Teppich wärmte Emmas nackte Fußsohlen. Er fühlte sich weich und tröstlich an, vollkommen anders als der von Stroh und Unrat übersäte Boden in ihrer Zelle. Doch trotz der Behaglichkeit, die der Raum ausstrahlte, hing Emma noch immer der Geruch von Schweiß und Urin in der Nase. Ganz gleich, was geschah, sie konnte nicht noch einmal in diese Zelle zurück. Es würde sie zerbrechen.
Als Tante Mabel sie sah, kam sie um den Tisch herum. Sie trug ein hochgeschlossenes hellgraues Kleid mit Rüschen an den Ärmelabschlüssen und am Kragen und ein Paar dünne weiße Handschuhe. Auf dem Tisch lagen ihr Sonnenschirm und ein kleiner grauer Hut. Ehe sie etwas zu Emma sagte, richtete sich ihr Blick auf den Wärter, der sich an der Tür postiert hatte. »Sie können jetzt gehen.«
Der Mann verließ mit einem knappen Nicken das Zimmer. Emma zweifelte nicht daran, dass er auf der anderen Seite der Tür Posten beziehen würde, als sei sie eine Schwerverbrecherin.
Sobald der Wärter fort war, richtete sich Mabels Aufmerksamkeit auf Emma. Einen Moment lang musterte sie ihre Nichte entsetzt, ehe sie sie in ihre Arme zog. »Geht es dir gut, Kind?«, flüsterte sie und schüttelte sogleich den Kopf. »Natürlich nicht! Was für eine dumme Frage. Ich wünschte wirklich, ich könnte dich mit nach Hause nehmen.«
»Dann tu es!« Emma befreite sich aus der Umarmung und sah ihrer Tante in die Augen. »Nimm mich mit.«
»Das kann ich nicht. Der Doktor sagt –«
Obwohl ihr das Sprechen noch immer schwer fiel und die Zunge trocken und geschwollen an ihrem Gaumen klebte, zwang sich Emma dazu, die Worte herauszupressen. »Ich weiß, was er gesagt hat, aber es stimmt nicht. Ich bin nicht verrückt!«
»Natürlich nicht, Schätzchen.« Tante Mabel strich ihr liebevoll über die Wange, doch diese Geste vermochte es keineswegs, sie zu beruhigen. Womöglich glaubte ihre Tante tatsächlich nicht, dass sie verrückt war. Ihr Verhalten ließ jedoch eindeutig auf ihre Überzeugung schließen, dass mit ihrer Nichte etwas nicht in Ordnung war. »Du musst hierbleiben, Emma. Doktor O’Connor kann dir helfen.«
»Indem er mich betäubt?«, gab Emma zurück. »Ich wüsste nicht, wie mir das helfen sollte.« Sie spürte die Wirkungen des Morphiums nur zu genau, es raubte ihr die Kraft und zwang sie, sich zu setzen. »Ich wünschte, das alles wäre nie passiert.« Dann schüttelte sie langsam den Kopf. »Nein, es geht mir nicht gut. Ich möchte nach Hause.«
»Bald, Emma.« Ihre Tante bedachte sie mit einem langen Blick, als suche sie nach den passenden Worten, dann sagte sie: »Ich muss einer Einladung von Lady Margaret aufs Land, nach Hares House, folgen und dich mit einer Unpässlichkeit entschuldigen. Alles muss weitergehen wie bisher. Niemand soll erfahren, dass es dir nicht gut geht und … wo du bist.«
Wir wollen doch deine bevorstehende Verlobung mit Mr Bell nicht gefährden, vollendete Emma den Satz im Stillen.
»Es ist wirklich das Beste, wenn du hier bleibst«, versuchte Tante Mabel es noch einmal. »Erinnerst du dich daran, wie hoch dein Fieber war, ehe dich Doktor Fitzmorton hierherbringen ließ? Es ging dir wirklich schlecht, Emma.«
Glaubst du, dass es mir hier besser geht? Da sie jedoch wusste, dass sie mit Widersprüchen gar nichts erreichen würde, sprach sie es nicht aus. »Ich sehe diese Bestie nicht mehr«, sagte sie stattdessen. Eine glatte Lüge, denn das Ungetüm war so präsent wie zuvor. Doch wenn es etwas gab, das ihre Tante beruhigen und davon überzeugen konnte, sie wieder nach Hause zu holen, dann das Wissen, dass die Bestie Emma nicht länger in ihren Träumen verfolgte. Dennoch war es ihr nicht nur wichtig, vernünftig zu wirken – zugleich wollte sie noch immer herausfinden, was sich hinter den Albträumen verbarg.
»Bin ich jemals einem wilden Tier begegnet, Tante Mabel?« Sie gab sich alle Mühe, unbeteiligt zu klingen, als sei sie lediglich neugierig. Ihre Tante durfte auf keinen Fall merken, wie verzweifelt Emma nach einer Antwort suchte. »Vielleicht, als ich noch bei Vater gelebt habe?«
Bei der Erwähnung ihres Vaters versteifte sich Tante Mabel sichtlich. Sie hatte sich nie gut mit dem Ehemann ihrer Schwester verstanden und machte auch keinen Hehl daraus. Emma liebte ihren Vater, auch, wenn sie ihn seit fünf Jahren nicht mehr gesehen hatte. Er war nur schwer mit dem Unfalltod seiner Frau – Emmas Mutter – zurechtgekommen und seitdem nicht mehr derselbe. Dennoch hatte er sein Bestes getan, sich um Emma zu kümmern, wenn auch auf eine eigenartig distanzierte Weise. An jenem Tag jedoch, als er Emma und Gabriel in inniger Umarmung vorgefunden hatte, war aus dem zurückhaltend wirkenden Mann ein tobender Sturm geworden. Er hatte Emma mit sich gezerrt und sie in ihrem Zimmer eingesperrt, bis Tante Mabel kam, um sie abzuholen. Seitdem hatte sie weder ihren Vater noch Gabriel wiedergesehen.
»Ich kann mich nicht erinnern, dass er oder deine Mutter – Gott hab sie selig – je von etwas Ähnlichem berichtet hätten.«
Emma schloss nicht aus, dass es dennoch ein derartiges Ereignis gegeben haben könnte. Womöglich hatten ihre Eltern es schlicht nicht für wichtig genug gehalten, Tante Mabel davon zu erzählen. Ihr Vater würde die Antwort kennen. Er konnte die quälende Frage beantworten, ob sie wirklich verrückt war!
»Ich weiß nicht, was es war«, fuhr Emma in ihrem Versuch fort, Tante Mabel zu beruhigen. »Vielleicht waren die Träume lediglich die Vorboten des Fiebers. Alles nicht mehr als eine schlimme Grippe.«
»Seit du in London bist, warst du kein einziges Mal krank, Emma.«