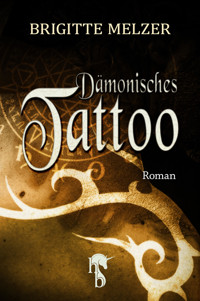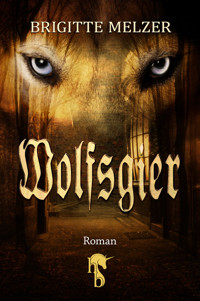4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: hockebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Jahrelang hat Serena die Erinnerung an Cale verdrängt. Der unsichtbare Freund aus ihrer Kindheit hat nie wirklich existiert. Als seine Stimme nach einem Überfall plötzlich wieder in ihrem Kopf erklingt, begreift sie jedoch, dass Cale keineswegs ihrer Einbildung entsprungen ist. Er ist kein Mensch, sondern ein Wesen aus einer anderen Welt. Und er ist in Gefahr. Serena allein kann ihm helfen, aber kann sie ihm auch vertrauen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 531
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Brigitte Melzer
Wesen der Nacht
Band 1: Geistwandler
Roman
Prolog
Die Dunkelheit umgab ihn wie ein Leichentuch. Nur dass er ein Leichentuch hätte packen und zur Seite reißen können. Diese Dunkelheit jedoch war starr und unnachgiebig. Die Wände seines Gefängnisses, dessen beklemmende Enge ihn in eine kauernde Haltung zwang, waren durchzogen von Silber und eingeritzten Schutzrunen. Verdammtes Metall! Es machte ihn wehrlos, behinderte den Fluss seiner Kräfte.
Dabei waren die Wände, die ihn – keine Armlänge entfernt – umgaben, nicht einmal aus Stein, sondern lediglich aus Holz. Er saß in einer Kiste. Einem lächerlichen Ding, mit dem die Menschen Gegenstände in ihrer Welt umherschickten. Holz, organisches Material. Wie sehr wünschte er sich, es mit der Macht eines Gedankens in seine einzelnen Atome zu zerlegen. Dummerweise gehörte das nicht zu seinen Fähigkeiten. Ein Wesen wie er, befand er, sollte dazu in der Lage sein. Nichts und niemand sollte es vermögen, sich einem Geschöpf des Jenseits in den Weg zu stellen. Ganz sicher keine verfluchte Holzschachtel!
Er hatte gelernt auszusehen wie sie, sich so zu benehmen und sich ihrer Welt anzupassen. Trotzdem hatte der Jäger hinter die Fassade des Teenagers geschaut, mit der er sich umgeben, in der er sich sogar wohlgefühlt hatte, und erkannt, was er wirklich war.
Alles war gründlich schiefgegangen. Er hatte seine Mission in den Sand gesetzt und jetzt stand sein Leben auf dem Spiel. Er fürchtete nicht, dass ihn der Wächter töten würde, der ihn hier festgesetzt hatte. Es war sein Auftraggeber, der ihm Sorge bereitete. Dieser verstand keinen Spaß und hatte deutlich gemacht, welche Konsequenzen ein Versagen mit sich bringen würde. Anders als er selbst war sein Auftraggeber durchaus in der Lage, ihn in seine einzelnen Atome zu zerlegen.
Sein Befehl war es gewesen, ein Druckmittel in seine Gewalt zu bringen. Statt sich jedoch unauffällig im Hintergrund zu halten, hatte er nach einem Ausweg gesucht. Dabei war er einem Jäger ins Netz gegangen und fast hatte es den Anschein, als wäre es nicht der Plan des Mannes gewesen, ihn an den Torwächter zu übergeben. Der Jäger hatte kurz gezögert, seinen Fang dann aber widerspruchslos übergeben, woraufhin der Wächter ihn in diesen Kasten gesteckt hatte.
Warum war er überhaupt noch hier? Es war schwer zu sagen, wie viel Zeit vergangen war, seit sich die Tür seines Gefängnisses über ihm geschlossen hatte.
Von wegen Tür. Er schnaubte. Ein elender Deckel! Nenn die Dinge ruhig beim Namen. Du bist nichts weiter als Frachtgut, Caleridon!
Während der ersten Stunden war er noch in der Lage gewesen, dem Fluss der Zeit zu folgen, dann aber hatte sich die Zeit verselbstständigt, hatte ein eigenes, der Finsternis angepasstes Tempo angenommen und plötzlich war es ihm nicht mehr möglich, zu sagen, wie lang er in diesem Loch festsaß. Seine Auslieferung hätte nicht länger als ein paar Stunden auf sich warten lassen sollen. Im schlimmsten Fall einen Tag. Seine Gefangenschaft jedoch dauerte nun schon bedeutend länger an, so viel war gewiss.
Er hatte versucht, sich zu befreien. Hatte sich mit aller Macht gegen die Wände geworfen und, als das nichts half, seinen Geist nach jemandem außerhalb dieses Würfels ausgestreckt. Früher einmal wäre es ein Leichtes für ihn gewesen, jemanden auf sich aufmerksam zu machen und dazu zu bringen, ihm zu Hilfe zu kommen. Doch er verfügte nicht länger über diese Gabe. Er hatte sie schon vor langer Zeit aufgegeben. Es war eine bewusste Entscheidung gewesen und bisher hatte es ihm nie etwas ausgemacht. Selbst heute bereute er nicht, was er getan hatte, auch wenn sich die Dinge anders entwickelt hatten als erhofft. Seine Kräfte hätten ihm ohnehin nichts geholfen, solange das Silber sie blockierte.
Fähigkeiten hin oder her, er wollte sich nicht in sein Schicksal fügen, das würde er niemals tun. Auf keinen Fall konnte er hier sitzen und tatenlos darauf warten, dass man ihn der Gerichtsbarkeit jenseits der Pforten übergab. Nicht etwa der harten Strafe wegen, die ihn für den unerlaubten Grenzübertritt erwartete, sondern wegen seines Auftraggebers. Sobald dieser vom Scheitern seiner Mission erfuhr – und eine Überstellung an den Rat war ein eindeutiger Beweis für sein Versagen –, war sein Leben verwirkt. Ebenso verwirkt war es, wenn der Zeitraum verstrich, den man ihm für die Durchführung seines Auftrags eingeräumt hatte, ohne dass er einen Erfolg vorweisen konnte.
Wenn er eine Chance haben wollte, mit heiler Haut davonzukommen, musste er handeln, solange er sich noch auf dieser Seite der Grenze befand. Aber das Denken fiel ihm schwer. Die Enge und die Finsternis raubten ihm mehr und mehr die Sinne und drohten schon bald jeden klaren Gedanken im Keim zu ersticken.
In der Dunkelheit mochte die Zeit anderen Gesetzen unterliegen, eines jedoch blieb gleich: Sie spielte noch immer gegen ihn. Das Silber verhinderte, dass sich seine Lebensenergie aufladen konnte, wie es draußen der Fall gewesen wäre. Wenn er keinen Weg in die Freiheit fand, würde sie mehr und mehr dahinschwinden. Damit wäre sein Ende besiegelt. Doch noch blieb ihm Zeit. Zwei Wochen mochten es sein – wenn er Glück hatte und mit seinen Kräften haushielt, ein wenig mehr. Es gab allerdings noch eine Möglichkeit.
Caleridon streckte seinen Geist nach der einzigen Verbindung aus, über die er in dieser Welt verfügte. Einer Verbindung, die er vor Jahren verloren hatte und die nun seine letzte Hoffnung war.
1
»Serena, ist alles in Ordnung?«
Pepper hatte Mühe, mir durch das Gedränge die Stufen nach oben zu folgen, als ich aus dem U-Bahnschacht an die Oberfläche floh. Nur raus hier! Raus aus der Dunkelheit und der Enge. Ich brauchte Luft!
Schwer atmend blieb ich vor der Treppe stehen, den Blick auf die Archway Tavern gerichtet, einen roten Ziegelbau mit weiß eingefassten Fenstern, der auf einer dreieckigen Insel zwischen zwei Straßen thronte. Ich starrte auf den Turm mit der Uhr, der sich in der Mitte des Daches erhob, verwundert darüber, dass ich das Ticken bis hierher hören konnte. Doch es war nicht die Uhr, es war mein eigener Herzschlag, der mir in den Ohren dröhnte.
Mit weichen Knien wich ich dem Strom der Menschen aus, die hinter mir die Treppen nach oben drängten. Ich lehnte mich an das massive Metallgeländer neben dem U-Bahnaufgang und sog begierig die Luft ein. Dort unten, in der Enge des vollgestopften Zuges hatte ich geglaubt, ersticken zu müssen. Ohne Vorwarnung hatte ich zu zittern begonnen. Kalter Schweiß war mir auf die Stirn getreten, und mit einem Mal war mir so schlecht geworden, dass ich nur noch einen Gedanken kannte: Luft!
Pepper hatte zu mir aufgeschlossen und blieb vor mir stehen. »Bist du sicher, dass es dir gut geht? Du bist weiß wie eine Wand!«
Ich nickte. »Mir ist nur schlecht geworden. Hitzestau.« Tatsächlich war es für Mitte Juni erstaunlich warm und die Belüftung in der U-Bahn war, wie so oft, ausgefallen gewesen. Kein Wunder, wenn mir da schlecht wurde. Es ging mir auch schon besser, seit ich dem ratternden Waggon entkommen war. Alles, was blieb, war ein leichtes Frösteln, das mich überkam, sobald mir der Sommerwind über den verschwitzten Nacken strich. Unwillkürlich hob ich die Hand und fuhr mir über den Hals. Die drei Anhänger an meinem Bettelarmband, das Dad mir zum Geburtstag geschenkt hatte, klirrten leise. Das Geräusch beruhigte mich.
Trotzdem wich ich Peppers besorgtem Blick aus. Meine Augen blieben an einem Typ hängen, der mit ans Ohr gepresstem Handy die Treppen nach oben lief und sich angeregt zu unterhalten schien. Hatte er mich gerade angesehen? Er war zwei oder drei Jahre älter als ich, vielleicht ein Student. Für einen Moment verstummte er, als er an Pepper und mir vorbeiging. Er musterte mich neugierig. Meine Güte, ich musste aussehen wie ein Wrack!
Immerhin schenkte er mir ein kurzes, mitleidiges Lächeln, dann nahm er seine Unterhaltung wieder auf. »Ich bin auf dem Weg«, hörte ich ihn in sein Telefon sagen. Seine weiteren Worte gingen im Verkehrslärm unter, als er sich langsam entfernte.
Pepper hingegen sah mich noch immer an.
Ich seufzte. »Es geht mir gut, Peps. Wirklich. Mir wird nur seit einer Weile dauernd schlecht. Vielleicht habe ich mir einen Virus eingefangen oder mir den Magen verdorben.«
»Oder du bist schwanger.«
Ich zog eine Augenbraue hoch. »Von nichts kommt nichts.« Du liebes bisschen, ich hatte nicht einmal einen Freund und ganz sicher niemanden, mit dem ich mich zwischen den Laken hätte wälzen können. Oder wollen. Nein, es war wohl eher irgendein fieser Virus.
Manchmal war es nur ein kurzer Moment, in dem ich das Gefühl hatte, dass mir übel wurde, doch so schnell das Gefühl kam, war es auch wieder vorbei. Manchmal dauerte es Minuten, dann wurde es so schlimm, dass ich nur noch an Flucht denken konnte. So wie vorhin in der U-Bahn. Und fast kam es mir so vor, als könne ich der Übelkeit tatsächlich davonlaufen. Wie sonst ließ sich erklären, dass es mir, nachdem ich den Zug verlassen hatte, schlagartig besserging?
Angefangen hatte es vor zwei Wochen, ausgerechnet an meinem sechzehnten Geburtstag. Dad war extra aus den Highlands nach London gekommen, einmal quer über die Insel, um den Tag mit Mom und mir zu verbringen. Nur mein Bruder Trick, der eigentlich Patrick heißt, war nicht dabei gewesen. Ihn hatte eine Sommergrippe ans Bett gefesselt, sodass er in Duirinish geblieben war. Wer weiß, vielleicht hatte Dad ja ein paar von Tricks Viren im Gepäck gehabt. Es war wie verhext. Seit Mom und Dad sich getrennt hatten und Mom und ich in London lebten, fehlte immer jemand bei Feiern und Festtagen. Bis vor drei Jahren war es stets Dad gewesen, der mit Abwesenheit geglänzt und lediglich angerufen oder Postkarten und E-Mails geschickt hatte.
Dann war Trick, der bis dahin bei Mom und mir gelebt hatte, zu Dad gezogen. Seitdem bekam ich Dad häufiger zu Gesicht. Aber nie gleichzeitig mit meinem Bruder. Die beiden arbeiteten als Aufseher eines Naturschutzgebiets in den Highlands und vertraten sich gegenseitig. Warum ein Stück Landschaft nicht einmal für ein paar Tage unbeaufsichtigt bleiben konnte, hatte mir bisher allerdings niemand erklären können.
»Es geht einfach nicht«, war der Satz, den ich regelmäßig zur Antwort bekam. Früher nur von Dad, inzwischen auch von Trick. Als würde die Welt untergehen, wenn niemand ein Auge auf diesen blöden Landstrich hatte.
Dabei liebte ich diese Gegend, in der ich die ersten fünf Jahre meines Lebens verbracht hatte. Bis Mom und Dad sich getrennt hatten und Mom mit uns fortgezogen war. Unzählige Male hatte ich Mom angebettelt, Dad besuchen zu dürfen. Doch zu meinem Leidwesen erlaubte Mom es mir nie. Er sei zu beschäftigt und ich wäre ihm nur im Weg, behauptete sie dann. Also wirklich, ich war sechzehn, kein kleines Kind mehr, das rund um die Uhr beaufsichtigt werden musste! Trotzdem blieb sie unbeirrbar.
Manchmal verstand ich meine Eltern nicht. Wenn ich die beiden zusammen sah, wollte mir einfach nicht in den Kopf, warum sie sich überhaupt getrennt hatten. Sie wirkten so harmonisch und gingen so liebevoll miteinander um. Sie telefonierten ständig und die Blicke, die sie einander zuwarfen, wenn Dad zu Besuch kam, sprachen Bände. Scheiden hatten sie sich auch nicht lassen und neulich hatte ich sie knutschend in der Küche erwischt, als sie eigentlich den Abwasch erledigen wollten! Sobald sie mich bemerkten, waren sie auseinandergefahren und hatten so getan, als wäre nichts passiert. Wenn sie stritten, taten sie es hinter verschlossenen Türen. Ich wusste nicht, wo das Problem der beiden lag, denn dass sie sich liebten, war schwer zu übersehen. Doch offensichtlich war dieses Problem ausreichend groß, um ein Zusammenleben unmöglich zu machen.
Nach zehn Jahren in London verstand ich immer noch nicht, wie Mom lieber in dieser hektischen Stadt leben mochte als in meinen geliebten Highlands. Dads Job war zeitraubend. Manchmal war er mehrere Tage unterwegs, führte Touristen auf ihren Wanderungen oder sah irgendwo nach dem Rechten. Vielleicht hatte Mom nicht mit der Einsamkeit umgehen können. Andererseits hatte sie Trick und mich gehabt und ehrlich gesagt war sie auch hier in London nicht sonderlich kontaktfreudig. Mom sagte, es hätte mit meiner Krankheit zu tun. Sie wollte an einem Ort sein, an dem sie jederzeit einen Arzt erreichen konnte. Mir ging es schon seit langer Zeit wieder gut, trotzdem waren wir nicht zurückgekehrt.
Pepper boxte mich in die Schulter und riss mich aus meinen Gedanken. »Hey, hörst du mir eigentlich noch zu? Ich hab dich gefragt, ob du schon beim Arzt warst! Ist vermutlich sowieso egal. Wenn es ein Virus ist, habe ich ihn mir bestimmt schon eingefangen und werde spätestens heute Abend über der Schüssel hängen.«
»Ich habe gar nicht gekotzt.« Auch wenn ich manchmal kurz davor war. »Mir ist nur schlecht, und ich glaube nicht, dass es ansteckend ist. Sonst hätte Mom es schon längst. Und du genauso.«
Immerhin verfolgte mich die Übelkeit schon seit meinem Geburtstag. Wir waren chinesisch essen gewesen und vielleicht hatte ich etwas Verdorbenes erwischt. Andererseits hatten wir die Platte für drei Personen gehabt und meinen Eltern fehlte nichts. Auch die eigenartigen Wellen, in denen die Übelkeit kam und ging, passten nicht zu einer Lebensmittelvergiftung. Auch nicht zu einem Virus.
»Hier.« Pepper hielt mir eine Flasche Wasser hin. »Trink etwas.«
Dankbar griff ich danach, schraubte den Deckel ab und nahm einen Schluck. Schon bei unserer ersten Begegnung vor zehn Jahren war Pepper es gewesen, die dafür gesorgt hatte, dass es mir besserging. Mom, Trick und ich waren damals gerade nach London gezogen. Bis dahin hatte ich mein ganzes Leben in einem einsam gelegenen Cottage in Duirinish verbracht und die Großstadt, mit ihrem Lärm und der Enge, überforderte mich vollkommen. Dass wir kein eigenes Haus mehr hatten, sondern in einem grauen Betonbunker mit unzähligen Wohneinheiten leben sollten, ließ mich in Tränen ausbrechen, sobald ich den grau gefliesten Hauseingang zum ersten Mal betrat. Mom und Trick schleppten die Kisten mit unseren Sachen ins Haus, keiner von ihnen bemerkte, dass ich mich davonstahl. Ich lief die Treppen hinauf, bis es nicht mehr weiterging, setzte mich oben auf die letzte Stufe und starrte vor mich hin, während mir die Tränen in Strömen über die Wangen liefen. Ich bemerkte das Mädchen mit den kupferroten Locken, den neugierig funkelnden grünen Augen und dem Puppengesicht erst, als es sich neben mich setzte.
»Warum heulst du?« Pepper war schon als Sechsjährige ziemlich direkt gewesen.
»Alles hier ist so grau und trist«, schniefte ich. »Ich vermisse das Gras und das Meer. Und den Himmel. Ich will nach Hause.«
»Komm, ich zeig dir den Himmel.«
Bevor ich wusste, wie mir geschah, packte sie mich an der Hand und zog mich den Gang entlang zu einer Feuerschutztür, die auf das Flachdach hinausführte. Dahinter lag ein kleines Paradies. Zumindest etwas, das meiner Vorstellung davon ziemlich nahe kam.
Jemand hatte das Dach mit künstlichem Rasen ausgelegt und am Rand unterhalb der Dacheinfassung Blumenkästen und ein kleines Kräuterbeet aufgestellt. Der kleine Dachgarten wurde sofort zu meinem Lieblingsplatz, und Pepper, die auf unserer Etage wohnte, zu meiner besten Freundin. Durch sie fand ich in der Schule schnell Anschluss, trotzdem blieb sie immer die Allerwichtigste für mich. Daran hatte sich auch nichts geändert, als Mom und ich vor ein paar Monaten aus dem heruntergekommenen Mietshaus in ein Reihenhaus in Camden gezogen waren.
Selbst nach zehn Jahren in London vermisste ich noch immer die schroffe schottische Küste, an der ich aufgewachsen war. Ich vermisste das Rauschen des Meeres, das Raunen des Windes und die Stille. In der Stadt war es ständig laut, es stank und immer war irgendwo etwas los. Immerhin hatte mir der Lärm, so wenig ich ihn mochte, geholfen, die Stimme aus meinem Kopf zu vertreiben. Jene Stimme, die der Grund dafür gewesen war, dass Mom mich hierher verpflanzt hatte. Meine Krankheit.
In Gedanken versunken schraubte ich den Verschluss wieder auf die Flasche und gab sie an Pepper zurück. Sie stopfte sie in ihre Tasche und deutete auf die Treppe zu den U-Bahntunneln. »Bist du so weit?«
Auch wenn die Übelkeit verflogen war und ich mich wieder vollkommen normal fühlte, behagte mir die Vorstellung nicht, nach unten zu gehen. Was, wenn mir wieder schlecht wurde, sobald wir in der U-Bahn waren? Die Strecke war nicht lang, nur noch eine einzige Station. Ich redete mir ein, dass ich das wohl hinbekommen würde. Andererseits war eine Station auch locker zu Fuß zu schaffen und der Gedanke an einen Spaziergang gefiel mir weit besser als die Vorstellung, mich wieder in einen vollgestopften Wagen zu zwängen.
»Lass uns den Rest laufen.«
Es war ein ungewöhnlich warmer Tag, die Hitze flirrte über dem Asphalt und am Himmel war kein Wölkchen in Sicht. In einer halben Stunde konnten wir am Tor von The Queen’s Green sein, der bewachten Wohnanlage, in die Mom und ich gezogen waren. Wenn es um unser neues Zuhause ging, schlugen zwei Seelen in meiner Brust. Einerseits tat es mir leid, nicht mehr so nah bei Pepper zu wohnen, andererseits mochte ich die weitläufige Anlage, in der wir jetzt lebten. Dort war von der Enge der Stadt nichts zu spüren. All der Lärm und die Hektik verschwanden, sobald man die Bäume hinter sich ließ, die das Grundstück umgaben. Ich hatte nicht die leiseste Ahnung, woher das Geld stammte, mit dem Mom das Haus bezahlt hatte. Angesichts der Preise in London bezweifelte ich, dass es ein Schnäppchen gewesen war, doch wann immer ich sie danach fragte, lächelte sie nur und meinte, ich solle mir darüber keine Gedanken machen.
Dass wir nicht mehr im selben Haus wohnten, hatte nichts daran geändert, dass Pepper und ich ständig zusammenhingen. Wenn das Wetter schön war und uns nicht der Sinn danach stand, uns in irgendwelchen Einkaufszentren oder Cafés herumzutreiben, zog es uns meistens zu mir nach Hause. Pepper war immer noch jedes Mal begeistert davon, in einem richtigen Garten mit echtem Rasen zu sitzen. Und das war auch der Plan für diesen Nachmittag.
»Du willst echt laufen?« Mit einem Seufzen rückte Pepper den Riemen ihrer Tasche zurecht und setzte sich in Bewegung. Sie war noch nie eine Sportskanone gewesen, was man ihr auch ansah – sehr zu ihrem Leidwesen. Sie war nicht nur kleiner, sondern auch fülliger als ich. Es hatte eine Zeit gegeben, in der sie die weniger freundlichen Kids die Kugel nannten. Pepper hatte sich davon nie aus der Ruhe bringen lassen, zumindest nicht nach außen hin. Trotzdem wusste ich, wie weh ihr dieser Spott tat. Inzwischen war sie ein paar Zentimeter gewachsen und ihre Pfunde hatten sich besser verteilt, sodass es nur noch wenige Leute gab, die sie deshalb aufzogen. Das änderte jedoch nichts daran, dass es ihr immer noch zu schaffen machte. Umso höher rechnete ich ihr an, dass sie bereit war, das Stück um meinetwillen zu Fuß zu gehen. Die Luft an der befahrenen Straße war stickig und schwer von Abgasen.
Mit schnellen Schritten gingen wir nebeneinander her. Sobald wir die Stelle erreichten, ab der die Straße nur noch zweispurig war, verlangsamten wir unser Tempo. Der scheußlichste Teil der Strecke lag hinter uns. Hier war es ruhiger. Zu beiden Seiten säumten zweistöckige Ziegelbauten die Straße, in denen sich ein kleiner Laden an den anderen reihte. Einige mit bunten Fassaden und dekorierten Auslagen, andere heruntergekommen und verwaist.
Plötzlich überkam mich ein eigenartiges Gefühl – als würde mich jemand beobachten. Tatsächlich entdeckte ich ein paar Meter vor uns, vor einem der Geschäfte, den Studenten mit dem Handy, der mich schon an der U-Bahn gemustert hatte. Er hielt das Telefon immer noch an sein Ohr gepresst, vermutlich war beides längst miteinander verwachsen, und die Hand, mit der er es hielt, war nur Tarnung, um die Leute nicht zu erschrecken. Sobald sich unsere Blicke trafen, schenkte er mir ein Lächeln, ähnlich mitleidig wie das von vorhin, und drehte mir den Rücken zu. Die Augen in die Auslage eines Computerladens gerichtet, quatschte er weiter in sein Telefon. Als wir an ihm vorbeigingen, folgte sein Blick meinem Spiegelbild im Schaufenster. Schnell checkte ich mein Aussehen in der Scheibe. Ich zupfte den dunkelblauen Faltenrock meiner Schuluniform zurecht und zog die kurzen Ärmel der weißen Bluse gerade. Meine langen schwarzen Locken saßen so, wie sie sitzen sollten. Ich war noch ein wenig blass, aber das dunkle Make-up um meine Augen befand sich an Ort und Stelle. Nichts verschmiert. Das entlockte mir ein zufriedenes Grinsen.
Neben mir leuchtete Peppers kupferroter Schopf in der Scheibe, eine Farbe, um die ich sie immer beneidet hatte, auch wenn ich das niemals zugeben würde, und sie früher deshalb kleine Hexe genannt hatte.
»Du hast mir noch gar nicht erzählt, was Doug heute von dir wollte«, sagte sie.
Mit einem unterdrückten Seufzer riss ich meine Aufmerksamkeit von meinem Spiegelbild und von dem des Studenten los und wandte mich wieder Pepper zu. Doug Shusterman und ich waren letzten Freitag miteinander ausgegangen. Im Gegensatz zu mir schien es ihm gefallen zu haben, weshalb er mich nach Schulschluss auf dem Gang abgefangen hatte, ehe ich die Flucht ergreifen konnte.
»Jetzt rede schon!«, drängte Pepper.
»Er wollte morgen noch einmal mit mir weggehen.«
»Und?«
»Ich habe Nein gesagt.« Ich hatte behauptet, jemand anderen zu treffen. Das war zwar gelogen, aber immer noch besser, als ihm ins Gesicht zu sagen, dass unser letztes Date meine Erwartungen nicht erfüllt hatte. Oder wenigstens irgendeine meiner Erwartungen. Zwei verschwendete Freitage hintereinander waren einfach zu viel.
»Du hast Nein gesagt?!«, quietschte Pepper. »Bist du verrückt? Doug ist heiß!«
Heiß ja – aber leider auch sterbenslangweilig. »Du weißt doch, wie es letzte Woche gelaufen ist!« Erst hatte er mich in einen Actionfilm geschleppt, ohne sich auch nur ansatzweise zu erkundigen, ob ich den überhaupt sehen wollte. Gegessen hatten wir danach an einem Schnellimbiss an der Straße. Er hätte wenigstens einen Laden aussuchen können, in dem man sich hinsetzen konnte. Aber nein, stattdessen hatten wir Fish & Chips samt Coladose in der Hand balanciert, und ich hatte zu kämpfen gehabt, mich nicht über und über mit Soße zu bekleckern. »Kein bisschen romantisch.«
Pepper verdrehte die Augen. »Er ist ein Junge. Du hättest ihm einfach sagen sollen, was du willst. Das kann er dir nicht von deinen schönen blauen Augen ablesen.«
Natürlich hatte Pepper recht. Trotzdem hatte ich gehofft, Doug käme von sich aus auf die Idee, mich zu fragen, was ich wollte. Oder wüsste es sowieso – was meine Idealvorstellung gewesen wäre.
»Willst du ihm nicht noch eine Chance geben?«, hakte Pepper nach. »Mit ein paar Anweisungen kriegt er das bestimmt hin.«
Ich verzog das Gesicht. Selbst wenn er nächstes Mal all meine Wünsche erfüllte, änderte das nichts daran, dass wir uns nichts zu sagen gehabt hatten. Noch einen Abend mit jemandem verbringen, der kein anderes Thema kannte als seine Computerspiele? Nein, danke. Heiß auszusehen war eben nicht genug. Doch bevor ich ihr das sagen konnte, klingelte Peppers Handy. Sie zog es aus der Tasche. Beim Blick auf das Display leuchteten ihre Augen auf, und ich ahnte sofort, wer dran war. Was vermutlich hieß, dass dieser Anruf unseren Plänen für den Nachmittag ein Ende setzen würde.
»Hi, Jonah«, flötete Pepper ins Telefon.
Bingo! Da war er – der Fleisch gewordene Todesstoß für unseren Mädchennachmittag. Jonah war einer der Verkäufer im Hexenkessel, dem Zauberbedarfsladen, in dem Pepper jobbte. Und sie war bis über beide Ohren in ihn verschossen. Sie sagte ein paar Mal »Ja« und »Hm« und schließlich »Alles klar, bis gleich«. Dann beendete sie das Gespräch und sah mich schuldbewusst an, wobei es ihr nicht gelang, das Grinsen ganz aus ihren Mundwinkeln zu vertreiben, das sich dort festgesetzt hatte. »Okay, was ist los?«
»Eine der Aushilfen ist ausgefallen, Madame Veritas ist mit ihren Séancen ausgebucht und Jonah braucht dringend jemanden, der den Laden schmeißt, weil er früher weg muss«, sprudelte es aus ihr heraus.
»Und wenn du ihm zu Hilfe eilst, wird er ewig in deiner Schuld stehen und sich früher oder später mit dir verabreden.«
»Das ist der Plan.« Ihr Grinsen wurde breiter. »Wenn ich mich mit der Kassenabrechnung beeile, schaffe ich es vielleicht trotzdem noch vor Ladenschluss zu Waterstones, um mir den neuesten Hearts of Darkness zu holen.«
»Ist es heute so weit?«
»Erstverkaufstag!«
Pepper liebte Vampirromane und verschlang jeden Schmöker, in dem auch nur ansatzweise die Themen Blutsauger und Liebe vorkamen, aber Hearts of Darkness war ihre Lieblingsreihe. Sie war total in den muskulösen und geheimnisvollen Sergej Darkov verschossen und wurde nicht müde, mir jedes Mal so ausführlich davon zu erzählen, dass ich hinterher das Gefühl hatte, das Buch selbst gelesen zu haben. Dabei konnte ich mit dieser Art von Büchern gar nichts anfangen. Ich hätte es allerdings nicht übers Herz gebracht, Peppers Begeisterung zu bremsen. Es gab nicht viele Dinge, die sie davon abhalten konnten, das neueste Abenteuer von Sergej Darkov sofort bei Erscheinen zu inhalieren – eigentlich kamen nur ein Weltuntergang, Jonah und ich dafür infrage.
Ich musste sie überrascht angesehen haben, denn plötzlich stieß sie einen theatralischen Seufzer aus. »Ich weiß, ich weiß. Du wunderst dich, warum ich dich noch nicht in den Buchladen geschleppt habe.«
Ich nickte.
»Es fällt mir nicht leicht, aber glaube mir, noch schwieriger wäre es, in deinem Garten zu sitzen und Sergejs neues Abenteuer unbeachtet in der Tasche zu haben. Ich wollte es auf dem Heimweg mitnehmen.«
Spätestens ab heute Abend würde sich Pepper mit dem Buch in der Hand in ihrem Zimmer verschanzen. Vermutlich würde ich sie in den nächsten zwei Tagen nicht oft zu Gesicht bekommen.
Pepper musterte mich. »Kann ich dich allein lassen?«
»Mir ist nicht mehr schlecht, falls du das meinst.« Nach drei Sekunden Pause fügte ich hinzu: »Und ich werde es vermutlich auch überleben, den Nachmittag allein zu verbringen, wenn ich dir damit den Weg zu deinem Liebesglück mit Jonah ebnen kann.«
»Du bist die Beste!« Sie umarmte mich schnell, dann machte sie kehrt und rannte mit einem letzten Winken in Richtung der nächsten Bushaltestelle davon.
Ich blieb allein zurück und kam mir trotz der belebten Straße plötzlich erstaunlich einsam vor. Zumindest bis zu dem Augenblick, in dem ich erneut das Gefühl hatte, beobachtet zu werden.
2
Unwillkürlich sah ich mich nach dem Studenten aus der U-Bahn um, konnte ihn aber nirgendwo entdecken. Auch sonst schien mir niemand Beachtung zu schenken. Trotzdem wollte das Gefühl, dass mich jemand anstarrte, nicht weichen. Ich glaubte die Blicke regelrecht zu spüren, die sich in meinen Rücken bohrten.
Vor einer Schaufensterfront blieb ich stehen. Ich gab vor, die Auslage zu betrachten, während ich die Scheibe als Spiegel benutzte und die Straße hinter mir nach einem heimlichen Verfolger absuchte. Zwei oder drei Minuten blieb ich stehen, wartete und behielt die Umgebung im Auge. Abgesehen davon, dass ich keine Ahnung hatte, wer mich verfolgen sollte, dämmerte mir allmählich, wie lächerlich ich mich benahm. Als ob ein Blick etwas Greifbares wäre, das ich hätte spüren können. Vermutlich war alles, was ich gespürt hatte, die Enttäuschung über den geplatzten Nachmittag mit Pepper. Ich rückte meine Tasche zurecht, drehte mich entschlossen um und ging weiter.
Zehn Minuten später bog ich in die Musswell Road und ein paar Meter darauf in die Wood Lane ein, an deren Ende mein Zuhause lag. Von dem geschäftigen Treiben, das eben noch geherrscht hatte, war hier nichts mehr zu bemerken. Ein teures Einfamilienhaus reihte sich ans nächste und die Straße war so eng, dass kaum zwei Autos aneinander vorbeikamen. Auf den ersten Metern gab es nur auf der rechten Seite einen schmalen Gehweg. Ich folgte ihm, vorbei an den Häusern und den in den Auffahrten parkenden Wagen. Immer mehr Büsche und Bäume säumten die Zufahrten zu den Grundstücken und weiter hinten verschwand die Straße unter einem Dach aus Baumkronen. Dort, wo die Wood Lane in die Queenswood Road überging, wurde die Fahrbahn wieder breiter. Rechts und links im Schatten der Bäume parkten jetzt Autos. Die Häuser zu beiden Seiten waren einem lichten Wald gewichen und an einigen Stellen bahnte sich die Sonne ihren Weg durch das Blätterdach und zeichnete Inseln aus Licht auf die schattige Straße.
Nachdem ich so lange auf aufgeheiztem Asphalt in der Sonne gelaufen war, atmete ich tief durch und genoss die kühle Luft. Ich fröstelte sogar ein bisschen. Eine Gänsehaut breitete sich auf meinen nackten Armen aus und ich spielte mit dem Gedanken, meinen Schulblazer aus der Tasche zu holen, verwarf ihn allerdings wieder. In ein paar Minuten wäre ich sowieso zu Hause. Zu meiner Linken konnte ich bereits die hohe Backsteinmauer zwischen den Bäumen ausmachen, die The Queen’s Green umgab. Ab da war es nicht mehr weit bis zum Tor. Ein paar Meter die Straße entlang und dann kam links schon die Zufahrt in die zurückversetzt liegende Anlage.
Ich liebte die Queen’s Woods, die unser Zuhause von drei Seiten umgaben, mochte die Ruhe, die sie ausstrahlten, und die Abgeschiedenheit, besonders am Abend, wenn es langsam dunkel wurde und sich die Spaziergänger allmählich in Pubs und Restaurants verzogen. Das war die Zeit, in der ich meine Sportsachen anzog und laufen ging.
Es war herrlich ruhig hier. Fast ein bisschen zu ruhig. Seit ich die Wood Lane mit den eleganten Wohnhäusern verlassen hatte, war kein Wagen mehr an mir vorbeigekommen und ich hatte weder Fußgänger noch Radfahrer gesehen. Von Zeit zu Zeit knackte ein Ast und hin und wieder raschelte es im Unterholz, die einzigen Geräusche, wenn man vom Zwitschern der Vögel und dem entfernten Rauschen des Verkehrs absah. Schlagartig kehrte das ungute Gefühl zurück, beobachtet zu werden. Oder war es nur die Erinnerung daran? Unwillkürlich wurde ich schneller. Ich ärgerte mich über mich selbst, konnte aber dem Drang nicht widerstehen, mich nach einem Verfolger umzusehen. Da war niemand. Natürlich nicht.
Als ich die Grundstücksmauer erreichte, atmete ich unwillkürlich auf. Nur noch ein paar Meter, dann war ich zu Hause, konnte dieses blöde Gefühl abschütteln. Raus aus der Schuluniform, rein in Shorts und T-Shirt und mich dann im Garten unter dem großen Baum ausstrecken.
Ein Motor heulte hinter mir auf, ich drehte mich um und sah einen Wagen auf mich zuschießen. Ich wich an den hinteren Rand des Gehwegs zurück, bis ich fast die Mauer zwischen den lichten Bäumen berühren konnte, um nicht auf den letzten Metern noch von einem durchgeknallten Raser über den Haufen gefahren zu werden, der auf der engen Straße die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Doch statt an mir vorbeizurauschen, kam der Wagen mit quietschenden Reifen vor mir auf dem Gehweg zum Stehen. Ein dunkelblauer Lieferwagen, die Art von Auto, wie Handwerker sie fahren – oder in die man Entführungsopfer zerrt. Vielleicht war ich überempfindlich, vielleicht war es aber auch der gesunde Menschenverstand, der mir befahl, wegzulaufen.
Als sich die Türen öffneten, packte ich meine Tasche fester und lief am Wagen vorbei in Richtung Wohnanlage. Jemand folgte mir. Mehrere Leute.
Ich rannte schneller. Nicht mehr weit bis zur Einfahrt. Sobald ich die erreichte, war ich in Sicherheit. Der Wachmann am Tor würde mir helfen.
Eine Hand griff nach mir. Ich streifte sie ab, doch mein Verfolger ließ nicht locker. Beim zweiten Versuch erwischte er mich. Ein harter Ruck durchfuhr meinen Arm, wo er mich gepackt hatte, bis zum Schultergelenk hinauf. Ich wurde zurückgerissen, geriet ins Stolpern und taumelte gegen den Mann. Für einen Moment geriet auch er aus dem Tritt. Meine Chance. Dann sah ich ihn. Den Studenten mit dem Handy. Er kam mit einem Jutesack in der Hand auf uns zu. Verflucht, ich hatte mich nicht getäuscht! Ich war tatsächlich beobachtet worden!
Der Schreck kostete mich wertvolle Zeit, in der sein Kumpan, der mich immer noch festhielt, das Gleichgewicht wiederfand. Wie eine Schraubzwinge schlossen sich seine Finger um meinen Arm. Ich kämpfte dagegen an, schrie, trat und schlug nach ihm, doch ein Dritter kam ihm zu Hilfe. Er holte aus und schlug mir mit der Faust in den Magen. Ich klappte zusammen und hing hilflos im Griff des anderen Mannes, der mich langsam zu Boden gleiten ließ. Das Letzte, was ich sah, ehe mir der vermeintliche Student den Sack über den Kopf stülpte, war eine Tätowierung an der Innenseite seines Handgelenks.
Ein modriger Geruch stieg mir in die Nase und der raue Stoff kratzte mir über die Wange. Ich wehrte mich, doch sie drückten mich jetzt zu dritt zu Boden. Ein Knie bohrte sich zwischen meine Rippen. Jemand griff nach meinen Händen und zog sie mir auf den Rücken. Ein kurzes Klimpern war zu hören, als einer von ihnen mein Armband streifte, dann schloss sich ein festes Band um meine Handgelenke. Ein kräftiger Ruck, und ich war gefesselt.
Wieder versuchte ich mich loszureißen, das Knie grub sich fester in meinen Rücken, presste mir die Luft mit einem Keuchen aus den Lungen und raubte mir jegliche Bewegungsfreiheit. Ich weiß nicht, was schlimmer war, nicht sehen zu können, was um mich herum geschah, oder zur Reglosigkeit verdammt zu sein. Immerhin spürte ich, dass mich jetzt nur noch einer von ihnen hielt. Die Schritte der anderen entfernten sich.
»In den Wagen mit ihr!«
Panik überflutete mich. Sie wollten mich fortbringen! Zum ersten Mal fragte ich mich, was sie von mir wollten. Mit mir vorhatten. Das Gleiten einer Schiebetür war zu vernehmen, dann wurde ich auf die Beine gerissen. Nein! Wenn sie mich erst in den Wagen verfrachtet hatten, war es vorbei. Hier auf der Straße hatte ich noch eine Chance, aber da drinnen war ich ihnen endgültig ausgeliefert. Adrenalin durchströmte meine Adern, brennend heiß und eiskalt zugleich. Verzweifelt wand ich mich unter den Schraubstockfingern des Kerls. Als er nicht nachgab, ließ ich mich in die Knie sacken. Ein schmerzhafter Ruck ging durch meinen Arm, ehe ich seiner Hand entglitt. Es war nur ein kurzer Moment, den er benötigte, um seinen Griff zu verändern, doch diesen winzigen Augenblick, in dem sich seine Finger um meinen Arm lockerten, nutzte ich. Ich fuhr hoch, wirbelte herum und stieß ihm meine Schulter in den Leib. Ein wütender Aufschrei erklang.
Plötzlich war ich frei.
Durch den Sack hindurch glaubte ich Schatten zu erkennen, doch ich war nicht sicher und hatte auch gar keine Zeit, darüber nachzudenken. Die Hände noch auf dem Rücken gefesselt, rappelte ich mich auf und rannte los in die Richtung, wo ich den Eingang zur Wohnanlage vermutete, in der Hoffnung, nicht vollkommen die Orientierung verloren zu haben.
Die Männer folgten mir. Ihre Schritte kamen näher. Ich blieb mit dem Fuß an etwas hängen, geriet ins Stolpern und fiel der Länge nach hin. Wegen meiner gefesselten Hände war der Aufprall ungebremst und schmerzhaft. Trotzdem versuchte ich, sofort wieder auf die Beine zu kommen.
Sie waren dicht hinter mir. So dicht, dass ich glaubte, ihren Atem in meinem Nacken zu spüren. Hände streiften mich, bekamen mich jedoch nicht zu fassen. Dann traf mich ein Schlag am Hinterkopf und schickte mich erneut zu Boden.
Benommen lag ich auf dem Asphalt, blinzelte gegen die Dunkelheit an, die nicht mehr allein von dem Sack über meinem Kopf rührte.
»Schnapp sie dir!« Ich wartete darauf, dass mich jemand auf die Beine zerrte, konnte schon hören, wie sich jemand näherte, doch ich hörte noch etwas anderes. Etwas, das sich wie ein Knurren anhörte. Schreie erklangen, gefolgt von Geräuschen, die auf einen heftigen Kampf schließen ließen. Während ich mich noch fragte, ob ein Spaziergänger seinen Hund auf meine Angreifer losgelassen hatte, wurde mir schlecht.
Die Übelkeit kam mit solcher Heftigkeit, dass ich glaubte, jeden Moment das Bewusstsein zu verlieren. Kalter Schweiß trat mir auf die Stirn und ich schluckte und schluckte, um gegen den Brechreiz anzukämpfen, der immer stärker wurde. Ich musste von hier fort, doch ich konnte mich nicht bewegen. Zitternd und hilflos lag ich da und kämpfte gegen die Panik an, die mir einflüsterte, dass ich ersticken würde. An meinem eigenen Erbrochenen oder an dem schieren Sauerstoffmangel, der unter diesem Sack herrschte.
Ich rollte mich zur Seite, wodurch die Übelkeit ein wenig erträglicher wurde, und konzentrierte mich auf meine Umgebung. Immer wieder waren dumpfe Laute zu hören, als würde ein Mensch gegen einen anderen prallen, unterbrochen vom Knurren eines großen Hundes. Ich fürchtete mich vor Hunden, ganz besonders vor den großen, im Augenblick jedoch war dieses wütende Grollen der wunderbarste Laut, den ich mir vorstellen konnte.
Mir war noch immer schlecht, doch ich hatte mich zumindest so weit im Griff, dass ich nicht mehr fürchten müsste, mich jeden Moment zu übergeben.
Warum war nur der Hund zu hören? Wo war sein Besitzer? Wahrscheinlich war er oder sie klug genug, in sicherer Entfernung zu bleiben und die Polizei zu rufen. Es irritierte mich allerdings, dass nirgendwo Stimmen zu hören waren, die nicht zu meinen Angreifern gehörten. Niemand forderte die Männer auf, aufzuhören. Alles, was ich hörte, waren der Hund und die aufgeregten Rufe der Männer, unter die sich immer wieder Kampfgeräusche mischten.
Ein dumpfer Aufprall.
Schnelle Schritte.
Ein unterdrücktes Stöhnen.
Ich verlor mich in der unsteten Melodie und merkte erst, dass sie sich verändert hatte, als das Schlagen der Wagentüren an mein Ohr drang. Ein Motor heulte auf. Reifen quietschten. Und plötzlich wurde es still.
Wie erstarrt wartete ich darauf, dass sich mir jemand näherte, und hoffte, dass es nicht der Hund sein würde. Dann vernahm ich Schritte. Einen Herzschlag später griff jemand nach meinem Arm und zog mich auf die Beine. Übelkeit und Schwindel ließen mich wanken.
»Ganz ruhig«, erklang eine tiefe Stimme neben mir. »Sie sind fort. Alles ist gut.« Der Fremde nestelte an meinem Nacken und einen Moment später war der Sack von meinem Kopf verschwunden. Ein kühler Wind strich über mein erhitztes Gesicht. Ich schnappte gierig nach Luft und schloss den Mund sofort wieder, als mich eine weitere Welle der Übelkeit überkam.
»Komm, setz dich.« Mein Retter zog mich zur Seite und half mir, mich auf einem Baumstumpf niederzulassen, bevor er meine Fesseln mit einem Taschenmesser durchtrennte. Er trug die Uniform des Wachdienstes unserer Anlage. Ich kannte den bulligen Mann mit dem kurz geschorenen, stahlgrauen Haar und dem gestutzten Vollbart vom Sehen, hatte aber noch nie mit ihm gesprochen.
»Alles in Ordnung mit dir?« Er ging neben mir in die Knie und musterte mich aus hellblauen, beinahe farblosen Augen. »Brauchst du einen Arzt?«
»Mir ist schlecht«, entfuhr es mir.
Einen Moment noch sah er mich nachdenklich an, dann griff er in seine Hosentasche und zog eine Hasenpfote daraus hervor. »Nimm die, die wird dich von der Übelkeit ablenken.«
Ich zog eine Augenbraue in die Höhe, griff aber trotzdem danach. Krampfhaft schlossen sich meine Finger um das Fell, und ich sah überrascht auf, als die Übelkeit schlagartig abflaute.
»Das hilft immer«, sagte der Mann.
Sein Name war Gus Miller, zumindest stand das auf dem kleinen goldenen Schild, das über der Brusttasche seines Uniformhemdes prangte. Den grauen Haaren und den tiefen Furchen nach zu schließen, die sich in sein Gesicht gegraben hatten, stand er entweder kurz vor der Rente oder besserte sich diese bereits mit dem Job als Wachmann auf. »Du bist das Munroe-Mädchen, oder?«
Irgendwie brachte ich es fertig, nicht nur seine Frage zu verstehen, sondern auch zu nicken. Jetzt, da ich nicht länger in Gefahr war und in das vertraute Gesicht des Wachmanns blickte, ließ die Wirkung des Adrenalins augenblicklich nach. Ich war heilfroh, dass Mr Miller die Voraussicht besessen hatte, mich auf den Baumstamm zu verfrachten, andernfalls hätten spätestens jetzt meine schlotternden Knie unter mir nachgegeben. Die Hasenpfote rutschte mir aus der Hand. Mit einem vernehmlichen Laut schluckte ich einen erneuten Anflug von Übelkeit herunter.
»Verflucht, Mädel, hat dir denn niemand was gegen diese Übelkeit gegeben?« Er drückte mir die Pfote wieder in die Hand.
Eine Hasenpfote? Und wie hätte jemand ahnen sollen, dass ich überfallen werden und in Panik geraten würde? Klar, die Übelkeit war auch schon vorher dagewesen, aber das konnte Mr Miller nicht wissen. Verwirrt sah ich ihn an. Eigentlich hatte ich gar nichts sagen wollen, doch sein durchdringender Blick zwang mich geradezu zu einer Antwort. Du meine Güte, so fühlte ich mich sonst nur unter Moms Blick, wenn sie wirklich, wirklich sauer war.
»Ich habe es schon mit Pepto-Bismol und Alka-Seltzer versucht, aber nichts hilft.«
Mr Miller runzelte die Stirn. »Aber du weißt, woher sie kommt?«
»Wenn ich das wüsste, hätte ich längst etwas dagegen unternommen.«
Er nickte, als hätte ihm meine Antwort etwas bestätigt, was er längst geahnt hatte. Warum interessierte er sich überhaupt dafür? Ich war um ein Haar entführt worden, und statt den Kerlen hinterherzujagen, die Polizei zu rufen oder wenigstens seinen Kollegen Bescheid zu geben, erkundigte er sich nach meiner Übelkeit.
Das Motorengeräusch eines näherkommenden Wagens ließ mich auffahren.
Mr Miller legte mir eine Hand auf die Schulter. »Mach dir keine Sorgen, die kommen erst mal nicht zurück.«
Erst einmal. Dieser Gedanke sorgte dafür, dass mir gleich wieder speiübel wurde. War das möglich? Würden sie noch einmal versuchen, mich zu erwischen? Unwillkürlich schüttelte ich den Kopf. Das würde bedeuten, dass ich kein Zufallsopfer war, und das konnte und wollte ich beim besten Willen nicht glauben. Meine Eltern waren weder reich noch berühmt. Niemand konnte so dämlich sein, große Summen Lösegeld von uns zu erwarten. Es sei denn … Was, wenn sie unerwartet zu Geld gekommen waren? Vielleicht war eine Tante gestorben, von der ich nichts wusste, oder ein reicher Onkel. Das würde zumindest das Haus erklären. Allerdings erklärte es nicht, warum irgendwelche Entführer davon wussten, während meine Eltern mir nichts davon erzählt hatten.
Der Wagen fuhr an uns vorüber, ohne dass uns jemand Beachtung schenkte. Als er endlich außer Sichtweite war, entspannte ich mich ein wenig.
»Hast du eine Ahnung, wer diese Typen waren?«, riss mich Mr Miller aus meinen sich im Kreis drehenden Gedanken.
Ich schüttelte den Kopf.
»Ist dir etwas an ihnen aufgefallen? Etwas Besonderes?«
Abgesehen davon, dass sie mich verschleppen wollten? »Einer hatte eine Tätowierung.« Es war mein Student gewesen, der Typ mit dem Handy, der mich so nett angelächelt hatte. Fantastisch! In Zukunft würde ich wohl jeden Typen, der freundlich lächelte, für einen potenziellen Entführer halten. Das dürfte es schwierig machen, ein vernünftiges Date zu finden – eines, das nicht ständig mit Leichenbittermiene herumlief. Aber was tat ich hier überhaupt? Da saß ich und dachte über irgendwelche Dates nach, die es wahrscheinlich ohnehin niemals geben würde, statt mich darauf zu konzentrieren, so viele Informationen wie möglich über diese Männer weiterzugeben, damit die Polizei sie schnappen konnte.
»Wo? Wie sah sie aus?«
»An der Innenseite des Handgelenks. Ich glaube, es sollte eine Weltkugel sein.«
Er zog eine Augenbraue in die Höhe.
»War das ein Gangzeichen?« Unmöglich! Der Kerl hatte viel zu gepflegt ausgesehen, um einer Gang anzugehören. Er hatte teure Markenjeans getragen und sein Smartphone war sicher auch nicht billig gewesen. Dort, wo die meisten Gangmitglieder herkamen, konnte man sich so etwas überhaupt nicht leisten. Es sei denn, er hatte die Sachen jemandem abgezogen. »Mr Miller?«, hakte ich nach, als er nicht sofort antwortete. »Waren das Gangmitglieder?«
»So etwas Ähnliches. Hast du so eine Tätowierung schon einmal gesehen?«
»Nein, noch nie. Dieser Kerl muss uns gefolgt sein, seit wir aus der U-Bahn ausgestiegen sind.« Ich erzählte ihm davon, dass ich mit Pepper unterwegs gewesen, mir in der U-Bahn schlecht geworden war und wir uns entschlossen hatten, den restlichen Weg zu Fuß zu gehen. Berichtete von den Begegnungen mit dem Kerl, davon, dass Pepper gehen musste und wie ich mich immer wieder beobachtet gefühlt hatte. Mr Miller hörte sich alles in Ruhe an, nickte hin und wieder oder runzelte die Stirn, unterbrach mich aber kein einziges Mal.
»In dieser Stadt gibt es eine Menge schräger Gestalten.« Er sprach die Worte langsam und bedächtig aus, als hätten sie noch eine andere, unterschwellige Bedeutung. Wenn das der Fall war, verstand ich sie nicht.
Da er eine Antwort von mir zu erwarten schien, ich aber nicht recht wusste, was ich erwidern sollte, sagte ich: »Spinner gibt es wirklich überall.«
Einen Moment lang wirkte er beinahe resigniert, dann reichte er mir die Hand und half mir auf die Beine. »Komm, ich bring dich nach Hause.«
Ich klopfte mir den Straßenstaub vom Rock und von der Bluse und zupfte alles so weit zurecht, dass ich halbwegs normal aussah. Meine Knie waren wie Pudding. Vorsichtig wie ein Kleinkind, das gerade laufen lernte, tappte ich hinter ihm an der Mauer entlang in Richtung der Einfahrt. »Woher wussten Sie überhaupt, was hier los ist?«
»Mein Hund hat ein gutes Gehör und noch bessere Instinkte.«
»Und wo ist er jetzt?«
Gus wies vage die Straße entlang. »Er ist dem Wagen hinterhergelaufen. Bestimmt kommt er bald zurück.« Wir gingen schweigend nebeneinander her. Es war ein gutes Schweigen, das eine beruhigende Wirkung auf mich und meine zitternden Hände und Knie hatte. Allerdings nur für kurze Zeit. »Glaubst du, dass es Dinge gibt, die nicht in unsere Welt passen?«, fragte Mr Miller plötzlich.
»Mathematik«, witzelte ich, weil mir im Augenblick nicht der Sinn danach stand, mich mit ernsten oder gar tiefschürfenden Fragen zu beschäftigen. »Die passt zumindest nicht in meine Welt.«
Mr Miller ließ sich nicht beirren. »Ich dachte eher an etwas weniger Logisches.«
»Übernatürliches?«
Er zuckte die Schultern und verzog das Gesicht, als sei ihm seine Frage im Nachhinein peinlich. Das brachte mich zum Lachen. »Mir fällt es schon schwer zu glauben, dass die Leute sind, wie sie sind. Da brauche ich nun wirklich nicht noch irgendwelchen Geisterkram.«
Ein paar Herzschläge lang sah er mich nur ernst an. Schließlich sagte er: »Du musst in Zukunft vorsichtiger sein.«
»Wegen der Geister?« Noch immer weigerte ich mich, darüber nachzudenken, was gerade geschehen war, doch Mr Miller sah mich auf eine Weise an, dass mir das Grinsen schlagartig verging. »Okay«, stimmte ich kleinlaut zu und war mir sicher, dass es mir nicht schwerfallen dürfte, dieses Versprechen einzuhalten. Vermutlich würde ich zumindest in der nächsten Zeit hinter jedem Schatten eine Gefahr wittern und sofort das Weite suchen. Studenten, Lieferwagen und Tätowierte standen ab sofort ganz oben auf meiner schwarzen Liste der bösen Dinge.
Wir hatten die Einfahrt erreicht, doch statt in sein verwaistes Wachhäuschen zu gehen, das wie ein übergroßer Karton rechts vom Tor stand, hielt er geradewegs auf die schmiedeeiserne Fußgängerpforte zu. Die Scharniere quietschten ärgerlich, als er sie öffnete und zur Seite trat, um mich durchzulassen.
Ich blieb stehen. »Danke, Mr Miller. Vielen, vielen Dank. Ich weiß nicht, was ich ohne Sie gemacht hätte.« Oder was diese Typen mit mir gemacht hätten.
»Schon in Ordnung.« Zum ersten Mal stahl sich so etwas wie ein Lächeln in seine zerfurchten Züge. »Es ist immerhin mein Job, auf die Bewohner dieser Anlage aufzupassen. Ich werde dafür sorgen, dass die Tore für die nächste Zeit geschlossen bleiben. Meine Kollegen werden ein besonderes Auge darauf haben, wer hereinwill.« Mr Miller deutete in die Bäume und erst auf den zweiten Blick entdeckte ich eine gut verborgene Videokamera. Das war London, Kameras waren hier an der Tagesordnung und natürlich wurden sie auch in unserer Anlage genutzt. Trotzdem waren sie mir bisher nicht aufgefallen, während die CCTV-Kameras auf den Straßen allgegenwärtig waren. »Gehen wir, ich werde deiner Mom alles erklären.«
Ach du Scheiße! Mom würde ausrasten! Selbst wenn keine Gefahr drohte, machte sie sich ständig Sorgen um mich und hätte mich am liebsten in einen kleinen goldenen Käfig gesperrt, um mich vor der bösen Welt da draußen zu beschützen. Erst nach meinem vierzehnten Geburtstag war es mir gelungen, mir ein bisschen Selbstständigkeit zu erkämpfen und Mom davon abzubringen, mich jeden Tag zur Schule zu bringen und wieder abzuholen. Oder darauf zu bestehen, dass Peppers Mom oder ihre Schwester Ally es taten. Ich hatte nicht einmal aus dem Haus gehen dürfen, ohne dass Pepper oder jemand anderes dabei gewesen war. Von den ständigen Kontrollanrufen ganz zu schweigen. Es hatte mich unzählige Gespräche, Wutanfälle und zornige Tränen gekostet, Mom endlich davon zu überzeugen, die Leine ein wenig lockerer zu lassen. Wenn sie auch nur einen Bruchteil von dem erfuhr, was gerade passiert war, würde sie mich zurück in den goldenen Käfig stopfen und den Schlüssel im Klo runterspülen. »Ähm, könnten wir das vielleicht irgendwie diskret behandeln?«
»Diskret?« Aus seinem Mund klang dieses eine Wort wie ein Knurren.
»Meine Mom. Also, sie soll nicht …« Sie würde mich glatt von der Schule nehmen und mir einen Privatlehrer engagieren, wenn sie damit verhindern konnte, dass ich noch einmal das Haus verlassen musste. »Sie würde durchdrehen. Die sperrt mich glatt weg. Bitte, Sir.«
Mr Millers Blick war fest auf meine Augen gerichtet und ich gab mir alle Mühe, ihm zu signalisieren, wie wichtig sein Schweigen für mich und den Fortbestand meines Soziallebens war.
Endlich nickte er. »Aber nur unter einer Bedingung.«
»Und die wäre?« Mir war alles recht. Ich würde seine Stiefel polieren, seine Uniform bügeln und ihm jeden Tag eine Kanne Kaffee kochen, wenn mir das sein Schweigen erkaufte. Verflucht, ich würde ihm sogar jeden Tag ein Gurkensandwich bringen.
»Du musst lernen, dich zu schützen.«
Damit hatte ich nicht gerechnet.
Bevor ich etwas erwidern konnte, sagte er: »Komm am Montag nach der Schule in die Turnhalle hinter der alten Bibliothek an der Musswell Road, dann bringe ich dir bei, wie du dich verteidigen kannst.«
Das war mehr, als ich erwartet hatte. Er würde nicht nur Mom gegenüber dichthalten, nein, er bot mir sogar noch ein Kampftraining an.
»Ja, Sir. Danke, Sir.«
3
Erst vor meiner Haustür bemerkte ich, dass meine Hand sich immer noch um Mr Millers Hasenpfote klammerte. Ich schob sie in meine Tasche und nahm mir vor, sie ihm am Montag zurückzugeben. Mit einem unguten Gefühl öffnete ich die Tür. Zum einen wusste ich nicht, wie ich Mom gegenübertreten sollte, zum anderen fürchtete ich mich davor, mit meinen Gedanken und den Bildern der letzten Stunde allein in meinem Zimmer zu sein. Nur zu gerne hätte ich über das geredet, was passiert war. Ich brauchte jemanden, der mir versicherte, dass alles in Ordnung und ich in Sicherheit war, doch Mom kam dafür nicht infrage. So oft ich mich ihr sonst auch anvertraute, das war nichts, worüber ich mit ihr sprechen konnte. Nicht, wenn ich nicht all meine über die Jahre mühsam erkämpften Freiheiten mit einem Schlag wieder verlieren wollte. Ich würde Pepper anrufen, sobald sie nach Hause kam.
Auf der Schwelle blieb ich stehen und lauschte. Vielleicht gewährte mir das Schicksal einen kleinen Aufschub und Mom war noch in der Redaktion. Ein paar Stunden Zeit, um mich zu beruhigen, würden es mir sicher leichter machen, zu tun, als sei nichts gewesen.
Meine Hoffnung erstarb mit dem Klappern der Tastatur, das aus der Küche zu hören war. Der Esstisch war Moms bevorzugter Platz, wenn sie zu Hause arbeitete. Vermutlich, weil sie hier dem grenzenlosen Teenachschub am nächsten war. Mom war süchtig nach Tee und Arbeit. Sie schrieb für ein kleines Londoner Blatt. Meistens drehten sich ihre Artikel um Jugendliche, bevorzugt um kriminelle Jugendliche, die die Straßen unsicher machten und immer wieder als Beispiel dafür herhalten mussten, wie gefährlich es war, allein unterwegs zu sein.
Behutsam schloss ich die Haustür hinter mir. Wenn ich leise genug war, konnte ich mich vielleicht in mein Zimmer schleichen, ohne dass Mom mich bemerkte.
»Serena, bist du das?«
Mit einem resignierten Seufzer ließ ich meine Tasche fallen und warf den Hausschlüssel auf den Schuhschrank, wo er scheppernd zum Liegen kam. »Nein, Mom«, rief ich und war erstaunt, wie fest meine Stimme klang. »Ich bin der Alien, der deine Tochter entführt und ihren Platz eingenommen hat.«
Der Witz wäre mir um ein Haar im Hals stecken geblieben, als mir bewusst wurde, wie nah ich dem Entführt-Teil gekommen war. Ich schlüpfte aus meinen Schuhen, straffte die Schultern und ging in die Küche. »Hi, Mom.«
»Hallo Liebes.« Als ich hereinkam, sah sie kurz von ihrem Laptop auf, beugte sich aber gleich wieder über die Tastatur, um den angefangenen Satz zu beenden. Erst, als sie beim Punkt angekommen war, wandte sie sich mir wieder zu. Ihr Blick wanderte an mir vorbei. »Wo ist Pepper?«
»Die musste im Laden einspringen.«
Nach der sommerlichen Hitze draußen war es im Haus schattig und kühl. Hätte mir nicht die Angst noch immer in den Knochen gesteckt, hätte ich es vermutlich als angenehm empfunden. So jedoch konnte ich nicht verhindern, dass es mich fröstelte. Um meine Nervosität zu unterdrücken und meinen zittrigen Händen etwas zu tun zu geben, schnappte ich mir den Wasserkocher, füllte ihn und schaltete ihn ein. Obwohl ich Moms Teeliebe nicht geerbt hatte, nahm ich mir eine Tasse aus dem Schrank und warf den nächstbesten Beutel rein, ohne das Etikett auch nur anzusehen.
Als ich mich stark genug fühlte, um mich Mom wieder zuzuwenden, warf sie einen demonstrativen Blick auf die Digitaluhr am Herd. »Du bist spät dran.«
»Ich bin vom Archway aus zu Fuß gegangen.« Weil ich sonst die U-Bahn vollgekotzt hätte. Glücklicherweise hatte ich im Laufe der Jahre gelernt, mir vor Mom nicht anmerken zu lassen, was in mir vorging. Als ich noch klein war, hatte sie immer sofort gespürt, wenn ich mit etwas hinter dem Berg hielt.
»Ich habe dich angerufen. Warum bist du nicht ans Telefon gegangen?«
Ich verdrehte die Augen. Als ich vor ein paar Jahren mein erstes Handy bekam, hatte Mom beinahe stündlich angerufen. Nachdem mein Telefon an einem Vormittag zum zweiten Mal während des Unterrichts klingelte, hatte Mr Holiday es mir abgenommen und es mir erst am Ende der Woche zurückgegeben. Danach hatte ich mir angewöhnt, es auf lautlos zu schalten. »Ich habe vergessen, den Klingelton nach der Schule wieder anzustellen.«
»Serena, so geht das nicht. Ich erwarte von dir, dass du dein Handy zuverlässig wieder einschaltest.« Ihre Augen hefteten sich auf meine Bluse. »Wie siehst du überhaupt aus? Du bist ja ganz schmutzig.«
»Ich bin über einen offenen Schnürsenkel gestolpert und gefallen«, sagte ich lahm.
Das Wasser kochte. Froh, mich nicht länger Moms missbilligendem Blick aussetzen zu müssen, goss ich meinen Tee auf. Es war nicht ihre Schuld, dass sie sich so benahm. Ihr Verfolgungswahn hatte mit ihrer Vergangenheit zu tun und Mom litt heute noch darunter. Dumm nur, dass ich jetzt mit den Folgen einer Sache leben musste, die Jahre vor meiner Geburt passiert war. Damals war Tante Beth, Moms Schwester, entführt worden.
Der Zuckerlöffel entglitt mir und fiel scheppernd auf die Arbeitsplatte. Entführt. Dasselbe wäre mir um ein Haar auch passiert. Mit zitternden Fingern nahm ich den Löffel wieder auf und rammte ihn so fest in die Zuckerdose, dass ich schon fürchtete, durch den Boden zu stoßen. Zuckerkristalle stoben über den Rand des Gefäßes und rieselten auf die Arbeitsfläche. Nur zu deutlich war ich mir Moms Aufmerksamkeit bewusst, glaubte ihren Blick zu spüren, wie ich auch den Blick meines Verfolgers gespürt hatte. Reiß dich zusammen, Serena! Wenn ich jetzt zuließ, dass meine Gefühle die Oberhand gewannen, würde Mom sofort merken, dass etwas nicht stimmte. Meine Finger krampften sich um den Löffel. Ich schaufelte Zucker in meine Tasse, viel mehr, als ich normalerweise nahm, kippte einen Schuss Milch hinterher und rührte um. Der Löffel klirrte, Tee schwappte über den Tassenrand und hinterließ einen nassen Ring darunter. Ich holte einen Lappen und wischte mein Missgeschick auf. Bis ich den Lappen ausgewrungen und aufgehängt hatte, hatte ich mich wieder einigermaßen unter Kontrolle. Zumindest war mein Verstand wieder klar genug, um zu begreifen, dass meine Beinahe-Entführung nichts mit Tante Beth’ Verschwinden von vor zwanzig Jahren zu tun haben konnte. Das waren junge Männer gewesen, die versucht hatten, mich in ihre Gewalt zu bringen. Wären es dieselben gewesen, die auch meine Tante verschleppt hatten, hätten sie wohl eher wie Mr Miller ausgesehen – mit grauem Haar und Falten im Gesicht.
Dass die Polizei damals nach monatelanger Fahndung die Ermittlungen eingestellt und weder Tante Beth noch ihre Entführer jemals gefunden worden waren, änderte nichts daran, dass die Ähnlichkeit des Verbrechens nur ein dummer Zufall sein konnte. Ich umfasste meine Tasse mit beiden Händen und drehte mich wieder zu Mom herum.
»Ich will nicht, dass dir etwas passiert.« Früher hatte Mom mit diesem Argument jede Diskussion über meine Freiheit im Keim erstickt. Inzwischen ließ ich mich davon nicht mehr ins Bockshorn jagen. Heute jedoch brachten mich ihre aufrichtig besorgten Worte um ein Haar dazu, mich in ihre Arme zu werfen und ihr alles zu erzählen.
»Ich muss noch Hausaufgaben machen.« Bevor ich eine Dummheit machen und meine hart erkämpfte Freiheit durch ein paar unbedachte Worte selbst aufs Spiel setzen konnte, verschwand ich mit meiner Tasse aus der Küche. Draußen sammelte ich meine Tasche ein und lief die schmale Treppe nach oben. Unter der Dachschräge meines Zimmers hatte sich die Hitze des Tages gesammelt. Die Luft war stickig und nach der Kühle unten unangenehm warm. Ich ließ meine Tasche zu Boden gleiten, stellte den Tee auf dem Schreibtisch ab und befreite mich aus meiner Schuluniform. Sobald die Sachen im Wäschekorb waren und ich in Jeans und T-Shirt steckte, ließ ich mich in den Schreibtischstuhl fallen. Mein Bauch tat weh, dort wo mich einer der Kerle geboxt hatte, und ich würde wohl einige blaue Flecken bekommen, ansonsten schien mir nichts zu fehlen. Zumindest nicht körperlich.
Eine Weile starrte ich einfach nur vor mich hin, ließ meinen Blick durch mein Zimmer schweifen und hielt mich an der Ordnung fest, die hier herrschte. Alles hatte seinen Platz und bis auf das Buch auf meinem Nachttisch und ein paar Schulunterlagen auf meinem Schreibtisch lag nichts herum. Wenn es um mein Zimmer ging, war ich ein echter Freak. Selbst meine Eltern machten sich über meine ungewöhnliche Ordnungsliebe lustig, die ich mir schon sehr früh angeeignet hatte. Vermutlich ging es mir damals, als ich angefangen hatte, mein Zimmer aufzuräumen und sauber zu halten, gar nicht so sehr darum, dass alles seinen Platz haben sollte. Vielmehr war es wohl das Aufräumen an sich, das ich brauchte. Das Gefühl, etwas Sinnvolles zu tun, das mich davon abhielt, über andere Dinge nachzudenken. Andere Dinge wahrzunehmen. Der Grund, aus dem ich diesen Sauberkeitstick entwickelt hatte, war längst verschwunden. Die Ordnungsliebe war geblieben, wenn auch nicht mehr so extrem. Ich hasste Staub und ich konnte es nicht leiden, wenn Papiere unordentlich gestapelt waren. Bücher schob ich immer so hin, dass sie im rechten Winkel zur Tischkante lagen, bei Stiften war es dasselbe. In meinem Zimmer stapelte sich kein altes Geschirr, die schmutzige Wäsche lag im Wäschekorb und alle anderen Klamotten befanden sich ordentlich zusammengefaltet oder auf Bügel gehängt in meinem Schrank. Ordnung war gut. Sie bedeutete Sicherheit und Kontrolle. Beides Dinge, nach denen ich mich im Augenblick sehnte.
Ich lehnte mich im Stuhl zurück und schloss die Augen. Beinahe sofort kehrte die Erinnerung an den rauen Stoff des Sacks, den modrigen Geruch und den Griff fremder Hände zurück. Also öffnete ich die Augen wieder und holte meinen iPod aus der Tasche. Entschlossen, mich nicht von der Angst überrollen zu lassen, steckte ich mir die Stöpsel in die Ohren und drehte die Lautstärke auf.
Ich saß nur da, lauschte der Musik und versuchte, an nichts zu denken. Als das nicht funktionierte, ließ ich die Bilder des Überfalls Revue passieren, versuchte mich an etwas zu erinnern, was der Polizei helfen könnte, diese Kerle zu erwischen. Da war die Tätowierung. Mehr wollte mir jedoch beim besten Willen nicht einfallen. Von dem Tätowierten einmal abgesehen, hatte ich auf keinen der anderen mehr als einen flüchtigen Blick erhaschen können. Meine Beschreibung fiel ebenso dürftig aus wie die des Wagens, in den sie mich hatten zerren wollen. Trotzdem griff ich mir einen Bleistift und kritzelte alles, woran ich mich erinnern konnte, auf ein Blatt Papier.
Nachdenklich trommelte ich mit dem Stift auf der Tischplatte herum und versuchte mich an weitere Details zu erinnern, als mir plötzlich bewusst wurde, dass die Polizei überhaupt nicht gekommen war. Hatte Mr Miller sie vielleicht erst gerufen, nachdem er mich nach Hause geschickt hatte? Wenn die Bullen bei uns vor der Tür auftauchten, war ich geliefert! Mom würde durchdrehen.
Als in den folgenden zwei Stunden jedoch weder das Telefon klingelte, noch irgendjemand an der Tür stand, wagte ich zu hoffen, dass niemand mehr kommen würde. Wenn mir das Glück gewogen blieb, hatte Mr Miller seine Aussage zu Protokoll gegeben und ich konnte in den nächsten Tagen auf die Wache fahren und dasselbe tun, ohne dass Mom davon Wind bekam.
Am liebsten wäre ich in meine Turnschuhe geschlüpft und laufen gegangen, um meine Rastlosigkeit loszuwerden, aber ich traute mich nicht vor die Tür.
Schließlich schaffte ich es auch so, mich ein wenig zu beruhigen, und bis zum Abendessen hatte ich sogar einen Teil meiner Hausaufgaben fertig. Mom verlor kein Wort mehr über Handys und ständige Erreichbarkeit, und ich gab mir alle Mühe, die Unterhaltung auf unverfängliche Dinge zu lenken. Nach dem Essen verfrachtete ich schnell das Geschirr in die Spülmaschine, verschwand in mein Zimmer und machte mich an die restlichen Hausaufgaben. Zwischendurch versuchte ich immer wieder, Pepper zu erreichen, bekam aber nur ihre Mailbox zu hören. Da ich keine Ahnung hatte, wie ich das, was in mir vorging, in knappe, verständliche Sätze packen sollte, legte ich jedes Mal wieder auf, ohne eine Nachricht zu hinterlassen, und richtete meine Aufmerksamkeit wieder auf meine Schulbücher.