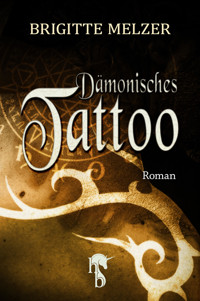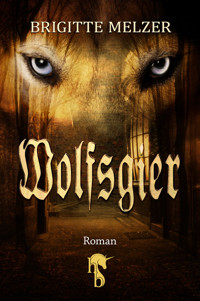4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: hockebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Schottland, 13. Jahrhundert: Sie sollten Feinde sein, doch das Schicksal machte sie zu Verbündeten. Auf der Flucht vor einer arrangierten Ehe rettet Sessany, Tochter des Chiefs der MacKenzies, einen vermeintlichen Wilderer vor dem Galgen. Dieser Wilderer ist niemand anderer als Alasdair, der Erbe des verfeindeten MacDonald-Clans. Auf der Flucht vor den Schergen ihres Vaters kommen Sessany und Alasdair einer Intrige auf die Spur, die das ganze Land in den Krieg stürzen kann. Gemeinsam nehmen sie den Kampf auf – für den Frieden und ihre Liebe. Highlands & Islands 1.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 438
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Brigitte Melzer
Der Schwur des MacKenzie-Clans
Roman
Schottische Highlands im Jahre 1279
1
Leise Schritte schreckten Alasdair MacDonald aus dem Schlaf. Ohne die Augen zu öffnen, lauschte er in die Dunkelheit. Jemand näherte sich seinem Bett. Vermutlich Diarmid, der ihn zu einem Ausflug in den Weinkeller überreden wollte. Nicht heute Nacht, Vetter. Ich bin müde. Er vernahm das Rascheln von Stoff, begleitet von einem leisen Knarzen. Eine Lederrüstung? Wozu? In den dreiundzwanzig Jahren seines Lebens war Burg Finlaggan stets der sicherste Ort gewesen, den er kannte. Er riss die Augen auf. Der Eindringling war näher, als er angenommen hatte. Zuckender Fackelschein fiel vom Gang in das Zimmer und hüllte die Gestalt, die über ihm aufragte, in einen feurigen Ring. Ein Axtblatt blitzte auf. Alasdair warf sich herum. Der Hieb, der ihn hätte töten sollen, riss eine klaffende Wunde in seine Seite. Schmerz explodierte in seinem Körper und raubte ihm den Atem. Keuchend vollendete er die Drehung, riss seinen Dolch vom Nachttisch und rollte sich über die Bettkante. Der Aufprall war hart. Schwärze breitete sich vor seinen Augen aus. Geräusche drangen nur noch gedämpft an sein Ohr. Mit seinem Bewusstsein schwand der Schmerz. Ich will nicht sterben! Dieser Gedanke riss ihn in die Welt zurück. Seine Finger klammerten sich um das Heft des Dolches. Schritte. Er wälzte sich auf den Rücken und blickte geradewegs in die grimmigen Züge des Fremden, der mit erhobener Waffe über ihm stand. Ein Nordmann! Fassungslos starrte er dem blonden Krieger entgegen. Alasdair wusste, dass er nur einen Versuch hatte. Für mehr reichte seine Kraft nicht. Als der Nordmann ausholte, warf Alasdair seinen Dolch. Die Klinge bohrte sich in das linke Auge und drang tief in den Schädel. Ein markerschütternder Schrei erfüllte die Luft, gefolgt von einem Poltern, als der Nordmann seine Axt fallen ließ. Alasdair sah nicht mehr, wie er in die Knie brach. Alles verschwamm vor seinen Augen. Der Schmerz hüllte die Welt in Dunkelheit.
*
Der Lärm war unerträglich.
Finstere Dämonen fegten durch seinen Geist und hielten ihn in der Dunkelheit gefangen. Er versuchte, ihnen zu entfliehen. Kreischend und schreiend zerrten sie an ihm, weigerten sich, ihn freizugeben. Schon bald dröhnte das Getöse so sehr in seinem Schädel, dass er die Hände hob, um sich die Ohren zuzuhalten. Er wollte die Hände heben. Sobald er sich bewegte, flammte brüllender Schmerz in seiner Seite auf. Plötzlich begriff er, dass die Verletzung ihm das Bewusstsein geraubt hatte, das jetzt langsam und qualvoll in seinen Körper zurückkehrte. Er spürte den kalten Steinfußboden unter sich und öffnete die Augen.
Schreie drangen vom Gang her an sein Ohr, tanzten durch die Luft und bohrten sich in seinen Verstand. Der Nordmann war nicht allein gekommen.
Keuchend hob Alasdair den Kopf und sah sich um. Der Angreifer lag reglos da, den Dolch im Schädel. Alasdair kämpfte sich auf die Knie, griff nach der Axt des Toten und stemmte sich auf die Beine. Was haben Wikinger in Finlaggan zu suchen? Seine Knie gaben nach, sodass er sich am Bett abstützen musste, um nicht erneut zu Boden zu gehen. Mit der Axt in Händen taumelte er auf den Gang hinaus – mitten hinein in einen Albtraum. Überall war Blut und Tod. Sämtliche Türen standen offen. In einigen Zimmern wurde noch gekämpft. In anderen war es entsetzlich still. Menschen lagen reglos in ihren Betten, die Laken dunkel von Blut. Menschen, die weniger Glück gehabt hatten als er und nicht rechtzeitig erwacht waren. Seine Freunde, seine Familie. Er zwang sich, ihren Anblick aus seinem Geist zu verdrängen. Er musste zu seinem Vater. Wenn er noch lebt.
Immer wieder musste er innehalten, um Kraft zu schöpfen. Obwohl überall Schreie zu hören waren, traf er auf keine weiteren Kämpfer. Sichtlich hatten sie sich inzwischen in einen anderen Teil der Burg vorgearbeitet.
Alasdair folgte der engen Treppe nach oben und betrat den Flur, auf dem die Gemächer seiner Eltern lagen. Als er sah, dass auch hier alle Türen offen standen, beschleunigte er seinen Schritt.
Das Bild, das sich ihm im Schlafzimmer seiner Eltern bot, brannte sich für alle Zeit in sein Gedächtnis. Sein Bruder Angus war im Zimmer des Chiefs gewesen, als die Wikinger über sie hergefallen waren. Er lag nahe der Tür. Daneben … Alasdair stand wie erstarrt da, unfähig den Blick von der Leiche seiner Mutter zu lösen.
»Alasdair.« Die schwache Stimme seines Vaters riss ihn aus seiner Erstarrung. Er fuhr herum und fand ihn auf dem Boden vor dem Bett, das mächtige Claymore, mit dem er sich und die Seinen verteidigt hatte, noch in Händen. In seinem silbergrauen Haar klebte Blut, ebenso in seinem Gesicht. Sein Körper war von unzähligen Wunden gezeichnet. Dennoch versuchte er, sich aufzusetzen.
»Vater!« Alasdair fiel neben ihm auf die Knie. »Bleib liegen! Ich hole Hilfe.«
Donald, der Chief und Begründer des Clans Donald, schüttelte den Kopf. »Du musst fort.« Seine Finger klammerten sich um das Handgelenk seines Sohnes, als sollte sein Griff die Dringlichkeit seiner Worte unterstreichen. »Bring dich in Sicherheit. Geh!«
»Du kommst mit mir.«
»Mein Bein ist gebrochen.«
»Dann werde ich dich tragen.« Sein Vater musste nichts erwidern. Alasdair wusste auch so, dass er sich kaum selbst auf den Beinen halten konnte.
Schritte erklangen. Sein Vater rief eine Warnung. Alasdair reagierte nicht. Sein Vater wollte hier sterben? Was machte es dann aus, wenn er mit ihm starb? Sein Leben hatte in einer einzigen Nacht jeden Sinn verloren. Die sichere Burg seiner Familie hatte sich in eine steinerne Grabstätte verwandelt.
Die Schritte kamen näher. »Alasdair!«, keuchte sein Vater.
Das Knarzen einer Lederrüstung, unmittelbar hinter ihm. Mehr von Reflex als von Überlebenswillen getrieben fuhr Alasdair herum. Die Bewegung bereitete ihm entsetzliche Schmerzen, dennoch riss er die Axt in die Höhe und fing die Klinge des Wikingers ab. Unter Aufbietung seiner letzten Kräfte stemmte er sich gegen seinen Gegner und warf ihn zurück. Schon fürchtete er, der Nordmann würde nachsetzen, als ein dumpfer Schlag erklang – gefolgt von einem unterdrückten Stöhnen. Der Wikinger sackte zu Boden, einen Pfeil zwischen den Schulterblättern. Alasdairs Blick flog zur Tür, wo Diarmid den Bogen sinken ließ und, gefolgt von Iain, in den Raum trat.
»Bringt meinen Sohn von hier fort«, befahl der Chief den beiden Clansmen. »Ich lege seine Sicherheit in eure Hände.«
»Was ist mit Euch, Herr?«
Der Chief schüttelte den Kopf. »Geht ohne mich. Aber nehmt den Schwurstein mit euch.« Seine Finger gruben sich in Alasdairs Arm. »Du bist jetzt die Zukunft der MacDonalds.«
Ich bin nicht die Zukunft! Angus ist es!, wollte er schreien. Sein Blick glitt zur Tür, wo Angus mit durchschnittener Kehle lag, die leeren Augen starr zur Decke gerichtet. Es gab keine Zukunft mehr.
Diarmid nahm Alasdair die Axt aus der Hand und half ihm auf die Beine. »Gehen wir.«
Alasdair musste nur in die angespannten Gesichter seiner Freunde sehen, um zu wissen, dass es sinnlos war, sich ihnen zu widersetzen. Er wandte sich noch einmal seinem Vater zu, prägte sich die kantigen Züge und die warmen, dunklen Augen ein, während er krampfhaft versuchte, sich an sein freundliches Lächeln zu erinnern. Alles, was er sah, war ein Mann, der sterbend in seinem Blut lag.
Später wusste er nur noch lückenhaft, was in den folgenden Stunden geschah. Er wusste, dass Iain den Schwurstein in ein Tuch gewickelt und an sich genommen hatte und zwei weitere Clansmen – Colin und Bran – auf dem Gang zu ihnen gestoßen waren. Immer wieder mussten sie sich verstecken, um nicht von den Nordmännern entdeckt zu werden. Bald war Alasdair nicht mehr in der Lage, sich aus eigener Kraft auf den Beinen zu halten, sodass Diarmid ihn stützen musste.
Einmal blieb Colin vor einer Leiche stehen. Er stand einfach nur da und starrte den Toten an. Bran wollte ihn weiterziehen, doch Colin riss sich los. Tränen rannen über seine Wangen. Sein Atem dampfte in der kalten Februarluft. »Die Überlebenden … Wir müssen ihnen helfen!«
Iain nickte. »Du und Bran – tut, was ihr könnt. Diarmid und ich bringen Alasdair fort.«
Bran und Colin verschwanden mit gezückten Schwertern, während Diarmid, Iain und Alasdair sich an den Feinden vorbei in den Bergfried schlichen. Sie durchschritten eine Geheimtür und stiegen einige Stufen hinab, bis sie auf einen schmalen Gang stießen. Burg Finlaggan erhob sich auf Eilean Mor, einer Insel inmitten des Loch Finlaggan. Es gab eine schmale Brücke zum Festland, die jetzt jedoch von den Eindringlingen besetzt war. Der Weg, den Alasdair und seine Begleiter beschritten, war nur wenigen bekannt.
Alasdairs Welt schrumpfte auf eine endlose Abfolge rauer Mauern zusammen, während er sich darauf konzentrierte, einen Fuß vor den anderen zu setzen. Der Gang veränderte sich, als sie die inneren Mauern von Finlaggan hinter sich ließen. Erde trat an die Stelle des Steins. Die Luft roch feucht und modrig. Zeit und Raum verloren für Alasdair mehr und mehr an Bedeutung. Der Gedanke, zu fliehen, während über ihm Familie und Freunde starben, quälte ihn. Mehr als einmal war er drauf und dran, kehrtzumachen. Er wollte die erstbeste Waffe ergreifen und die Klinge in kaltem Wikingerblut baden. Die Verletzung hielt ihn nicht davon ab. Wenn er seine letzten Kräfte aufbot, konnte er es zurück auf den Burghof schaffen. Er würde sein Leben teuer verkaufen und so viele Nordmänner wie möglich mit ins Grab nehmen. Er stemmte sich gegen Diarmids Griff und versuchte, sich loszureißen, doch seine Kraft reichte nicht aus. Immer wieder kämpfte er gegen seinen Freund an. Ich bin ein Sohn Schottlands, unbeugsam und stark wie das Land selbst!
»Hör endlich auf!«, fuhr Iain ihn an. Seine Stimme klang ungewöhnlich rau. »Denkst du etwa, wir wollen kampflos fliehen?« Er packte Alasdair bei den Schultern und zwang ihn, ihn anzusehen. »Wir haben deinem Vater geschworen, dich in Sicherheit zu bringen! Dein Überleben ist für den Clan von größter Bedeutung. Hörst du, Alasdair? Für den gesamten Clan! Nicht nur für die Menschen von Finlaggan!«
Nur langsam erreichte der Sinn von Iains Worten seinen Verstand. Der gesamte Clan. Eine eiserne Faust schloss sich um seine Eingeweide. Iain hatte recht. Es ging um weit mehr als nur Finlaggan.
Schließlich öffnete sich der Gang zu einer kleinen Grotte, in der ein Ruderboot vertäut lag. Diarmid machte es los und griff nach den Rudern. Iain half Alasdair ins Boot, stieß es vom Ufer ab und sprang hinein.
Das Wasser klatschte in leisen Wellen gegen den Bug. Der Geruch von Algen stieg ihm in die Nase. Noch immer hallten die Schreie in seinen Ohren wider. Seine Finger waren klebrig von Blut. Alasdair lag auf dem Rücken und starrte an die niedrige Decke. Eine Weile blieb es finster. Dann fuhr ein eisiger Windhauch über ihn hinweg und plötzlich sah er den Sternenhimmel über sich. Sollte sich der Himmel nicht blutrot verfärben? Es erschien ihm unglaublich, dass er hoch oben am Firmament kein Anzeichen für das Blutbad dieser Nacht entdecken konnte. Alles, was er sah, war ein samtschwarzes Tuch, in dem unzählige Diamanten funkelten. Die Stille und der Friede, den er bei diesem Anblick empfand, erstaunten ihn selbst dann noch, als sich bereits die Bewusstlosigkeit über ihn senkte und die Sterne auslöschte.
2
Wispernd und raunend fuhr der Wind durch die Ritzen und fing sich im hohen Gebälk. Von der zaghaften Wärme der ersten Frühlingssonne war hinter den kalten Steinmauern von Burg Eilean Donan nichts zu spüren. Fröstelnd zog Sessany ihren Wollschal enger um sich. Ihre Augen wanderten durch die Halle, die hufeisenförmig angeordneten Tische entlang – eine Barriere aus dunklem, schartigem Holz, die sie von den Männern des Chiefs trennte. Bohrende Blicke versengten ihre Haut. Geflüsterte Worte krochen zischelnd wie eine Schlange von Ohr zu Ohr und ließen die unsichtbare Mauer zwischen ihr und diesen Menschen weiter anwachsen. Sie musste die Worte nicht verstehen, um zu wissen, worüber sie sprachen. Wie kann sie nur so herumlaufen? Warum ist sie noch nicht vermählt? Warum ist sie so anders? Es waren immer dieselben Fragen, die ihr begegneten – laut ausgesprochen oder hinter einem höflichen Lächeln verborgen. Sie wünschte, der Chief würde endlich das Wort an sie richten und damit das Getuschel zum Verstummen bringen. Hilfe suchend blickte sie zur Empore an der Stirnseite des Raumes, wo der Chief in seinem Sessel thronte und leise mit Murdoch, seinem engsten Vertrauten und Berater, sprach. Selbst als man Sessany in die Halle führte, hatte er sein Gespräch nicht unterbrochen. Er hatte sie noch nicht einmal angesehen. Bemüht dem durchdringenden Starren der Männer zu entfliehen, richtete sie den Blick an die Wand, wo zwischen zwei gekreuzten Schwertern das Wappen der MacKenzies hing. Golden schimmerte der Hirschkopf auf dunkelblauem Grund. Ein lebloses Abbild der Natur, das ebenso wenig hierher zu gehören schien wie sie selbst.
Sessany konnte sich kaum erinnern, wann der Chief sie das letzte Mal hatte rufen lassen. Wie oft hatte sie sich nach seiner Aufmerksamkeit gesehnt, doch Kenneth MacKenzie schien die meiste Zeit zu vergessen, dass er eine Tochter hatte. Ihr Bruder Iomaér hingegen war sein ganzer Stolz. Auf ihn konzentrierte sich all sein Interesse. Iomaér war die einzige Familie, die Sessany kannte, denn an ihre Mutter, die früh gestorben war, konnte sie sich kaum erinnern. Die Menschen sprachen nur wenig über sie und Sessanys Fragen blieben zumeist unbeantwortet. Wann immer sie an ihre Mutter dachte, erschien in ihrem Geist ein bleiches, von Krankheit gezeichnetes Gesicht.
Nach ihrem Tod hatte man Sessany in die Obhut einer Erzieherin übergeben. Deórsa hatte ihre Pflicht ernst genommen und sich bemüht ihrem Schützling die Dinge beizubringen, die eine junge Dame wissen musste. Eine Freundin oder gar Mutter war sie ihr dabei jedoch nie gewesen.
Seit Deórsas Gemahl nach einem Kampf gegen die Nordmänner schwer verletzt nach Eilean Donan zurückgebracht worden war, hatte sie ihre Aufgaben als Erzieherin ruhen lassen und sich einzig und allein der Pflege ihres Mannes verschrieben. Fünf Jahre war sie nur selten von seinem Krankenlager gewichen, bis er im vergangenen Sommer starb. Ein harter Schlag für Deórsa, die sich seither trauernd zurückgezogen hatte.
Niemand hatte je daran gedacht, eine neue Erzieherin für Sessany zu bestimmen, weshalb sie während der vergangenen Jahre alle Freiheiten genoss. Sie ging mit Iomaér jagen und fischen und maß sich in unzähligen Übungsgefechten mit ihm. Während er zu einem kräftigen Mann heranwuchs, war sie ihm dabei immer deutlicher unterlegen. Längst maß er sich mit anderen im Kampf – vorwiegend mit den jungen Clanskriegern, die ihm treu ergeben waren und nur selten von seiner Seite wichen. Einzig im Bogenschießen konnte Sessany ihm noch das Wasser reichen.
Seit dem letzten Jahr waren ihre gemeinsamen Ausflüge selten geworden. Ihr Vater beanspruchte zunehmend die Zeit seines Sohnes, um ihn darauf vorzubereiten, eines Tages den Clan zu führen. Daraufhin hatte Sessany begonnen, allein durch die Highlands von Wester Ross zu streifen.
Sie war gerade von einem Ausflug zurückgekehrt, als eine Torwache ihr eröffnet hatte, dass der Chief sie zu sprechen wünsche – sofort.
Sessany blickte an sich hinab. Ihre Stiefel waren voller Schlamm, das bequeme dunkelgrüne Wollkleid übersät mit Erd- und Grasflecken. Verstohlen zupfte sie ein Blatt aus ihrem Zopf. Als hätte ihre Bewegung den Chief an ihre Anwesenheit erinnert, richtete er plötzlich seine Aufmerksamkeit auf sie. Mit einem Wink bedeutete er ihr vorzutreten, bis sie nur noch zwei Stufen von seinem strengen Blick trennten. Wie ein Raubvogel, der über seiner Beute kreist, ragte er über ihr auf – bereit jeden Augenblick zuzustoßen. Im Gegensatz zu seinen Clansmen trug der Chief keinen Plaid, sondern war nach englischer Sitte mit Wams und Beinlingen bekleidet. Die Kappe mit dem daran gehefteten Pinienzweig – dem Erkennungszeichen der MacKenzies – war das einzige Zugeständnis an die übliche schottische Gewandung.
»Du wirst heiraten.«
Sessany konnte ihn nur anstarren. Sie hatte immer gehofft, dass dieser Tag niemals kommen würde. Die meisten Mädchen ihres Alters waren bereits seit zwei oder drei Jahren verheiratet. Dass sie es mit ihren siebzehn Sommern noch immer nicht war, hatte sie hoffen lassen. Sie war anders als diese Mädchen. Modische Gewänder und komplizierte Frisuren waren ihr ebenso lästig wie Handarbeiten. Wer sollte mich schon heiraten wollen?
Der Chief betrachtete sie aus eisgrauen Augen. »Du wirst die Burg nicht mehr verlassen.«
»Aber Vater …«
»Schweig!« Sein harscher Tonfall ließ sie verstummen. »Sieh dich nur an! Du läufst herum wie ein Bauernmädchen! Ich lasse mich von dir nicht zum Gespött machen!« Die Wände fingen seine donnernde Stimme auf und warfen sie zurück. Seine Raubvogelaugen verengten sich zu schmalen Schlitzen. »Deine Erziehung wurde lange genug vernachlässigt. Damit ist jetzt Schluss! Ab sofort bist du wieder Deórsas Obhut unterstellt. Noch vor dem Sommer wirst du vermählt sein!« Mit einem Blick auf ihre drahtige Gestalt schüttelte er den Kopf. »Es ist ein Wunder, dass Lachlan dich überhaupt will.«
Lachlan? Lachlan MacMathain? Der Sohn von Chief Cormac MacMathain war letzten Sommer Gast auf Eilean Donan gewesen. Sie war ihm einige Male begegnet, doch so sehr sie sich auch bemühte, sie vermochte nicht, sich zu erinnern, wie er ausgesehen hatte. Ehe sie etwas erwidern konnte, entließ der Chief sie. Mit einer Verneigung floh Sessany aus der Halle und wäre beinahe mit Deórsa zusammengestoßen, die sie auf dem Gang erwartete.
Das einst rabenschwarze Haar der Erzieherin war größtenteils ergraut und streng zurückgebunden. Das schlichte Kleid zeugte ebenso von ihrer Trauer wie die tiefen Linien, die sich in ihre hageren Züge gegraben hatten. Ihr strenger Blick wanderte über ihren Zögling. »Dein Vater hat recht. Es ist höchste Zeit, dass ich meine Aufgaben wieder wahrnehme. Wir haben einiges nachzuholen.«
Nur mühsam gelang es Sessany, ein Stöhnen zu unterdrücken. Nach all den Jahren der Freiheit hatte sie angenommen, dass die Maßreglungen und endlosen Ermahnungen längst hinter ihr lagen.
Deórsa geleitete Sessany in einen kleinen Raum neben der Küche, wo ein großer Waschzuber bereitstand. Zwei Mägde schrubbten sie, bis ihre Haut brannte, entwirrten ihre honigfarbenen Locken und wuschen ihr Haar. Deórsa packte Sessanys Kleid und warf es ins Feuer. »Hol ein angemessenes Kleid für die Herrin«, wies sie eines der Mädchen an.
»Ich bin gewachsen«, protestierte Sessany, obwohl das Mädchen schon zur Tür hinaus war. »Meine angemessenen Kleider sind mir schon vor zwei Jahren zu klein geworden.«
Erneut ließ Deórsa ihre kritischen Augen über sie wandern. Unwillkürlich wickelte Sessany sich enger in das Wolltuch, das man ihr zum Abtrocknen gereicht hatte. »Du bist größer geworden, aber du bist noch immer mager. Deine Kleider dürften dir kaum zu eng geworden sein. Es wird gehen, bis wir dir neue nähen lassen.«
Die zweite Magd machte sich daran, Sessanys Haar aufzustecken und unter einer mit Spitzen besetzten Haube zu verbergen. Sie war gerade fertig, als das Kleid gebracht wurde. Ein Kleid aus fliederfarbener Seide, vor einigen Jahren nach der damaligen englischen Mode angefertigt. Während Sessany sich in das eng anliegende Gewand helfen ließ, dachte sie an die Worte ihres Vaters. Du wirst noch vor dem Sommer vermählt sein. Vor dem Sommer! Der Winter war gerade zu Ende gegangen und sie hatte sich gefreut, die kalten Mauern Eilean Donans endlich wieder für längere Ausflüge hinter sich lassen zu können. Und das alles sollte jetzt ein Ende haben?
Statt in ihre bequemen Stiefel zu schlüpfen, musste sie ihre Füße in enges, knöchelhohes Schuhwerk zwängen, das mit einer silbernen Schnalle geschlossen wurde. Sie musste nicht in den Spiegel blicken, um zu wissen, wie lächerlich sie in dem viel zu kurzen, engen Kleid aussah. Die Gesichter der Mägde sprachen Bände.
Deórsa wirkte, als hätte sie am liebsten die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. »Gehen wir.«
Ohne eine Antwort abzuwarten, führte Deórsa sie ins Frauengemach, einen düsteren und zugigen Raum unter dem Dach des Haupthauses, hoch über dem Hof. Die fünf Damen, die hier über ihren Handarbeiten saßen, erhoben sich und knicksten artig, als die Tochter des Chiefs eintrat. Trotz der zur Schau gestellten Höflichkeit entgingen Sessany die verstohlenen Blicke, die sie wechselten, keineswegs.
»Was glaubst du, was du da tust!«, fuhr Deórsa sie an, als sie sich mit untergeschlagenen Beinen niederlassen wollte. »Setz dich, wie es sich für eine Dame gehört! Rücken gerade. Kinn nach oben. Beine zusammen.« Die Anweisungen prasselten auf sie ein. Nachdem sie endlich eine Haltung angenommen hatte, mit der Deórsa zufrieden war, spürte sie jeden einzelnen Muskel in ihrem Körper.
»Hier!« Deórsa wedelte mit einem Stück Leinen vor Sessanys Nase. »Ich will sehen, wie weit deine Stickkünste gediehen sind.«
Künste? Sie war in der Lage, Löcher in ihren Gewändern auszubessern – von Kunst konnte dabei keine Rede sein. So sehr sich die Damen auch bemüht hatten, ihr die Meisterschaft mit Nadel und Faden beizubringen, es war ihr noch nie gelungen, die nötigen akkuraten Stiche zu setzen, um Verzierungen und zierliche Bilder auf Tuch zu bannen.
Als Deórsa sah, dass Sessany die Nadel wie einen Dolch in Händen hielt, seufzte sie. »Stell dich nicht so an! Hier«, sie griff nach der Nadel und drehte sie zwischen Sessanys Fingern, »so musst du das machen. Und jetzt fang an.«
Als nachmittags Unruhe auf dem Hof von der Ankunft eines Boten kündete, reckte Sessany den Hals und fing sich sofort einen Tadel ein. »Hör auf zu glotzen! Das schickt sich nicht!« Obwohl sie vor Neugierde brannte, blieb ihr nichts anderes übrig, als ihre Aufmerksamkeit erneut ihrer Stickerei zuzuwenden.
Am späten Abend, nachdem Deórsa sie endlich entlassen hatte, verkroch sie sich in ihr Zimmer. Sie warf die lästige Seidenhaube zur Seite, streifte die drückenden Schuhe ab und machte sich im Dunkeln an den Schnüren ihres Kleides zu schaffen. Sie schälte sich aus dem Gewand und schlüpfte in ein bequemes Wollkleid, ehe sie sich mit einem Seufzer der Erleichterung aufs Bett fallen ließ. Die Ruhe währte nicht lang. Ein Klopfen schreckte sie auf. Einen Atemzug später steckte ihr Bruder den Kopf zur Tür herein. »Darf ich eintreten?«
»Seit wann fragst du?«
Iomaér kam herein und entzündete eine Talgkerze. »Wie ich hörte, hattest du das Vergnügen mit Deórsa.« Er zog sich einen Schemel heran und setzte sich. Iomaér war eine jüngere Ausgabe ihres Vaters. Er hatte die eisgrauen Augen und die scharfen Züge des Chiefs geerbt, ebenso sein dichtes blondes Haar. Zu ihrer Erleichterung endete die Ähnlichkeit damit. Die Kälte des Chiefs lag nicht in seiner Natur.
»Als Vergnügen würde ich es nicht bezeichnen. Ich nehme an, du hast von Vaters Plänen gehört?«
»Heute Nachmittag.«
Sie war versucht, ihn zu bitten, mit dem Chief zu sprechen, in der Hoffnung, er würde auf seinen Sohn hören, wenn dieser ihm sagte, dass ihre Heirat nicht von Nutzen sei. Doch ihr war klar, selbst Iomaér würde es nicht gelingen, ihren Vater umzustimmen. Ihre Verbindung mit den MacMathains würde das Bündnis stärken, das zwischen den beiden Clans bestand. Er verschachert mich, um seinen Einfluss zu vergrößern. Das passte zu ihrem Vater. Die MacKenzies gehörten nicht umsonst zu den mächtigsten Highland-Clans. Und jetzt macht er mich zu einem Teil seiner Politik. »Wie kann er das tun? All die Jahre hat er sich einen Dreck um mich geschert und plötzlich nimmt er mir alles, was mir etwas bedeutet.«
»Übertreibst du jetzt nicht ein wenig?«
Sie kniff die Augen zusammen. »Er hat mir verboten, Eilean Donan zu verlassen. Ich darf nicht einmal mehr an den Loch Duich, von Ausflügen in die Highlands ganz zu schweigen. Und noch vor dem Sommer werde ich die Gemahlin irgendeines … eines, ich weiß nicht was, sein!«
»Die Frau eines künftigen Chiefs! Vielleicht wird alles gar nicht so schlimm, wie du es dir im Augenblick vorstellst. Immerhin scheint Lachlan ernsthaft an dir interessiert zu sein. Wer weiß, womöglich magst du ihn ja auch. Warum wartest du nicht erst einmal ab?«
»Als ob ich eine Wahl hätte.« Um sich von ihrem Kummer abzulenken, wechselte sie das Thema. »Ich habe einen Boten ankommen sehen. Schlechte Nachrichten?«
»Im Gegenteil.« Iomaér grinste. »So wie es aussieht, werden uns die MacDonalds künftig keine Schwierigkeiten mehr bereiten.«
Sessany sah auf. Seit sie denken konnte, lagen die MacKenzies mit den MacDonalds von Islay in Fehde. Obwohl sie den Grund für diese Feindschaft nicht kannte, wusste sie, dass sich die beiden Clans seit einem Vierteljahrhundert erbittert bekämpften. Doch der Zwist der beiden Familien war nicht der einzige Unruheherd in den Highlands. Wie oft hatte sie abends mit Iomaér zusammengesessen und seinen Ausführungen über die Lage Schottlands gelauscht, bis sie beinahe ebenso vertraut mit der Politik der Clans war wie er selbst.
Obwohl Somerled – Donalds Urahn –, in dessen Adern noch das Blut der Nordmänner floss, die Wikinger vor beinahe hundert Jahren von den westlichen Inseln vertrieben hatte, hatte es immer wieder Kämpfe mit plündernden Nordmännern gegeben, die mit ihren Langbooten an der schottischen Küste gelandet waren. Seit einigen Jahren herrschte ein zerbrechlicher Friede zwischen Schotten und Wikingern, doch die Highlands kamen trotzdem nicht zur Ruhe. Immer häufiger flammten Kämpfe unter den Clans auf. Ein Streit um Vorherrschaft, der mit jedem Mal erbitterter geführt wurde. Viele litten Hunger. Einige waren bereits gezwungen, sich den großen Clans zu unterwerfen, um ihre Familien zu retten. Andere trachteten danach, ihren Einfluss zu vergrößern. Während auch Sessanys Vater bedacht war, seine Macht auszubauen, schwebte dem alten Donald etwas anderes vor. Er sprach davon, dass das Land von einem Rat der mächtigsten Chiefs beherrscht werden sollte, dem sich alle Clans zu unterwerfen hatten. Chief Donald war der Ansicht, dass es auf diese Weise gelingen konnte, die Kämpfe zu beenden und die Clans zu einen. Nur vereint konnten sie auf Dauer gegen die Engländer bestehen, denn auf die Hilfe des schottischen Königs konnten sie nicht zählen. Obwohl ihm die Chiefs die Treue geschworen hatten, reichte König Alexanders Einfluss nicht bis in die Highlands. Womöglich ist das ja der Grund, warum die Chiefs ihm überhaupt Gefolgschaft gelobt haben. In den Highlands galten eigene Gesetze und bisher hatte sich niemand die Mühe gemacht, etwas daran zu ändern. Bisher haben sich die Engländer auch nicht wirklich für Schottland interessiert. Alexander vermochte es ebenso wenig, die Clans in Zaum zu halten, wie es ihm gelang, sich gegen die Engländer zur Wehr zu setzen. Trotz der Oberhoheit Englands war der schottische König stets unabhängig von London gewesen. Jetzt jedoch streckte Edward von England seine Hände nach Schottland aus. Einige Lords in den Lowlands hatten sich ihm bereits unterworfen. Und schon bald würde er versuchen, sich ganz Schottland untertan zu machen.
Donald von Islay vertrat die Belange seines Clans weniger mit dem Schwert als mit dem Wort. Das machte ihn gerade bei den kleineren Clans beliebt, die oft seine Hilfe erbaten, wenn es darum ging, in Auseinandersetzungen zu vermitteln. Ohne ihn wäre der Clan MacKenzie längst die stärkste Macht in den Highlands. Sessany hatte nur zu oft mit angehört, wie ihr Vater Donalds ständige Einmischung verfluchte. »Was weiß der schon, wie es bei uns auf dem Festland zugeht!«, hatte sie ihren Vater mehr als einmal schimpfen hören. Tatsächlich lagen die größten Teile von Donalds Ländereien auf den westlichen Inseln – Islay, Kintyre und Mull –, sodass sein Clan von den zunehmenden Auseinandersetzungen mit der englischen Krone bisher verschont geblieben war. Wie kann er behaupten zu wissen, was für die Highland-Clans das Beste ist?
»Was soll das heißen, die MacDonalds machen keine Schwierigkeiten mehr?«
Iomaérs Grinsen wurde breiter. »Es gab eine Schlacht auf Islay – in Finlaggan. Chief Donald und seine Erben sind tot. Das Treffen wird nicht stattfinden.«
Donald war es gelungen, die Chiefs zu einem Treffen zu bewegen. Die Zusammenkunft hätte noch vor dem Sommer stattfinden sollen. Zweifelsohne war es dabei um seinen Wunsch gegangen, den Rat ins Leben zu rufen, von dem er stets gesprochen hatte.
»Was, wenn ein anderer dieses Treffen einberuft?«, gab sie zu bedenken.
Iomaér schüttelte den Kopf. »Dazu hat keiner den Mumm.«
»Was geschieht jetzt mit dem Land der MacDonalds?«
»Wenn sich nicht binnen kürzester Zeit in den Reihen der Überlebenden ein neuer Chief findet, der in der Lage ist, den Clan auch zu schützen, werden sich die umliegenden Clans auf die Ländereien stürzen und sich dabei gegenseitig zerfleischen.«
»Wer war verrückt genug, die Macht der MacDonalds herauszufordern?«
Er zuckte die Schultern. »Das wusste der Bote nicht. Vielleicht war es MacDougal von Argyll. Grund genug hätte er, nachdem Donalds Ältester seinem Erben letzten Sommer die Braut ausgespannt hat.«
Iomaér hatte früher oft Geschichten von beeindruckenden Schlachten erzählt. Sessany versuchte, sich vorzustellen, wie die Schlacht um Finlaggan gewesen war. Sie sah Krieger der MacDonalds vor sich, die einer undurchdringlichen Reihe von MacDougals gegenüberstanden. Mann gegen Mann traten sie einander im ehrenhaften Kampf entgegen. Zweifelsohne war es eine gute Schlacht gewesen.
*
Der nächste Morgen brachte Regen.
Nachdem Sessany das Kleid angezogen hatte, zwängte sie ihre Füße erneut in die drückenden Schuhe. Sie war kaum fertig, da erschien Deórsa. Während eines langen Vormittags ließ die Erzieherin endlose Litaneien über das richtige Benehmen auf sie herniederprasseln. Alles Dinge, die Sessany schon hundertmal gehört, sich aber nie zu Eigen gemacht hatte. Als es endlich an der Zeit war, zu Mittag zu essen, ließ Deórsa das Mahl auftragen. Sie belehrte Sessany so lange darüber, wie sie ihren Gemahl bei Tisch zu bedienen hatte, dass der Braten kalt war, als sie endlich essen durfte.
»Und nun geh und mach dich frisch«, sagte Deórsa, kaum dass die Reste des Essens abgetragen waren.
Sessany wusste, dass Deórsa erwartete, sie würde auf ihr Zimmer gehen und ihr Haar und das Gewand richten. Nachdem sie jedoch den ganzen Vormittag im Haus verbracht hatte, hatte sie das Gefühl, verrückt zu werden, wenn sie jetzt keine frische Luft bekam. Statt sich zurückzuziehen machte sie sich auf den Weg zur Hintertreppe.
Inzwischen regnete es nicht mehr. Die letzten dunklen Wolken hatten sich verzogen und einem blassblauen Himmel Platz gemacht. Freudig begrüßte Sessany den Schwall erdiger Frühlingsluft, der ihr bereits an der Tür entgegenströmte. Sie sprang die steilen Stufen zum Küchenhof hinunter – und versank bis zu den Knöcheln im Schlamm. Fluchend hob sie ein Bein und betrachtete den Schuh, der sich mit einem schmatzenden Laut aus dem Boden löste.
Deórsa wird mich umbringen. Da es ohnehin zu spät war, zog sie beide Schuhe aus, nahm sie in die Hand und setzte ihren Weg barfuß fort. Kalter Schlamm quoll zwischen ihren Zehen hervor und kühlte ihre schmerzenden Füße.
Am Eingang zum Küchenhaus entdeckte sie einen Mann in einem einfachen Plaid, das silbergraue Haar mit einem Lederband im Nacken zusammengebunden. Fearghas! Zum ersten Mal an diesem Tag hellte sich ihre Miene auf. Seit ihr Vater ihn von seinem Posten als Hauptmann der Burgwache entbunden und durch einen Jüngeren ersetzt hatte, lebte er zurückgezogen in einem Haus an der Küste und kam nur noch alle paar Wochen nach Eilean Donan, um seine Vorräte aufzufrischen. Schon als er noch in der Burg gelebt hatte, hatte sie gerne seinen Geschichten gelauscht, und nachdem er fortgezogen war, hatten sie und Iomaér begonnen, ihn zu besuchen.
Als sie ihn sah, ließ sie die Schuhe fallen und rannte los. Der hochgewachsene Krieger hatte sie gerade entdeckt, da fiel sie ihm schon in die Arme. Sein dichter Bart bebte, als er sie lachend auffing und mit seinen Pranken umfangen hielt, ehe er sie wieder absetzte und eingehend betrachtete. »Bei Gott, Sessany! Seit wann freust du dich so, mich zu sehen?«
Fearghas’ gutmütiges Gesicht, mit der mehrfach gebrochenen Nase und den buschigen Augenbrauen, war so sehr mit dem Gedanken an die Highlands und ihre verlorene Freiheit verbunden, dass ihr plötzlich die Tränen in die Augen stiegen. Hastig blinzelte sie sie fort. »Ich habe dich eben vermisst.«
»Und du bist sicher, dass dein Verhalten nicht zufällig mit einer bevorstehenden Vermählung zu tun hat?«
»Woher …?«
»Die ganze Gegend spricht von dir und MacMathain«, grinste er. »Einen richtig guten Fang hast du da gemacht. Da kann ich dir wohl nur gratulieren.« Als sie das Gesicht verzog, runzelte er die Stirn. »So sollte niemand dreinblicken, der bald die Frau eines zukünftigen Chiefs sein wird. Was ist los?«
»Deórsa hat mich wieder unter ihre Fittiche genommen und ich soll noch vor dem Sommer vermählt sein!« Plötzlich sprudelten die Worte aus ihr hervor, als hätte Fearghas einen Damm zum Einsturz gebracht. »Vor dem Sommer! Das sind nur noch ein paar … Es ist viel zu kurz! Und ich kenne ihn nicht einmal! Ich weiß einfach nicht …«
»Sieht aus, als hättest du hier nicht die Ruhe, um über alles nachzudenken. Warum kommst du nicht mit mir? Vergiss Deórsa und den ganzen Rummel für ein paar Tage.« Er deutete in Richtung des Haupthauses. »Pack deine Sachen. Sobald ich meine Vorräte verladen habe, brechen wir auf.«
Sessany stand wie angewurzelt da. »Vater hat mir verboten, die Burg zu verlassen.« Zum ersten Mal wurde ihr wirklich bewusst, was diese Heirat für sie bedeutete. Bald würde sie von Eilean Donan fortgehen müssen. Ihr Ziel war nicht das östliche Cromarty, wo Chief Cormac MacMathain seinen Sitz hatte, sondern Dùntràth, der Landsitz der MacMathains am Loch Linneh. Dort würde Lachlan sie erwarten. Die Highlands lagen dann für immer hinter ihr – ebenso wie ihr altes, ungezwungenes Leben. Sie wäre den Wünschen ihres Gemahls ausgeliefert. Als Frau des künftigen Chiefs war es ihre Pflicht, ihm einen Erben zu gebären. Allein der Gedanke, dass sie mit einem Fremden das Lager teilen sollte, ließ sie schaudern. »Ich bin eine Gefangene«, brachte sie mit erstickter Stimme hervor.
»Himmel, Sessany! Dein Anblick bricht mir das Herz. Diese Haube, das Kleid. Das bist nicht du.«
»Ich …« Es fiel ihr schwer, sich nicht einfach an seine Brust zu werfen. Fearghas verkörperte alles, was sie sich bei ihrem Vater immer gewünscht hatte. Er spendete Trost, hörte ihr zu und nahm sie ernst.
»Sessany MacKenzie!« Schneidend durchfuhr Deórsas Stimme die Stille. Sessany fuhr herum und blickte geradewegs in das erzürnte Gesicht ihrer Erzieherin, die – mit Sessanys verdreckten Schuhen in Händen – vor ihr stand. Ohne den Krieger eines Blickes zu würdigen, packte Deórsa sie beim Arm und schob sie zum Haus zurück. Ihr blieb nicht einmal Zeit, sich von Fearghas zu verabschieden.
Deórsa brachte sie in eine Kammer und warf ihr die Schuhe vor die Füße. »Du wirst diesen Raum erst verlassen, wenn sie sauber sind. Ich werde in einer Stunde wieder nach dir sehen.« Sie rauschte zur Tür hinaus und ließ Sessany allein zurück.
Eine Weile starrte sie finster auf die schlammverkrusteten Schuhe. Schließlich seufzte sie, holte eine Bürste und einen Lumpen und machte sich daran, sie zu reinigen. Ein mühsames Unterfangen, das nur von mäßigem Erfolg gekrönt war. Der feuchte Schlamm verteilte sich bloß immer mehr, je länger sie das weiche Leder mit der Bürste bearbeitete. Auch der Lumpen brachte sie nicht voran. Sie weiß genau, dass sie ruiniert sind! Wutentbrannt schleuderte sie die Bürste zu Boden, packte die Schuhe und stürmte aus dem Raum. Sie stürzte auf den Hof und überquerte ihn mit langen Schritten. Vor der Pferdetränke hielt sie inne und versenkte die Schuhe darin. Kleine Blasen stiegen auf, als sie untergingen. Schlammbröckchen trieben an die Oberfläche und färbten das Wasser braun. Als sie die Schuhe schließlich herausfischte, waren sie triefnass, aber frei von Schlamm. Mit grimmigem Lächeln kehrte sie zum Haus zurück und wartete.
Deórsa zeigte sich bei ihrer Rückkehr wenig beeindruckt. Mit knappen Worten befahl sie Sessany, die nassen Schuhe anzuziehen und ihr zu folgen. Den Rest des Tages verbrachte sie in einer düsteren Kammer, wo Deórsa sich abmühte, ihr die Grundregeln von Anmut und Grazie beizubringen. Als sie spätabends endlich in ihr Zimmer zurückkehrte, waren ihre Füße übersät mit großen schmerzhaften Blasen.
3
Während sich Sessany in den folgenden Wochen weiter unter Deórsas wachsamen Blicken in Benimm übte, erreichten immer wieder Nachrichten über blutige Zusammenstöße zwischen den MacLennans von Glen Affric und den Männern ihres Vaters die Burg. Schon länger hatte ihr Vater Interesse am Land des benachbarten Clans im Osten. Zu Lebzeiten des alten Donald hatte er jedoch nie gewagt, so offen gegen die MacLennans vorzugehen.
Schließlich hatte der Chief Eilean Donan verlassen, um Lachlan MacMathain aufzusuchen und mit ihm die Bedingungen der Vermählung zu besprechen. In dieser Zeit gelangte Sessany endgültig zu der Überzeugung, dass sie nicht heiraten wollte – nicht heiraten würde. Schon jetzt hielt sie es kaum noch in dem steinernen Gefängnis aus, zu dem Eilean Donan geworden war. Die kleine Insel, auf der Eilean Donan lag, war kaum größer als die Burg selbst und erhob sich am östlichen Ufer des Loch Duich, dem letzten Ausläufer eines Atlantikfjordes. Sessany sehnte sich danach, das Rauschen der Blätter zu hören und den Wind im Haar zu spüren. Oft stand sie am Fenster und blickte auf den Loch Duich und die dahinter liegenden Highlands hinaus. Dann wurde sie von einer Wehmut erfasst, die ihr das Herz zu zerreißen drohte. In diesen Momenten war sie drauf und dran, ihre Sachen zu packen und davonzulaufen, doch sie wusste, dass sie nicht einmal an den Torwachen vorbeigekommen wäre. Ihr Vater hatte seinen Männern befohlen, sie nicht passieren zu lassen. Sie durfte nicht einmal einen Fuß auf die Brücke setzen, die die Insel mit dem Festland verband. Im Laufe der Zeit war ein Plan in ihr gereift. Sie würde sich scheinbar in ihr Schicksal fügen und sich auf den Weg zu ihrem Bräutigam begeben, sobald es von ihr verlangt wurde. Nur dass ich dort niemals ankommen werde. Wie es dann weitergehen sollte, wusste sie noch nicht. Womöglich würde sie erst einmal zu Fearghas gehen. Vielleicht konnte er ihr weiterhelfen.
Es war ein sonniger Apriltag, drei Wochen nach der Abreise ihres Vaters, als sie mit Deórsa und den anderen Damen im Frauengemach saß. Längst hatten ihr die Näherinnen neue Kleider angefertigt, sodass sie nicht mehr in dem viel zu kurzen Gewand umherlaufen musste. Wohl fühlte sie sich dennoch nicht, entsprachen die Gewänder doch einmal mehr der unpraktischen englischen Mode. Erfüllt von einer Ungeduld, die jeden Tag stärker wurde, plagte sie sich mit der immer selben Stickerei. Die Nadel zuckte zwischen ihren rastlosen Fingern, ohne dass es ihr gelingen wollte, einen vernünftigen Stich zu setzen. Immer wieder glitten ihre Blicke aus dem Fenster. Sie hörte den Gesang der Vögel und spürte mehr denn je den Drang, hinauszugehen. Verdrossen blickte sie auf den Stickrahmen. Seit Wochen plagte sie sich nun schon mit demselben Stück Stoff. Gestern Abend war ein Viertel des eingespannten Tuchs verziert gewesen. Heute Morgen hatte Deórsa ihre Arbeit in Augenschein genommen. Beim Anblick der ungelenken Stiche hatte sie den Kopf geschüttelt und Sessany die Arbeit von zwei Tagen auftrennen lassen. Schon wieder. So kam es, dass sie erneut über einem leeren Tuch saß.
Plötzlicher Lärm auf dem Hof weckte ihre Aufmerksamkeit. Rufe mischten sich unter das Stampfen von Hufen. Sessany fuhr herum.
»Wenn du ständig aus dem Fenster starrst, wirst du es nie lernen«, wies Deórsa sie zurecht, ohne den Kopf zu heben.
Werde ich ohnehin nicht. Sessany reckte den Hals, bis es ihr gelang, einen Blick auf den engen Hof zu erhaschen. Dort hatten sich einige Menschen versammelt, um die Männer in Empfang zu nehmen, die eben ihre Pferde durch das Tor führten. Enttäuscht stellte sie fest, dass es nur Moran, der Jagdaufseher ihres Vaters, und sein Gehilfe Pádraig waren. Dann entdeckte sie den Mann, den Moran an einem Strick hinter seinem Pferd herzerrte. Seine Hände waren auf den Rücken gefesselt und das Seil in einer Schlinge um seinen Hals gelegt. Er taumelte und schien kaum in der Lage, sich auf den Beinen zu halten. Moran zügelte sein Pferd. Hustend fiel der Gefangene auf die Knie.
Die Neugierde hielt Sessany nicht mehr auf ihrem Platz. Sie warf ihren Stickrahmen zur Seite und sprang auf. Nadel und Garn rutschten von ihrem Schoß und fielen zu Boden. Ohne auf Deórsas Rufe zu achten, stürmte sie aus dem Raum.
»Ein Wilderer«, erklärte Moran gerade, als sie auf den Hof trat. Eine Front aus den Rücken Schaulustiger verstellte ihr die Sicht, sodass sie kaum mehr als Morans strohblonden Schopf und einen Teil seines wettergegerbten Gesichts zu sehen bekam.
Sie stellte sich auf die Zehenspitzen, um zu erkennen, mit wem er sprach, als sie Iomaérs Stimme vernahm. »Wo hast du ihn gefunden?«
»Am südlichen Ende des Loch Duich, Herr. Er hat einen Hirsch des Chiefs erlegt. Teile davon hatte er bereits beiseitegeschafft. So wie es aussah, kam er ein weiteres Mal, um auch noch den Rest zu holen.«
Sessany reckte sich, um einen Blick auf den Gefangenen zu erhaschen. Im Gegensatz zu allen anderen Männern auf dem Hof trug er keinen Plaid, sondern ein einfaches Hemd und Wollhosen, beides starrte vor Dreck. Sein Gesicht lag unter einer dicken Schmutzschicht, das lange Haar und der zottige Bart waren grau vor Staub. Einzig seine dunklen Augen waren deutlich zu erkennen.
Moran wandte sich seinem Gefangenen zu. »War dies das erste Mal, dass du das Wild meines Herrn erlegt hast?« Als der Mann nicht antwortete, zog der Jagdaufseher so heftig am Seil, dass er umgerissen wurde. »Rede!« Moran packte ihn am Kragen und zerrte ihn auf die Beine. Schwankend kam der Gefangene zum Stehen. Noch immer sagte er kein Wort. Er stand nur da. Sessany drängte nach vorn, während Moran seinen Gefangenen schüttelte. »Rede, verdammter Wilddieb!«
»Moran!« Iomaérs Tonfall rief den Jagdaufseher zur Räson. Augenblicklich gab er den Gefangenen frei. Taumelnd tat der einen Schritt zur Seite, ehe er in aufrechter Pose verharrte.
Sessany bahnte sich ihren Weg zwischen den Leuten hindurch. Einige machten Platz, um sie passieren zu lassen, an anderen musste sie sich vorbeizwängen.
Moran wandte sich seinem Herrn zu. »Auf Wilderei steht der Tod. Er soll hängen, Herr.«
An der Miene des Gefangenen war nicht zu erkennen, ob er begriff, was Moran forderte. »Ich glaube nicht, dass er ein Wort von dem versteht, was wir sagen«, meinte Pádraig mit einem Blick auf die verwahrloste Gestalt. Er umrundete den Gefangenen langsam und versperrte Sessany die Sicht. Für eine Weile sah sie nur Pádraigs schlanke Silhouette. Dann war endlich der Weg frei. Sie trat zu Iomaér.
Er bedachte sie mit einem missbilligenden Blick. »Du solltest im Haus sein.«
Sie tat seine Worte mit einem Schulterzucken ab.
»Womöglich ist er ein Fremder, der unsere Sprache nicht spricht«, überlegte Pádraig weiter. »Seinen Gewändern nach zu urteilen vielleicht ein Nordmann.«
»Ja«, rief jemand aus der Menge, »oder ein Schwachkopf, der nicht sprechen kann.« Der Zwischenruf wurde mit Gelächter belohnt.
»Willst du ihn wirklich hängen?«, fragte sie Iomaér leise genug, dass nur er sie verstehen konnte.
»Das ist die Strafe, die einem Wilddieb zusteht«, gab er gedämpft zurück. Immer mehr Stimmen wurden laut, die eine Entscheidung forderten, wie mit dem Gefangenen zu verfahren sei.
Sessany rückte näher an ihren Bruder heran. »Sieh ihn dir an, Iomaér.« Sie hatte Mitleid mit diesem Mann, der trotz der Fesseln und seines erbärmlichen Zustands Stolz und Würde ausstrahlte. »So wie er aussieht, wäre er ohne das Fleisch verhungert.« Als sie klein war, hatte sie einmal mit ansehen müssen, wie ein Mann gehängt wurde. Der Anblick hatte sie lange nicht losgelassen. »Er hat Unrecht getan«, fuhr sie leise fort. »Dafür soll er bestraft werden, aber nicht gehängt. Pádraig hat recht. Der Mann ist ein Fremder, der sichtlich nicht einmal unsere Sprache versteht. Wie sollte er da unsere Gesetze kennen?«
»Du verlangst von mir, auf eine Hinrichtung zu verzichten?«
»Wir können ihn doch nicht für etwas töten, von dem er nicht einmal wusste, dass es Unrecht ist.«
Iomaér betrachtete den Gefangenen abschätzend. »Zwanzig Peitschenhiebe, dann sperrt ihn ein«, fällte er sein Urteil, ohne das Raunen zu beachten, das wie eine Welle über den Hof ging. Noch nie hatte man auf Eilean Donan einen Wilddieb verschont!
Sessany hätte um ein Haar aufgeschrien. Peitschenhiebe! Sie hatte geglaubt, dass er ihn in den Kerker werfen und nach ein paar Tagen oder Wochen wieder auf freien Fuß setzen würde. Sie biss sich auf die Unterlippe und hielt den Mund. Immerhin würde der Mann leben.
Ihr Blick heftete sich auf die ausdruckslose Miene des Gefangenen. Ihre Augen begegneten seinen. Erschöpfung spiegelte sich darin. Sessany schenkte ihm ein zaghaftes Lächeln und wandte sich ab. Sie wollte nicht dabei sein, wenn seine Bestrafung begann.
Statt zu den Frauen zurückzukehren ging sie auf ihr Zimmer und schloss die Tür hinter sich. Sie vermied es, aus dem Fenster zu blicken. Sie wollte nicht sehen, wie Iomaérs Männer dem Gefangenen das Hemd vom Leib rissen, wollte nicht wissen, ob sie ihn festhielten oder an einen Pfosten fesselten, damit er der Peitsche nicht entgehen konnte, und ganz sicher wollte sie nicht mit ansehen, wie der Lederriemen seine Haut zerriss und in sein Fleisch schnitt! Ein kühler Lufthauch fuhr durch die Fensteröffnung, streifte über ihre Arme und überzog sie mit einer Gänsehaut. Mit einem Ruck wandte sie sich ab und warf sich aufs Bett. Geräusche drangen vom Hof empor. Stimmen schwebten durch den Raum. Unverständliches Gemurmel, durchbrochen vom Knallen der Peitsche. Jeder Schlag gefolgt von einer quälend langen Pause. Angespannt lauschte sie, wartete auf die Schreie des Gefangenen, doch sie blieben aus. War da ein unterdrücktes Keuchen? Wieder knallte die Peitsche. Zum wievielten Mal? Sollte es nicht längst vorbei sein? Abermals biss das Leder zu. Sessany sprang auf, warf die Fensterläden zu und sperrte die quälenden Geräusche aus. Doch was sie gehört hatte, ließ sich nicht mehr aus ihrem Geist bannen. Immer wieder stahlen sich ihre Gedanken zu dem Wilderer. Wie mochte er sich jetzt fühlen? Es dämmerte bereits, als sie – getrieben von Mitleid und Neugier – ihre Kammer verließ.
4
Alasdair erwachte zitternd vor Kälte.
Stimmen hatten ihn aus dem Schlaf geschreckt. Im ersten Moment konnte er sich nicht erinnern, was geschehen war, doch mit seinen Sinnen kehrte auch die Erinnerung zurück. Eilean Donan – ausgerechnet! Der Jagdaufseher hatte ihn aufgegriffen, als er die Reste des Hirschs hatte holen wollen. Fleisch für die Familie, in deren Obhut Diarmid und Iain ihn gegeben hatten, ehe sie selbst nach Islay, zum Loch Finlaggan, zurückgekehrt waren, um nach Überlebenden zu suchen. Seither nagten Sorge und Furcht an ihm. Wochen waren verstrichen, während er jeden Tag gehofft hatte, Iain oder Diarmid würde endlich durch die Tür treten und ihn aus seiner Ungewissheit erlösen. Doch es gab keine Nachricht aus Finlaggan – kein Lebenszeichen von seinen Freunden oder seiner Familie.
Seine Wunde war gut geheilt und mit jedem Tag war seine Ungeduld gewachsen, bis er es kaum noch erwarten konnte, endlich nicht länger ans Bett gefesselt zu sein. Der Winter war lang und hart gewesen und hatte die Vorräte schrumpfen lassen, sodass Seamus und Rhoda es sich nicht leisten konnten, ein weiteres hungriges Maul zu stopfen. Deshalb war er auf die Jagd gegangen, doch die Gegend fern seiner Heimat war ihm fremd. Ohne es zu ahnen, war er zu weit in den Norden geraten – auf MacKenzies Land.
Er erinnerte sich daran, dass sie ihn hatten hängen wollen. Dann war die junge Frau erschienen. Irgendwie war es ihr gelungen, sein Leben zu retten. Wenn du wüsstest, wer ich bin, hättest du das nicht getan. Zu seiner Erleichterung kannte ihn hier niemand. Statt ihn also am nächsten Baum aufzuknüpfen, hatten sie ihn ausgepeitscht und danach in einer Kerkerzelle ins Stroh geworfen.
Alasdair ließ sich nicht anmerken, dass er wach war. Stattdessen lauschte er auf die leisen Stimmen in seinem Rücken und versuchte herauszufinden, wie schlimm seine Lage war.
Eine der Stimmen gehörte dem Mann, der das Urteil verhängt hatte – Iomaér, der Erbe des alten MacKenzie. Die andere war die der jungen Frau. Er vernahm das leise Rascheln von Stoff und Stroh, als sie neben ihm niederkniete. Um ein Haar wäre er zusammengezuckt, als er ihre Hände spürte. Sie schob die Fetzen seines Hemdes zur Seite und machte sich daran, die blutigen Striemen auf seinem Rücken zu reinigen. Obwohl sie vorsichtig war, stöhnte er auf. Dennoch gab er weiter vor, nicht bei Bewusstsein zu sein.
»Du weißt, dass du dir Ärger einhandeln wirst«, hörte er Iomaér sagen.
»Nicht, wenn du mich nicht verrätst.« Wie Iomaér auch sprach sie in jenem harten Dialekt, wie er für die Bewohner in diesem Teil der Highlands typisch war. Behutsam tupfte sie seine Wunden mit einem feuchten Tuch ab. Alasdair biss knirschend die Zähne zusammen.
Iomaér seufzte. »Das würde ich nie tun! Aber wenn Deórsa dich hier erwischt …«
Er glaubte zu spüren, wie sie die Schultern zuckte. »Das lass mal meine Sorge sein.«
»Ich wollte dir nur Ärger ersparen.«
Ihr Gewand raschelte, als sie herumfuhr. »Was glaubst du eigentlich, was mein Leben ist, Iomaér? Ein einziger großer Spaß?« Hatte er sie zuvor noch beinahe mühelos verstanden, ließ ihre Wut sie jetzt in einen breiteren Dialekt verfallen, der es schwer machte, ihren Worten zu folgen. »Ich lebe in einem Gefängnis. Ich kann keinen Schritt mehr machen, ohne dass mir jemand sagt, was ich zu tun oder wie ich mich zu verhalten habe. Glaubst du, das will ich?«
»Das Leben ist nicht immer einfach.«
»Früher war es das.«
»Du übertreibst.«
Statt zu antworten, begann sie eine Paste auf Alasdairs geschundenen Rücken aufzutragen. Glühende Feuerbälle explodierten vor seinen Augen. Er unterdrückte ein Keuchen. Schweiß trat auf seine Stirn. Seine Finger krallten sich ins Stroh.
»Ich muss gehen«, drang erneut Iomaérs Stimme an sein Ohr. »Ich habe jetzt das Vergnügen, Murdoch zu erklären, warum ich ihn nicht gehängt habe.«
Ihre Röcke raschelten leise, als sie sich bewegte. »Danke, Iomaér.«
»Schon gut.« Schritte entfernten sich, dann fiel eine Tür ins Schloss.
Sie war fertig und zog die kümmerlichen Reste seines Hemdes zurecht. Eine Weile wagte er nicht zu atmen, aus Furcht, die Besinnung zu verlieren. Nur langsam ließ der Schmerz ein wenig nach. Alasdair war versucht, ihr zu danken – nicht nur für die Behandlung seiner Wunden –, doch er schwieg. Wie alle anderen auch hielt sie ihn dank seiner Gewandung und seines Schweigens für einen Nordmann, der ihre Sprache nicht verstand. Allein deshalb war er noch am Leben. Ursprünglich hatte er nur geschwiegen, da er sich nicht vor einem MacKenzie für eine Tat rechtfertigen wollte, auf die ohnehin der Tod stand. Wenn sie ihn für einen Fremden hielten – umso besser. Vielleicht war das seine Möglichkeit, davonzukommen.
Sie erhob sich. »Ich werde bald wieder nach dir sehen.« Ein Knarren verkündete, dass sie die Tür erreicht hatte. Dann war auch sie fort.
Endlich öffnete er die Augen und setzte sich auf. Sein Gefängnis aus rauem Stein war kaum größer als sechs auf neun Fuß, verschlossen von einer massiven Eichentür. Dämmerlicht fiel durch einen schmalen Lichteinlass über ihm und hüllte die Zelle in ein Gewirr aus wachsenden Schatten. Ein kühler Luftzug strich über ihn hinweg und ließ ihn frösteln. Erschöpft rollte er sich im Stroh zusammen. Es gab keine Decke, seine Stiefel hatten sie ihm genommen und das, was von seinen Gewändern übrig geblieben war, hielt ihn kaum warm. Dennoch schlief er ein.
Als er später erwachte, war es finster. Bohrender Hunger plagte ihn. Sein Magen verkrampfte sich schmerzhaft, sein Mund war trocken und ihm war übel. Wann hatte er das letzte Mal etwas gegessen?
Ein Geräusch schreckte ihn auf. Knarrend wurde der Riegel zurückgeschoben und die Tür geöffnet. Licht strömte in die Zelle und füllte sie bis in den letzten Winkel aus. Die plötzliche Helligkeit schmerzte. Geblendet kniff er die Augen zusammen und setzte sich auf. Ein massiger Kerl kam herein mit einem Tablett, das er neben der Tür auf den Boden stellte. Hinter ihm trat die junge Frau ein, eine Laterne in der einen und eine Decke in der anderen Hand.
»Seid Ihr sicher, dass ich Euch allein lassen soll, Herrin?« Als sie nickte, verließ der Wachmann die Zelle und schloss die Tür hinter sich.
Sie stellte die Laterne ab und ging zu ihm. »Ich habe gesehen, wie du gezittert hast. Hier.« Sie hielt ihm die grobe Wolldecke entgegen. Im Gegensatz zu vorher, als sie wütend gewesen war, sprach sie jetzt fast ohne Dialekt, sodass es ihm leicht fiel, sie zu verstehen. Überrascht und ein wenig zögernd nahm er die Decke an sich. »Wie fühlst du dich?« Ihre Fürsorge hätte ihn beinahe dazu gebracht, sein Schweigen zu brechen. Hastig wandte er den Blick ab und starrte ins Nichts. »Du verstehst mich ja nicht. Das hatte ich vergessen. Du bist sicher hungrig. Ich habe dir etwas zu essen gebracht. Zuerst möchte ich mir noch einmal deine Wunden ansehen.«
Mit ausdrucksloser Miene beobachtete er, wie sie nach einem Tiegel griff, der neben einer Schale mit dampfender Suppe und einem Becher auf dem Tablett stand. »Dreh dich um.« Als er nicht reagierte, griff sie nach seinen Schultern und drehte ihn sanft herum, ehe sie ihn von seinem Hemd befreite. Halbherzig versuchte er, sich ihrer Behandlung zu entziehen und zuckte zusammen, als sie begann die Paste aufzutragen.
»Halt still. Es wird gleich besser.«
Alasdair starrte an die Wand, bemüht den verlockenden Duft der Suppe zu ignorieren, der ihm immer stärker in die Nase stieg.
»Hast du einen Namen?« Schweigen antwortete ihr. »Ich bin Sessany. Kannst du mich denn gar nicht verstehen?« Er glaubte ihre Blicke in seinem Rücken zu spüren und zwang sich, reglos zu verharren. Als sie fertig war, verschloss sie den Tiegel und stand auf. Er wandte sich zu ihr um. Ihr Blick blieb an der frischen Narbe hängen, die sich quer über seine rechte Seite zog. Die Wunde war inzwischen verheilt, auch wenn der Schmerz jener Nacht niemals vergehen würde.