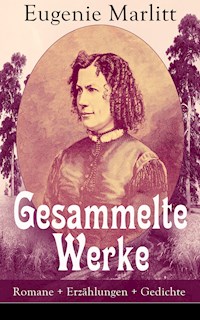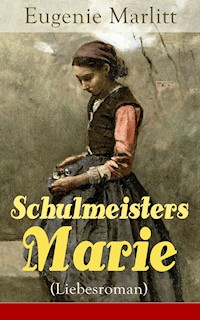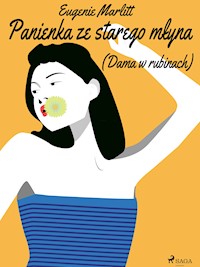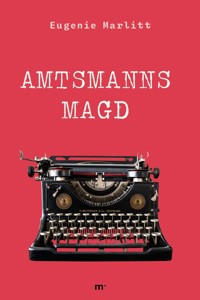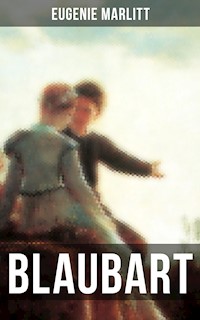Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Musaicum Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In "Im Schillingshof: Liebesroman" von Eugenie Marlitt tauchen wir ein in die Welt des 19. Jahrhunderts und begleiten die junge Protagonistin Christine durch eine turbulente Liebesgeschichte. Marlitts literarischer Stil zeichnet sich durch detailreiche Beschreibungen, feinen Humor und eine ausdrucksstarke Darstellung der Protagonisten aus. Das Buch reflektiert die gesellschaftlichen Normen und Werte der damaligen Zeit und hebt sich durch seine realistische Darstellung von anderen Liebesromanen des 19. Jahrhunderts ab. Eugenie Marlitt, eine der bekanntesten deutschen Schriftstellerinnen des 19. Jahrhunderts, war eine Pionierin des Gesellschaftsromans. Als Frau in einer von Männern dominierten Literaturszene setzte sie sich mit ihren Werken für die Rechte von Frauen ein und thematisierte soziale Missstände. "Im Schillingshof" spiegelt Marlitts Engagement für Gleichberechtigung und ihre kritische Auseinandersetzung mit der damaligen Gesellschaft wider. "Im Schillingshof: Liebesroman" ist ein fesselnder Roman, der nicht nur Liebhaber klassischer Literatur ansprechen wird. Die authentischen Charaktere, die detaillierte Darstellung der Zeit und die mitreißende Handlung machen das Buch zu einem empfehlenswerten Leseerlebnis, das sowohl unterhält als auch zum Nachdenken anregt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 665
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Im Schillingshof: Liebesroman
Inhaltsverzeichnis
1.
Der »Schillingshof« hieß es, das herrliche, alte Haus, nahe der Benediktinerkirche; im Volksmund aber war und blieb es »das Säulenhaus«, ob auch die Neuzeit ganze Straßenfronten mit Säulen und Säulchen schmückte und so eigentlich die Auszeichnung aufhob. Ein Benediktinermönch hatte das Haus gebaut.
In jenen Zeiten, wo die Beherbergung von Reisenden noch kein städtisches Gewerbe war, nahmen sich die Klöster und Ritterburgen der durchziehenden Fremden an. Mancher Klosterorden errichtete zu diesem Zweck ein Hospiz auf seinem Grund und Boden – so war das Säulenhaus entstanden. – Das Kloster war ein sehr reiches, und Bruder Ambrosius, der Baumeister und Bildhauer, war schönheitstrunken von Italien heraufgekommen; zudem galt es, ein standeswürdiges Unterkommen zu schaffen für gefürstete Häupter und hochgräfliche Herren, die mit Ehegemahl und Gefolge oft des Weges daherzogen und gern an das Klostertor klopften – dies alles machte, daß sich neben dem plumpen Giebelbau des Bruderhauses jene köstliche Fassade erhob, die auf einem hallenartigen, weitgeschwungenen Säulengang ein Obergeschoß mit halbrundbogigen Fenstern trug, und in jeder Bogenfüllung, auf Konsolen und Friesen, und auf den Pfosten der mächtigen Rundbogentür, innerhalb der offenen Halle, den bewunderungswürdigen Schmus einer ganzen steinernen Vegetation zeigte. Während der Oberbau zu beiden Seiten zurücktrat, lief das Erdgeschoß mit feinem Säulengang um je drei Fenster flügelartig weiter; so stieß nur dieses untere Stockwerk hart an die südliche Klosterwand und bildete, durch Steinbrüstungen gekrönt, zwei luftige Seitenterrassen, auf die verschiedene Türen des Obergeschosses mündeten.
Was dieser Fremdling auf deutschem Boden in jenen versunkenen Zeiten erlebt und gesehen, davon wußte das neunzehnte Jahrhundert nur wenig. Damals hatte das Benediktinerkloster außerhalb der Stadt, im freien Felde gelegen; nur einige Lehmhütten hatten sich wie versprengt am gegenüberliegenden Saum der Heerstraße in das Strauchwerk geduckt und kaum die Holzladen ihrer Fensterlöcher gelüftet, wenn abends Pferdegetrappel und herrische Stimmen vor der gewaltigen, die Klostergebäude umschließenden Mauer laut geworden waren.
Der grell auftauchende Flammenschein der Pechfackeln im Hofraum, der höllische Lärm, den die tobenden Klosterhunde und die Reisigen mit ihren wiehernden und stampfenden Rossen verursachten, erlosch nach kurzem wie ein toller Spuk, und die Hüttenbewohner krochen neidisch in ihre Höhlen zurück; denn so viel wußten sie, daß das Kloster einen herrlichen Wein schenkte und seine Schlote Tag und Nacht dampften ... Drin aber, hinter den teppichverhangenen Fenstern der weiten Säle flimmerte das Licht dicker Wachskerzen von den eisernen Reifen der Deckenleuchter, und die hochgeborenen Herren und Frauen, der beengenden und verhüllenden Reitertracht ledig, sammelten sich um die langen, mit dem fürstlich reichen Silbergeschirr des Abtes beladenen Eichentische. Da kreisten die Becher oft bis weit über Mitternacht, die Würfel klirrten, und die fahrenden Spielleute, denen drüben im Bruderhause zur nächtlichen Rast Stroh auf die Steinfliesen geschüttet morden war, durften kommen und aufspielen, solange die müden Finger und Kehlen aushielten.
Sie kamen oft von verschiedenen Seiten her, die großen und mächtigen Herren, um in dem durch Klosterschutz gefeiten Säulenhause geheime Vereinbarungen zu treffen: manche wichtige Urkunde aus jenen Zeiten bezeichnet das Benediktinerkloster als den Ort ihres Ursprunges. Und die Herren Benediktiner hatten sich nicht schlecht dabei gestanden. Sie waren stets, ohne im Säulenhaus gegenwärtig zu sein, lediglich vermöge ihres Scharfsinnes, ihrer feinen Kombinationsgabe, den geheimen Verhandlungen ihrer Gäste gefolgt, und dieses oft an ein Wunder grenzende Wissen hatte ihnen einen unberechenbaren Einfluß in die Hände gespielt.
Später, zu Ende der Reformation, wanderten die Klosterbrüder aus. Das Säulenhaus und den größeren Teil von Wald, Wiesen und Feld brachte das Geschlecht derer von Schilling an sich; die kleinere Hälfte aber und das Kloster selbst mit seinen Wirtschaftsgebäuden kam in die Hände des Tuchwebers Wolfram. Die von Schilling brachen die hohe Mauer weg, die das Säulenhaus von der Heerstraße trennte, und verlegten sie, so hoch sie war, zwischen ihr Grundstück und das des Tuchwebers, denn dazumal war eine freundnachbarliche Gemeinschaft undenkbar ... Die Lehmhütten verschwanden; der betriebsame Geist der Stadt sprengte die enggewordenen Stadtmauern; er schob neue Straßen wie Fangarme in das Feld hinaus, und nach Verlauf kaum eines Jahrhunderts lag das Säulenhaus inmitten eines stattlichen, volksbelebten Stadtviertels, wie ein wunderseltenes Goldkäferlein, verstrickt in die Netzfäden einer fleißigen Spinne.
Und die Herren von Schilling waren mit diesem neuen Geist gegangen. Ein Nürnberger Meister hatte ihnen an Stelle der niedergerissenen Mauer, die Straße entlang ein kunstreiches Eisengitter, klar und durchsichtig wie ein brabanter Spitzenmuster aufgestellt; den ehemaligen grünen Anger dahinter durchkreuzten schmale, mit farbigem Sand bestreute Gänge und teilten ihn in einzelne Rasenstücke und Blumenbeete voll Rosen, Salbei und bunter Nelken; vor der Säulenhalle sprangen Brunnen aus einem hochgetürmten, schönen, schneeweißen Steinabbild, und seitwärts schatteten seltene Zierbäume. Die Tuchweber nebenan aber waren viel konservativer, als die Ritterlichen im Schillingshof. Sie rissen nicht nieder und bauten nicht; sie stützten nur, und wo ein Stein wankte, da wurde er mit ängstlicher Sorgfalt wieder eingekittet; deshalb hatte das »Klostergut«, wie sie ihr Besitztum fort und fort benannten, nach fast drei Jahrhunderten noch vollkommen das Aussehen, das ihm die Mönche gegeben. Altersdunkel zwar, in der gewaltigen Balkenlage ein wenig verschoben, und scheinbar tiefer in die Erde eingesunken, hob sich der Giebelbau ungeschlacht und finster wie immer hinter der Straßenmauer. Und diese Mauer war eitel Flickwerk, wie das eichene Bohlengefüge in ihrem hochgewölbten Torbogen, wie das Pförtchen zur Seite der großen Einfahrt, an welchem einst die müden Fußgänger um Einlaß geläutet, und das heute noch wie damals in denselben Lauten rasselte und schnarrte, wenn um sechs Uhr abends die Leute aus allen Gassen und Straßen herbeikamen, um, ebenfalls wie seit alten, alten Zeiten, die Milch bei den ehemaligen Tuchwebern zu holen; denn die Wolframs hatten sehr bald den Webstuhl mit der Ackerwirtschaft vertauscht, und emsig, wo sie irgend konnten, Grund und Boden und Triftgerechtigkeiten der Stadtflur käuflich an sich gezogen. Sie kargten und sparten, und zäh, hartköpfig und beständig von Charakter waren sie alle, wie sie nacheinander kamen. Die Männer scheuten sich nicht, hinter dem Pflug herzugehen, und die Hausfrauen, eine nach der anderen, standen zur Abendzeit pünktlich auf ihrem Posten am Milchschanktisch, auf daß kein Pfennig durch ungetreue Mägde in fremde Hand komme. Und sie taten recht, die Wolframs, wie es sich im Lauf der Zeiten auswies. Ihr Reichtum wuchs, und mit ihm das Ansehen; sie wurden fast ohne Ausnahme in den Rat der Stadt gewählt, und endlich nach abermals hundert Jahren kam auch die Stunde, wo die Herren von Schilling es für angezeigt hielten, zu bemerken, daß sie einen Nachbar hatten. Von da an entspann sich ein freundlicher Verkehr. Die hohe Mauer blieb zwar stehen – sie hatte sich inzwischen vom Schillingshofe her mit dem undurchdringlichen Geflecht einer köstlichen Weinrebensorte bedeckt, und drüben umklammerte sie dunkler Efeu mit zähen Armen – aber der Geist einer humaneren Zeit schlüpfte über sie weg; die von Schilling fanden es nicht mehr unter ihrer Würde, einen kleinen Wolfram über das Taufbecken zu halten, und wenn sie den nachbarlichen Senator zu Tische luden, so fiel es ihm nicht ein, besondere Ehre darin zu sehen. Ja, es trat die Macht des Wechsels allmählich, im Laufe des letzten Jahrhunderts, so hart an beide Geschlechter heran, daß, während die einst mißachteten Tuchweber mit Patriziernimbus vor ihren Truhen voll verbrieften, reichen Besitztums standen, die Kästen derer von Schilling sich in erschreckender Weise leerten. Sie hatten zu vornehm, in stolzer Üppigkeit gehaust, und der letzte Senior der Familie, der Freiherr Krafft von Schilling, stand bereits voll zitternder Angst mit einem Fuße über dem Abgrund des selbstverschuldeten Unterganges, als der Vetter starb, dem sie Hab und Gut verpfändet hatten. Und das war die Rettung des sinkenden Geschlechtes – der einzige Sohn des Freiherrn heiratete die einzige Tochter des Verstorbenen und mit ihr kamen alle Güter an das Schillingsche Haus zurück. Das geschah im Jahre 1860.
In dieses rettende Jahr fiel aber auch ein Ereignis, das im Nachbarhaus« mit einem wahren Jubel begrüßt wurde. Durch mehrere Generationen hindurch hatte die Familie Wolfram immer nur auf zwei Augen gestanden; seit fünfzig Jahren aber war kein männlicher Erbe auf dem Klostergut geboren worden. Der Letzte des Stammes, der Rat und Oberbürgermeister der Stadt, Franz Wolfram, hatte sich infolgedessen zum finsteren wortkargen Eheherrn umgewandelt, dem der Groll sichtlich am Herzen nagte. Fünf Töchterlein hatten nacheinander das Licht der Welt erblickt, alle so »unausstehlich« flachshaarig wie die Mutter, alle mit der Neigung im kleinen, bangen Kerzen, sich vor dem gestrengen Vater in dunkle Winkel zu verkriechen, bis sie nach kurzem Dasein die hellockigen Köpfchen erlöst und friedfertig auf das weiße Kissen des Totenschreins betten durften... Die Frau Rätin waltete befangen und schweigend, wie eine Schuldbewußte, neben dem verbitterten Eheherrn; nur sein näherkommender Schritt jagte ihr stets die Flamme heftigen Erschreckens über das blasse Gesicht, sonst glich sie einem wandelnden Steinbild mit ihrem stillen, freud- und klaglosen Wesen.
Und nun, sieben Jahre nach dem Tode ihres letzten Töchterleins, lag sie wieder droben in der Hinterstube, unter dem schneeweißen Betthimmel; draußen zogen schwere, dunkle Wolken vorüber, aber ein einzelner Sonnenblitz durchzuckte sie und spielte über der Stirne der blassen Dulderin.
»Ein Sohn!« sagte feierlich die alte Wartfrau.
»Ein Wolfram!« brach es wie ein Jubelschrei von den Lippen des Rates. Er warf zwei Goldstücke in das Bad, das die braunen Glieder des Kindes benetzte, dann trat er an das Bett und küßte zum erstenmal nach zwanzigjähriger Ehe die Hand der Frau, die seinem Sohne das Leben gegeben.
Dann kam ein Tag, wie ihn das Klostergut wohl noch nicht gesehen hatte.
Es war nicht die Art der Wolframs, mit Hab und Gut zu prunken; sie entzogen im Gegenteil ihre Silber- und Leinenschätze, das Familiengeschmeide, die alten, kostbaren Weine in ihren Kellern sorgfältig der Öffentlichkeit – ihnen genügte es, sich im Besitze zu wissen; in den Nachmittags- und Abendstunden jenes Tages indessen breitete sich in der sogenannten großen Stube, dem ehemaligen Refektorium der Mönche, der öffentlich verleugnete Glanz des Hauses in seinem ganzen Umfang aus. Auf der mächtigen, damastgedeckten Speisetafel funkelte das Jahrhunderte hindurch aufgespeicherte Silbergerät, die Schalen und Schüsseln, Kannen und schlanken Becher, die riesigen Salzfässer und rings an den braunen, holzgeschnitzten Wänden vielarmige Leuchter, alles gediegen, in herrlich getriebener Arbeit. Und in der kleineren Stube nebenan stand der Tauftisch. Die Wolframs waren keine Blumenfreunde; nie hatte sich ein Blumentopf auf den Fenstersimsen breitmachen dürfen, und im Obst- und Gemüsegarten hinter den Wirtschaftsgebäuden blühten kaum einige wilde Rosensträucher, die sich freiwillig angesiedelt, in den Ecken, – heute aber umstand eine duftende, den Treibhäusern der Stadt entliehene Orangerie den weißbehangenen Tisch mit dem Taufgerät; den Täufling umrauschte das alte Familienerbstück, eine Taufschleppe von dickem, apfelgrünem Atlas, und auf dem dunkelhaarigen Köpfchen saß die dazu gehörige altfränkische Mütze mit einer kaffeegelben Mechelner Spitzengarnitur und Stickereien von indischen Staubperlen.
Die alte Wartfrau saß derweil droben in der Wochenstube am Bett und erzählte der Frau Rätin von der Pracht drunten, von der stolzen Gevatterschaft in Samt und Seide, von dem Weine, den man wie Gewürz durchs ganze Haus röche, und daß das »Ratssöhnchen« wie ein Prinz unter Rosen- und Myrtenbäumen getauft worden sei.
Das vergrämte Gesicht der Wöchnerin lächelte in bitterer Wehmut; ihren kleinen Mädchen hatte die grüne Taufschleppe nicht gebührt – sie war von der Urahne nur für die männlichen Nachkommen gestiftet worden –, es hatten auch keine Rosen und Myrten um das Taufbecken gestanden, und der Silberschatz des Hauses war unter seinen schützenden Lederdecken verblieben... Auf den Wangen der blassen Frau begannen auch Rosen aufzublühen, dunkle Fieberrosen, und während drunten die Gläser klangen zum Wohl und Gedeihen des heißersehnten Stammhalters, teilten sich droben die weißen Bettvorhänge, und fünf Kinder schlüpften herein – sie waren alle da bei der Mutter, die kleinen Mädchen, und sie herzte sie heiß, inbrünstig und spielte mit ihnen Tag und Nacht in sel'ger Mutterlust, und die Ärzte standen ratlos um die unaufhörlich flüsternde Frau, bis sie mit müdem, seligem Lächeln den Kopf in das Kissen drückte und einschlief für immer. – – – –
Ihr Heimgang hinterließ keine bemerkenswerte Lücke. Der kleine Veit hatte eine Amme, und wenige Stunden nach dem letzten Atemzuge der Hausfrau kam die Schwester des Rates, die schöne, bitterernste Frau, aus ihrem Wohngelaß im oberen Stockwerk herab, um die Schlüssel und mit ihnen die Leitung des verwaisten Hauswesens zu übernehmen.
Sie war eine echte Wolfram in ihrem ganzen Tun und Wesen, wie in der äußeren Erscheinung, an der sechsundvierzig Lebensjahre fast spurlos vorübergeglitten waren. Nur einmal in ihrem Leben hatte sie die Leidenschaft über die anerzogenen strengen Grundsätze siegen lassen, und das war ihr »folgerichtig« zum Unheil ausgeschlagen. Sie war neben dem Rat die einzige Miterbin des Wolframschen Besitztums und dabei ein selten schönes Mädchen gewesen. Im Schillingshofe hatte man das Nachbarkind wie eine eigene Tochter gehätschelt, und dort hatte sie auch den Major Lucian aus Königsberg kennen gelernt, mit dem sie sich auch verheiratete, allen Ermahnungen des Bruders, ja, der eigenen inneren Warnstimme zum Trotz... Und sie hatten in der Tat zusammengepaßt wie Wasser und Feuer, die herbe, in ihre Familientraditionen verbissene Wolframsnatur und der elegante, leichtlebige Offizier. Sie hatte darauf bestanden, ihn in ihre Lebensgewohnheiten zu zwingen, und er war »dem Spießbürgertum« mit scharfem Spott entschlüpft, wo er nur konnte. Das hatte zu bösen Auseinandersetzungen geführt, und eines Abends war die Majorin, ihr fünfjähriges Söhnchen an der Hand, aus Königsberg zurückgekehrt – sie war heimlich abgereist, um fortan auf dem Klostergut zu bleiben...
Der kleine Felix hatte den Kopf in ihren Reisemantel gedrückt, als sie ihn an jenem Abend durch ihr Vaterhaus geführt. Die Treppe, die in die verlassene Stille der oberen Stockwerke führte, mit ihrem fratzenhaft geschnitzten Geländer und ihren kreischenden Stufen voll ausgetretener Astknorren, die lagernde Dämmerung in den klaftertiefen Türbogen, und in den Schiebefenstern die bleigefaßten, glanzlosen Scheiben, an denen aufgescheuchte Nachtmotten lautlos taumelten, und durch die das Abendsonnenlicht gelb und träge wie Öl auf das zersprungene Estrich des Vorsaales floß – das war dem Knaben spukhaft erschienen, wie das Menschenfresserhaus im Walde ... Und das schlanke, feingliedrige Kind in seinem blauen Samtröckchen, seinem glänzenden, goldgelben Gelock war auch wie verirrt gekommen – sie bringe ihm einen buntscheckigen Kolibri in das alte Falkennest, hatte ihr Bruder, der Rat, finster und mit scheelem Blick gesagt.
Fremden Blutes war und blieb der kleine Entführte auch. Die kühle Luft des Klostergutes blies ihm umsonst gegen die Idealgestalten in Kopf und Herzen – er war eine poetische, warmblütige Natur wie sein Vater ... Der verlassene Mann in Königsberg hatte übrigens alles aufgeboten, seinen Knaben wieder in die Hand zu bekommen; allein an der juristischen Meisterschaft des Herrn Rat Wolfram waren alle Versuche gescheitert – die geschiedene Frau war im Besitz des Kindes verblieben. Infolgedessen hatte Major Lucian seinen Abschied genommen; er war aus Königsberg verschwunden und nie hatte man erfahren, wohin er sich gewendet.
Seitdem bewohnte die Majorin wieder, wie in ihren Mädchenjahren, das große, nach der Straße gelegene Giebelzimmer. Sie paßte mit Leib und Seele zwischen diese einfach gestrichenen Wände, vor deren tief eingelassenen Schränken breite, braungebeizte Flügeltüren lagen; sie saß wie vordem auf dem steiflehnigen Lederstuhl in der tiefen Fensterecke und schlief hinter dem dickfaltigen härenen Türvorhang der anstoßenden Kammer, zu welchem einst ihre Großmutter die groben Fäden eigenhändig gesponnen... Den Schillingshof aber hatte sie nie wieder betreten – sie floh jede Erinnerung an ihren geschiedenen Mann, wie einen mörderischen Feind. Der kleine Felix dagegen war sehr bald heimisch drüben geworden. Der einzige Sohn des Freiherrn Klafft von Schilling war sein Altersgenosse. Beide Knaben hatten sich vom ersten Augenblick an zärtlich geliebt, und die Majorin war mit diesem Verkehr einverstanden gewesen, jedoch nur unter der ausdrücklichen Bedingung, daß ihr Kind nie mit einem Wort an seinen Vater erinnert werde.
Später waren die jungen Leute auch Studiengenossen in Berlin gewesen. Sie hatten beide Jura studiert. Arnold von Schilling hatte die Staatslaufbahn in Aussicht genommen, und Felix Lucian sollte, ganz in die Fußstapfen seines Onkels tretend, anfänglich ein städtisches Amt bekleiden und später das Klostergut übernehmen; denn seit auch die letzte der kleinen, flachshaarigen Cousinen gestorben, hatte ihn der Rat zu seinem Erben und Nachfolger bestimmt, vorausgesetzt, daß er seinem väterlichen Namen den Namen Wolfram anfüge. Da änderte, wie bereits erwähnt, das Jahr 1860 alle Familienverhältnisse im Schillingshof und Klostergut – Arnold von Schilling kam heim, um auf die Bitten seines kränkelnden Vaters hin mit der Hand seiner Cousine die Schillingschen Güter wieder zu übernehmen, und auf dem Klostergute blies der Spätling, der kleine Veit Wolfram, mit seinem schwachen Lebensatem die Erbansprüche seines Vetters Felix über den Haufen ...
2.
Die Frau Rätin Wolfram war an einem schneestöbernden Aprilmorgen im Familienbegräbnis beigesetzt worden. An jenem Tage hatte Felix Lucian nur auf wenige Stunden in die Heimat eilen können, um der verstorbenen Tante das letzte Geleit zu geben. Heute nun, nach zwei Monaten, wo der Syringenduft der ersten Junitage die Lüfte erfüllte und der abgeschüttelte Schnee der Baumblüte weiß auf dem Rasen lag, kam er wieder auf das Klostergut zu einer mehrtägigen Erholungszeit, wie er seiner Mutter geschrieben hatte.
In dem weiten Hausflur, den er nachmittags betrat, hatte die tote Hausfrau die letzte Rast gehalten. Noch war es ihm, als müsse Weihrauchduft das Deckengebälk bläulich verschleiern, und der Geruch der Buchsbaumgirlanden, zwischen denen die schlankhingestreckte Frau mit dem schlichten Flachshaar an den Schläfen so friedsam gelegen, ihm durchdringend entgegengeschlagen. Aber es waren heute nur wirbelnde Stäubchen, die in einem Lichtreflex an der Decke spielten; aus der offenen Küche quoll der Duft schmorenden Geflügels, und am Milchschanktische stand seine Mutter und zählte Eier in den Korb der Magd, die nach altem Brauch wöchentlich zweimal mit Eiern und frischgeschlagener Butter die Runde bei bevorzugten Stadtkunden machen mußte.
Einen Moment erstrahlten die Augen der Majorin wie unbewacht in nicht verhehltem Mutterstolz, als der schöne, hochgewachsene Jüngling auf sie zuschritt; aber sie hielt in jeder Hand fünf Eier und reichte ihm so behutsam über die Schulter hinweg die Wange zum Kuß. – »Gehe einstweilen hinauf, Felix!« sagte sie hastig, in der Besorgnis, sich zu verzählen, oder ein Ei zu zerbrechen.
Er zog schleunig die Arme zurück, die er um ihre Schultern geschlungen, und stieg die Treppe hinauf. Von der Wohnstube her klang ihm plötzlich Kindergeschrei nach – der neue Erbherr des Klostergutes schrie häßlich und boshaft auf wie eine junge Katze. Dazu krähten die Hähne im Hinterhof, und oben über den Vorsaal schlich der riesige, fette Hauskater. Er kam vom Kornspeicher, von der Mäusejagd und rieb und drückte sich behaglich an der eleganten Fußbekleidung des Heraufsteigenden hin – der junge Mann schleuderte ihn weit von sich und stampfte voll Abscheu mit den attackierten Füßen, als schüttele er Schnee ab.
Im Zimmer der Majorin standen die Fenster offen, und die weiche Frühlingsluft strömte herein; aber nicht sie trug den köstlichen Veilchenduft im Atem, der die ganze Stube erfüllte – er kam aus den offenen Flügeltüren eines Wandschrankes. Wie Silberschein flimmerte es in diesen tiefen Fächern; so glänzend türmte sich das Leinenzeug aufeinander; und zwischen diesen Paketen dorrten Tausende von Veilchenleichen. Nie hatte der kleine Knabe der Majorin ein Veilchensträußchen zu seiner Augenweide in ein Glas Wasser stellen dürfen – es stand ja nur im Wege und konnte umgeschüttet werden – wohl aber mußte er die kleinen Kelche zur Verherrlichung der Leinenschätze von den Stielen zupfen. Die weißen Lagen, mit denen die Mutter immer einen förmlichen Kultus getrieben, waren ihm deshalb stets verhaßt gewesen – er warf auch jetzt einen finsteren Blick nach dem Schranke.
Die Majorin war augenscheinlich beim Revidieren gestört worden; auf dem breitbeinigen Ahorntische im Fensterbogen lag noch das Buch, in das sie ihre Notizen zu machen pflegte. Felix kannte diese Hefte voll der verschiedenartigsten Rubriken sehr gut, aber die aufgeschlagene Blattseite hier war ihm neu in ihrer Bezeichnung. »Mitgabe an Hauswäsche für meinen Sohn Felix« stand obenan ... Sein eigener, künftiger Hausstand! – Er wurde rot wie ein Mädchen bei dieser Vorstellung ... Diese Dutzende von Gedecken, Handtüchern, Bettbezügen reihten sich breit und wichtig aneinander, als seien sie die erste Grundbedingung des künftigen Familienglückes ... Und dieses ernsthafte, langweilige Register sollte in dem übermütigsten, tollsten Lockenkopfe haften, der je auf weißen Mädchenschultern gesessen? – »O Lucile, wie würdest du lachen!« flüsterte er und lachte selbst in sich hinein.
Mechanisch ließ er die Blätter durch die Finger laufen. Hier, in dieser »Zinseneinnahme« summierten sich Tausende und Tausende. Welcher Reichtum! Und dabei dieses unbeirrte Sammeln und Sparen, diese Angst, daß mit einem zerschlagenen Ei ein paar Pfennige verloren gehen könnten! – Der junge Mann stieß das Heft wie im Ekel fort, und mit beiden Händen ungeduldig durch das reiche Blondhaar, fahrend, trat er an das Fenster. Mit seiner vornehmen Erscheinung, dem leisen Hauch feinsten Odeurs, der sie umschwebte, mit den ungesucht eleganten Manieren stand er auch heute so fremd zu dem »alten Falkennest«, wie die seinen Handschuhe, die er lässig abgestreift und hingeworfen, auf den plumpfüßigen, weißen Ahorntisch, die glänzenden Lackstiefel auf den groben, ausgetretenen Dielenboden paßten.
Er drückte die Stirn an das Fensterkreuz und sah hinaus. Wie ein Anachronismus steckte das Klosterhaus zwischen den geschmückten Neubauten. Jenseits der Straßenmauer lief jetzt die eleganteste, mit rotblühenden Kastanien besetzte Promenade der Stadt hin. Er schämte sich, daß die seine Welt täglich an dem geflickten Mauerwerk vorüber mußte; er fühlte sich gedemütigt angesichts des gegenüberliegenden, schloßartigen Hauses, von dessen bronzeumgitterten Balkons man den Hof übersehen konnte, der zwischen dem Klosterhaus und der Mauer lag. Wohl waren es vier herrliche, alte Lindenwipfel, die seine Mitte füllten – sie strotzten auch heuer wieder in maienhaftem Grün, von keinem dorrenden Ästlein entstellt –, allem die altehrwürdigen Steinsitze zu ihren Füßen und der Porphyrtrog des Laufbrunnens, den sie beschatteten, waren garniert mit dem frischgescheuerten Holzgerät der Milchkammer... Dazu der Lärm vom Hofe... Eben wurde frischer Klee eingefahren. Der Knecht fluchte über die enge Einfahrt des Torweges und hieb auf die Pferde ein; die barfüßige Stallmagd scheuchte zwei störrige Kälber, die sich in den Vorhof verlaufen, schimpfend aus dem Wege, Taubenschwärme flogen auf, das andere Federvieh stob schreiend auseinander – »Bauernwirtschaft!« murmelte Felix zwischen den Zähnen und wandte das beleidigte Auge zur Seite.
Dort breitete sich das schöne Erdgeschoß des Schillingshofes aus; und er atmete wie erlöst auf – dort war er ja immer heimischer gewesen, als auf dem Klostergute. Über die efeubewachsene Mauer hinweg sah er allerdings nur ein Stück des Rasenspiegels, in dessen Mitte die Wasser vor dem Säulenhause sprangen; er sah auch nur beim Hinausbiegen seitwärts einen Schein der Spiegelscheiben zwischen den Steinornamenten der Rundbogen blinken; aber dieser trennenden Mauer gegenüber schlossen drei Reihen prächtiger Platanen den Schillingshof von dem jenseitigen Nachbargrundstück ab. Sie konnte er vollkommen überblicken – sie liefen als Doppelallee vom Straßengitter aus neben der Südseite des Säulenhauses hin, tief in den eigentlichen Garten hinein. Diese herrliche Baumhalle war einst der Haupttummelplatz für ihn und seinen kleinen Freund Arnold gewesen; sie behütete treulich die grüne Dämmerung, die frische Kühle drunten, und für den Freiherrn Krafft war sie an heißen Sommertagen eine Art Salon; er empfing da Besuche, hielt seine Siesta und trank den Nachmittagskaffee unter den Bäumen.
Auch jetzt stand die Kaffeemaschine auf dem Tisch, aber nicht die wohlbekannte messingene – sie hatte einer silbernen Platz gemacht. Es gruppierte sich überhaupt viel Silbergeschirr dort, auch kleine, mit Likör gefüllte Kristallkaraffen funkelten dazwischen – so war der Kaffeetisch früher nie besetzt gewesen. Damals hatte man auch auf weißgestrichenen Gartenbänken von Holz gesessen,– heute stand eine Menge eleganter, gußeiserner Möbel zwischen den Bäumen; Schlummerrollen und farbenglänzende Kissen lagen umher, und aufgestellte, reichdekorierte Wandschirme bildeten behagliche, vor dem Zugwind geschützte Plauderwinkel.
Das Fremdartigste aber war die Dame, die in diesem Augenblick neben dem Säulenhaus hervorkam – sie ging, offenbar wartend, langsam auf und ab ... Arnolds Mutter war früh gestorben, eine Schwester hatte er nie gehabt, darum war das weibliche Element, soweit Felix zurückdenken konnte, immer nur durch die gute, dicke Wirtschaftsmamsell vertreten gewesen. Nun schimmerte eine blauglitzernde Seidenschleppe durch den Alleeschatten, und Frauengeist und Frauenwille durften nach fast zwanzig Jahren wieder neben dem Regiment des alten Freiherrn ebenbürtig im Schillingshofe walten.
Als Felix vor zwei Monaten zur Beisetzung der Tante auf dem Klostergute gewesen war, da hatte zur selben Zeit auch Arnolds Hochzeit in Koblenz stattgefunden – der Freund hatte vorher nur kurz und trocken angezeigt, daß er »das lange Mädchen«, die Koblenzer Cousine, heirate ... Das war sie nun, die junge Frau, die neue Herrin des Schillingshofes, eine überschlanke Gestalt mit schmalen Schultern, an Brust und Rücken flach und dürftig, vornübergeneigt, wie die meisten großen Leute, und doch vornehm, sichtlich eine Dame von Stande in jeder ihrer lässig schleppenden Bewegungen. Das Gesicht konnte er nicht voll erfassen, in scharfer Profilstellung erschienen ihm die Züge langgestreckt, von englischem Typus, und blaß angehaucht; doch besaß die junge Frau einen herrlichen Schmuck in dem reichen, hellblonden Haar, das zwar elegant, aber so locker aufgesteckt war, als schmerze und beschwere diesen jungen Kopf peinlich jede Haarnadel. Sie sah öfter mit leisen Zeichen der Ungeduld abwechselnd nach den Fenstern und der Tür unter der Säulenhalle und ordnete und rückte wiederholt an den Tassen und Kuchenkörben.
Dann kam eine junge Person im weißen Latzschürzchen, augenscheinlich die Kammerjungfer, aus dem Hause. Sie legte ihrer Gebieterin einen weichen Schal um die Schultern und zog ihr Handschuhe an. Und die Dame stand da wie ein Automat; sie hielt die langen, schlanken Hände unbeweglich hingestreckt, bis jedes Knöpfchen geschlossen war; sie regte sich nicht, als das Mädchen vor ihr niederkniete und eine aufgesprungene Spange an dem farbigen Schuh wieder befestigte. Sie sprach auch nicht und zog nur schließlich, trotz der durchsonnten, köstlich warmen Juniluft, fröstelnd den Schal über der Brust zusammen. »Verwöhnt und nervös!« dachte Felix, während sie sich unmutig in die mit roten Kissen gepolsterte Ecke einer Bank sinken ließ.
Inzwischen war Adam, der langjährige Diener des alten Freiherrn Krafft, aus der Tür des Säulenhauses gekommen. Er wohnte im Schillingshofe, war Witwer und hatte sein einziges Kind, ein zehnjähriges Mädchen, bei sich. Das führte er jetzt an der Hand.
Die Kammerjungfer ging mit einem schnippischen Achselzucken an ihm vorüber, und die Dame auf der Bank sah nicht, daß er grüßte. Felix hatte den stillen, ernsthaften Diener sehr gern, dessen äußere Ruhe und Gelassenheit im Schillingschen Hause sprichwörtlich waren. Deshalb befremdete ihn die aufgeregte Hast, mit welcher der Mann den Rasenplatz umschritt und den Schillingshof verließ, um nach wenigen Minuten in den Hof des Klostergutes einzutreten. Sein kleines Mädchen schrie ängstlich auf und klammerte sich an ihn fest – ein großer Puter lief zornig kollernd auf es zu, als habe er die Absicht, ihm das rote Röckchen vom Leibe zu reißen.
Der Mann scheuchte das erboste Tier fort und sprach beruhigend auf das Kind hinein; aber das geschah in atemloser Aufregung, und die Wangen glühten ihm, als sei er betrunken.
Felix sah nur noch flüchtig, wie der alte Freiherr, auf den Arm seines Sohnes gestützt, in die Platanenallee trat und sich mit einer ritterlichen Handbewegung neben seiner Schwiegertochter niederließ – ein Gefühl inniger Teilnahme trieb ihn vom Fenster weg, in den Hausflur hinab. Auf der unteren Treppenwendung blieb er einen Augenblick stehen. Die Magd hatte mit Eierkorb und Buttergelte das Haus verlassen, und seine Mutter zog eben das Geflügel aus der Bratröhre.
»Mein Bruder ist nicht zu Hause, Adam,« sagte sie zu dem Manne, der an der Küchentüre stand. Sie setzte die dampfende Pfanne auf den steinernen Spültisch und trat an die Schwelle. »Ich will doch nicht hoffen, daß Sie ihn noch einmal mit der dummen Geschichte belästigen!«
»Ja, Frau Majorin,« unterbrach er sie höflich aber fest, »ich komme deswegen. Nur der Rat kann mir noch helfen; er weiß am besten, daß ich unschuldig bin – er wird der Wahrheit die Ehre geben.«
»Sie sind nicht bei Sinnen, Mann!« entgegnete die Majorin scharf und streng. »Soll der Herr Rat vielleicht beschwören, daß er mit der Dienerschaft des Herrn von Schilling niemals intim verkehrt hat?«
»Was ist denn das für eine Differenz zwischen hüben und drüben?« fragte Felix erstaunt hinzutretend.
»Ach, Herr Referendar, die Differenz bringt mich um Brot und Ehre!« sagte Adam mit brechender Stimme. Sonst hatte er den jungen Mann bei dessen Heimkunft immer freudestrahlend begrüßt – heute schien er gar nicht zu wissen, daß er ihn lange nicht gesehen hatte. »Eben hat mich mein alter, gnädiger Herr einen Duckmäuser, einen miserablen Spion genannt; er hat mir sein schönes Mundglas nachgeworfen, daß es in tausend Stücken auf dem Erdboden 'rumgeflogen ist –« »Sind ja recht schöne, adlige Manieren,« warf die Majorin trocken ein. Sie hatte währenddessen einen Bratenteller aus dem Küchenschrank genommen und hielt ihn, seine Sauberkeit prüfend, gegen das Fensterlicht.
Ihren Sohn empörte diese unbeirrte Geschäftigkeit angesichts des tief erregten Mannes. Er reichte ihm herzlich die Hand. »Ich begreife nicht, was den alten Herrn dermaßen erbittern mag, daß er sich zu Tätlichkeiten hinreißen läßt,« sagte er teilnehmend. »Noch dazu seinem treuen Adam gegenüber – er hat Sie ja immer vor allen anderen hochgehalten –«
»Nicht wahr, Herr Lucian, das wissen Sie auch? ... Ach, du mein Gott ja – und das ist nun alles aus!« rief der Mann in Jammer ausbrechend, und Tränen füllten seine Augen. »Ich ein Spion – ich! – Ich soll gehorcht haben, der Steinkohlengeschichte wegen, die mich auf der Gotteswelt nichts angeht!«
Felix sah seine Mutter verständnislos und fragend an.
»Er meint das Kohlenlager im kleinen Tale,« berichtigte die Majorin in ihrer wortkargen Weise. »Der Alte im Schillingshofe ist von jeher ein anmaßender Patron gewesen – er denkt, was er ausklügelt, das kann keinem anderen einfallen.«
»Der gnädige Herr hat's ja nicht selber ausgedacht, Frau Majorin,« – sagte Adam – »das ist's ja eben! ... Sehen Sie, Herr Referendar, er sagt immer, die Schillings und die Wolframs hätten seit Jahrhunderten die Klosteräcker am kleinen Tale gehabt, und es war' bis auf den heutigen Tag keinem eingefallen, von dem großen steinigen Grund nebenan, der den Gotters von alten Zeiten her gehört, eine Handbreit auch nur geschenkt zu nehmen, geschweige denn zu laufen – es ist zu elender Boden; der alte Gotter hat ihn oft genug selber verwünscht, er hat's so wenig gedacht, wie seine Nachbarsleute, die jahraus, jahrein daneben gepflügt und geackert haben, daß was Gescheiteres darunter stecken könnte. Da ist aber der fremde Ingenieur hieher versetzt worden, der hat gleich auf den ersten Blick gewußt, daß gerade unter diesem Grunde ein großes Kohlenlager ist – die Kohlen lägen ja geradezu am Tage, hat er gesagt –«
»Ist auch so gewesen,« fiel die Majorin vom Küchentisch herüber ein. Sie entfaltete ein schneeweißes Tellertuch und rieb und wischte an der Bratenschüssel.
»Und weil er mit meinem gnädigen Herrn von früher her bekannt war,« fuhr Adam fort, »so hat er ihm den Vorschlag gemacht, mit ihm zusammen den Grund zu kaufen und ein Kohlenbergwerk anzulegen. Mein Herr ist auch mit tausend Freuden drauf eingegangen, und sie haben alles im geheimen abgemacht. Weil aber gerade zu der Zeit die Hochzeit in Koblenz sein sollte, so ist der Ankauf des Grundstückes bis nach der Reise an den Rhein verschoben worden. Es ist ihnen ja nicht im Traume eingefallen, daß ihnen ein anderer zuvorkommen könnte – es hat ja keine Seele drum gewußt – so haben sie wenigstens gemeint – ja prosit! – wie sie nachher zum alten Gotter gekommen sind, da hat der geflucht und gewettert, er hätte sich überrumpeln lassen, er hätte dem Herrn Rat Wolfram seinen Grund um ein Spottgeld verkauft – und nun seien ja Kohlen die schwere Menge drunter, und der Herr Rat habe schon bei der Behörde auf das Grundstück Mutung eingelegt – ist das nicht die reine Zauberei, Herr Lucian?«
»Ein merkwürdiges Zusammentreffen auf alle Fälle!« rief der junge Mann überrascht.
»Das sage ich auch – es ist eben Glück dabei gewesen, und der Onkel kann nicht dafür, wenn es andere Schlafmützen vergessen,« setzte seine Mutter hinzu. »Übrigens lügt der alte Gotter, wenn er von Überrumpeln und von einem Spottgeld spricht – er hat sich zu Anfang ins Fäustchen gelacht, weil er seinen saueren Wiesengrund so vorteilhaft losgeworden ist.« Das klang so kühl und nüchtern, so fertig und abgeschlossen im Urteil. Dabei war diese Frau doch, trotz ihres bürgerlichen Gebarens, eine vornehme Erscheinung. Sie war schlank und hatte über dem schönen Gesicht nußbraunes Haar, so voll und kräftig, wie das eines jungen Mädchens; und die ehemalige Offiziersfrau vergaß bei allem Bienenfleiß ihre Stellung nicht – sie war sorgfältig frisiert und sehr gut gekleidet, wenn auch der schöne Fuß im festen Lederstiefel steckte, und eine breite blauleinene Küchenschürze augenblicklich das elegant sitzende Kleid umhüllte.
»Da iß, Kind,« sagte sie und reichte dem kleinen Mädchen des Dieners ein Stück Kuchen aus dem Fliegenschranke.
Die Kleine wandte mit finsteren Augen den Kopf weg und wehrte die Gabe ab.
»Die nimmt nichts, Frau Majorin,« sagte ihr Vater weich. »Sie hat heute noch keinen Bissen gegessen – sie kann's nicht sehen, wenn die Leute nicht gut mit mir sind, und heute hat ja das Quälen und Zanken den ganzen Tag nicht aufgehört ... Herr Lucian, ich habe viel ertragen in der letzten Zeit. Der gnädige Herr bleibt dabei, die Sache sei nicht mit rechten Dingen zugegangen, er habe irgend einen ›falschen Christen‹ in seinem Hause, der gehorcht und geklatscht hätte, und weil ich, wie die Herren beisammen saßen, ein paarmal mit Wein ab- und zugegangen bin, da fällt nun auf mich armen Kerl der Verdacht ... Das ewige Sticheln Hab' ich geduldig verbissen, ich wollte ja mein Brot nicht verlieren, Hannchens wegen« – er strich mit der Linken zärtlich über die dicken Haarflechten des Kindes – »aber seit gestern, wo die Leute von nichts anderem sprechen als von dem großen Glück, das der Herr Rat mit seinem Unternehmen hat – es sollen ja Kohlen sein, so gut wie die besten englischen – da kennt sich der gnädige Herr nicht mehr vor Wut und Ärger. Ich wollte nun den Herrn Rat noch einmal ganz gehorsamst bitten, daß er's meinem Herrn begreiflich macht –«
»Das geht nicht, Adam – so viel sollten Sie sich selbst sagen,« unterbrach ihn die Majorin kurz. »Mein Bruder wird sich schwerlich herbeilassen, den Leuten auch noch gütlich zuzusprechen, die ihn heimlich anstünden, weil er ebenso gescheit gewesen ist, wie sie ... Das schlagen Sie sich aus dem Sinn – sehen Sie zu, wie Sie sich selbst heraushelfen.«
Der Mann biß die Zähne zusammen –er kämpfte schwer mit seiner Erbitterung. »Hätt' es freilich wissen sollen,« sagte er achselzuckend mit einem tiefen Seufzer; »zwischen zwei großen Herren fällt so eine armselige Bedientenehre allemal auf den Boden. Da bleibt einem armen Teufel, wie mir, ja wirklich nichts anderes mehr übrig, als – ins Wasser zu gehen!« fuhr es ihm verzweiflungsvoll heraus.
»Ach nein, das tust du nicht, Vater! Gelt, das tust du nicht?« schrie das kleine Mädchen auf.
»Reden Sie doch nicht so gotteslästerlich, Mann!« schalt die Majorin streng und entrüstet.
Felix aber nahm den Kopf des Kindes, das in ein unaufhaltsames Weinen ausbrach, sanft zwischen seine Hände: »Sei still, Herzchen,« beruhigte er, »das tut dein Vater nicht, dazu ist er viel zu brav. Ich will in den Schillingshof gehen und mit dem alten Herrn sprechen, wenn Sie es wünschen, Adam.«
»Ach nein, ich danke Ihnen, Herr Referendar!« versetzte der Mann – »ich weiß, Sie meinen es gut mit mir; aber das macht Ihnen nur Ungelegenheiten, und mir hilft es doch nichts.« Er grüßte, schlang den Arm um sein kleines Mädchen und führte es nach der Haustüre. »Komm her, wir gehen zu deiner Großmutter.«
»Ja, Vater,« sagte das Kind, augenblicklich sein Schluchzen niederkämpfend: »aber du bleibst auch dort, gelt? Du gehst nicht fort in der Nacht, Vater?«
»Nein, mein gutes Hannchen.«
Sie gingen durch den Hof, und der Puter lief wieder auf das Rotröckchen zu; aber die Kleine beachtete ihn nicht; ihre Füßchen suchten Schritt mit dem Vater zu halten, wobei sie weit vorgebogen ihm beweglich unter das Gesicht sah – sie traute seiner mechanisch gesprochenen Versicherung nicht. »Ich schlafe die ganze Nacht nicht, paß auf!« drohte sie mit ihrem angstbebenden Stimmchen.– »Ich sehe es, wenn du fortgehst!« – Und als die Hoftüre längst hinter ihnen zugefallen war, da hörte man noch über die Mauer her die unsäglich angstvolle, kindliche Drohung: »Ich schlafe nicht–ich laufe dir nach, wenn du fortgehst, Vater!«
3.
Die Majorin kehrte mit einem Achselzucken an den Küchentisch zurück. »Mit dieser Art von Leuten ist nicht viel anzufangen – sie sind gleich außer Rand und Band,« sagte sie gelassen wie immer.
»Nun, den möchte ich doch sehen, der sein inneres Gleichgewicht behält, wenn er ungerecht beschuldigt wird und darüber auch noch sein Brot verliert!« rief ihr Sohn tief erregt. »Sei nicht böse, Mama – aber auf dem Klostergute werden seit Jahrhunderten nur reiche, kluge Leute geboren – kein warmblütiges Menschenherz!«
»Wir backen ,seit Jahrhunderten' wöchentlich sechs Armenbrote, mag das Korn geraten oder nicht,« entgegnete sie, ohne auch nur eine Miene ihres ernsten Gesichtes zu verziehen. »Wir unterstützen auch vielfach auf andere Weise, wenn wir das auch nicht an die große Glocke schlagen. Aber wir sind bedächtiger Natur und rennen nicht mit jedem Kopf, der obenaus will ... Du bist allerdings nicht auf dem Klostergute geboren –« die gelassene, gleichmütige Stimme konnte sehr spitz werden – »du bist auch so ein neumodischer Brausekopf, der den einen in den Himmel hebt und dabei das gute Recht eines anderen zertritt ... Meinst du wirklich, der Onkel solle öffentlich erklären, daß er um ›das Geheimnis‹ des Herrn von Schilling nicht gewußt hat?«
»Das durchaus nicht, aber –«
»Es würde auch dem wunderlichen Menschen, dem Adam, nichts nützen, so wenig wie dem alten Mann im Schillingshofe zu helfen ist,« fiel sie ihm in das Wort. »Die ,brillante' Heirat hat die verpfändeten Güter nicht so unbedingt an die Familie wieder zurückgebracht. Der Vormund der jungen Frau, ein schlauer Fuchs, hat einen Ehekontrakt aufgestellt, der den Schillings sehr viel zu wünschen übrig lassen soll – daher die grimmige Laune, die der Alte drüben nun an der Dienerschaft ausläßt.«
»Der arme, alte Papa Schilling!« rief Felix bedauernd. »Da mag er freilich tief erbittert sein und um den gescheiterten Plan doppelt grollen – der Kohlenfund hätte ihm jedenfalls wieder zu eigenem Vermögen verholfen. Er tut mir unsäglich leid – er büßt doch zumeist für die Sünden seiner Vorfahren.«
Die Majorin räusperte sich vernehmlich – sie wußte es jedenfalls besser –, aber sie erwiderte kein Wort; sie widersprach nur, wenn sie im eigenen Interesse mußte, dann aber auch energisch. Während ihr Sohn einigemal mit raschen Schritten den Hausflur durchmaß, schälte sie eine frische Gurke zum Salat.
»Wunderbar aber ist und bleibt es, daß zwei Köpfe fast zur selben Stunde den gleichen Gedanken hegen, einen Schatz zu heben, an dem alle Vorfahren und sie selbst so lange Zeit ahnungslos vorübergegangen sind!« sagte der junge Mann nach einem augenblicklichen Schweigen gespannt und trat wieder auf die Schwelle der Küchentüre.
»Hm – ich frage den Onkel sehr selten und lege mir alle Vorkommnisse selbst zurecht,« entgegnete seine Mutter, ohne von ihrer Beschäftigung wegzusehen. »Der Onkel wird schon längst ebenso klug gewesen sein, wie der Herr Ingenieur; aber er hat wohl die Unruhe und das Risiko des Unternehmens gescheut ... Nun ist der kleine Veit nachgekommen – die Wolframs blühen wieder auf, und da wird jeder neue Erwerb zur Pflicht.«
»Mein Gott, soll denn dieses fieberhafte Erwerben bis in Ewigkeit fortgehen, Mama? Ich sollte doch meinen, deine Familie hätte längst übergenug!«
Die Majorin fuhr wie entsetzt herum, und ein langer, unwillig überraschter Blick maß strafend den Sohn – es glimmte doch auch nicht ein Funke des Wolframschen Familiengeistes in ihm! »Übergenug haben!« Den vermessenen Gedanken hatte man auf dem Klostergute noch nicht gedacht, geschweige denn laut werden lassen – wie den Schlafwandelnden, so schreckt ja ein unbesonnener Anruf das scheue Glück vom Wege und macht es stürzen. –
»Über die Vermögensverhältnisse spricht man in unserer Familie nicht, das merke dir!« wies sie ihn scharf und schneidend zurecht. Sie drehte an einem Hahn über dem Spültisch und ließ sich das frische Brunnenwasser über die Hände laufen. »Dein spätes Mittagsbrot ist fertig – gehe in die Stube, ich komme gleich nach!« sagte sie kurz über die Schulter.
Das war ein barsches Kommando. Felix biß sich zornig auf die Unterlippe und schritt an seiner Mutter vorüber in die anstoßende Stube. Da hatte zu allen Zeiten der Eßtisch gestanden, und der tiefe Fensterbogen war der unbestrittene Platz der Hausfrau gewesen. Die Fenster gingen, wie die der Küche, auf den Hinterhof, den die Wirtschaftsgebäude und nach dem Schillingshofe zu eine Mauer umschlossen. Vor dem oberen Stockwerk der Gebäude hin lief ein bedeckter Gang; eine Reihe kleiner Fenster, von schmalen Türen unterbrochen – einst die Mönchszellen –, mündeten auf ihn; das waren jetzt die Heu- und Kornböden, die Obstkammern. Spreusiebe und Rechen hingen an den Außenwänden, und auf dem Holzgeländer trockneten Getreidesäcke und Pferdedecken.
Der überhängende Gang verfinsterte den Hof und ganz besonders die Stube, vor deren Fenstern auch noch eine uralte Rüster ihren mächtig entwickelten Wipfel ausbreitete... In diesem grüngefärbten, ungewiß hereinfallenden Licht stand das Nähtischchen, und hier hatte die stille Frau Rätin die Erholungsstunden ihres an Liebe so karg bemessenen Ehelebens verbracht. Das Krähen und Krakeln des Hühnervolkes auf der Düngerstätte, die Brummstimmen der Kühe von den Ställen her, die Hantierung der ab- und zugehenden Knechte und Mägde – das war das Lebensgeräusch für die Einsame gewesen.
Felix erinnerte sich noch, daß sie eines Sonntagnachmittags die Korbwanne mit ihrem schlafenden Töchterchen neben sich gestellt hatte, in der Meinung, ihr gestrenger Eheherr sei ausgegangen. – Da war der Rat plötzlich eingetreten. Die Frau war jäh emporgefahren, die Glut des Ertapptseins auf dem blassen Gesicht, Fingerhut, Schere und Nadelbüchse waren auf die Dielen gepoltert, und der finstere Mann hatte mit einem halben Blick nach dem Korbbettchen beißend gesagt, hier sei sein Eßzimmer und nicht die Kinderschlafstube.
An diesen Vorfall wurde Felix beim Eintreten lebhaft erinnert; denn fast auf derselben Stelle schlief jetzt auch ein Kind; aber nicht in der primitiven Korbwanne, zwischen buntgewürfeltem Bettzeug – ein elegantes Wiegenbettchen stand da – grüne Seide spannte sich über das Verdeck, und ein langer grüner Schleier fiel über die kleine, flockenweiche und weiße Bettdecke ... Und am Nähtisch, auf dem Platze der sanften, schlanken Frau saß eine vierschrötige Person, mit dem bäurischen Kopftuch über dem dummdreisten, vollstrotzenden Gesicht und strickte an einem groben Strumpfe. Sie erhob sich nicht von ihrem Sitze, als der junge Herr eintrat, und fuhr fort, mit der Fußspitze die Wiege zu schwenken – sie war sich wohl bewußt, daß die Amme augenblicklich die Herrschende auf dem Klostergute sei.
Felix hätte gern einen Blick durch den Schleier geworfen, um das Gesicht des kleinen, schlafenden Vetters zu sehen, allein der Anblick des Frauenzimmers auf dem Platze der verstorbenen Tante empörte und verletzte ihn. Er setzte sich schweigend an den Eßtisch und zog ein Lederetui aus der Tasche, das er öffnete, um ein zusammengeklapptes Eßbesteck von Silber herauszunehmen ... Das war das einzige von den Lucians herstammende Stück, das die erzürnte, unversöhnliche Frau aus dem Königsberger Hausstand mit heimgebracht hatte, das Patengeschenk des Großvaters, des längstverstorbenen Obersten Lucian, für seinen Enkel Felix, den er selbst aus der Taufe gehoben ... Das Etui war seitdem in der dunkelsten Ecke des Silberschrankes droben im Giebelzimmer verblieben. Bei seinem letzten längeren Aufenthalt auf dem Klostergute aber hatte der junge Eigentümer durch Zufall das geflissentlich verborgene großväterliche Geschenk entdeckt, er hatte es sofort mit heimlich aufjauchzendem Herzen wiedererkannt und, trotz des mütterlichen Protestes, als sein eigen reklamiert.
Nun schob er das einfache, holzstielige Besteck des Hauses beiseite und legte das silberne auf die hingebreitete Serviette.
In diesem Augenblick trat die Majorin ein. Sie trug ein gebratenes Hähnchen und den Gurkensalat auf einem Präsentierbrett und war eben im Begriff, einen gewärmten Teller vor ihren Sohn niederzusetzen, als ihr Blick auf das Silberbesteck fiel. Sie wurde dunkelrot im Gesicht und blieb regungslos stehen. »Nun, ist dir unser Eßzeug nicht blank oder stolz genug?« fragte sie kurz, wie mit zugeschnürter Kehle.
»Das nicht, Mama,« – versetzte der junge Mann und legte mit einem fast zärtlichen Gesichtsausdruck die Hand auf den Messergriff, der den großeingravierten Namen Lucian trug; – »aber ich bin so glücklich, etwas aus der alten Zeit im Gebrauch zu haben – von diesem Andenken trenne ich mich nie! ... Ich weiß noch genau, wie er aussah, mein schöner, stolzer Großpapa, obgleich ich nicht viel über vier Jahre alt gewesen bin, als er gestorben ist. Der Papa« – ein Schmettern und Klirren machte ihn emporfahren, zugleich erschrak er über sich selbst, denn zum erstenmal nach vieljähriger, von der strengen Mutter ihm auferlegten Selbstbeherrschung, war ihm wie unbewußt das teure, seinem Gedankengang so geläufige Wort »Papa« über die Lippen geschlüpft – und nun stand sie vor ihm, die Zürnende, mit funkelnden Augen; aus dem eben noch rot überflammten Gesicht war jeder Blutstropfen gewichen, und die jäh aufzuckende Hand hatte unwillkürlich den Teller zu Boden geschleudert.
Die Amme kreischte auf, und die Kinderstimme in der Wiege stimmte aus Leibeskräften mit ein. »Aber, Frau Majorin, wenn das jetzt der Herr Rat wüßte! – Veitchen kann ja Krämpfe kriegen vor Schrecken!« sagte die Amme in frech zurechtweisendem Ton und nahm das schreiende Kind aus dem Bettchen.
Zum höchsten Erstaunen des Sohnes erwiderte die stolze, strenge Frau keine Silbe. Sie half den Schreihals beruhigen, dann raffte sie die Scherben von den Dielen auf und ging hinaus in die Küche. Felix wußte, wie heiß sein Onkel und auch seine familienstolze Mutter einen direkten Erben des Wolframschen Namens ersehnt hatten; aber er ahnte doch nicht, welche Macht dieser kleine Junge im Wickelkissen auf dem Klostergute war. – Der junge Mann starrte mit einem heimlichen Schrecken nach dem borstigen, schwarzen Haarbüschel, der unter dem verschobenen Mützchen hervorkam. – Hätte die Frau Rätin, die ihre fünf kleinen Mädchen, eines wie das andere, mit kornblumenblauen Augen aus zarten Schneewittchengesichtern angesehen hatten, in ihr irdisches Heim zurückblicken können, sie wäre jedenfalls sehr betroffen gewesen über das zigeunerhafte Kerlchen, zu dem sich der mit ihrem Leben erkaufte Sohn entwickelte – ein braunes, faltig mageres Gesichtchen zwischen den weit abstehenden Ohren, und lange, dürre Fingerchen, die wie Spinnenfüße auf dem weißen Steckkissen krabbelten – das war der Erbe des Klostergutes!
»Schlaf, Kindlein, schlaf – schlaf sanfter als ein Graf!« – sang die Amme in rucksenden Tönen. Sie ging am Eßtisch vorüber, und den Takt auf das Steckkissen patschend, stieß sie eine Tür auf und marschierte in die anschließende Stube. Das war das Geschäfts- und Arbeitszimmer des Herrn Rates – es tat sich auf wie ein weiter Saal, und sein mächtiges Bogenfenster ging auf den Vorderhof.
Das Kind war still, und die Amme schlug drüben den Fensterflügel zurück und rief den draußen beschäftigten Knechten plumpe Witzworte zu – das war nun etwas ganz Unerhörtes auf dem Klostergute. So schlicht bürgerlich auch der Zuschnitt des gesamten Hausstandes war – das Gesinde wurde in strenger Zucht, in sklavischer Demut, fast wie Leibeigene, zu Füßen der Herrschaft niedergehalten; die Wolframs verstanden es, sich in Respekt zu setzen.
Die Majorin, die inzwischen wieder hereingekommen war und einen anderen Teller auf den Tisch gesetzt hatte, streifte mit einem Seitenblick das Fenster, an dem es so geräuschvoll zuging, aber sie sagte kein Wort. Die gleichmütige Ruhe, die ihr schönes Profil wieder angenommen hatte, erschien dem Sohne heute zum erstenmal unnatürlich und unheimlich – er wußte seit einigen Augenblicken, daß alle Nüchternheit und Besonnenheit, aller Schutt der Alltäglichkeit eine verstohlen glimmende Stelle in der Seele seiner Mutter nicht zuzuschütten vermochten – ein einziges Wort hatte Flammen aufschlagen lassen ...
Dem Eßtisch gegenüber wölbte sich der plump gemeißelte, steinerne Rundbogen einer Türe; hinter ihr, durch die klafterdicke Mauer hindurch, hatte einst eine Treppe nach dem erhöhten Parterre, in den Korridor des Säulenhauses geführt; sie war der Verbindungsweg zwischen der Klosterküche und den Speisesälen des Hospizes und überhaupt der einzige gewesen, der die zwei Häuser miteinander verbunden hatte. Bei der Teilung des Klostersitzes war der Türbogen in seiner ganzen Tiefe massiv vermauert worden; die praktischen Wolframs aber hatten ein wenig Raum als flachen Wandschrank hinter der Türe belassen. Diesen Schrank schloß die Majorin jetzt auf. Die Haushaltungsbücher lagen drin, und auf dem schmalen Regal stand ein lackierter Blechkasten, – dahinein floß der Erlös für Geflügel und dergleichen und das Milchgeld.
Felix sah mit verfinstertem Gesicht zu, wie seine Mutter eine derbe Ledertasche vom Gürtel nahm und den Inhalt, lauter kleine Münzen, in den Kasten schüttete. Sie mußte also jetzt auch, wie vordem die arme Rätin, am Schanktische stehen und die Milch nößelweise verkaufen; sie mußte das verlangte Geflügel in Hühnerstall und Taubenschlag zusammensuchen und den fremden Köchinnen im Gemüsegarten Salat und Kohlrabi abschneiden und sich die Groschen und Pfennige dafür in die Hand zählen lassen ...
Dem jungen Mann quoll der Bissen im Munde vor Verdruß; zudem kreischte in diesem Augenblick die Amme laut auf vor Vergnügen. Er warf Messer und Gabel hin und sprang auf. »Ist es dir wirklich möglich, so viel Gemeinheit in deiner Nähe zu dulden, Mama?« rief er entrüstet.
»Wenn ich unverständig wäre, dann empörte ich mich wahrscheinlich auch dagegen,« sagte sie, gelassen den Schrank schließend. »Das Kind ist schwach und elend – sein Leben liegt in der Hand der ungeschliffenen Person – da heißt es schlucken und schweigen.«
Ihr Sohn fühlte, wie ihm das Blut nach dem Kopfe schoß – welche große innere Opfer brachte diese Frau dem Kinde ihres Bruders, und ihr eigenes hatte sie vaterlos gemacht, weil sie – nicht schweigen wollte! Er erinnerte sich der Szenen zwischen seinen Eltern; er wußte noch, daß die Mutter dem aufbrausenden Manne gegenüber kalt und unerbittlich stets das letzte Wort behauptet hatte, bis er wie rasend vor Ungeduld aus dem Zimmer gestürmt war.
Sie hatte schwerlich eine Ahnung von der unsäglichen Bitterkeit, die augenblicklich in ihrem Sohn aufwogte, sonst wäre sie wohl nicht so gleichmütigen Blickes an ihm vorüber in das anstoßende Zimmer gegangen. »Wir wollen doch lieber das Fenster schließen, Trine,« sagte sie mit ruhiger Freundlichkeit, »die Zugluft könnte dem Kinde schaden.«
»Ach bewahre, es zieht nicht! Da müßte ich doch auch 'was spüren!« entgegnete Trine impertinent. »Ich bin die Amme, Frau Majorin. Unsereins muß doch wohl am besten wissen, was es zu tun und zu lassen hat.« Sie mußte übrigens doch schon ihre Erfahrungen bezüglich der Entschiedenheit der Dame gemacht haben, denn während die Majorin, die grobe Antwort völlig überhörend, unbeirrt die Fenstergriffe fester zudrehte, kehrte sie brummend an die Wiege zurück, legte das Kind in die Kissen und nahm ihren Strickstrumpf wieder auf.
Indessen war auch Felix in das Zimmer des Onkels getreten, zu seiner eigenen Verwunderung mit derselben beklemmenden Scheu, die er als Kind empfunden ... Diese holzbekleideten Wände schlossen stets dieselbe widerlich dumpfe, mit dem Geruch alter, lederner Büchereinbände erfüllte Luft und einen abgesperrten, gleichmäßig häßlichen Dämmerschein des Tageslichtes in ihr langgestrecktes Viereck. Zur Zeit seiner Amtstätigkeit – der Rat hatte seit einigen Jahren sein Amt als Oberbürgermeister der Stadt niedergelegt – war das Zimmer die sogenannte Amtsstube und damit ein Gegenstand der Furcht für alle Hausgenossen gewesen. Da waren oft bitterböse Worte zwischen heftig streitenden Männern gefallen; die leidenschaftlich gesteigerten Stimmen hatten draußen von den Wänden des Hausflurs widergehallt, und mancher war mit zornrotem Kopf fortgestürzt und hatte die Türen schmetternd zugeschlagen; denn der Rat hatte nicht gut mit den Bürgern der Stadt gestanden, er war verhaßt gewesen seiner herrischen Willkür, seiner oft bis zur grausamen Härte gehenden Unbeugsamkeit, seines beißenden Hohnes wegen.
Felix hatte das Zimmer als Kind fast nur betreten dürfen, wenn die Mutter ihn schickte, einen Verweis des Onkels in Empfang zu nehmen, und doch blieb er meist wie mit magischer Gewalt festgebannt noch einige Augenblicke nach Beendigung der Strafpredigt an der Schwelle stehen, bis ihn der Rat barsch hinausscheuchte. An der ganzen Südseite – derselben Wand, welche einst drüben im anstoßenden Zimmer der Verbindungsweg zwischen Kloster und Säulenhaus durchbrochen hatte – lief nämlich eine Galerie hin; ein hölzernes Treppchen von wenigen Stufen führte hinauf und teilte ihr geschnitztes, vor Alter schwarz gewordenes Geländer in zwei Hälften. Die Wand war bedeckt mit Holzschnitzereien, plumpen, unkünstlerischen, in Felder eingeteilten Darstellungen aus der biblischen Legende. Aber nicht diese Heiligengestalten mit ihren verrenkten Gliedmaßen und der plumpen Scheibe des Glorienscheins hinter den Köpfen zogen den sehnsüchtigen Blick des Knaben auf sich – die Orgel war es, zu der die Stufen direkt führten.
Sie war uralt und von der primitivsten Art; sie hatte nur wenige zinnerne Pfeifen und sehr breite Tasten, ein vollstimmiger Choral hatte nicht darauf gespielt werden können. Auch sie sollte ein Mönch gebaut haben, und zwar der Abt selber, dessen »Klause« dieses weite saalartige Zimmer einst gewesen ... Die Wolframs hatten die ganze raumversperrende Einrichtung dennoch unberührt gelassen – sie hatte heiligem Gebrauch gedient, und die Besorgnis, mit ihrer Beseitigung den Segen von ihrem Besitztum zu verscheuchen, beseelte sie alle, wie sich ja nur zu oft die Gottesfurcht in der egoistischen Menschenseele mit Furcht, weltliche Güter zu verlieren, identifiziert – freilich niemals eingestandenermaßen.
Jetzt sah der junge Mann auf den ersten Blick, daß die Orgel verschwunden war. Stumm vor Überraschung zeigte er auf das neue, braungebeizte Feld, das sich an Stelle der Orgelpfeifen zwischen die Heiligen geschoben hatte und mit seiner ungeschmückten, glatten Holztafel seltsam genug inmitten der krausen Schnitzereien aussah.
»Ja, du wunderst dich!« sagte die Majorin, die sich eben vom Fenster wegwendete. »Das war ein heilloser Schrecken! ... Die Pfeifen hatten freilich schon lange verschoben gestanden, aber wir hatten das nicht weiter beachtet, und da brach sie am Tage nach Veits Geburt mit einem furchtbaren Poltern in sich zusammen ... Sie war freilich immer eine spukhafte Mäuseherberge, aber es ging uns doch nahe, denn in Ehren haben wir sie alle gehalten. Die Trümmer sind auch von keiner fremden Hand angerührt worden; der Onkel hat die Ordnung selbst wieder hergestellt – auch nicht das kleinste Brettchen ist in das Küchenfeuer gekommen.«
Der junge Mann stieg auf die Galerie und öffnete das neueingesetzte Feld, das sich als eine Türe auswies. In der ziemlich tiefen dunklen Maueröffnung, die einst die Orgel ausgefüllt, waren in der Tat die Überreste sorgsam aufgeschichtet. Da lagen die zinnernen Pfeifen, die dickbäuchigen Holzengel, die sie umringt, die auseinandergesprengten Teile der Tastatur – es schien allerdings jeder Splitter so ängstlich aufgelesen worden zu sein, als hänge Unsegen und Verderbnis für das ganze Klostergut an seiner Verschleppung.
Wenn der Rat ganz allein die Ordnung wiederhergestellt hatte, dann rührten auch die Reparaturen an den beschädigten Innenwänden von seiner Hand her. Felix bog sich tief in den dämmernden Raum und betrachtete ein neues Stück Bretterverschalung. »Der Onkel hat ja gleich einem Zimmermann gearbeitet!« rief er lächelnd seiner Mutter zu, die eben hinausgehen wollte.
In diesem Augenblick wurde die nach dem Hausflur führende Türe geöffnet, und ein fester Fuß trat auf die Schwelle. »Nun, was hast denn du da oben zu suchen?« scholl es scharf, in hörbar unliebsamer Überraschung herein.
Fein fuhr empor – dieser Ton in des Onkels Stimme berührte stets sein ganzes Nervensystem, wie das plötzliche Schrillen von Metall. Er sprang nichtsdestoweniger rasch die Stufen herab und reichte mit einer leichten, eleganten Verbeugung dem Eingetretenen die Hand hin.
»Willst du nicht die Freundlichkeit haben, zuvor den Schrank wieder zu schließen, den du so wißbegierig durchstöberst?« fragte der Rat abermals mit finsterem Blick, ohne die dargebotene Hand zu ergreifen. »Und seit wann ist es denn Sitte bei uns, daß du mich in meinem eigenen Zimmer bewillkommnest?«
Der junge Mann war mit einem Satz wieder zurückgesprungen und bemühte sich, die verquollene Schranktüre zuzudrücken. »Seit deine Dienstboten den Weg frei gemacht haben, Onkel,« entgegnete er nicht ohne Schärfe, über die Schulter und zeigte durch die offene Türe nach der Amme, die sich grüßend vom Stuhl erhoben hatte.
»Veitchen schläft immer nur drüben ein – der Herr Rat wissen's ja,« sagte die Person, ihres angemaßten Rechtes sicher.
Der Rat warf schweigend seinen Hut auf den nächsten Tisch. Hochgebaut, nicht breit von Schultern, aber ein Bild zäher Kraft in der ganzen Haltung, war er ein Mann, der, auf dem Hintergrund der altertümlichen Wandbekleidung, in Koller, Spitzenkragen und Federhut eine prächtige Wallensteinfigur abgegeben hätte. Das starke, kurz verschnittene, leicht übergraute Haar bog sich als scharfgezeichnete Schneppe tief in die Stirne des geistreichen, schmalen Gesichts, das Luft und Sonne mit der gesunden, braunen Haselnußfarbe angehaucht hatten.
Er ging, den Schall seiner Schritte möglichst dämpfend, sofort hinüber an das Wiegenbettchen, hob mit vorsichtigem Finger den Schleier auf und bog sich horchend über das Kind. »Was ist das, Trine? Der Kleine atmet aufgeregt – das Köpfchen scheint auch heiß zu sein,« fuhr er wie atemlos vor Bestürzung empor – dieses Männergesicht voll Selbstbewußtsein war kaum wiederzuerkennen mit dem Ausdruck zitternder Angst.
»Veitchen hat sich erschreckt, Herr Rat,« sagte die Amme, die Hände über den Leib faltend, in anklagendem Tone. »Er kann eben gar keinen Lärm vertragen, und die Frau Majorin hat vorhin einen Teller auf den Erdboden fallen lassen – ich war halbtot vor Schreck und dachte mir's gleich, daß Veitchen krank würde – er schrie zu fürchterlich, Herr Rat!«
Der Rat schwieg und streifte mit einem finsteren Seitenblick seine Schwester, die ganz bleich vor Grimm und Ärger, langsam am Eßtisch hinging und zwecklos verschiedene Gegenstände aufnahm, um sie wieder hinzulegen. Jetzt trat sie rasch an die Wiege und befühlte die Stirn des schlafenden Knaben. »Du siehst Gespenster, – dem Kinde fehlt nichts!« sagte sie in ihrer kurzen, entschiedenen Weise, aber wie man sah, selbst erleichtert durch das Resultat ihrer Untersuchung.
»Gott sei Dank!« rief der Rat tiefaufatmend. »Ich weiß, du verstehst dich darauf, Therese! – Aber es wäre jedenfalls praktischer gewesen, Felix hätte oben in deinem Zimmer gegessen. Trine hat recht, Veit kann kein starkes Geräusch, nicht einmal lautes Sprechen vertragen – wir werden uns deshalb, solange dein Sohn hier ist, im vorderen Eckzimmer aufhalten ... Für jetzt muß das Kind in seine Schlafstube – die Luft hier ist zu dick, voller Speisedunst.«
Er ergriff die Wiege am Kopfende und winkte der Amme, die entgegengesetzte Seite aufzunehmen; aber die Majorin legte selbst Hand mit an, und so trugen die beiden alternden Geschwister den neuen Träger des Wolframschen Namens – ihrem Familienbewußtsein und Dünkel nach ein Menschenkind, kostbar wie ein Königsohn – durch Küche und Hausflur, und die Amme folgte, hochmütig das fette Doppelkinn vorstreckend, breitspurig mit ihrem Strickstrumpfe.
4.
Die Türen blieben offen, und Felix fühlte den lebhaften Wunsch, auch hinauszugehen und das »alte Falkennest«, aus dem der klägliche, kümmerliche Sproß da drüben schon jetzt mit seinen Spinnenfingerchen jeden Insassen anderen Namens stieß, auf Nimmerwiederkehr zu verlassen ... Von Neid und Mißgunst war keine Spur in der Seele des jungen Mannes; er hatte im Gegenteil laut aufgejubelt bei der Nachricht, daß ein Wolfram geboren sei; denn ihm war der Gedanke, einst auf dem Mustergut hausen zu müssen, immer ein verhaßtes Schreckgespenst gewesen. Freilich hatte er sich nicht träumen lassen, daß sich mit dem ersten Atemzuge des kleinen, mißgestalteten Burschen eine Wandlung vollziehen würde, die das Leben auf dem Klostergute geradezu unerträglich und ihn damit gewissermaßen heimatlos machte.
Der Onkel hatte ihm eben noch die Rolle eines Überflüssigen zugewiesen, der in jede beliebige Ecke gesteckt wurde, wenn seine Anwesenheit den schwachen Nerven des Wickelkindes nicht zusagte. – So hart und streng der Rat den phantasievollen Knaben einst behandelt, dem angehenden jungen Manne gegenüber war er doch in den letzten Jahren rücksichtsvoller, gleichsam vertraulicher gewesen. – Felix stampfte in zorniger Scham mit dem Fuße auf – das hatte nicht ihm, seinem aufrichtig gemeinten Streben, seinen erworbenen Kenntnissen gegolten, wie er fest geglaubt; es war die Rücksicht für den Einzigen gewesen, in dessen Adern noch Wolframsches Blut floß, die Achtung vor dem späteren Besitzer des Klostergutes. Nun schüttelte der Rat »das notwendige Übel«, den Lückenbüßer ab – in der seidenbehangenen Wiege lag sein eigen Fleisch und Blut – er trat wieder brüsk und herrisch auf, wie er einst mit dem fremden, jung einfliegenden Vöglein, dem armen »Kolibri« verfahren.