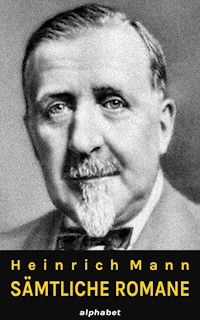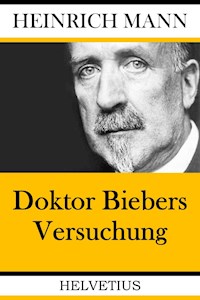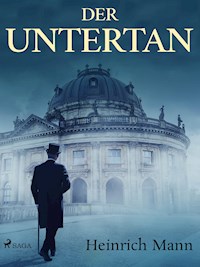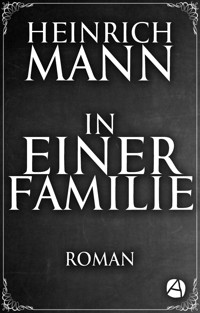Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Null Papier Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In seinem ersten Roman hat Heinrich Mann zugleich auch sein Lieblingsthema gefunden: die korrupte Gesellschaft zu Zeiten Kaiser Wilhelms II. Der Roman zeichnet Aufstieg und Fall des aus einfachen Verhältnissen stammenden und leidlich talentierten Möchtegern-Literaten Andreas Zumsse. Bedingt durch Glück und Beziehungen steigt er in der wilhelminischen Gesellschaft von Reichtum und Macht auf. Aber die Etablierten verzeihen ihm seinen Erfolg nicht. Und durch eigene Hybris und einem Hang zu Ränkespielen hat Zumsse schon bald seinen Zenit überschritten und sieht sich schlussendlich wieder auf dem Weg zurück nach unten. Jahre später schrieb Mann in einem Brief über seinen Roman: "Mit 20 konnte ich gar nichts. Gegen 30 lernte ich an meinem Schlaraffenland die Technik des Romans." Null Papier Verlag
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 523
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Heinrich Mann
Im Schlaraffenland
Ein Roman unter feinen Leuten
Heinrich Mann
Im Schlaraffenland
Ein Roman unter feinen Leuten
Veröffentlicht im Null Papier Verlag, 2024Klosterstr. 34 · D-40211 Düsseldorf · [email protected] EV: Albert Langen, München, 1900 2. Auflage, ISBN 978-3-962818-35-7
null-papier.de/neu
Inhaltsverzeichnis
Anmerkungen zur Bearbeitung
I. Der Gumplacher Schulmeister
II. Das »Café Hurra«
III. Die deutsche Geisteskultur
IV. Türkheimers
V. Ein demokratischer Adel
VI. Die Mittel, mit denen man was wird
VII. Eine Marotte
VIII. »Rache!«
IX. Politik und Volkswirtschaft im Schlaraffenland
X. Das Vergnügen, die Menschen zu durchschauen
XI. Die kleine Matzke
XII. Die leben, die genießen!
XIII. Die hohe Korruption
XIV. Familienrat
XV. Liebling
XVI. Das Bedürfnis nach Reinheit
Danke
Danke, dass Sie sich für ein E-Book aus meinem Verlag entschieden haben.
Sollten Sie Hilfe benötigen oder eine Frage haben, schreiben Sie mir.
Ihr Jürgen Schulze
Anmerkungen zur Bearbeitung
Schreibweise und Interpunktion des Originaltextes wurden übernommen; offensichtliche Druckfehler wurden korrigiert.
Die Orthografie wurde der heutigen Schreibweise behutsam angeglichen.
Grundlage dieser Veröffentlichungen bilden folgende Ausgaben:
Albert Langen, München, 1900
Verlag Kultur und Fortschritt, 1962
Rom, Januar 1898 – Riva, März 1900
I. Der Gumplacher Schulmeister
Im Winter 1893 arbeitete Andreas. Er war fleißig wie ein armer Student, der nicht in alle Ewigkeit auf den Wechsel von zu Hause rechnen kann. Als es aber Frühling ward, ging eine Veränderung mit ihm vor. Während der Osterferien, die er aus Mangel an Reisegeld in Berlin verbrachte, musste er immerfort an die Freunde denken und an die Fahrten, den Rhein zu Berge. Ein ausgiebiger Vorrat von des Vaters prickelndem Federweißen befand sich im Boot.
Das Heimweh veranlasste den jungen Mann zum Nachdenken. Er überlegte sich die große Zahl der Geschwister und die schlechte Ernte des vorigen Jahres. Nun, mit dem Weinberg, der nur noch alle sieben Jahre einmal ordentlich trug, würde er nichts mehr zu tun haben. Sein zukünftiges Erbteil ging bei seinem Studium im Voraus drauf. Merkwürdigerweise schloss Andreas hieraus nicht, dass er umso schneller auf das Examen loszuarbeiten habe, sondern dass seine Anstrengungen gar zu wenig lohnend seien. Als mittelloser Schulamtskandidat war alles, was er tun konnte: nach Gumplach zurückkehren und auf eine Anstellung am Progymnasium warten. War das eine Zukunft für ihn, Andreas Zumsee, dessen Talent, nach Ansicht aller, zu großen Hoffnungen berechtigt hatte? Mit achtzehn Jahren hatte er Gedichte gemacht, mit denen seine Freunde und sogar er selbst vollkommen zufrieden gewesen waren. Seitdem hatte der »Gumplacher Anzeiger« eine Novelle von ihm gebracht, die ihm die Gunst des Mäzens von Gumplach eingetragen hatte. Es war der alte Herr, den es in jeder kleinen Stadt gibt, und der bei seinen Mitbürgern als harmloser Sonderling gilt, weil er sich mit Literatur befasst.
Am Ostersonntag besuchte Andreas das Königliche Schauspielhaus, um den ersten Teil des Faust zu sehen. Auf der Galerie zog er sich hinter einen Pfeiler zurück. Er hatte keinen Bekannten in Berlin, schämte sich aber seines billigen Platzes. Seine Eitelkeit legte ihm Opfer auf. Im Zwischenakt stieg er, nicht weil es ihm Freude machte, sondern weil die Selbstachtung es ihm gebot, ins Parkett hinab und drängte sich auf dem Korridor in der guten Gesellschaft umher.
Einmal staute sich der Zug der Wandelnden, weil viele gaffend und horchend zwei bedeutend aussehende Herren umdrängten. Den größeren von ihnen erkannte Andreas sofort wieder; es war der Professor Schwenke, ein Akademiker, der sich eine Ausnahmestellung verschafft hatte dadurch, dass er alles Moderne protegierte. Er trug eine Künstlerlocke auf der Stirn, hielt die Hände in den Taschen seines hellen Jacketts und hatte so große Furcht, pedantisch zu erscheinen, dass er beim Sprechen den Oberkörper stets in einem burschikosen Schwunge erhielt. Sein Gegenüber war einen Kopf kleiner, bartlos, und sein borstiges schwarzes Haar hing über einem Halskragen von zweifelhafter Weiße. Er hatte eine Adlernase und gelblederne Gesichtshaut, und sein zu weiter Gehrock reichte bis unter die Knie hinab. Andreas war sehr begierig zu wissen, wer diese Persönlichkeit sei, die äußerlich zwischen Clergyman und Konzertvirtuosen ungefähr die Mitte hielt. Ein Herr, der von fern dem Kleinen winkte, rief:
»Herr Doktor Abell!«
»Sollte das Abell sein?« dachte Andreas, »der Kritiker des ›Nachtkurier‹?«
Er konnte es kaum fassen, dass man die großen Männer, die im Reich der Begriffe lebten, hier in der Wirklichkeit wiederfand. Sein Herz schlug höher, und er schaute sich argwöhnisch um, ob man ihm etwas anmerke. Denn er wollte um keinen Preis naiv aussehen.
Von seinem Galerieplatz suchte er die beiden Herren wieder auf; sie saßen dicht hinter dem Orchester. Andreas schielte mehrmals hastig nach seinem Nachbarn, einem blonden jungen Manne in bescheidenem schwarzen Röckchen. Endlich hielt er es nicht mehr aus:
»Entschuldigen Sie«, sagte er, »ich bin kurzsichtig. Ich meine dort vorn den Doktor Abell zu erkennen?«
Er bemühte sich, ganz dialektfrei zu sprechen. Der junge Mann erwiderte höflich:
»Gewiss. Das ist Doktor Abell. Er sitzt neben Doktor Wacheles vom ›Kabel‹. Zwei Reihen hinter den Herren sehen Sie auch Doktor Bär von der ›Abendzeitung‹ und Doktor Thunichgut von der ›Kleinen Börse‹.«
Neben ihnen machte man »Pst!«, und der Vorhang ging auf. Andreas sah nichts anderes mehr als die Rücken der Kritiker. Sie nahmen Plätze ein, denen auch er sich gewachsen fühlte. Mit sanguinischer Fantasie malte er sich schon seinen Eintritt in den Saal aus. Er schritt gelassen, im Gefühl seiner Unentbehrlichkeit, auf den ihm reservierten Sessel zu. Er lehnte sich zurück, verschränkte die Arme und lauschte nachlässig mit mildem Lächeln den Künstlern, die mehr für ihn als für tausend andere sprachen. Einige Zeilen in der Redaktion, wohin er nach der Vorstellung fuhr, flüchtig auf das Papier geworfen, sicherten ihm Macht, Einfluss, ein gutes Einkommen und eine angesehene gesellschaftliche Stellung in Berlin. Der Gumplacher Schulmeister durfte diese Zukunft nicht durchkreuzen. Das berufene Talent brach sich Bahn.
Um sich selbst in seinen Hoffnungen zu bestärken, hätte er sie gern laut ausgesprochen. Er sah mehrmals schnell um sich und schnappte vor Erregung nach Luft. Sein Nachbar, der ihn durch einen schwarzumrandeten Kneifer still anblinzelte, sagte verbindlich:
»Wir sind wohl Kollegen?«
Andreas stutzte und besann sich.
»Sie sind auch Schriftsteller?« fragte er.
Der andere verbeugte sich.
»Friedrich Köpf, Schriftsteller.«
Er sprach mit gespitzten Lippen, als sei es ihm eher peinlich, dies einzugestehen. Andreas wurde im Gegenteil rot vor Vergnügen, während er sich vorstellte. Es war das erste Mal, dass er sich als Literat bezeichnete. Er meinte seine Laufbahn hiermit in aller Form zu beginnen.
»Ich mache allerdings gerade die ersten Schritte in meinem Beruf«, setzte er hinzu.
»Oh, das berufene Talent bricht sich Bahn«, versicherte der junge Mann.
Andreas richtete sich auf und sah ihn drohend an; aber er überzeugte sich, dass der andere ganz harmlos lächelte. Er versetzte darauf:
»Ich bin bisher bloß Mitarbeiter eines Provinzblattes gewesen.«
»Ah, Sie sind bereits journalistisch tätig?«
»Ich habe am Feuilleton mitgearbeitet.«
Andreas vermied es, das unberühmte Blättchen zu nennen, das seine junge Kraft gewonnen hatte, und sein neuer Bekannter war diskret genug, nicht danach zu fragen. Er sagte überhaupt nichts mehr, sondern hörte voll Teilnahme zu, wie Andreas die Gedichte zusammenrechnete, die der »Gumplacher Anzeiger« gebracht hatte, und von dem ermutigenden Erfolge seiner Novelle erzählte.
Das Gespräch ward unterbrochen. Nach Schluss des Aktes begann Andreas wieder:
»Aber in Berlin bin ich bisher ganz fremd.«
»Wirklich?« sagte Köpf zweifelnd.
»Ich würde mich ja gern hier journalistisch betätigen, aber es ist so schwer, Anschluss zu finden.«
»Oh, was das anbelangt, man wird überall mit offenen Armen aufgenommen.«
»Wirklich?« fragte Andreas seinerseits.
Merkwürdig, er wusste niemals, was er aus den Worten des Kollegen machen sollte, obwohl alles, was dieser sagte, ungemein gutmütig klang. Köpf schien das Misstrauen des jungen Mannes zu bemerken und es beseitigen zu wollen. Er versetzte:
»Ich kann Sie zum Beispiel in das ›Café Hurra‹ einführen, wenn Ihnen daran liegt.«
»›Café Hurra‹?« fragte Andreas.
»Eigentlich Café Kühlemann, Potsdamer Straße. Sie treffen dort verschiedene Mitarbeiter angesehener Zeitungen.«
»Ah!« rief Andreas dankbar und voll Hoffnung. »Das wäre ja außerordentlich freundlich von Ihnen.«
»Also kommen Sie nächsten Donnerstag. Dann finden Sie mich wahrscheinlich dort.«
Köpf empfahl sich gleich nach beendeter Vorstellung. Andreas suchte, höchst zufrieden und den Schlagring kampfesmutig in der Faust, seine Wohnung in der Linienstraße auf. Der Gumplacher Schulmeister lag weit hinter ihm, es begann ein neues Leben.
II. Das »Café Hurra«
»Herr …?« fragte Köpf zögernd.
»Andreas Zumsee.«
Köpf stellte der Tafelrunde im »Café Hurra« den neuen Kollegen vor. Dieser ward mit Wärme aufgenommen. Der angesehenste der Herren ließ ihn an seiner Seite sitzen und zog ihn in die Unterhaltung. Als er den jungen Mann nach Studien und Absichten befragt hatte, sagte Doktor Libbenow mit einem vielleicht bescheidenen, vielleicht auch stolzen Seufzer:
»Ach ja, ich habe eigentlich seit zehn Jahren kein Buch gelesen.«
Man schien dies als eine beachtenswerte Leistung anzusehen, und auch Andreas empfand, er wusste nicht warum, Bewunderung für Doktor Libbenow.
Es war die Rede von den misslichen finanziellen Verhältnissen des Schauspielerpaares Beckenberger. Der Mann war in der Gunst des Publikums rapide gesunken, von seinem Direktor bekam er nur noch ein Taschengeld, und er verschwendete dasjenige, was sich die Frau in arbeitsamen Nächten, gleichfalls ohne Zutun des Bühnenleiters, verdiente. Vor sechs Jahren hatten sie jeder zehntausend Mark gehabt.
»I wo«, sagte Doktor Pohlatz.
»Sie glauben das doch nicht?« fragte er Andreas.
Dieser lächelte verbindlich.
Pohlatz erläuterte:
»Die Weiber bekommen nämlich überhaupt nie was, darauf gebe ich Ihnen mein kleines Ehrenwort.«
»Warum denn nicht?« riefen die anderen.
»Lizzi Laffé hat noch heute ihre zehntausend, und sie geht auf fünfzig.«
»Reden Sie doch keine Makulatur!« versetzte Pohlatz schroff. »Was Lizzi hat, hat sie von Türkheimer.«
Die Namen, die Andreas hörte, prägten sich ihm ein, alles, was gesprochen wurde, schien ihm bedeutend, am bedeutendsten aber Doktor Pohlatz. Er wusste alles, er widersprach allen, er kannte die Einnahmen jedes Schauspielers besser als dieser selbst. Aber als er endlich fortging, ward es noch gemütlicher. Andreas erlaubte sich die Frage:
»Welcher Zeitung gehört Herr Doktor Pohlatz an?«
»Doktor?« sagte jemand, »der Kerl ist ja zum Sterben zu dämlich.«
»Einen Kognak und das Adressbuch!« rief Doktor Libbenow.
»Das ist untrüglich«, sagte er, indem er den Finger auf Pohlatz’ Namen legte. »Hier sind dem Doktor seine Grenzen gesetzt.«
»Wer ist denn überhaupt noch Doktor?« bemerkte ein dicker, schäbig aussehender Herr mit wolligem schwarzen Vollbart.
»Wenn man nur sonst gesund ist«, fügte er hinzu.
»Doktor Buhl? Doktor Rebbiner?«
Ein Doktor nach dem anderen ward im Kalender aufgeschlagen, und keiner vertrug die Stichprobe. Nur Doktor Libbenow verschonte man aus Höflichkeit.
Dass auch Doktor Wacheles vom »Kabel« und der große Abell ihren Titel nur der Gefälligkeit der Kollegen verdankten, machte auf Andreas immerhin Eindruck, aber gewissermaßen brachte der Umstand sie ihm menschlich näher, indem er ihn mit ihrer Größe aussöhnte.
Köpf war bereits verschwunden, als die anderen aufbrachen. Doktor Libbenow sagte zu Andreas, der sich von ihm verabschiedete:
»Nehmen Sie sich vor Golem in acht; er will Sie anpumpen.«
Andreas bemerkte, wie der dicke Schäbige mit dem wolligen, schwarzen Vollbart sich eilig nach der anderen Seite entfernte.
Zwei Tage später erschien der junge Mann wieder im »Café Hurra«, und von da an kam er regelmäßig. Es schmeichelte ihm, seine Abende in der Gesellschaft von Mitarbeitern angesehener Zeitungen zu verbringen, und das Urteil seiner neuen Freunde über ihn lautete günstig. Wie er einmal unbemerkt in die Tür trat, hörte er Doktor Libbenow sagen:
»Der junge Zumsee? Das ist so’n Bengel, der Talent zum Glückmachen hat.«
Er zeigte gerade genug Naivität, um der Eitelkeit der anderen zu schmeicheln, und gerade genug Scharlatanismus, um nicht durch Einfalt zu beleidigen. Er sagte: »Och, han ich’n Freud gehabt«, wenn er froh war, nannte »Knatsch geck« jedermann, der ihm missfiel, und nahm es nicht übel, wenn man seinen Dialekt belächelte. Zum Lohn dafür durfte er Meinungen, die er nicht einmal hatte, sogar dem strengen Doktor Pohlatz gegenüber vertreten. Einmal ließ er es sich einfallen, den Sozialismus, der ihm durchaus gleichgültig war, nur darum herauszustreichen, weil er dies für etwas Besonderes hielt. Er irrte sich, aber Pohlatz, der jeden anderen unsanft zurechtgewiesen hätte, begnügte sich damit, ihm zu erwidern:
»Das verstehen Sie nicht, junger Mann, das verstehe ich ja kaum, und ich habe studiert.«
Bei dieser Gelegenheit erfuhr Andreas den Grund, weshalb das »Café Hurra« diesen Namen führte. Die Herren von der Tafelrunde hatten früher staatsumwälzenden Grundsätzen gehuldigt, bis im März 1890 sich die Sozialdemokratie als nicht mehr zeitgemäß herausstellte. Damals hatten alle einem Bedürfnis der Epoche nachgegeben, sie waren ihren freisinnigen Prinzipalen ein Stückchen Weges nach rechts gefolgt und bekannten sich seither zum Regierungsliberalismus und Hurrapatriotismus. Der Name des Lokals bewahrte die Erinnerung an diese Evolution.
Andreas bewegte sich den ganzen Sommer in diesem Kreise, voll des heiteren Bewusstseins, nunmehr der Berliner Literaturwelt anzugehören. Seitdem er sein Studium aufgegeben hatte, wartete er die Ereignisse ab, um eine neue Arbeit zu beginnen. Bei seinen jetzigen Verbindungen konnte es ihm auf die Dauer gar nicht fehlen. In Vertretung des dicken Golem, der unmäßig faul war, hatte er bereits mehrmals im Gerichtssaal als Berichterstatter fungiert. Wenn er spät abends nach dem Genusse von zwei Tassen schwarzen Kaffee und zwei Kognaks heimging, blickte er in eine glänzende Zukunft gerade hinein. Früher hatte er »geochst«, ohne an etwas zu denken, jetzt tat er nichts und war dabei von hohem Ehrgeiz beseelt.
Wohl blieben auch trübere, weniger zuversichtliche Stunden nicht aus. Andreas konnte manchmal ein Gefühl der Leere nicht verleugnen, wenn er den Tisch verließ, an dem von zehn bis zwölf Schauspielergehältern und schlecht zahlenden Verlegern gesprochen worden war. Golem verschwand einmal auf acht Tage, und bei seiner Rückkehr erzählte er den erstaunten Kollegen, dass er sein erstes Feuilleton geschrieben habe. Seit zehn Jahren machte er nur Gerichtsberichte, jetzt aber hatte ihn seine Zeitung nach Bayreuth geschickt. Dies hatte nichts Auffälliges an sich, über Wagner schrieb nachgerade jeder. Aber Andreas meinte, im »Gumplacher Anzeiger« zuweilen weniger schlechte Artikel gelesen zu haben.
Dieser Golem erfüllte ihn überhaupt mit Besorgnis. Doktor Libbenows Voraussicht, dass der Dicke ihn anpumpen werde, war nicht unerfüllt geblieben, und Andreas wagte bisher keine abschlägige Antwort zu geben. Er fürchtete noch zu sehr, das Wohlwollen der Kollegen zu verscherzen. Vielleicht war er nicht kräftig genug der öffentlichen Meinung entgegengetreten, die ihn für einen begüterten Dilettanten zu halten schien. Vorläufig erhielt nun Golem bald fünf und bald zehn Mark. Und in letzter Zeit ging der Unglückliche, den der Gerichtsvollzieher überallhin verfolgte, mit dem Plane um, ein Zimmer zu beziehen, das in Andreas’ Wohnung freistand.
Auch in anderer Beziehung stellte sich das neue Leben als kostspieliger heraus, als Andreas vorausgesehen hatte. Die Gesellschaft aus dem »Café Hurra« speiste häufig zusammen zu Abend, hier und da ließ sich jemand, der seine Börse vergessen hatte, von dem jungen Freunde bewirten. Im Theater wäre Andreas jetzt um keinen Preis mehr auf die Galerie gegangen. Aber alle diese Verpflichtungen, die ihm seine gesellschaftliche Stellung auferlegte, überstiegen die Kräfte eines armen Studentenwechsels. So kam es, dass Andreas sich um die Mitte des Monats gewöhnlich in ein vegetarisches Restaurant schlich. Einige Tage später bildete dann der schwarze Kaffee sein hauptsächliches Ernährungsmittel. Das Mittagessen musste nur zu häufig, wie Pohlatz sich ausdrückte, durch stramme Haltung ersetzt werden.
Andreas schuldete seit geraumer Zeit die Zimmermiete, und es war ein Glück für ihn, dass es auch mit der Entlohnung der Wäscherin nicht eilte. Er hatte Kredit erlangt dadurch, dass das junge Mädchen, das ihm seine frischen Hemden brachte, sich durch seine Liebe bestechen ließ. Sie bat nur um Freibilletts für das Theater, die ein Schriftsteller wie Andreas ihr doch wohl verschaffen könne. Andreas erklärte, dass nichts leichter sei, aber Libbenow sowohl wie Golem, der ihm doch vielfach verpflichtet war, vertrösteten ihn. Als nach vierzehn Tagen noch keine Freikarte zur Stelle war, verließ ihn die junge Wäscherin mit dem Ausdruck ihrer Geringschätzung und nicht, ohne die Rechnung auf seinen Tisch zu legen.
Im Oktober machte Andreas, entgegen seiner Gewohnheit, einsame Spaziergänge im Tiergarten, wo die Blätter fielen. Das »Café Hurra« vernachlässigte er. Mochten sie doch merken, dass er sie verachtete! Denn nachgerade fühlte er sich hierzu versucht. Waren sie denn eigentlich ein würdiger Verkehr für ihn, diese Leute, die meistens nicht einmal richtig Deutsch schrieben – soweit sie überhaupt etwas schrieben. Es ward ihm immer klarer: ihre Blasiertheit, die ihm anfangs als Überlegenheit gegolten hatte, war im Grunde nur der Ausdruck von Unwissenheit und Impotenz. Aber der ganze Berliner Ton kam schließlich bloß von Mangel an Tiefe. Sie ulkten, weil sie zu faul waren, auf die Dinge einzugehen. Er hatte genug davon. Das »Café Hurra« war für ihn eine Sackgasse, die niemals zu irgendeinem Ziele führen konnte. Keiner der dort kennengelernten Herren schien genug Einfluss zu besitzen, um ihn journalistisch zu fördern. Am Ende fehlte auch der gute Wille. Außer Golem, dessen schlechter Ruf seine Empfehlungen gefährlich machte, ließ keiner einen Neuling an seine Zeitung herankommen. In sechs Monaten hatte Andreas genau vierzehn Mark und fünfundsechzig Pfennig verdient, was ihm nicht hinreichend zur Begründung einer Zukunft deuchte. Das erste Studienjahr war darüber hingegangen, sein Wechsel lief jetzt noch zwei Jahre. Innerhalb des gegebenen Zeitraumes musste er es zu etwas bringen. Von dieser Notwendigkeit herausgestört, tauchte das Gespenst des Gumplacher Schulmeisters noch einmal vor ihm auf. Er wehrte es entrüstet ab. Aber was dann? Andreas vermochte auf diese Frage nur mit einem Seufzer zu antworten, und er hätte sich zweifellos seiner leichtsinnigen Untätigkeit aufs neue überlassen, wenn nicht eine kränkende Erfahrung ihn vollends aufgerüttelt hätte.
Er betrat am selben Abend das »Café Hurra« früher als die anderen und das Haupt umso höher erhoben, je tiefer ihm der Mut stand. Er machte die Runde um das fast leere Lokal und begrüßte das Fräulein am Büfett. Es war eine fade Blondine, Andreas hatte noch nie das Bedürfnis gefühlt, einen Angriff auf sie auszuüben. Heute aber glaubte er, dies seiner Würde schuldig zu sein. Kurz entschlossen legte er ihr den Arm um die Hüften. Das Mädchen, das sich hierdurch nicht angesprochen fühlen mochte, verzog die Mundwinkel in böse, scharfe Falten, sie versetzte dem jungen Mann einen heftigen Stoß gegen die Schulter und sagte mit Nachdruck:
»Jüngling, wie kommen Sie mir vor?«
Andreas sah sie eine Sekunde lang an, er war außerordentlich blass geworden. Darauf pfiff er durch die Zähne, drehte sich auf den Absätzen um und verließ gemessenen Schrittes den Raum.
Gleich den folgenden Morgen ging er zu Köpf, um sich mit ihm über seine nächsten Schritte zu beraten. Das »Café Hurra« war ebenso abgetan wie der Gumplacher Schulmeister. Wenn selbst jenes Mädchen, das ein halbes Jahr lang Zeuge seines vertrauten Umganges mit den Mitarbeitern der angesehensten Zeitungen gewesen war, ihm mit solcher empörenden Nichtachtung begegnen konnte, dann musste seine gesellschaftliche Stellung weniger glänzend sein, als er gewähnt hatte. Dies aber war dasjenige Bewusstsein, das er am wenigsten zu ertragen vermochte.
Er musste in Köpfs Zimmer, in der unteren Dorotheenstraße, einige Zeit warten und bemerkte darin eine gewisse Wohlhabenheit. Der breite Schreibtisch von Mahagoni und der bequeme, mit rotem Maroquin überzogene Lehnsessel wäre in keinem möblierten Zimmer anzutreffen gewesen. Die Wände wurden von hohen Büchergestellen verdeckt, angefüllt mit einem unglaublichen Plunder, vor dem Andreas staunend stand. Zerfetzte Pappbände und angefressene Lederrücken verbreiteten den Duft aller möglichen Trödlerbutiken. Eine alte Geschichte Ludwigs XIII. von Le Vassor füllte mit den Denkwürdigkeiten von Saint-Simon ein ganzes Fach. Weiterhin standen sogar die Kirchenväter. Andreas begriff nicht, welchen Zweck diese Dinge für jemand haben konnten, der Romane schrieb. Köpf beschäftigte sich, wie Libbenow wissen wollte, mit der Anfertigung von Romanen, die jedoch kein Mensch zu sehen bekam. Weiter wusste man von ihm schlechterdings nichts. Er erschien wöchentlich kaum einmal im »Café Hurra«, und dieser Umstand flößte Andreas in seiner jetzigen Lage Vertrauen ein, obwohl er es in letzter Zeit Köpf stark verdachte, dass er ihn überhaupt in jenen Kreis eingeführt hatte.
Es fragte sich jetzt nur, was er eigentlich von Köpf wollte. Andreas, den das Warten nervös machte, baute im Voraus einige schöne Sätze.
»Sie haben an der Entwickelung eines Ihnen völlig Unbekannten gleich anfangs so freundlichen Anteil genommen, dass ich, von neuen Zweifeln bedrängt, es nochmals wage, Sie um Ihren Rat und Ihre Hilfe zu bitten.«
Als die Periode fertig war, fand er sie albern. So sprach man nicht, besonders nicht in Berlin. Außerdem klang es falsch; er wollte Köpf doch nicht anpumpen.
Dieser erschien plötzlich in der Tür und begrüßte den Gast sehr erfreut.
»Ah, lieber Kollege!«
Andreas hatte einen Einfall:
»Wissen Sie, von dem ›Kollegen‹ hab’ ich schon bald genug«, sagte er und drehte sich halb um.
Köpf lächelte.
»Sie haben im ›Café Hurra‹ wohl ein Haar gefunden?«
»Mehrere.«
»Ich hätte Ihnen das voraussagen können. Aber es freut mich, dass Sie selbst dahintergekommen sind.«
Köpf blinzelte unschuldig. Andreas fand trotzdem, dass es eine Dreistigkeit sei, ihn in dieser Weise auf die Probe gestellt zu haben und es ihm jetzt ganz offen zu sagen. Der andere suchte seinen Unmut sofort zu beschwichtigen.
»Sie brauchen es nicht zu bereuen, diese scherzhafte Seite des Lebens unter Kollegen kennengelernt zu haben. Man muss dies tun, bevor man zu ernsteren Dingen übergeht. Nun wollen Sie aber Ernst machen?«
»Aber wie?« fragte Andreas ohne große Zuversicht.
»Oh, da gibt es verschiedene Wege, nämlich die Presse, das Theater und die Gesellschaft.«
»Sie vergessen die Literatur.«
»Durchaus nicht. Ich habe gesagt: das Theater, und eine andere Literatur gibt es bei uns nicht.«
Andreas nahm eine überlegene Miene an, denn er ertappte Köpf auf dem Ärger eines, der keinen Erfolg hat.
»Sie selbst schreiben doch wohl Romane?«
»Oh!« machte der andere mit gespitzten Lippen. »Reden wir lieber nicht davon. Ich schreibe für meinen Privatbedarf, es fällt mir nicht ein, das Unglück eines armen Verlegers herbeiführen zu wollen, der mir nie etwas zuleide getan hat und der etwa auf meine Werke hineinfiele.«
»Atem holen!« dachte Andreas, dem es Spaß machte, Köpfs Schwache zu beobachten.
»Inmitten eines Volkes«, fuhr dieser fort, »das durch alle Prügel der Welt nicht dazu bewogen werden könnte, ein Buch in die Hand zu nehmen, werden Sie also am besten tun, sich an das Theater zu halten.«
»Aber ich habe noch kein einziges Stück geschrieben!«
»Ist auch gar nicht nötig«, versicherte Köpf leichthin. »Das Theater hat zweifellos auch eine literarische Seite, aber die gesellige ist wichtiger. Beim Theater hat man es stets mit Menschen zu tun, in der eigentlichen Literatur doch schließlich nur mit Büchern. In der eigentlichen Literatur braucht man eine Menge Ernst, Abgeschlossenheit und Rücksichtslosigkeit; alles Eigenschaften, die beim Theater nur schaden können. Hier kommt es vor allem auf die gesellschaftlichen Verbindungen an. Sie aber, mein Lieber, sind ein Gesellschaftsmensch. – Soll ich Ihnen sagen, welches sichere Zeichen ich hierfür habe?«
»Bitte!«
»Man hat Sie im ›Café Hurra‹ nicht ernst genommen.«
Köpf sah mit seinem harmlosen Lächeln zu, wie Andreas zusammenzuckte.
»Seien Sie nicht böse!« bat er darauf. »Ich werde Ihnen dafür noch manches Schmeichelhafte zu sagen haben. Was Ihre Freunde im ›Café Hurra‹ betrifft: hat Pohlatz Ihnen jemals Grobheiten gesagt?«
»Nein, warum denn?«
»Nun, sehen Sie wohl. Wenn er Sie ernst genommen hätte, würden Sie alle Tage etwas an den Kopf bekommen haben. Sie glauben nicht, wie fein die Witterung dieser Leute ist, sobald sich ein Konkurrent blicken lässt. Sie, mein Lieber, sind keiner. Man hat gleich erkannt, dass Sie eine viel zu heitere, offene Natur sind, um sich mit Ingrimm und Püffen durch Literatur und Presse hindurchzuschlagen.«
»Ich glaube beinahe selbst«, bemerkte Andreas, der sich bemühte, blasiert auszusehen.
»Sie haben so etwas Glückliches an sich, das Sie beim Theater, das heißt in der Gesellschaft, ungemein rasch fördern wird. Man braucht dort nämlich nur glücklich zu erscheinen, um es sehr bald wirklich zu werden. Auch Ihre Harmlosigkeit, oder sagen wir, wenn Sie es lieber hören, Ihre scheinbare Harmlosigkeit wird Ihnen dort gut zustatten kommen. Man wird Sie in den reichen Salons ebensowenig ernst nehmen wie im ›Café Hurra‹, und es ist für Ihren Erfolg besonders wichtig, dass die Frauen Sie nicht ernst nehmen! Diese werden alles mögliche, was sie anderen nicht bewilligen würden, bei Ihnen für harmlos und ungefährlich halten. Sie sind dafür geschaffen, viel Glück bei den Frauen zu haben, mein Lieber!«
Diesmal blickte Andreas den anderen mit offenem Argwohn an. Aber aus Köpfs freundlichem Gesicht, das allerdings eine verdächtig spitze Nase zierte, war niemals klug zu werden. Für alle Fälle zeigte Andreas sich übellaunig, um nur nicht zuzugeben, dass er sich geschmeichelt fühle. Sein Glück bei Frauen, das er sich übrigens zutraute, schien ihm doch noch bewiesen werden zu müssen. Er gedachte der herben Enttäuschungen, die er dem Wäschermädchen und dem Büfettfräulein verdankte.
»Sie sagen mir eine Menge angenehme Dinge«, bemerkte er ziemlich trocken, »aber ich weiß noch immer nicht, wie Sie sich meine Karriere nun eigentlich denken. Was habe ich zu tun, wohin soll ich mich wenden?«
»Nehmen wir hinzu«, fuhr Köpf ohne zu antworten fort, »dass Sie als Rheinländer eine mehr heitere und ungezwungene Geselligkeit gewohnt sind. Inmitten der Furcht, sich lächerlich zu machen, die in Berlin Ursache aller Dummheit und Langeweile ist, werden Sie zunächst wohlwollend belächelt werden. Die Hauptsache ist, dass Sie auffallen.«
»Was habe ich zu tun, wohin soll ich mich wenden?« wiederholte Andreas ungeduldig.
»Wie? Das habe ich Ihnen noch nicht gesagt? Nun, ganz einfach: Sie gehen zum ›Nachtkurier‹, verlangen den Chefredakteur Doktor Bediener zu sprechen, und lässt er Sie vor, so gehen Sie nicht früher wieder weg, als bis er Ihnen unaufgefordert eine Empfehlung an Türkheimers gegeben hat.«
»Ah, Türkheimer! Das ist doch der mit Lizzi Laffé.«
»Sie kennen bereits die Verhältnisse?«
»Natürlich«, sagte Andreas stolz.
»Also Sie wissen Bescheid?« fragte Köpf, indem er dem jungen Manne zum Abschied die Hand schüttelte. »Unterrichten Sie mich doch vom Erfolge!«
Andreas versprach dies, fragte sich aber im geheimen, warum er alle die zweifelhaften Komplimente eigentlich angehört habe. Es konnte wohl sein, dass Köpf sich seit dem Augenblick, wo er ihn kennengelernt hatte, fortwährend über ihn lustig machte. Es war Andreas unmöglich, dies zu erfahren. Übrigens war es ja gleichgültig, sobald nur auch sonst niemand davon wusste. In seiner Lage, bei seinen mannigfachen inneren Zweifeln und der geringen Aussicht, es auf eine andere Weise zu etwas zu bringen, war es nun wohl das beste, Köpfs Rat blindlings zu befolgen. Er ging schon am nächsten Morgen, mit einem kalten Gefühl im Unterleibe, doch hocherhobenen Hauptes, zum Doktor Bediener.
III. Die deutsche Geisteskultur
Auf der Treppe, die er zur Redaktion des »Berliner Nachtkurier« hinaufstieg, blendete den jungen Mann der ganz neue und doch bereits arg besudelte Teppich. Alles im Hause war reich und durch den regen Geschäftsbetrieb mitgenommen. Jünglinge mit kotbespritzten Beinkleidern, sonst sehr elegant, hasteten an dem Besucher vorüber. Droben in dem großen Wartezimmer schob sich eine beträchtliche Menschenmenge durcheinander. Andreas, der gegen die Wand gedrängt wurde, blickte durch eine Glasscheibe in einen langen, kahlen Saal hinein, wo ungefähr dreißig junge Leute an Pulten saßen. Einige lasen Zeitungen, andere plauderten, indes sie Bleistifte spitzten oder ihre Nägel pflegten.
Eine Flügeltür ward aufgestoßen, und ein reich aussehender Herr mit rasierter Oberlippe und rotblonden Koteletten, den Hut in der Stirn, rief ins Vorzimmer hinein:
»Kommt denn der Chefredakteur nicht?«
Der herbeieilende Redaktionsdiener verbeugte sich:
»Muss sofort da sein, Herr Generalkonsul!«
»Endlich, mein lieber Doktor!« rief der Herr und streckte die Hand mit matter Anmut einem großen, eleganten Manne entgegen, der von der Treppe her eintrat und dem Diener Hut und Paletot1 zuwarf. Bevor die beiden hinter der Flügeltür verschwanden, hörte man den Generalkonsul fragen:
»Sie waren im Auswärtigen Amt? Nun, was sagt unser Minister?«
Andreas erschauerte vor Ehrfurcht, während er bedachte, welche Unendlichkeit von Macht und Ansehen diese Worte ahnen ließen. Wer hier im Vorzimmer des »Nachtkurier« stand, war gewissermaßen in den Bereich einer Organisation eingetreten, die es an Ausdehnung und Festigkeit selbst mit der des Staates aufnahm. Doktor Bediener ging im Palais der Wilhelmstraße aus und ein wie der Staatssekretär selbst. Sein Kollege war ein Minister des Innern, dem kein Wille im Lande leichtfertig zuwiderhandelte. Die Ämter waren verteilt genau nach dem Vorbilde des Staates, von den Botschaftern in allen Hauptstädten der Welt bis hinab zu jener Schar von überschüssigen kleinen Beamten, unbezahlten Referendaren, die ihre Bleistifte spitzten und sich die Nägel pflegten. Hoch über dieser unpersönlichen Verwaltungsmaschine aber, hinter dem Gehege der Gesetze und gedeckt durch die Verantwortlichkeit seiner Minister, die er berief und entließ, thronte der große Jekuser, der Besitzer des »Nachtkurier«, ein konstitutioneller Monarch. Von den Tagesmeinungen unabhängig wie andere gekrönte Häupter, bewahrte er dennoch einen unbeschränkteren Einfluss als diese, da er sogar die Volksvertreter vermöge seines »parlamentarischen Büros« zu zensieren und zu maßregeln vermochte. Und er war reicher als sie, denn von den Abgaben seines Volkes, von den fünfzehn Pfennigen, die Hunderttausende von Lesern täglich erlegten, blieb der größere Teil in seiner Tasche zurück.
Die Flügeltür öffnete sich halb, ohne dass jemand sichtbar wurde. Aber in der wartenden Menge pflanzte sich sogleich ein Stoß fort, den schließlich der gegen die Wand gedrückte Andreas vor die Brust erhielt. Er griff hastig in die Tasche, die seine Papiere enthielt. Glücklicherweise fand sich der Brief des Herrn Schmücke noch vor. Seit einem Jahre hatte der junge Mann nicht mehr des Empfehlungsschreibens gedacht, das ihm der alte Herr in Gumplach, der sich mit Literatur befasste, an den Doktor Bediener mitgegeben hatte. Andreas kam mit zu großer Ehrfurcht vor den Mächtigen der Erde nach Berlin, um sich gleich anfangs bis zu einem von ihnen vordrängen zu wollen. Herr Schmücke war gewiss ein braver liberaler Bürger, aber ob der Chefredakteur des »Nachtkurier« auf seine Empfehlung großes Gewicht legen würde, war mehr als zweifelhaft. Um den Brief nicht unbenutzt zu lassen, übergab Andreas ihn einem vorübergehenden Diener, der mit einer Handvoll Depeschen das Erscheinen des Chefs erwartete. Gleich darauf verabschiedete sich der Generalkonsul, den Doktor Bediener bis zur Treppe begleitete. Andreas verfolgte mit scheuem Blick jede Bewegung des Mannes, von dem sein Schicksal abhing. Er sah ihn mit einigen jungen Leuten, die zunächst an seinem Wege standen, leise Worte wechseln und nachdenklich, die Hand, auf der ein großer Brillant blitzte, an seinem grauen Spitzbart, in seinem Kabinett verschwinden. Welche betäubende Fülle von Geschäften und wie wenig Hoffnung für einen bescheidenen Neuling, hier ans Ziel zu gelangen! Doch schon nach wenigen Minuten trat ganz unerwarteterweise derselbe Diener, dem Andreas seine Empfehlung anvertraut hatte, auf den jungen Mann zu, um ihn zum Eintritt in das Büro des Herrn Chefredakteurs aufzufordern. Andreas durchschritt blutübergossen die Reihen der Wartenden. Er meinte, die Bevorzugung, die ihm zuteil ward, müsse jedermann auffallen.
Und dann führte er eine möglichst korrekte Verbeugung vor Doktor Bediener aus, der ihm lächelnd die Hand mit dem Brillanten entgegenstreckte.
»Sie sind mir als ein sehr aussichtsreiches Talent empfohlen, Herr – re…«
»Zumsee«, ergänzte Andreas.
»Herr Zumsee«, wiederholte Doktor Bediener.
Er wies auf einen Sessel, und Andreas, der dem Leiter des »Nachtkurier« gegenüber Platz nahm, sagte sich, dass der Empfang gar nicht günstiger hätte sein können. Doktor Bediener begann wieder:
»Die Empfehlung, die Sie geltend machen, ist mir besonders wertvoll, weil sie von einem langjährigen, lieben Freunde kommt. Ich hoffe, es geht meinem alten Schmücke gut?«
Andreas erteilte befriedigende Auskunft über die Gesundheit des alten Herrn. Aber er erfuhr mit Erstaunen die nahen Beziehungen des Chefredakteurs zu Schmücke, der sich deren nie gerühmt hatte.
»Ich meine sogar, Ihren Namen schon irgendwo gefunden zu haben, Herr, Herr – re…«
»Zumsee«, ergänzte Andreas.
»Herr Zumsee«, wiederholte Doktor Bediener, und er strich mit zwei gespreizten Fingern suchend über seine hohe Stirn. Dachte er an den »Gumplacher Anzeiger«? Andreas hätte gern von seinen Erfolgen und Hoffnungen, von den Gedichten, der Novelle, Köpf, dem »Café Hurra« und Türkheimer des längeren gesprochen. Aber durch die ungeahnte Liebenswürdigkeit des mächtigen Mannes ward in ihm ein solches Entzücken erregt, dass er, minutenlang stumm und rot vor heftiger Schwärmerei, den Doktor Bediener ansah.
Nie im Leben hatte Andreas solche ausgesuchten Manieren kennengelernt, solche weltmännische Haltung, solche natürliche Glätte in jeder Bewegung, jedem Blick und jedem Worte. Doktor Bediener saß ein wenig seitwärts über die Lehne geneigt, auf die er einen Arm stützte. Mit dem anderen beschrieb er zuweilen eine flüchtige, doch unnachahmlich runde Geste, die alles zu erklären schien, was er andeuten wollte. Sein Lächeln war offenbar so ganz für sein Gegenüber bestimmt, dass dieses sich nicht denken konnte, er werde je einem anderen so viel Aufmerksamkeit schenken. Er sprach zögernd, mit leicht verschleierter Stimme und ließ das R weit hinten im Halse verschwinden, was distinguiert klang. Er mochte mit einem armen jungen Manne noch so familiär tun, ohne es zu wollen, bewahrte Doktor Bediener in seinem ganzen Wesen stets eine so vornehme Zurückhaltung, dass es Andreas vorkam, als steige er aus einer höheren Diplomatensphäre hernieder, wohin er jeden Augenblick entrückt zu werden drohte.
Er ließ die Frage, wo er Andreas’ Namen schon gefunden haben mochte, nach einiger Überlegung auf sich beruhen, um sich zu erkundigen:
»Haben Sie schon literarischen Anschluss gefunden?«
»Es ist mir als ganz unbekanntem Anfänger sehr schwer gefallen«, erwiderte Andreas bescheiden.
»Ich kenne ein paar Redakteure, zum Beispiel Doktor Pohlatz.«
»Oh, Pohlatz«, sagte Doktor Bediener mit einer Handbewegung, die nicht viel Hochachtung auszudrücken schien. Doch setzte er hinzu:
»Ich schätze Pohlatz persönlich hoch, ich kann sogar sagen, dass wir recht gute Freunde sind.«
»Schon wieder jemand, mit dem ich verkehrt habe, ohne zu wissen, dass er mit dem Chefredakteur des ›Nachtkurier‹ befreundet ist«, dachte Andreas.
»Nur möchte ich Ihnen davon abraten«, fuhr Doktor Bediener fort, »an seinem Blatte mitzuarbeiten. Es würde für Sie wenig Wert haben – dies unter uns.«
Andreas verbeugte sich, voll Vergnügen über die vertrauliche Mitteilung, deren er gewürdigt wurde. Wie gut, dass Pohlatz gar nicht daran gedacht hatte, ihn beim »Kabel« einzuführen! Er lauschte atemlos auf Doktor Bedieners Belehrung.
»Alle diese Blätter mit strenger Parteirichtung taugen nichts für ein aussichtsreiches Talent«, sagte der Chefredakteur. »Sie würden sich dort kompromittieren, ohne für den Verlust Ihrer Selbstständigkeit entschädigt zu werden. Bei uns dagegen, wissen Sie wohl, behält jeder Mitarbeiter seine Eigenart. Der ›Nachtkurier‹ hat vor allen anderen erkannt, dass die Parteipresse sich überlebt hat. Dass man eine gesunde liberale Wirtschaftspolitik vertritt, versteht sich von selbst; wir wären verrückt, wenn wir es nicht täten. (Hier vollführte Doktor Bediener eine Armbewegung, die einer längeren Parenthese gleichkam.) Im Übrigen betrachten wir uns als ein Organ der deutschen Geisteskultur.«
Doktor Bediener hielt an; er war beinahe warm geworden. Aber er erlangte sofort sein vornehmes Gleichgewicht wieder, dessen augenblickliches Abhandenkommen Andreas in seiner Hingerissenheit gar nicht bemerkt hatte. Der Chefredakteur betrachtete den Eindruck, den er auf den jungen Mann machte, mit Wohlwollen. Er lächelte sogar, denn er hatte die Bemerkung gemacht, dass Andreas’ Blick, der zwischen dichten und langen Wimpern hervorkam, in seiner Treuherzigkeit merkwürdig einschmeichelnd sei, und dass die bedingungslose Verehrung, die er ausdrückte, einer Dame überaus angenehm sein müsse. Flüchtig dachte er sogar an Frau Türkheimer. Er zögerte noch, denn der misslungene schwarze Rock, der dem gut gewachsenen Jüngling etwas Ungeschicktes gab, forderte zur Vorsicht auf. Das Haar war erbärmlich geschnitten, doch trug Andreas den Kopf recht gut. Dann entschloss sich Doktor Bediener.
»Sie sollten sich vor allem beim Theater einführen, ich meine in den Kreisen, die dem Theater nahestehen.«
»Schon wieder das Theater«, dachte Andreas. »Es muss doch etwas damit los sein.«
Er öffnete den Mund, aber Doktor Bediener schnitt seinen Einwand ab.
»Sie werden noch nichts für die Bühne geschrieben haben, das tut nichts zur Sache. Man erobert die Welt nicht mehr von der Schreibstube aus. Auch der Schriftsteller muss heutzutage mit seiner Person eintreten. Sie werden sich in der Gesellschaft umsehen müssen.«
»Kommen jetzt Türkheimers?« fragte sich Andreas.
Aber der Chefredakteur zögerte wieder.
»Halten Sie sich vorläufig an uns«, sagte er. »Unsere Sonntagsbeilage ›Die Neuzeit‹ steht den jungen Talenten offen. Schicken Sie uns etwas, und nach zwei, drei Versuchen rechnen wir Sie zu unseren Hausdichtern, die bei den Bühnen natürlich einen Vorsprung haben. Das ist das, was ich Ihnen versprechen kann.«
Die letzten Worte sprach er langsamer, er schien auf etwas zu warten. Aber Andreas sah schon die Spalten des »Nachtkurier« zu seinem Empfange weit geöffnet. Seine sanguinischen Hoffnungen wurden alle wieder wach. Es ward ihm ganz heiß, und ohne sich zu bedanken, versetzte er:
»Herr Doktor, ohne die große unverdiente Güte, die Sie mir entgegenbringen, würde ich nie gewagt haben, Sie darum zu bitten, verzeihen Sie, dass ich es jetzt wage: würden Sie mich als Volontär aufnehmen?«
Doktor Bedieners Miene drückte plötzlich tiefe Besorgnis aus.
»Sie irren sich«, sagte er. »Ich meine es mit den jungen Leuten, die mir empfohlen sind, zu gut, um sie auf die von Ihnen bezeichnete Art kaltzustellen. Haben Sie die dreißig Unglücklichen gesehen, die dort drüben die Zeit totschlagen?«
Andreas begriff, dass das Fenster im Wartezimmer zu seiner und seinesgleichen Abschreckung angebracht sei.
»Wen Herr Jekuser dort hinsetzt, das geht mich nichts an«, fuhr Doktor Bediener fort. »Aber ich sehe, dass man dort durch das viele Herumlungern faul und unbrauchbar wird. Wer es am längsten ausgehalten hat, bringt es schließlich zu einer kleinen Anstellung bei einem Provinzblatt. Beschränken sich Ihre Träume darauf? – Nein, mein Lieber«, so schloss der Chefredakteur, »wir haben es besser mit Ihnen im Sinn. Was wir Ihnen versprechen können, habe ich schon gesagt. Sie wissen ja, welcher wirksamen Empfehlung Sie unser Wohlwollen verdanken.«
Bei jedem der von Doktor Bediener gebrauchten, geschäftsmäßig kühlen »wir« überrieselte es Andreas kalt. Er ward sich bewusst, dass seine persönliche Unterredung mit einem hohen Gönner beendet sei, und dass er sich nur noch als namenloser Bittsteller einem Mächtigen gegenüber befinde. Und dies bloß infolge seiner plumpen Ungeschicklichkeit; weil er durch eine dumme Bitte den ganzen schönen Erfolg des bisherigen Gespräches zerstört hatte! Nun fühlte er Doktor Bedieners Blick mit der deutlichen Ankündigung auf sich ruhen, dass die Audienz beendet sei. Und nun wandte sich der Chefredakteur ganz unverhohlen der Stutzuhr auf dem breiten Schreibtische zu. Der arme junge Mann biss sich auf die Lippen. Er war bleich und verwirrt, doch fest entschlossen, sich lieber vom Redaktionsdiener hinaussetzen zu lassen, als unverrichteter Dinge freiwillig zu gehen.
»Ich habe nichts mehr zu riskieren«, sagte sich Andreas. »Gehe ich jetzt, so hinterlasse ich den denkbar schlechtesten Eindruck.« – »Ich muss die Empfehlung an Türkheimer haben«, wiederholte er sich hartnäckig und starrte auf den hellgeblümten englischen Teppich, der den Boden des Zimmers bedeckte. Er wollte ein niedrig hängendes Ölgemälde betrachten, doch versagte ihm der Mut. Sein Blick wagte sich nicht höher als bis zu Doktor Bedieners Lackschuhen und den weißen Gamaschen, über die das graue Beinkleid mit unsäglicher Eleganz herabfiel. Wäre der Chefredakteur nur ein beliebiges großes Tier gewesen, vor dem ein armer junger Mann wie Andreas im Staube kriechen musste! Aber er gebot ihm Achtung als Persönlichkeit; darin lag das Demütigende. Vor Erregung ward Andreas von Ohrensausen befallen. Dazwischen hörte er Doktor Bediener auf den Rand des Schreibtisches trommeln. Er warf einen ängstlichen Blick von unten herauf, die Situation war nicht länger haltbar. Aber zu seiner Verwunderung drehte der Chefredakteur Herrn Schmückes Brief in der Hand. Er sah sogar mit einem halben Lächeln darüber hinweg auf den jungen Mann, dessen Standhaftigkeit ihm schließlich vielleicht Achtung abgewann. Der schwarze Rock musste allerdings mit in den Kauf genommen werden. Dennoch überwog das Empfehlende in Andreas’ Erscheinung. Auch war Herr Schmücke Gumplachs gewichtigster liberaler Wähler.
»Die gesellschaftlichen Verbindungen«, sagte Doktor Bediener, »betrachte ich, wie gesagt, als eine Hauptsache. Ich bin auch gern bereit, Ihnen den Anfang zu erleichtern. Warten Sie, ich werde Sie an ein Haus empfehlen, wo die aussichtsreichen Talente stets mit Wohlwollen aufgenommen werden. Die Hausfrau sammelt die Blüte unserer kunstsinnigen Gesellschaft um sich, Sie werden einflussreichen Leuten begegnen. Profitieren Sie von dem Ton, der bei Türkheimers herrscht, lieber Freund!«
Damit übergab er Andreas die Visitenkarte, die er während des Sprechens mit ein paar Zeilen beschrieben hatte. Der junge Mann sprang auf. In dem Stolz, den er über die Erreichung seines Zieles empfand, steckte er den kostbaren Umschlag so flüchtig in die Brusttasche, als käme es ihm gar nicht darauf an. Dieser Zug mochte den Beifall des Chefredakteurs finden, der die Hand auf Andreas’ Schulter legte und ihn sehr freundlich zur Tür geleitete. Im Vorzimmer konnte jedermann hören, wie Doktor Bediener zu dem sich Verabschiedenden sagte:
»Auf Wiedersehen, lieber Freund!«
»Merkwürdig«, dachte Andreas, der blind vor Glück die Treppe hinabeilte, »ich meinte schon, es ganz mit ihm verdorben zu haben, und jetzt bin ich gar sein lieber Freund, wie Schmücke und Pohlatz. Nur nicht ängstlich!« sagte er sich triumphierend, aber auf dem Treppenabsatz rannte er mit einem heraufstürmenden Menschen so heftig zusammen, dass beide sich aneinanderklammern mussten, um nicht umzufallen.
»Warum sagen Sie das nicht gleich?« versetzte der Fremde, während sie sich umarmt hielten. Dann hob er die Blume auf, die seinem Knopfloch entglitten war.
Trotz ihrer stürmischen Begegnung empfing Andreas einen günstigen Eindruck von dem anderen. Es war ein mittelgroßer, untersetzter junger Mann, der einen Zylinder trug. Seine Kleidung war ziemlich elegant, von einer Allerweltseleganz, die nirgends auffallen konnte. Sein Gesicht zeigte ebenfalls nichts Hervorstechendes, er konnte einen mit seinem forschenden Hundeblick ansehen und einem gerade unter der Nase umherschnüffeln, ohne dass man dies unverschämt fand. Er hatte etwas so Heiteres und Gutmütiges an sich, dass man ihn gewiss anstandslos überall einließ, ihm alles mögliche anvertraute und dabei gar nicht auf ihn achtete. Was wäre für einen Reporter wünschenswerter? Schon wie er Andreas liebenswürdig beiseite schob, um sich Platz zu machen, war es deutlich, dass er überall durchkommen und alles erfahren musste, was er wollte, ohne auf Hindernisse zu treffen. So unpersönlich wie er aussah, war ein Zusammenstoß mit ihm eigentlich gar keiner.
Er stieg zwei Stufen höher, kam aber eilig zurück und sagte:
»Ach, Pardon, hörensemal! Da wir nun doch Bekanntschaft gemacht haben, können Sie mir vielleicht sagen, ob der Chef guter Laune ist. Sie kommen doch vom Chef.«
»Ich war beim Doktor Bediener«, bestätigte Andreas.
»Können Sie mir sagen, was Sie da gemacht haben?« fragte der andere, und er schlug dabei einen so freundschaftlich zusprechenden Ton an, dass Andreas sofort die Überzeugung gewann, er könne im eigenen Interesse nichts Besseres tun, als dem Fremden sagen, was er beim Doktor Bediener gemacht habe.
»Nun, ich war an den Chefredakteur empfohlen«, versetzte er.
»Aha, Sie sind wohl ein neuer Kollege. Sehr erfreut!«
Er schüttelte Andreas die Hand, verbeugte sich und sagte:
»Kaflisch, vom ›Nachtkurier‹.«
»Andreas Zumsee.«
»Volontär, was?«
»Doch nicht«, sagte Andreas stolz ablehnend, als habe er nie den Wunsch gehegt, als Hilfsarbeiter in die Redaktion einzutreten.
»Dann hat er Ihnen wohl die Mitarbeit an der ›Neuzeit‹ angeboten?«
Andreas sah den schlau lächelnden Journalisten an. Kaflisch nahm die Überraschung des Neulings für eine Antwort und fragte weiter:
»Sagensemal, hat er Sie auch an Türkheimers empfohlen?«
»Na, herzlichen Glückwunsch!« sagte er, als Andreas bejahte. »Ein feines Haus und ’ne schöne Frau.«
Er schmatzte dabei so stimmungsvoll, dass Andreas plötzlich allerlei dunkle Begierden empfand.
»Und besten Dank, sehr geehrter Herr. Wenn der Alte einen zu Türkheimers schickt, dann ist er unfehlbar guter Laune. Dann kann ich ihm mit meinen Geschichten kommen. Es ist ja ’n Elend, nie mehr als zehn Pfennige für die Zeile und dabei noch den Staat erhalten! Jetzt will ich vor den Gerichtsvollziehern nach Breslau flüchten, wissense, wo jetzt der Lustmordprozess anfängt. Bediener gibt mir die Berichterstattung, passense mal auf. Wenn er zu Ihnen so nett ist und Sie zu Türkheimers schickt, dann tut er mir auch ’ne Liebe. Na, Mahlzeit, und viel Vergnügen! Auf Wiedersehen!«
Er war schon droben im Vorzimmer verschwunden, als Andreas ihm noch nachschaute. Dieser Kaflisch befremdete ihn zwar etwas, aber sein Wesen war nicht gerade abstoßend. Er versöhnte mit seiner zudringlichen Neugier dadurch, dass er auch in seinen eigenen Angelegenheiten keine Diskretion kannte.
Auf der Straße wandte sich Andreas um und sah zur Fassade des Hauses empor, über die die Inschrift »Berliner Nachtkurier« in mächtigen Relieflettern quer hinüberlief. Der Augenblick schien ihm feierlich, er fühlte, dass hier die ihm vorgeschriebene Laufbahn begann.
Zu Hause ging er sofort an die Sichtung seiner Garderobe. Es hatte seine Schwierigkeit, einen passenden Visitenanzug zusammenzustellen, da jedes der hellen Beinkleider den einen oder anderen Mangel aufwies. Seufzend entschloss sich der arme junge Mann zu der Frackhose, die zusammen mit dem verunglückten schwarzen Rock schon dem Doktor Bediener unvorteilhaft aufgefallen war. Andreas hatte dies wohl bemerkt. Er besaß ein angeborenes Verständnis für gute Kleidung, das sich in Berlin rasch ausgebildet hatte. So oft er über die Friedrichstraße ging, fing er den wohlwollenden Blick irgendeines hübschen Mädchens auf, den sie aber eilig zurückzog, sobald sie den Rock des jungen Mannes abgeschätzt hatte. Diese schlanken, blonden Mädchen, die am Arm kleiner geschniegelter Herren mit blanken Zylindern auf schwarzgelockten Häuptern dahinwandelten, ahnten nicht, wie tief sie Andreas verwundeten. Heute, wie schon oft, studierte er lange in seinem Rasierspiegel, und er sah besser als jeder andere, warum der Anzug, der doch wenig getragen war, ihm so etwas traurig Ungeschicktes verlieh. Der Gedanke, dass in ganz Berlin kein Schneider auf sein Glück und Talent vertrauen und ihm Kredit geben würde, drückte ihn tief danieder und hielt ihn zwei Tage von dem Besuche bei Frau Türkheimer ab.
Mit dem Mute der Verzweiflung schlug er endlich den Weg in die Potsdamer Straße ein. Er ging die Königin-Augusta-Straße entlang und bog entschlossen in die Hildebrandt-Privatstraße ein, eine stille mit Sand bestreute Allee, die an beiden Enden durch ein Gitter abgeschlossen war. Das Palais Türkheimer fiel als das großartigste unter den Gebäuden jedem Passanten auf. Es war in einem deutschen Renaissancestil erbaut, den man auf seine Echtheit nicht näher ansehen durfte. Andreas schellte an dem reichen bronzenen Gartentor, und es öffnete sich ohne das Erscheinen eines Menschen. Einsam wie der Märchenprinz, der ein verwunschenes Schloss erobert, schritt der junge Mann über eine Art von Burghof, betrat eine majestätische Freitreppe und stand vor der eleganten Glastür, die in die Wölbung des kunstvoll gemeißelten Portals von profanen Händen eingefügt schien.
Die Tür ging auf, doch der grün-silberne Lakai, der Andreas entgegentrat, besaß die Macht, den mutigen Eroberer von der Schwelle seines Paradieses zurückzuscheuchen. Er sagte, dass die gnädige Frau nicht zu Hause sei. Unter dem ersten Eindruck dieser Nachricht übergab ihm der junge Mann seine Karte und das Billett des Doktor Bediener. Gleich darauf fiel ihm ein, dass er dies nicht hätte tun sollen. Er blickte bleich vor Wut dem Diener in das unverschämte Gesicht und stand im Begriffe, einen Schlag hineinzuversetzen. »Wenn es nicht meinem Interesse zuwiderliefe«, sagte er sich, »würde ich es tun. Übrigens kann ich ihm seine Unverschämtheit nicht nachweisen, sie ist versteckt wie immer bei solchen Menschen.«
Er ging mit der Last seiner vernichteten Hoffnung auf der Brust die Straße zu Ende und befand sich am Tiergarten. Zwei Stunden lang trieb ihn sein enttäuschter Ehrgeiz in den entlaubten Wegen umher. Er fühlte sich so leer und ziellos wie an dem Tage, als er mit dem »Café Hurra« zu brechen beschloss. Aber inzwischen hatte er Schritte getan, die nicht so leicht zu wiederholen waren. Wenn nun der freche Lakai, der ihn wie einen stellungsuchenden Kandidaten gemustert hatte, die Karte des Chefredakteurs nicht abgab?
Aber schon am folgenden Morgen erhielt Andreas mit der Post eine Einladung zum Abend des zehnten November von Frau Adelheid Türkheimer.
leichter, zweireihiger Herrenmantel <<<
IV. Türkheimers
Andreas Zumsee erschien, weil er dies für vornehmer hielt, sehr spät auf der Soiree in der Hildebrandtstraße. An dem bronzenen Gatter, das diesmal weit aufstand, stieß ein majestätischer Portier seinen Stab auf den Boden. Andreas blickte ihm ins Gesicht, es drückte aber nur imposante Kälte aus. Der Lakai, der ihm seinen Mantel abnahm, war zufällig derselbe, den er kannte. Andreas sah ihn nicht einmal an. »Du hast mich nicht hindern können, herzukommen«, dachte er.
Das Selbstbewusstsein, mit dem er seinen Eintritt vollführte, erstickte seine geheime Verlegenheit, machte ihn aber auch unvorsichtig. Alsbald stieß ihm ein kleines Unglück zu. Neben der Garderobe lag ein Vorzimmer, das Andreas auf den ersten Blick für leer hielt. Er betrat es, ohne sich anzukündigen, aber schon nach zwei Schritten stand er auf der Schleppe eines Abendmantels. Es war ein Mantel aus gelber Seide mit Brokatstickerei, gefüttert mit Satin-Duchesse. Und Andreas konnte sich nicht schnell genug zurückziehen, um nicht mehr zu bemerken, dass die Besitzerin des Mantels von dem jungen Manne, der ihn ihr abnahm, einen Kuss empfing. Es war eine große starke Blondine, und das wütende Gesicht mit der aufgestülpten Nase, das sie Andreas zuwandte, erfüllte ihn mit solchem Schrecken, dass er unter gestammelten Entschuldigungen recht kläglich beiseite schlich.
Gleich darauf, wie er die Treppe zum ersten Stock hinanstieg, fielen ihm die geistreichsten Wendungen ein, mit denen er sein Ungeschick hätte gutmachen können. Ganz zerschlagen von dem Bewusstsein, der Lage nicht gewachsen gewesen zu sein, ließ er sich durch zwei Säle von einem Strom von Gästen fortziehen, der ihn an das Büfett führte. Im Gedränge stieß er einem distinguiert aussehenden alten Herrn heftig gegen die Schulter und brachte nicht einmal mehr ein Wort der Abbitte hervor, ganz entsetzt über sein neues Missgeschick. Indes sagte der alte Herr verbindlich »Pardon« und reichte Andreas Teller und Besteck. Der arme junge Mann gewahrte jetzt die seidenen Strümpfe des Haushofmeisters und wandte sich mit blutrotem Gesicht hinweg.
Vor ihm standen Kübel mit Sektflaschen. Ein Diener wartete auf seinen Wink, um ihm einzuschenken. Aber Andreas befürchtete, man möchte ihm ansehen, dass er noch niemals Champagner genossen habe. Er wollte einen Wein wählen, als man hinter ihm lachte. Die verschiedenen Demütigungen, die er in so kurzer Zeit erlitten hatte, brachten ihn außer sich, er war im Begriffe, seine Zukunft durch einen Skandal zu verderben. Sehr bleich drehte er sich nach zwei Herren in seiner Nachbarschaft um, er war entschlossen, den ersten, der ihn schief anzusehen wagte, zu ohrfeigen. Als die beiden jedoch sein Gesicht bemerkten, schienen sie es gar nicht gewesen zu sein. Der eine von ihnen sprach Andreas an, und auch das stärkste Misstrauen konnte in seiner Stimme nur ruhige Höflichkeit entdecken.
»Ich rate Ihnen zu dem Chablis dort«, sagte er. »Es ist das Feinste, was hier zu haben ist.«
Andreas dankte und trank mit wiedergewonnener Fassung mehrere Gläser. Da der Wein in einen nüchternen Magen gelangte, brachte er bald die freundlichste Wirkung hervor. Als Andreas den letzten Tropfen getrunken hatte, triumphierte er. »Die beiden Jobber haben vor meinem Gesicht Furcht gehabt«, sagte er sich.
Er empfand das Bedürfnis, zu sprechen; man schien sich hier ja unbekannterweise anzureden.
»Da ist ja Kaflisch!« rief er plötzlich, als begrüßte er einen lange vermissten Freund. Der Journalist zeigte sich am Arm eines korpulenten Herrn mit kurzem schwarzen Spitzbart, schweren Lidern und von dem Aussehen einer bedeutenden Persönlichkeit. Andreas meinte ihn zu erkennen.
Kaflisch musterte den Fremdling. Als er ihn in seinem Gedächtnis untergebracht hatte, schüttelte er ihm die Hand.
»Freut mich, Sie wiederzusehen. Nu sehnsewoll, wie ’ne Empfehlung von unser’m Alten hier wirkt?«
»Famos!« sagte Andreas. Er fühlte sich unternehmungslustig. Er erkundigte sich:
»Wissen Sie nicht, wo die Hausfrau ist?«
»Kommen Sie von Ratibohr?« fragte der korpulente Herr. Der junge Mann stutzte.
»Nein, von Gumplach«, erwiderte er.
Der Herr lächelte ihn wohlwollend an. Kaflisch brach in Gelächter aus.
»Goldherz meint, ob Sie der Hausfrau von Herrn Ratibohr was zu sagen haben. Sie wollen sich ihr wohl nur vorstellen? Hat ja gar keinen Zweck.«
Der korpulente Herr folgte gelangweilt dem Ruf eines Bekannten. Kaflisch nahm Andreas’ Arm wie den eines Jugendfreundes.
»War das der berühmte Verteidiger?« fragte der junge Mann.
»Ihn selbst haben Ihre sterblichen Augen gesehen. Wissense, den müssen Sie kennenlernen.«
Im Mentorton setzte Kaflisch hinzu:
»Von denen, die hier sind, kann keiner sagen, dass er ihn nicht eines Tages nötig haben wird.«
»Wie geht es Ihnen sonst?« fragte er gleich darauf. »Ist Bediener nett zu Ihnen?«
»Sehr«, sagte Andreas. »Vorigen Sonntag ist was von mir erschienen.«
»Aha, das Gedicht in der ›Neuzeit‹.«
»Haben Sie es gelesen?«
»Das können Sie nicht verlangen. Aber von jedem aussichtsreichen Talent, das an den Alten empfohlen ist, bringt die ›Neuzeit‹ ein Gedicht. Auf das zweite können Sie lange warten. – Da haben Sie Asta«, setzte er schnell hinzu, stieß Andreas an und wandte sich unverfroren nach einer vorübergehenden Dame um.
»Wer, Asta?« fragte Andreas, der Kaflisch’ Beispiel folgte. Aber seine weinselige Aufgeräumtheit rächte sich sofort, er trat der Dame auf die Schleppe, und sie zeigte ihm ein Gesicht voller Verachtung.
»Nu haben Sie sie doch mal angesehen«, sagte Kaflisch freundlich. Die Dame ging weiter, einem langen, blonden Herrn mit schütterm Bart entgegen, der ihr über den Köpfen der Menge, hinten an der Tür zuwinkte.
Andreas war jetzt nicht mehr so leicht aus der Fassung zu bringen. Er fragte, übermütig lachend:
»Sagen Sie doch, wer ist denn die Asta?«
»Die Tochter vom Hause, mein junger Freund. Und wenn die hier spazierengeht, so können Sie glauben, dass die Mutter ganz wo anders ist.«
»Warum?« fragte Andreas. Er war doch leicht erschrocken.
»Warum? Die liebe Unschuld! Asta ist ’n Mädchen mit Grundsätzen, das heißt, sie geht à la Ibsen frisiert, modernes Weib, mehr intellektuell als Geschlechtswesen, verstehnse mich, sehr geehrter Herr?«
Kaflisch sprach mit der Nase dicht an Andreas’ Mund und sehr laut. Es lag ihm offenbar nichts daran, sein Licht unter den Scheffel zu stellen. Um sie her fing man an zu lachen. Andreas fühlte die Aufmerksamkeit auf sich gerichtet, was ihm schmeichelte.
»Und die Mutter?« fragte er mit erhobener Stimme, während sie weiterschlenderten.
»Die ist ’ne gute Frau«, erklärte Kaflisch leichthin. »Sogar zu gut gegen uns junge Leute.«
»Ich verstehe«, sagte Andreas mit einer Betonung, die er für vielsagend hielt.
»Kommt dort nicht Lizzi Laffé?« fragte er. Der Name jener Dame, die er schon im Vorzimmer durch seine Indiskretion beleidigt hatte, war ihm zu seinem Schrecken eingefallen. Er kannte sie von der Bühne her, der sie angehörte, und Lizzis Beziehungen zu Türkheimer waren im »Café Hurra« des öfteren erörtert.
»Abend, Lizzi«, sagte Kaflisch, der ihr im Vorübergehen die Hand schüttelte. Sie bemerkte Andreas gar nicht, der voll Ehrfurcht feststellte, dass ihre Toilette, seit sie den gelbseidenen Mantel abgelegt, an Prunk noch nichts verloren hatte. Er schaute ihr vorsichtig nach, wie sie in ihrer alle einschüchternden Üppigkeit, mit Brillanten übersät, am Arm desselben Herrn dahinschritt, mit dem er sie überrascht hatte. Es war ein geschniegelter junger Mann, mit bartlosem, doch herausforderndem Gesicht, breitschultrig, beleibt und von der Haltung eines Korpsstudenten.
»Also Lizzi ist auch da!«
Andreas bemühte sich, recht harmlos zu sprechen. Die Begegnung mit dieser Frau, die einer beleidigten Herzogin glich, hatte ihn völlig ernüchtert. Auch sah ihr Begleiter gefährlich aus.
»Na, sie gehört hier ja zum Inventar«, setzte Andreas hinzu. Kaflisch grinste.
»Solange es dauert, heißt das. Türkheimer soll sie satt haben. Komisch, gerade jetzt, wo seine Frau den Edelberg los ist, wissense?«
»Hab’ ich auch gehört«, log Andreas, der sich vornahm, ohne weiteres alles zu begreifen.
»Es ist aber nicht schön von Lizzi«, sagte er vertraulich, »was ich vorhin zwischen ihr und dem jungen Mann gesehen habe, mit dem sie eben vorbeikam.«
Kaflisch horchte auf.
»Mit dem, der so staatserhaltend aussieht?« fragte er. »Nun, was machten sie denn?«
»Sie küssten sich.«
»Mehr nicht?«
Kaflisch war enttäuscht. Andreas suchte sich zu entschuldigen.
»Na, hier im Hause –« meinte er.
»Unsinn. Diederich Klempner ist ja ihr Schoßhündchen. So’n Posten sollten Sie sich auch suchen, mein Lieber. Klempner ist ein Streber, aber ohne Lizzi wäre er nichts geworden.«
»Was ist er denn?« fragte Andreas.
»Das wissen Sie nicht? Dramatiker doch!«
»Klempner? Ich habe ihn nie auf dem Theaterzettel gesehen.«
»Die liebe Unschuld! Ist ja gar nicht nötig, er schreibt nie was, aber Dramatiker ist er doch.«
»Wieso?« fragte Andreas ziemlich kurz. Er fand den Ausdruck »Die liebe Unschuld« etwas zu herablassend. Kaflisch erläuterte:
»Wenn er was schreiben würde, dann würde es vielleicht ein Drama werden. Verstehnse mich?«
Sie betraten jetzt den ersten der drei großen Salons, in deren Tiefe man hineinsah. Er war blassgrün, der zweite purpurrot und der dritte bleu mourant1 und Rokoko. Eine erstaunliche Menschenmenge erschwerte das Weiterkommen, aber Kaflisch besaß das Talent, überall Platz zu finden. Andreas wunderte sich über die Menge von Händedrücken, die er rechts und links austeilte. Er schob die Leute mit einem freundschaftlichen Scherz beiseite und wand sich hindurch.
Man hörte schon von Weitem eine Gruppe von Herren streiten, die Börsenbesucher sein mussten, denn sie sprachen von einem Herrn Schmeerbauch, der die Gewohnheit hatte, jeden Tag mit einer neuen Hose zur Börse zu kommen. Heute hatte er eine schon bekannte angehabt, was allerlei Zweifel erregte. Man rief einen untersetzten, behäbigen Herrn an, der mit einer schlanken jungen Blondine vorüberging.
»Blosch! Wissen Sie was über Schmeerbauch?«
»Ist ja alles nicht wahr!« sagte Blosch phlegmatisch.
»Das mit der Hose?« fragte jemand.
»Ein Anfall von Melancholie«, versetzte Blosch. »Schmeerbauch hat eine unglückliche Liebe.«
Schmeerbauchs Kredit war wieder hergestellt.
»Der Glückliche!« seufzte ein schlanker junger Mann mit feinem schwarzen Schnurrbart und mandelförmigen dunklen Samtaugen, denen gewiss noch keine widerstanden hatte.
»Duschnitzki, wenn Sie renommieren, möchte man Sie prügeln, so dumm sehen Sie aus«, sagte ein anderer. Duschnitzki entgegnete sanft:
»Süß! Die liebe Unschuld!«
»Schon wieder die liebe Unschuld«, bemerkte Andreas für sich.
»Da ist ja Kaflisch!« riefen die anderen.
»Kaflisch, wissen Sie was von ›Rache!‹?«
»Durch!« antwortete der Journalist. »Türkheimer hat es durch seinen Schwiegersohn in spe beim Polizeipräsidenten durchgesetzt.«
»Ja, wenn man einen Schwiegersohn im Ministerium hat. Hochstetten ist doch Geheimer Rat?«
»Und nicht zu seinem Vergnügen. Vorläufig muss er Türkheimer einen Orden verschaffen. Man weiß nicht welchen, aber irgendeiner soll im Heiratskontrakt inbegriffen sein. Der Sonnenorden von Puerto Vergogna tut es nicht mehr. Und dann muss er ›Rache!‹ aufführen lassen.«
»Ganz und gar?«
»Mit lumpigen Änderungen«, erklärte Kaflisch. »Der Barrikadenkampf, die Ermordung des Verwaltungsrats durch die empörten Proletarier, die Auspeitschung der Bankiersfrau auf offener Straße, alles darf bleiben. Bloß das bisschen Kirchenschändung und die Benutzung der geweihten Gefäße zu unsauberen Zwecken muss weg.«
»Zustand!«
»Frechheit!«
Man rief durcheinander.
»Darf man nur uns auf der Bühne vergewaltigen und die Pfaffen nicht? Was haben die vor uns voraus?«
»Die Religion ist doch eine Sache für sich«, sagte die schlanke junge Frau, die mit Blosch gekommen war. Einer der Herren bemerkte:
»Die liebe Unschuld!«
Andreas wunderte sich nicht mehr, dass man ihn selbst mit dem Ausdruck anredete, da er auch einer Dame an den Kopf geworfen wurde. Übrigens kehrte das Wort immer wieder. Jeder, der nur zwei Sätze sprach, war es sich schuldig, es zu gebrauchen. Indes fühlte Andreas die Verpflichtung, für die junge Frau Partei zu nehmen. Auch fürchtete er albern dazustehen, wenn er noch länger schwieg.
»Die gnädige Frau hat recht«, sagte er mit Entschiedenheit. »Die Religion muss aus dem Spiel bleiben.«
»Kann sein«, meinte einer zögernd, aber Duschnitzki ergriff eifrig die umschlagende Stimmung.
»So ist es. Sie haben recht, gnädige Frau, und Sie, Herr, Herr –«
»Andreas Zumsee«, sagte Andreas.
»Schriftsteller«, setzte Kaflisch hinzu. Duschnitzki fuhr fort:
»Heutzutage, bei den Zuständen kann man alles verulken und mit Füßen treten, die Ehre des Bürgertums –«
»Und unser ruhmreiches Heer!« rief Süß.
»Die allerhöchsten Personen!« meinte ein anderer.
»Den Ruf einer Frau!« der nächste.
»Sogar die Börse«, schlug leise einer vor.
»Aber den lieben Gott!« sagte Duschnitzki nachdrücklich. »Das geht nicht!«
»Das muss die Polizei verbieten!« schrie Süß. »Es erregt Ärgernis!«
»Und es ist geschmacklos«, setzte Duschnitzki geringschätzig hinzu.
»Stimmt!« versetzte Kaflisch unter allgemeinem Beifall. »Wir haben das überwunden! Man muss schon ’n bisschen veralterter Würdengreis sein wie der große Mann da hinten.«
Die Gesellschaft begann zu lachen. Andreas, der den Blicken der anderen folgte, bemerkte am Eingang zum zweiten Salon einen langen Greis mit kleinem, lächelnden Vogelkopf. Ein wenig Flaum tanzte auf seinem kahlen Schädel. Er redete emphatisch auf einen großen Kreis von Damen und Herren ein, aus dem er hoch aufragte. Andreas erhaschte abgerissene Worte: »Dunkle Gestalten erheben heute wieder ihr Haupt …« Er meinte, den Greis schon gesehen zu haben.
»Ist das nicht Waldemar Wennichen?« fragte er Kaflisch.
»Natürlich! Sie kennen doch unseren großen Dichter. Wollen wir uns dem Kreise seiner Verehrer anschließen?«
Kaflisch suchte Andreas loszuwerden. Er hatte gehofft, der junge Mann werde zu lachen geben, was für ihn, seinen Mentor, schmeichelhaft gewesen wäre. Da Andreas augenblicklich sogar Beifall geerntet hatte, langweilte er Kaflisch.
Der Neuling, aufmerksam und beflissen, nach Doktor Bedieners Weisung von dem hier herrschenden guten Ton zu profitieren, merkte sich, dass man mit Aufklärung nicht prahlen durfte. Während sie ihren Weg fortsetzten, erkundigte er sich bei dem Journalisten, wer jene schlanke junge Frau gewesen sei. Kaflisch erklärte sogleich:
»Die wird nicht gereicht. Es ist Frau Blosch. Lassen Sie sich Ihre Geschichte mal erzählen, zum Beispiel von Diederich Klempner, der versteht es als Dramatiker.«
Sie traten an die Wennichensche Gruppe heran.
»Seien Sie mir gegrüßt, mein Liebling!« redete Kaflisch einen ernsten Herrn mit tadellosem Frack und schwarzem Vollbart an.
»Darf ich die Herren bekannt machen?« setzte er hastig hinzu. »Herr Schriftsteller Andreas Zumsee, Herr Liebling, Zionist.«