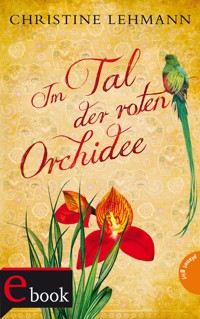
17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Planet!
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
"Auch du wirst einen Ort finden, wo dein Herz zu Hause ist." Als Isa mit ihrer Familie nach Kapstadt zieht, ist sie sicher: Hier will sie nicht lange bleiben. Doch plötzlich ist sie mitten drin im afrikanischen Leben. Mit dem attraktiven Südafrikaner Greg begibt sie sich auf eine abenteuerliche Reise durch den Busch – dabei kommen die beiden nicht nur einem dunklen Familiengeheimnis auf die Spur, sondern auch sich immer näher … Ein Roman der ganz großen Gefühle
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Buchinfo
„Auch du wirst einen Ort finden, wo dein Herz zu Hause ist.“
Als Isa mit ihrer Familie nach Kapstadt zieht, ist sie sicher: Hier will sie nicht lange bleiben. Doch plötzlich ist sie mitten drin im afrikanischen Leben. Mit dem attraktiven Südafrikaner Greg begibt sie sich auf eine abenteuerliche Reise durch den Busch – dabei kommen die beiden nicht nur einem dunklen Familiengeheimnis auf die Spur, sondern auch sich immer näher …
Ein Roman der ganz großen Gefühle
Autorenvita
© privat
Christine Lehmann, 1958 in Genf geboren, wollte bereits mit 14 Jahren Schriftstellerin werden. Die promovierte Literaturwissenschaftlerin arbeitet als Nachrichten-Redakteurin beim SWR. Darüber hinaus schreibt sie seit fast 20 Jahren Krimis und Liebesromane, Essays, Kurzgeschichten für Anthologien und Kriminalhörspiele fürs Radio. Christine Lehmann lebt mit ihrem Mann in Stuttgart.
CHRISTINE LEHMANN
Planet Girl
1.
Ein Kapgeier segelte seelenruhig am violetten Gebirgskamm entlang. Man sah ihn nur noch selten in Afrika. Ich erkannte ihn an den gespreizten Schwungfedern. Ein Anblick, der mich kurz über das Elend hinwegtröstete, das sich gerade auf dem See ereignete.
Das Boot meines Teams kenterte zweihundert Meter vor dem Ziel. Die Zuschauer johlten. Denn es war gar nicht so leicht, einen Achter zum Kentern zu bringen. Ohnehin hatte mein Team auf dem letzten Platz gelegen. Ich sah Gregs spöttisches Lächeln vor mir. Das Ganze war zum Scheitern verurteilt gewesen.
»Wer auf einen Baum steigen will, fängt unten an, nicht oben«, hörte ich den alten Qwara murmeln. »Immerhin hat der Start geklappt.«
Gut war anders. Aber das war jetzt auch egal. Während der Black Shark des Frauenachters der Privatschule aus Port Elisabeth wie ein schwarz-roter Pfeil durch die Zielbojen glitt und umjubelt eine Ehrenrunde ruderte, fischte ein Motorboot meine Mädchen aus dem Wasser und zog unseren Wit Swaan zum Anleger. In der Umkleide gaben sie sich gegenseitig die Schuld. Tembisa hatte den Wettkampfschlag nicht mehr mithalten können und das Ruderblatt nicht schnell genug aus dem Wasser bekommen. Der Griff war ihr gegen die Rippen geschlagen und hatte sie aus dem Boot katapultiert. Das hatte das ganze lange Rennboot aus dem Gleichgewicht gebracht. Karu, die vor ihr saß, hatte sich umgedreht, und plötzlich ragten backbord alle Riemen in die Höhe, und der Wit Swaan kippte. Aus die Maus.
Die Siegerehrung war eine Veranstaltung, die mit uns nichts zu tun hatte. Die Mädchen vom Black Shark stellten sich zum Pressefoto auf und bissen auf ihre Goldmedaillen. Und der unter Grinsen und Gelächter gespendete Trost der anderen Ruderteams auf der Grillparty am Abend wäre auch verzichtbar gewesen.
Klar, zehn Monate Training für Ruderanfängerinnen waren zu wenig, wenn man gegen Ruderinnen antrat, die seit Jahren trainierten. Was hatte ich denn geglaubt? Dass ich Wunder bewirken konnte? Greg würde kein Wort sagen. Das war schlimmer noch als der freundliche Trost, den man uns daheim im Ruderclub spenden würde. »Immerhin habt ihr es versucht. Aber natürlich könnt ihr nicht erwarten, dass ihr den South Cape School Cup holt.«
Die zufriedenen Mienen ärgerten mich jetzt schon. Man hatte uns alle Chancen gegeben, aber gut, dass wir sie nicht genutzt hatten. Die Welt blieb in Ordnung, schwarze Mädchen konnten nicht mithalten. Insgeheim waren sie doch alle Rassisten, allen voran Greg. Der ganze Ruderclub war weiß. Es gab nur zwei schwarze Ruderer. Alle anderen waren muskulöse blonde junge Männer. Und Greg war der blondeste, blauäugigste und arroganteste von ihnen. Ausgerechnet dem hatte ich beweisen wollen, dass mein schwarzer Frauenachter etwas reißen konnte, wenn wir nur wollten.
2.
Alles hatte gut ein Jahr zuvor im deutschen Sommer damit angefangen, dass Mama meiner Schwester, Papa und mir erklärte, sie werde nach Südafrika geschickt, nach Kapstadt. Meine Mutter war Karrierefrau. Nun sollte sie das Kapstadt-Büro der Filmproduktionsgesellschaft Intermovie leiten. In den letzten zehn Jahren war ich in London, in Paris und sogar ein Jahr in Sankt Petersburg zur Schule gegangen – immer in deutschen Schulen für Diplomatenkinder. Meine zwei Jahre jüngere Schwester, Laura, sprach besser Englisch und Französisch als Deutsch. Sie war sechzehn.
Eigentlich hatte ich gehofft, mein Abitur in München machen zu können. Denn nach Sankt Petersburg hatte Mama erklärt, sie habe die Nase voll vom Ausland und wolle sich nicht so schnell wieder irgendwohin schicken lassen. Vielleicht hatte sie es wirklich vorgehabt, ein paar Jahre in München zu bleiben, aber sie hatte es nicht ausgehalten. Zu viele Intrigen, zu viel Bürokratie, zu viele Sitzungen und Konferenzen im Mutterhaus. Als Chefin eines Auslandsbüros war man seine eigene Herrin. Also hatte sie sich überreden lassen, wieder ins Ausland zu gehen. Mein Vater machte alles mit. Er war Hausmann. Laura und ich hatten ihn lange Zeit Mapa genannt, weil er unsere Mama war, als wir klein waren. Es war das erste Wort, das Laura sagen konnte: Mapa. Irgendwie hatte sie damals schon kapiert, dass Papa die Mamarolle spielte. Andere Kinder hatten Mamas, wir nicht.
Inzwischen nannten wir ihn nicht mehr so. Wir sagten Papa. Es klang irgendwie erwachsener und würdiger, fand ich. Ich glaube, er fand das auch besser.
Bei uns war immer alles anders. Ich wurde zwar in Berlin geboren, aber dort gelebt hatte ich nicht. Laura kam in Hamburg zur Welt. An die Jahre dort konnte ich mich auch nicht erinnern. Meine ersten Erinnerungen waren das Oktoberfest in München und die Isar. Aber in München ging ich nur ein Jahr zur Schule. In London und Paris hatte ich länger gelebt. Ich hatte keine Heimat, ich kam nirgendwoher. Nicht so wie andere, die sagten, sie kämen aus Bremen oder Düsseldorf, weil sie dort zur Schule gegangen waren und ihre erste Liebe erlebt hatten.
Kapstadt war meine letzte Station. Das hatte ich mir geschworen. Sobald ich an der Deutschen Internationalen Schule das Abitur gemacht hatte, war ich weg. Dann ging ich nach Deutschland.
Aber alles der Reihe nach: Wir flogen im September von München in den beginnenden heißen Sommer von Südafrika und bezogen in Muizenberg in der Green Close einen Bungalow hinter einer hohen Mauer mit Blick auf den Tafelberg. Zum Strand waren es nur ein paar Minuten mit dem Fahrrad, zur Deutschen Internationalen Schule Kapstadt wurden wir jeden Morgen mit dem Auto gefahren, anfangs von Papa, später meistens von Qwara. Man fuhr überhaupt viel mit dem Auto, aus Sicherheitsgründen.
Zu unserem Haus gehörten die beiden Housekeeper Qwara und Sabra. Mir wurde erst später bewusst, dass sie verheiratet waren. Denn Sabra war einen Kopf größer als Qwara. Er war eine schmächtige, aber sehnige Gestalt und unser Gärtner und Chauffeur. Sie führte uns den Haushalt. Ich schätzte beide auf über fünfzig. Ab und zu redete Sabra von Kindern und Enkeln, die von ihren Einkünften abhängig waren. Beide kamen frühmorgens und machten sich abends mit der Metrorail auf den langen Weg nach Hause. Sie wohnten in Nyanga. Sabra sprach den Namen des Stadtteils leise aus, wie ein unanständiges Wort. Erst nach einer Weile kapierte ich, warum. Es handelte sich um eine Township. So hießen hier die Barackengettos der Schwarzen. Eigentlich hieß das Wort ja nur Gemeinde. Aber hier, in Südafrika, war eine Gemeinde ein Ort, wo man als Weißer, vor allem als junge weiße Frau, niemals hinging. Mama verbot uns das quasi bei Todesstrafe. Wir würden hundert pro mindestens vergewaltigt, wenn nicht gar ermordet werden.
Ich fand, im Grunde war es in allen Großstädten der Welt gleich. Gefährliche Viertel gab es überall, genau so wie glänzende Einkaufsmeilen, reiche und arme Gegenden, Supermärkte und kleine Läden, Restaurants und Kneipen. Überall fuhren viel zu viele Autos, mal im Rechtsverkehr oder aber links, wie hier in Südafrika, und es roch nach Staub und Benzin. Überall strebten die Leute morgens aus dem Haus und kehrten abends heim, überall wurde eingekauft, gekocht und gegessen. Ich sagte immer: Überall leben Ameisen. Tatsächlich, Ameisen gab es wirklich so gut wie überall auf der Erde. Nur in Grönland, Island und am Südpol gibt es keine, hatte ich mal gelesen.
Laura lebte sich schnell ein. Als ich zwei Jahre jünger war, fiel mir das auch noch leichter. Da war ich noch neugierig auf neue Freunde und auf einen Freund. Sie gehörte bald zu einer Clique, mit der sie die Sommerferien, die hier Anfang Dezember begannen, am Strand mit Kitesurfen verbrachte. Ich war auch mal mit dabei, aber sie waren mir zu aufgedreht. Sie interessierten sich nur für Party.
Ich mochte keine Freundschaften mehr schließen, nicht für ein oder zwei Jahre. Ich hatte in London und Paris Freundinnen zurückgelassen. In Sankt Petersburg hatte ich schon versucht, Freundschaften zu vermeiden, die intensiven jedenfalls. Die, wo es wehtat, sich zu trennen und zu wissen, dass man sich zwar mailen und miteinander skypen konnte, aber so bald nicht wiedersehen würde. Man konnte es sich noch so fest vornehmen, man besuchte sich nie, wenn man über Kontinente fliegen musste.
Kapstadt war ganz schön: warm, bunt, viel Natur, viel Wasser. Und über allem thronte der große Felsen, der Tafelberg. Er sah jeden Tag anders aus, morgens kroch der Nebel von ihm herab, manchmal hing eine Wolke an ihm fest. Die Straßen waren großzügig angelegt, die Schule war freundlich und ehrgeizig.
Die DSK bot zwei Abschlüsse an, das für Deutschland gültige Abitur und das NSC, den höchsten südafrikanischen Schulabschluss. Ich besuchte den Kombizweig, der beide Abschlüsse vereinigte. Es wurde in zwei Sprachen unterrichtet, Deutsch und Englisch. Wir waren Kinder und Jugendliche aller möglichen Nationalitäten von Diplomaten und Familien, die es, wie meine, wegen des Berufs eines Elternteils hierher verschlagen hatte. Meistens waren es die Väter, die hier arbeiteten, und die Mütter, die daheimblieben und sich von der Schule für Theateraufführungen, Feiern und Feste einspannen ließen. Schon beim ersten Fest, Ende November, löste mein Vater Erstaunen aus, weil er es war, der mit Salatschüsseln ankam. Die Frauen kriegten sich kaum wieder ein. Ich weiß nicht, ob sie ihn bewunderten oder verachteten.
Vor allem interessierten sie sich für meine Mutter. Sie leitete das Büro von Intermovie, das die Filmdrehs in Südafrika organisierte. Ungefähr die Hälfte aller Filme fürs deutsche Fernsehen wurde in Südafrika gedreht. Das war billig und einfach, denn es gab auch dank Intermovie eine bestens organisierte Infrastruktur dafür: Flugzeuge, Autos, Ausrüstung, Kameraleute, Wildhüter und Pfadfinder, die sich in den Nationalparks gut auskannten, und Tiertrainer, die für Filmszenen mit Löwen, Elefanten und anderem Großwild arbeiten konnten. Alle standen um sie herum, wenn meine Mutter anfing, Anekdoten zu erzählen. Sie lachten über die Schauspielerin, der ein Affe die Perücke vom Kopf gerissen hatte, oder über den Geparden, der sich derartig in die Kamera verliebt hatte, dass er einen eitlen Schauspieler immer wieder wegdrängte und schließlich sogar wegbiss.
Schon recht bald entdeckte ich am Schwarzen Brett der Schule einen Hinweis auf den South Cape School Cup im Rudern, der immer im November unter südafrikanischen Schülern und Schulen auf einem mir noch unbekannten See ausgetragen wurde. Teilnehmen durften alle unter 20 Jahren. Und an den Start durften nur Achter, die Königsklasse im Rudern.
Zufällig stand Charlotte, eine aus meiner Klasse, neben mir und sagte: »Interessierst du dich fürs Rudern? Mein Bruder rudert auf dem Sandvlei.«
Das war der See dort, wo ich wohnte. »Dürfen da auch Mädchen mitmachen?«, fragte ich.
Sie lachte. »Ja, klar. Aber ich gehe nicht rudern. Ich will keine Muskeln bekommen.« Dabei fuhr sie sich über die dünnen Oberarme. »Ich kann gern mal mit dir hingehen, wenn du willst.«
»Ist aber schon eine Weile her, dass ich gerudert bin«, erklärte ich ihr. Was meine Oberarme nicht unbedingt entschuldigte.
Sie meinte es nicht als Kritik. Charlotte war eine durch und durch freundliche Person ohne jedes Bedürfnis, andere zu kritisieren oder mit Ratschlägen zu belästigen. Ihr Vater besaß eine große Möbelschreinerei und war ebenfalls ein sehr freundlicher Mensch. Sie hatte ihn mir bei der Nikolausfeier vorgestellt. Ihre Mutter kam aus Deutschland, deshalb ging Charlotte auf die bilinguale Schule. Sie war klein und zierlich, dunkelhaarig und hatte funkelnde schwarze Augen. Ihr Teint war zart und hell, und sie achtete darauf, nicht zu viel Sonne abzubekommen, cremte sich ständig ein und suchte Schatten.
Ich war dagegen nicht so zierlich und graziös. Auch nicht klein. Eine meiner französischen Klassenkameradinnen hatte mich mal eine deutsche Walküre genannt. Wobei sie das gar nicht böse gemeint hatte, sondern anerkennend. Ich war auch nicht dick, nur eben groß und kräftig. Die französischen Jungs hatten mich zwar irgendwie interessant gefunden, aber mit mir gegangen war keiner. Vielleicht, weil ich selber die Sache etwas unübersichtlich gefunden hatte. In Sankt Petersburg wiederum schminkten sich die Mädchen, donnerten sich auf und trugen Absätze nicht unter zehn Zentimetern. Die russischen Jungs hatten mich überhaupt nicht wahrgenommen.
Es war mein wunder Punkt. Ich war gerade achtzehn geworden, als wir nach Kapstadt kamen, aber ich hatte mit noch keinem Jungen geschlafen. Jedenfalls nicht so richtig. Laura war da schon weiter. Wir sprachen nicht groß darüber. Es war mir peinlich und ihr auch. Irgendwie kam ich mir auf diesem Gebiet wie eine Versagerin vor. Und ihr tat das leid. Sie hätte mir sicherlich gern geholfen, mich irgendwie in ein nettes süßes Mädchen zu verwandeln wie sie eines war, mit ihren blonden Locken und großen Augen. »Lächle doch mal«, sagte sie. »Und lauf nicht immer in Sportklamotten herum.«
Aber ich machte nun mal gern Sport und ich trug nicht so gern Rock und Pumps. Doch allmählich wurde es mir selber peinlich. Die Hässlichen kriegten doch auch einen Freund ab, warum ich nicht? Am Aussehen konnte es nicht liegen. Zumal ich ganz passabel war mit meinen nussbraunen Locken und länglichem Gesicht ohne Pickel oder anderen ungünstigen Eyecatchern.
»Du stellst zu hohe Ansprüche«, behauptete Laura.
»Was für Ansprüche stelle ich denn?« Von einer zwei Jahre jüngeren Schwester ließ man sich nicht gern Tipps geben.
»Er soll intelligent sein ...«
Das war ja nun das Mindeste.
»Und natürlich supergut aussehend.« Laura kicherte. »Und sportlich.«
»Gar nicht wahr.«
Allerdings guckte man halt hin, wenn ein Junge gut gebaut war. Greg zum Beispiel. Ich lernte ihn im Ruderclub kennen.
Am ersten Ferientag nahm Charlotte mich mit an den See, der nur ein paar Fahrradminuten von unserem Haus entfernt lag. Er hieß Sandvlei. Am Westufer hatte der Muizenberg Rowing Club seine grün-weiße Fahne gehisst. Charlotte stellte mich ihrem Bruder Harrie vor, den ich in der Schule schon ein paarmal gesehen hatte, ein stets lächelnder Junge mit braunen Augen und Lockenkopf.
Er war gerade im Begriff, mit drei anderen in einen Rennvierer zu steigen. Sie standen am Steg und warteten. Einer fiel mir sofort auf. Er war zwar etwas größer als die anderen, aber nicht muskulöser oder besser gebaut. Was es genau war, weiß ich bis heute nicht. Vielleicht seine Haltung, eine geradezu unverschämte Selbstsicherheit, die er ausstrahlte und die augenblicklich meinen Widerwillen erregte. Ich weiß noch genau, wie ich dachte: Das ist das böse Bild des Buren, des herrschsüchtigen weißen Siedlers, der Schwarze prügelt, weil er sie für Tiere hält. Mir war sofort klar: Mit dem wollte ich nichts zu tun haben.
Harrie brachte mich zu zwei Frauen im grün-gelben Einteiler des Muizenberg Rowing Clubs. Sie waren sofort bereit, mich im Vierer zu einer ersten Probeausfahrt mitzunehmen. Und sie bestätigten meinen Verdacht: Man ruderte hier nicht gemischtgeschlechtlich. Das war eine von diesen Rückschrittlichkeiten, die mir an diesem Land nicht gefielen. Man legte arg gern fest, wie andere zu sein hatten, um echte Frauen, echte Männer, echte Weiße oder echte Schwarze zu sein.
Aber ich liebte das Wasser. Und Bewegung. Schon nach den ersten Schlägen wusste ich, was ich in Paris und Sankt Petersburg vermisst hatte: das Rudern, das Licht auf dem Wasser, das sanfte Gluckern unterm Kiel, das Klacken der Skulls in den Dollen, wenn man aushob. Ich war auf Gewässern zu Hause. Ein anderes hatte ich ja nicht. Es war das Wasser, das mir Kraft und Ruhe gab.
3.
Eines Tages entdeckte ich im verdorrten Gras hinter dem Clubhaus den Bootsfriedhof. Zwischen Gebüsch und Steinen lagerten ausrangierte Rennboote, darunter ein alter hölzerner Riemenachter. Auf seinem Bug stand kaum noch lesbar Wit Swaan, leicht zu übersetzen als Weißer Schwan. Von seinem Rumpf blätterte weiße Farbe, aber sonst schien er mir intakt. Von den Auslegern fehlten ein paar, einige waren verbogen. Um zu schauen, wie es innen aussah, hätte man ihn umdrehen müssen. Ich konnte nur kurz drunterschauen, indem ich mich auf den Boden legte und das Boot an einer Seite anhob. Rollsitze und Stemmbretter fehlten. Aber die konnte man ersetzen.
Im Rudern gab es verschiedene Sorten von Booten: breite Gigs und schmale Rennboote. Und die unterteilen sich in solche mit zwei Skulls und solche, wo der Ruderer nur mit einem Teil ruderte, dem Riemen. Ein Skullboot konnte man allein rudern, ein Riemenboot musste immer von mindestens zweien gefahren werden. Bei den Gigs gab es zwar auch Doppelachter, also Boote, die mit zwei Skulls gerudert wurden, aber Rennen wurden aus irgendwelchen Gründen nur mit dem Riemenachter ausgetragen.
Am selben Abend erzählte Mama von einem Dreh in einer Township mit einem deutschen Fußballstar – keine Ahnung, wie der hieß –, den sie organisierte. Er sollte mit niedlichen kleinen schwarzen Jungs kicken und für sich und ein Hilfsprojekt werben. Wir geben den Jungs aus den Slums Sport und Zukunft, so die Art.
»Und für die Mädchen, was tut man für die?«, fragte ich.
Mama seufzte. »Das ist doch jetzt hier gar nicht das Thema. Für Mädchen gibt es sicher auch Programme.«
»Aber bestimmt nur für Hauswirtschaft oder so. Und da kommt auch kein Sportstar, sondern eine superschöne Schauspielerin, die ihnen deutlich macht: So wie ich werdet ihr nie aussehen. Lernt also mal schön kochen und putzen.«
»So verkehrt ist das ja auch nicht, Isa«, antwortete meine Mutter. »Wenn man in diesen Ländern die Mädchen zur Schule schickt und ihnen eine gute Ausbildung gibt, bessern sich die Lebensverhältnisse. Sie halten das Geld zusammen.«
»Und wenn eine Karriere machen will, so wie du?«
»Die Jungs machen auch keine Karriere, nur weil ein Fußballstar kommt«, bemerkte Laura.
So kam ich auf die Idee. Ich dachte an den alten Wit Swaan auf dem Bootsfriedhof hinterm Clubhaus und an die Mädchen in den Townships, zu denen niemand kam, um sie zu selbstbewussten Frauen zu machen, die ihre eigene Kraft kannten. Und plötzlich sah ich einen schwarzen Frauenachter vor mir, wie er bei den nächsten olympischen Spielen allen davonfuhr und die Goldmedaille gewann.
»Wer ist denn bei euch für die Boote zuständig?«, fragte ich bei meinem nächsten Besuch eine meiner Rudergefährtinnen.
»Greg Vermooten«, antwortete sie und deutete auf einen, der gerade zusammen mit drei anderen ein Rennboot aus den Böcken nahm, über Kopf stemmte und ins Bootshaus hineintrug.
Ich hatte keine Vorurteile. Echt nicht. An mein Gefühl beim ersten Blick, dass ich mit dem nichts zu tun haben wollte, erinnerte ich mich kaum noch. Allerdings entstand sofort eine gewisse Anspannung in mir, als ich mich zum Bootshaus wandte. Greg kam gerade heraus und eilte über den Platz zum Steg, wo noch die Skulls lagen. Er sah mich nicht oder wollte mich nicht sehen.
Der grün-gelbe Einteiler aus Radlershorts und Trägertop betonte die schmalen Hüften der Athleten und ihre ausgeprägten Schulterpartien. Gregs Arme waren braun gebrannt, aber nicht verbrannt. Kleine Härchen schimmerten golden in der Abendsonne. Ich glaube, er hatte mich bis zu diesem Tag noch nie wirklich wahrgenommen. Außer dem knappen südafrikanischen Gruß »Howzit« – eine Abkürzung von »How goes it?« – hatten wir bisher kein Wort gewechselt. Ich bezwang mein Herzklopfen und folgte ihm zum Anleger. Er bückte sich gerade nach einer Wasserflasche, die er dort abgelegt hatte, nachdem sie ausgestiegen waren. Er hatte wie üblich mit seinen Jungs zuerst das Boot versorgt, es aus dem Wasser gehoben, in Böcke gelegt, abgewaschen, die Schienen der Rollsitze gereinigt und ins Bootshaus getragen. Nun holte er die Skulls.
»Hallo, Greg«, sagte ich.
Er richtete sich auf und blickte mich an. Er trug wie fast alle hier eine Sonnenbrille. Seine Augen konnte ich nicht sehen. Und der Rest seines Gesichts zeigte kein großes Interesse. Sein Mund deutete ein höfliches Lächeln an, er sagte aber nichts. Seine Miene war wohl Erlaubnis genug für mich, weiterzureden.
»Hinter dem Bootshaus liegt ein alter Achter aus Holz«, begann ich.
Greg deutete ein Nicken an, sagte aber immer noch nichts. In mir stieg leichte Wut hoch. So deutlich musste er mir nicht zeigen, dass er keine rechte Lust hatte, mit mir in ein Gespräch einzusteigen. Typisch Mann, dachte ich: maulfaul. Und nach flirten war ihm offenbar nicht zumute, zumindest nicht mit mir. Er lässt reden, dachte ich, und entscheidet sich dann, ob es ihn interessiert. Eine Frau hätte wenigstens aufmunternd Ja gesagt oder einen Ton von sich gegeben, wahrscheinlich aber sofort angefangen zu erzählen, was es mit diesem alten Achter auf sich hatte.
»Ist der noch in Ordnung? Könnte man mit ihm fahren?«, setzte ich meine Fragerei fort.
»Nein«, erwiderte Greg.
»Was ist denn nicht in Ordnung an ihm?«
»Man muss ihn generalüberholen.«
»Aber ein Leck hat er nicht? Der Rumpf ist intakt, oder?«
»Ich denke schon.«
Wir schauten uns an. Seine Miene war immer noch nicht viel interessierter geworden, sein Blick blieb hinter den Sonnenbrillengläsern verborgen. Er hatte sich die Kappe tief in die Stirn gezogen. Der Schweiß war ihm von den Schläfen über Wangen und Hals zum Schlüsselbein gelaufen, das von ausgeprägten Muskeln umgeben war, und hatte eine kleine Salzspur hinterlassen.
Jeder andere hätte mich jetzt fragen müssen, warum ich diese Fragen stellte. Ich zögerte einen Moment, ob ich ihm von meiner Idee erzählen sollte. Ich würde letztlich nicht drum herumkommen, wenn ich ihm erklären wollte, warum ich mich um die Instandsetzung des alten Holzachters kümmern wollte. Andererseits interessierte es mich, ob es mir gelingen würde, Greg aus der Reserve zu locken und so etwas wie rudimentäre Neugier bei ihm zu wecken. Deshalb sagte ich nur: »Ich würde ihn gern instandsetzen und in Betrieb nehmen.«
Vergeblich. Er fragte nicht, warum. Er sagte nur knapp: »Nein.«
»Wieso nicht?«
»Wir haben bereits einen Riemenachter.«
Den hatte ich im Bootshaus gesehen, ein schickes, teures wettkampftaugliches Teil. In diesem Boot würde kein Ruderclub der Welt Anfängerinnen trainieren lassen. Das Risiko von Beschädigungen war viel zu groß.
»Darf denn damit jeder fahren, auch Anfänger?«, fragte ich.
»Nein. Das ist unser Wettkampfachter.«
»Siehst du«, sagte ich, »darum dachte ich an das alte Holzboot als Trainingsboot ...«
Gregs Augenbrauen erschienen über der Sonnenbrille.
»... für Anfänger«, setzte ich mutig hinzu.
»Was für Anfänger sollen das denn sein?«, fragte er.
Ich triumphierte innerlich. Hatte ich ihn endlich so weit.
»Ich will mit Mädchen aus den Townships trainieren«, sagte ich.
Jetzt war es raus. Wenn ich gehofft hatte, Greg in Überraschung zu versetzen, sah ich mich getäuscht. Er war nicht überrascht. Er sagte einfach nur: »Das wird wohl kaum gehen.«
»Kannst du das einfach so bestimmen?«, fragte ich.
»Ja.«
Da spürte ich, wie Zorn bei mir die Regie übernahm. Ich würde gleich Sachen sagen, die ich später bereute.
Das entging ihm offenbar nicht. Ganz so ein gefühlloser Stoffel war er dann wohl doch nicht. Er milderte plötzlich seinen abweisenden Ton und fuhr etwas verbindlicher fort: »Ich bin der Bootswart und Mitglied im Vorstand. Der Wit Swaan ist nicht fahrbereit, und eine Rundumerneuerung wäre viel zu teuer.«
»Und wenn ich mich ganz allein um die Restaurierung kümmern würde?« Ich hatte keine Ahnung, wie ich das tun wollte.
Auf Gregs Lippen erschien ein spöttisches Lächeln. Aber er fragte nicht, wie ich mir das denn vorstellte. Er überlegte und sagte dann: »Also gut, wir werden das im Vorstand besprechen. Wir brauchen das Boot ja nicht mehr.«
Ich war high, als ich heimkam. Aber Mama holte mich gleich runter.
»Und wo willst du die Mädchen herkriegen, die das Boot fahren sollen?«, fragte sie beim Abendessen.
»Ich frage über Facebook und Internet an den Schulen herum.«
»Die schwarzen Mädchen haben alle einen fetten Arsch«, bemerkte meine Schwester Laura. »Passen die überhaupt ins Boot?«
»Erstens spielt das überhaupt keine Rolle«, rief ich. »Und zweitens ist das Rassismus pur, was du da sagst. Immer sollen die Schwarzen irgendwas nicht können, weil sie anders aussehen oder anders denken oder überhaupt nicht denken.«
»Kinder«, mahnte Mama. »Beim Essen wird nicht gestritten. Und wenn du meinst, du schaffst das, Isa, dann musst du es versuchen.«
»Es könnte aber sein, dass ich Geld brauche. Wahrscheinlich muss man neue Rollschienen, Sitze und Stemmbretter kaufen.«
»Dann kriege ich aber ein Kiteboard und einen Gleitschirm!«, schrie Laura.
Seit Tagen lag sie meinen Eltern damit in den Ohren. Geld gab es bei uns ja genug. Aber meine Eltern hatten hin und wieder das Gefühl, sie müssten uns manche für Geld leicht zu habende Dinge vorenthalten, damit wir lernten, dass man für alles hart arbeiten musste. Oder eben warten, wenn man noch nicht selber Geld verdiente. Das tat auch weh. Besitz sollte sich durch Schmerzen, Sehnsüchte und Ungeduld erkauft werden, so das Prinzip. Aber ich hatte ein gutes Argument parat.
»Ich will das Geld ja nicht für mich«, widersprach ich Laura. »Sondern für ein Projekt, das schwarzen Mädchen helfen soll.«
»Aber du weißt doch noch gar nicht, ob du genügend Mädchen findest. Vielleicht wollen die sich von dir auch gar nicht helfen lassen.«
»Ich sag ja auch gar nicht, dass ich sofort Geld brauche. Es könnte aber halt eben sein.«
»Darüber reden wir zum gegebenen Zeitpunkt«, beschied Mama.
Sie hatte verschiedentlich klargestellt, dass es ihr Geld war, über das wir mit unseren Wünschen verfügten. Ich dachte manchmal, es war ja eigentlich auch Papas, denn im umgekehrten Fall wurde man ja nicht müde zu betonen, dass die Hausfrau mit ihrer Arbeit dem Karrieremann den Rücken freihielt und somit zum Wohlstand der Familie beitrug. Er gab uns zwar das Taschengeld und kaufte ein, aber wenn es um größere Summen ging, wurde Mama gefragt.
Immer öfter fiel mir jetzt auf, dass ich keine Ahnung hatte, wie meine Eltern ihre Ehe und die Finanzen wirklich organisiert hatten. Papa hob das Geld einfach ab. Das hatte ich oft als Kind und Jugendliche gesehen. Er musste nicht um Haushaltsgeld bitten. Sie hatten beide gleichberechtigt Zugang zum Konto. Aber wenn er sich selbst etwas anschaffen wollte, redete er mit Mama.
»Ich denke darüber nach, mir eine neue Kamera zuzulegen«, sagte er beispielsweise.
»Mach das doch«, antwortete sie dann. Und um nicht desinteressiert zu wirken, fragte sie nach, was das für eine Kamera sei. Während er die Vorteile erklärte, wanderte ihr Blick durchs Zimmer und ich wusste, dass sie an irgendein Problem bei ihrer Arbeit dachte, einen Dreh plante, sich vornahm, diesen oder jenen anzurufen.
Und wenn sie sich Schuhe oder einen Blazer kaufte, fragte sie meinen Vater nicht. Sie sagte auch nicht, sie denke darüber nach, sich ein paar Ohrringe zu kaufen oder eine neue Handtasche. Das besprach sie mit niemandem. Sie kaufte einfach. Früher hatte ich mir nichts dabei gedacht, aber inzwischen fand ich es nicht mehr richtig. Manchmal fragte ich mich, ob mein Vater glücklich war. Womöglich waren sie nur noch wegen uns Kindern zusammen und ließen sich scheiden, sobald wir aus dem Haus waren. Manchmal fragte ich mich, was mein Vater sich für sein Leben noch wünschte.
Meine Mutter war eine schicke und für ihr Alter schlanke Frau. Welche Haarfarbe sie genau hatte, wusste ich nicht. Sie trug ein goldbraunes Blond, halblang. Sie war zwar nicht nach der letzten Mode gekleidet, aber teuer und immer war alles farblich aufeinander abgestimmt.
Seit ich denken konnte, hatte mein Vater uns das Frühstück gemacht und abends gekocht. Er wusch die Wäsche, er putzte, wenn nicht Dienstpersonal das übernahm. Lange Zeit hatte ich mich nicht gefragt, wer er war und was er für sich tat, aber als ich älter wurde, fiel mir auf, dass er nicht nur gern fotografierte und filmte, sondern die Fotos und Filme auch gerne stundenlang am Computer bearbeitete. Immer hatte es zu Geburtstagen und Silvesterfeiern ein Familienvideo gegeben. Außerdem war er sportlich. Er ging laufen und fuhr viel mit dem Fahrrad. Wenn wir Gäste hatten, war er eher still, während meine Mutter redete. Sie tat die faszinierenderen Dinge. Aber er wusste mehr als sie. Er wusste die überraschendsten Dinge. Man fragte sich, wann er Gelegenheit gehabt hatte, sie zu erfahren oder zu lernen. Tauchte eine historische oder naturwissenschaftliche Frage auf, wusste er die Antwort.
Ich glaube, ich hatte meinen Vater nie richtig wahrgenommen. Ich war immer zu sehr damit beschäftigt, mich irgendwo einzugewöhnen. Und so war es auch jetzt in Kapstadt.
Woher bekam ich mein Team für einen Achter? Mitten in den Ferien erst einmal gar nicht. Und die würden noch bis Mitte Januar dauern. Ich guckte, wie viele Schulen in den Townships es gab, die in Facebook vertreten waren. Es waren mehr, als ich gedacht hatte, aber die Seiten waren kaum gepflegt, auf manchen hatte sich seit Monaten nichts mehr getan. Charlotte schlug vor, Schulen in ganz Kapstadt anzumailen. »Allerdings«, überlegte sie, »darfst du nicht schreiben, dass du nur farbige oder schwarze Mädchen suchst. Das würde als Rassismus gewertet. Und du erreichst natürlich nur die Mittelschicht. Da machen die Mädchen meist keinen Sport, und wenn, dann spielen sie Tennis.«
Es stellte sich heraus, dass Charlotte eigentlich gar keine schwarzen Familien kannte. Sie nannten sich zwar die Regenbogennation in Südafrika, und Toleranz allen Minderheiten gegenüber, egal welcher Religion oder Hautfarbe, war ganz wichtig. Wobei in Südafrika die Schwarzen natürlich keine Minderheit, sondern die Mehrheit darstellten. Aber Weiße und Schwarze hatten privat fast nichts miteinander zu tun. Sie blieben unter sich. Man traf sich an der Schule, an der Uni, im Beruf, vielleicht auch beim Sport, aber nicht zur Grillparty, nicht mal in der Nachbarschaft.
»Aber«, sagte Charlotte, »wenn du Hilfe bei der Instandsetzung des Boots brauchst, kann mein Bruder dir helfen und mein Vater natürlich. Er repariert oft die Boote vom Club. Das ist kein Thema. Das macht er gern. Er wäre gern Bootsbauer geworden, nicht Möbeltischler. Er freut sich.«
4.
Harrie war ganz schön verknallt in mich. Ich mochte ihn auch. Er war unkompliziert und lachte gern. Wir holten den Wit Swaan mit dem Hänger seines Vaters. Dazu mussten wir das Boot auseinanderschrauben. Jeder Achter hatte so eine Nahtstelle, die ihn in ein längeres und ein kürzeres Stück teilte. Harrie und ich brachten etliche Nachmittage mit Schrauben, Schleifen, Ausbessern, Lackieren und Ausmessen zu. Harrie verstand echt was von Booten. Er war so genau, wie man sein musste, verbiss sich aber nicht, wenn etwas nicht klappte. Seine braunen Augen blitzten, er hatte eine freundliche Art zu reden. Und ich fühlte mich wohl in seiner Gesellschaft. Harrie schaffte es, fast jede Situation zu entspannen. Er ließ etwas fallen und lachte, ich machte einen Fehler und er lachte. Selbst als ich ein Spant zerbrach, lachte er, obwohl er es neu machen musste. Bei ihm konnte ich keine Fehler machen. Er hatte nicht das Bedürfnis, etwas besser zu wissen oder zu können oder mir zu zeigen, dass ich etwas nicht hinkriegte oder nicht verstanden hatte. Es war schön, mit ihm zu arbeiten.
»Du bist doch sicher auch bei der Weihnachtsfeier in Sterboom Huis«, sagte er eines Tages.
»Nicht, dass ich wüsste. Was ist das denn?«
»Das ist ganz toll. Wir bilden Fahrgemeinschaften, der ganze Ruderclub geht hin. Du bist sicher auch eingeladen. Der ganze Ruderclub ist eingeladen.«
»Wer lädt denn ein?«, fragte ich.
»Na, Greg. Sterboom Huis hat seinen Eltern gehört. Es ist eine ehemalige Schaffarm. Gregs Vater hat dort Merinoschafe gezüchtet. Jetzt ist die Farm zu einem Gästehaus umgebaut worden. Sie liegt in der Nähe von Calvinia. Das ist ein Stück nach Norden, in den Bergen. Es wird dir gefallen. Es gibt einen Nationalpark dort, man kann Wanderungen machen. Oder man nimmt die Pferde. Kannst du reiten?«
»Nein.«
»Das ist nicht schwierig, ich zeige es dir, wenn du Lust hast.«
»Mal sehen.« Ich beschloss, nicht zu viel Begeisterung zu verraten und abzuwarten, ob ich auch eingeladen wurde. Außerdem hatten meine Eltern seit jeher feste Vorstellungen, wie wir Weihnachten zu verbringen hatten.
»Hier geht man an den Strand«, teilte Laura uns mit, als ich das Thema beim Abendessen anschnitt. »Das ist voll lustig.«
»Ich habe mir extra Urlaub genommen, damit wir die Tage gemeinsam verbringen können«, sagte Mama. »Wir könnten eine Reise zum Eastern Cape in den Elefanten-Nationalpark machen. Was meinst du, Peter?«
Mein Vater nickte. »Gute Idee.«
»Ich finde das aber total öde«, sagte Laura. »Elefanten angucken kann ich auch im Zoo. Wieso müssen wir in die Pampa fahren, wo nichts los ist? Die anderen gehen alle zur Strandparty. Sie stellen Zelte auf, wir übernachten dort. Das wird voll gut.«
»Wir sind aber nicht die anderen«, sagte meine Mutter.
»Aber wenn Isa auf diese Farm darf, dann möchte ich auch machen, wozu ich Lust habe. Nur weil ich noch nicht achtzehn bin, habe ich nicht weniger Rechte als sie.«
»Es ist doch noch gar nicht gesagt, dass ich nach Sterboom Huis eingeladen werde«, antwortete ich. »Und ob ich dann gehe, auch nicht.«
Laura schmollte. »Nie unterstützt du mich!«
»Und es ist auch keine Frage der Rechte, Laura«, sagte Mama. »Du bist noch nicht volljährig. Und du übernachtest nicht in Zelten am Strand bei Leuten, die ich nicht kenne.«
»Dann lern sie halt kennen!« Laura sprang vom Tisch auf. »Aber das interessiert dich ja nicht. Du bist ja nie da. Kein Wunder, dass du meine Freunde nicht kennst. Da müsstest du dir ja mal Zeit für uns nehmen. Aber uns zu Weihnachten zur Familienfeier verdonnern. Nur weil du da gerade Urlaub genommen hast, müssen wir auf alles verzichten.«
Meine Mutter schluckte. »Was ist denn dabei, wenn wir uns einmal im Jahr für ein paar Stunden zusammensetzen und feiern?«
»Bitte, Laura«, sagte mein Vater, »setz dich wieder hin. Darüber kann man auch in Ruhe reden.«
»Als ob euch interessieren würde, wie ich mich fühle! Ihr wollt doch nur recht behalten!« Laura rannte hinaus und hoch in ihr Zimmer.
Meine Eltern blickten sich an.
»Pubertät«, bemerkte meine Mutter. »Das musste ja einmal kommen.«
Dann schaute sie mich an. Ich hatte nie solche Szenen gemacht. Strandpartys zu Weihnachten hatten mich nie interessiert. Ich war überhaupt kein Typ für Partys. Die fand ich meistens langweilig. Alle standen herum, es wurde nichts Sinnvolles besprochen, und man musste mehr trinken, als ich gut fand.
»Und du?«, fragte mich Mama. »Willst du denn wirklich auf diese Farm?«
Ich zuckte mit den Schultern. »Nicht unbedingt. Und noch bin ich ja nicht eingeladen.«
Ich wusste wirklich nicht, ob ich mit Harrie und Charlotte auf Gregs Farm fahren wollte. Es würde dort nicht anders sein als überall auch, wenn sich viele Leute auf einem Haufen versammelten, laut, betrunken, überfröhlich. Andererseits verspürte ich eine gewisse Anspannung, ein nagendes Sehnen. Ich konnte mir nicht erklären, warum, aber es kam mir wichtig vor, eingeladen zu werden. Unglaublich wichtig. Und wenn Greg mich nicht einlud, wäre ich bitter enttäuscht.
»Es ist dein Ruderclub«, bemerkte mein Vater. »Und du brauchst die Unterstützung des Clubs, wenn du wirklich einen Frauenachter trainieren willst. Da sollte man bei sozialen Ereignissen nicht außen vor bleiben. Das ist politisch unklug.«
Ich musste lachen. »Ich wusste gar nicht, dass ich Politik mache.«
Mein Vater lächelte. »Wenn man Mädchen aus den Townships zum Rudern bringen und mit einem Achter den Südkap-Schulpokal gewinnen will, dann ist das Politik. Oder etwa nicht?«
Meine Mutter stimmte ihm zu. »Soziale Netzwerke sind wichtig, Isa. Sie sind Arbeit.«
So hatte es mein Vater auf seine ruhige Art geschafft, dass meine Mutter zustimmen würde, falls ich wirklich über Weihnachten weg sein wollte oder eben musste. Und dann würde man vermutlich meiner Schwester ein bisschen Strandparty auch nicht verwehren. Meine Mutter würde ihren Urlaub verkürzen, mein Vater sich eine Radtour gönnen.
Allerdings stellte meine Mutter nun die heikle Frage: »Wie weit ist das denn gediehen mit deinem Achter? Hast du inzwischen Ruderinnen gefunden?«
Ich musste einräumen, dass ich das nicht hatte. Und ich hatte auch keine Ahnung, wie ich an Mädchen aus den Slums herankommen sollte. Das Problem hatte ich zurückgestellt, während Harrie und ich den Wit Swaan restaurierten. Alles der Reihe nach, hatte ich mich beschwichtigt.
»Du könntest dich an eine Hilfsorganisation wenden«, schlug meine Mutter vor. »Eine Organisation, die gezielt Mädchen fördert, an Plan International oder World Vision.« Sie grübelte. »Ich könnte auch mal bei mir im Büro fragen. Wir haben sicher Kontaktadressen. Allerdings arbeiten wir ja bevorzug mit Reisebüros und Nationalparks zusammen.«
Die Tipps meiner Mutter hatten immer so etwas von Undurchführbarkeit. Sie lebte in einer Welt, in der Kontakte selbstverständlich waren, weil viele Leute sich sehr dafür interessierten, mit ihr in Verbindung zu treten. Sie war wichtig, darum liefen ihr die Leute hinterher. Aber ich war nicht wichtig. Mit mir musste niemand in Kontakt sein. Ich hatte ja nichts zu bieten.
Aber da täuschte ich mich. Ich hatte nur in die falsche Richtung geschaut. Als ich tags darauf vom Rudern heimkam, traf ich unsere Haushälterin am Tor.
Sabra war eine Frau von traditioneller Statur, wie sie hier sagten, also füllig, eigentlich dick. Sie trug ein buntes Kleid und Schlappen an den Füßen. Bei uns im Haus war sie weniger bunt gekleidet, aber sie zog sich um, bevor sie sich auf den Heimweg machte. Sie trug eine volle Tasche. Aus den Diskussionen meiner Eltern wusste ich, dass sie die Erlaubnis hatte, das eine oder andere mitzunehmen, was vom Kochen übrig war, oder Obst und Gemüse, das man am anderen Tag nicht mehr verwenden konnte. Mein Vater hatte den Schwund in der Küche beklagt. Meine Mutter hatte erklärt, dass Dienstpersonal klaue, das sei bekannt. So waren sie übereingekommen, eine Erlaubnis auszusprechen, Lebensmittel mitzunehmen. Wir waren ja keine Armen, auch wenn es meine Eltern irritierte, dass sie praktisch für den alten Qwara, Sabra und deren Familie mit einkauften. Aber sie waren arm, lebten in einer Township, da wollten meine Eltern nicht knausrig wirken.
Sabra lächelte mich an und schaute mir dabei so intensiv in die Augen, dass ich den Eindruck hatte, sie wollte von der gut gefüllten Tasche ablenken, denn eigentlich blickten sich die Südafrikaner beim Reden nicht direkt an.
»Du kommst vom Rudern«, sagte sie. »Was für ein schöner Sport, immer an der frischen Luft, auf einem See. Das Wasser ... Ich habe meiner Nichte davon erzählt. Sie ist Lehrerin in einer Schule in Nyanga, wo ich wohne. Sie sagte: Wenn doch auch nur meine Mädchen rudern gehen könnten. Sport ist so gesund. Es lenkt ab. Bei uns herrscht so viel Gewalt, weißt du? Die Mädchen verlieben sich in die falschen Jungs, und ihr Schicksal ist besiegelt.«
Ich überlegte, was sie mir sagen wollte. »Aber die Mädchen können rudern, wenn sie wollen. Ich bringe es ihnen bei.«
Sabra tat überrascht. Ich war sicher, sie hatte gelauscht oder einfach nur zugehört, als ich von meinem Projekt redete. »Wie? Sie könnten rudern lernen? Das geht? Aber wie denn? Sie leben weit weg in Nyanga. Die Metrorail ist teuer. Sie gehen doch noch zur Schule, auf die Sithembele Matiso High School. Das ist eine gute Schule. Die Schülerinnen und Schüler sind fleißig und ehrgeizig. Die Lehrer geben sich große Mühe. Vier meiner Großnichten gehen dorthin.«
»Wollen deine Großnichten rudern?«
»Ich weiß nicht.«
»Ich könnte die Schule doch mal besuchen und vom Rudern erzählen.«
»Oh, Gott!« Sabra lachte. »Das ist viel zu gefährlich für dich. Nein, nein, das wird nicht gehen.«
Ich dachte an Mamas Verbot, in irgendeine Township zu gehen. Andererseits war ich volljährig. Sie konnte es mir nicht verbieten. Sie musste es aber auch gar nicht erfahren, jedenfalls nicht im Vorfeld.
»Vor Weihnachten«, fiel mir ein, »werde ich sicher keine Zeit haben ...«
»Ja, vor Weihnachten ist immer so viel zu tun. In den Ferien ist die Schule ja auch geschlossen. Und jetzt muss ich gehen. Es wird bald dunkel, ich muss kochen.«
Damit verabschiedete sie sich und ging mit ihrer wohlgefüllten Tasche die Straße hinunter. Ich fragte mich zum ersten Mal, wie sie nach Hause kam. Meistens fuhren Qwara und sie gemeinsam, aber wenn er meine Mutter vom Büro abholte, dann verspätete er sich manchmal, und sie brach allein auf. Vermutlich war sie einige Zeit unterwegs. Wo Nyanga genau lag, wusste ich nicht.
Zu dieser Jahreszeit, dem südafrikanischen Sommer, ging die Sonne meistens mit großem Pomp um sieben Uhr im Meer unter. Nach Sonnenuntergang hatte man Angst. Offenbar auch Sabra. Das erstaunte mich. Ohne nachzudenken, hatte ich angenommen, die Schwarzen seien für uns weiße Frauen eine Bedrohung, schwarze Frauen seien dagegen sicher. Was für ein rassistischer Gedanke!
Ja, mag sein, dass in den Townships die Gewalt der jungen schwarzen Männer ohne Zukunftschancen regierte, und da hatten wir Weißen nichts zu suchen mit unserem Reichtum und unseren glänzenden Lebensaussichten. Aber die weißen jungen Männer waren ja auch keine Engel. Eine Alte wie Sabra fühlte sich vermutlich zudem dort nicht sicher, wo sie nicht zu Hause war. Sabra hatte die Apartheid ja noch miterlebt.
Als sie abgeschafft wurde, war ich noch nicht mal in den Kindergarten gegangen. Ich hatte das Wort irgendwann in der Schule verstehen gelernt: Apartheid, das war die Rassentrennung, die in Südafrika perfektioniert worden war. Schwarze durften nicht dort sein, wo Weiße waren, nicht am Strand, nicht in Parks, sie teilten sich auch keine öffentliche Toilette, sie wohnten in getrennten Stadtteilen. Und natürlich wohnten die Weißen dort, wo es schön war, an den Küsten, in den Innenstädten, und die Schwarzen lebten in Wellblechhütten in den staubigen Ebenen des Hinterlands großer Städte.
Ich hätte mich näher damit beschäftigen müssen, aber ich hatte keine große Lust, mir das dritte Land meines Lebens anzueignen. Als wir in London wohnten, lernte ich noch eifrig, um eine echte Britin zu werden, in Paris war mein Eifer schon erlahmt. Ich wusste ja, in drei oder vier Jahren würden wir Frankreich verlassen. Auf München hatte ich mich gefreut. Auch wenn die Stadt mir im Grunde genauso fremd gewesen war, wie Kapstadt. Aber wie man in Deutschland lebte, wie man einkaufte, wo man hinging und wie man feierte, das hatte ich lernen wollen.
In Kapstadt würde ich nicht lange bleiben. Die Geheimnisse dieses Landes musste ich nicht durchschauen. Das lohnte sich nicht. In ziemlich genau einem Jahr würde ich mit der Schule fertig sein, und dann nach Deutschland gehen.
5.
Am 24. Dezember fuhren Charlotte, Harrie und ich Richtung Norden aus Kapstadt hinaus. Qwara saß am Steuer unseres Wagens mit Vierradantrieb. Die Fahrt nach Calvinia würde ungefähr fünf Stunden dauern, keine Entfernung für Südafrikaner. Das Land war groß und weit, man fuhr immer stundenlang, ehe man bei Freunden ankam.
Die N7 führte zwischen Zäunen durch gelb verdorrtes Hügelland. Hin und wieder passierten wir grüne Baumgruppen. Meistens waren es Eukalyptusbäume. Wenn sie direkt an der Straße standen, befand sich fast immer ein Wagen mit offenen Türen in ihrem Schatten, Leute machten Pause. Jeder Abzweig war eine Sensation. Im Wesentlichen ging es geradeaus.
Harrie saß vorn, Charlotte schlief, denn wir waren früh am Morgen aufgebrochen, und ich hatte Zeit, über das Gespräch mit Greg nachzudenken. Seit drei Tagen dachte ich darüber nach. Es ging mir nicht aus dem Kopf, und das ärgerte mich.
Harrie hatte mich gebeten, ihn zur Weihnachtsfeier in Sterboom Huis zu begleiten. Er sagte, es sei in Ordnung, wenn er mich mitbrächte. Außerdem lade Greg immer den ganzen Ruderclub ein. Ich solle ihm glauben, das gehe in Ordnung.
»Das mag schon sein«, hatte ich Harrie geantwortet, »aber wenn nicht, wäre es megapeinlich. Vielleicht möchte Greg ja gerade mich nicht bei sich im Haus haben. Also bei uns in Deutschland, da lädt man die Leute persönlich ein, wenigstens schreibt man eine Rundmail, sodass klar ist, ob sie mit einem rechnen oder nicht. Immerhin müssen wir ja auf der Ranch übernachten.«
Ich hatte zwar keine Ahnung, wie das in Deutschland war, aber bisher war es überall so gewesen, dass ich entweder direkt angesprochen worden war oder eine Mail bekommen hatte, wenn jemand zu einer großen Party lud. Und das konnte hier nicht anders sein. Davon war ich überzeugt. Außerdem hatte ich irgendwie das Gefühl, dass Greg keinen gesteigerten Wert darauf legte, sich mit mir abzugeben. Und ich glaubte, das hatte mit meinem Projekt zu tun, dem Achter für Mädchen aus den Townships. Der Clubvorstand hatte meiner Idee zwar prinzipiell zugestimmt und mir zugesichert, dass die Mädchen im Revier mit dem alten Wit Swaan trainieren durften, ohne einen Mitgliedsbeitrag zu bezahlen, aber vermutlich dachten sie, dass ich das eh nicht zustande bringen würde. Und insgeheim war ich überzeugt, dass Greg dagegen gewesen war, obgleich es keinen Hinweis darauf gab.
Doch zwei Tage nach dem Gespräch mit Harrie passte Greg mich ab. Wir hatten die Boote versorgt und waren auf dem Weg zur Terrasse, um etwas zu trinken. Ich hatte meine Wasserflasche am Bootssteg liegen lassen und war sie noch schnell holen gegangen. Im Augenwinkel sah ich Greg aus dem Bootshaus treten und das Tor schließen. Als ich wieder hinschaute, steuerte er direkt auf mich zu.
Mein Herz begann zu klopfen. Das tat es leider immer wieder, wenn ich ihn sah. Dabei konnte ich mir nicht richtig erklären, warum ich so reagierte, so angespannt. Es war kein angenehmes Gefühl. Es war Stress pur, und ich fühlte jedes Mal das Bedürfnis, mich umzudrehen und wegzulaufen. Bloß nicht mit ihm reden, ihm bloß nicht in die arroganten Augen schauen müssen. Und trotzdem musste ich immer wieder hingucken, etwa wenn er hoch über Kopf auf den gestreckten Armen den Renneiner aus dem Bootshaus über den Platz zum Steg trug und mit einer kraftvoll flüssigen Bewegung hinunterschwenkte und am Steg behutsam ins Wasser setzte. Jedes Mal bewunderte ich seine zart gebräunte Haut. Er war ein hellhäutiger Typ. Und irgendwie – vermutlich mit Sonnencreme – schaffte er es, dass seine Haut nicht verbrannte, wie bei den anderen Ruderern, die fast jeden Tag auf dem Wasser waren.
Doch jedes Mal, wenn ich ihn sah, ärgerte ich mich auch über seine Arroganz. Er schien ganz spezielle Freunde zu haben, mit denen er sich unterhielt. Mit anderen sprach er nicht. Zum Beispiel mit mir. Wenn sich unsere Blicke zufällig trafen, grüßte er höflich, aber desinteressiert. Ich kam mir jedes Mal vor wie ein dummes kleines Huhn, mit dem zu kommunizieren weit unter seiner Würde lag.
Doch jetzt kam er raschen Schrittes auf mich zu, als ich vom Steg zur Terrasse hochstieg. Dabei schaute er mich an. Aber meinte er wirklich mich? Oder machte ich mich lächerlich, wenn ich meinen Schritt bremste und mich ihm zuwandte? Ich senkte den Blick und wollte weitergehen. Aber er sprach mich an.
»Moment!«
Ich erschrak, blieb stehen und schaute hoch. Meinen Namen hatte er nicht genannt. Wusste er nicht, wie ich hieß?
»Harrie hat mir erzählt«, fuhr er fort, »dass du eine Extraeinladung brauchst.«
Peinlich. »Nein, so habe ich das nicht gesagt«, stammelte ich. »Ich war mir nur nicht ... äh ... sicher, ob ... Bei mir daheim ...« Wo auch immer das war. Ich redete Stuss.
»Offenbar hast du meine Rundmail nicht bekommen«, sagte er, ohne groß auf mein Gestammel zu achten.
»Nein, ich habe keine E-Mail bekommen.«
»Wahrscheinlich bist du noch nicht in meinem Verteiler.«
»Das könnte sein«, antwortete ich, als sei es meine Aufgabe, eine Entschuldigung zu suchen und ihm zu präsentieren.
»Den Weihnachtsbrief des Vorstands hast du auch nicht bekommen?«, fragte er.
»Nein.«
»Okay. Dann muss ich mir den Verteiler mal anschauen. Jedenfalls lade ich dich hiermit persönlich zu unserer alljährlichen Weihnachtsfeier ein, damit du auch wirklich glaubst, dass du erwünscht bist.«
»Oh, ja ... äh ... danke. Aber das ... das wäre nicht nötig gewesen. Ich habe nur gedacht, weil ich doch erst seit Kurzem im Club bin und weil ich doch wahrscheinlich auch gar nicht lange bleibe ... höchstens ein Jahr, bis ich Abitur habe ...« Ich redete schon wieder Blödsinn. Das interessierte den doch gar nicht.
Sein Lächeln war dann auch ziemlich spöttisch. »Am besten, du verabredest dich mit Harrie und Charlotte, und ihr bildet eine Fahrgemeinschaft. Die können dir auch alles erklären, was du vielleicht wissen möchtest.«
»Äh ... meine Eltern ... also wir feiern Weihnachten normalerweise ...« Es klang, als wollte ich mich jetzt rausreden.
Er runzelte die Stirn.
»Aber ich ... ich werde mit meinen Eltern sprechen«, faselte ich weiter. »Ich habe noch eine kleine Schwester, für die ist Weihnachten wichtig.« Was ja gar nicht stimmte, aber anscheinend waren mir Vernunft und Verstand abhandengekommen. »Aber ich glaube«, redete ich mich aus meiner eigenen Lüge wieder heraus, »die hat auch etwas vor.«
Darauf sagte er nichts. Ich kam mir wie ein dämliches kleines Kind vor, das zu sagen versuchte, dass es erst Mama und Papa fragen musste. Immerhin besann ich mich auf ein »Vielen Dank für die Einladung«.
»Gut, dann ist jetzt hoffentlich alles klar«, sagte er.
Ich nickte. »Mehr als klar.«
Daraufhin drehte er sich ohne ein weiteres Wort zur Terrasse um. Vor mir her ging er mit großen Schritten hinauf. Er hatte sich bereits umgezogen und trug T-Shirt und Shorts, die seine schmalen Hüften und breiten Schultern betonten. Ja, ich guckte ihm auf den Hintern. Es ging ja gar nicht anders. Und wieder einmal durchfuhr es mich. Er sah verteufelt gut aus. Und ich hasste das.
Nach zwei Stunden Fahrt kamen wir an den Olifantsrivier – Rivier hieß Fluss auf Afrikaans – und die Gegend wurde bergiger und grüner. Wir fuhren auf der immer gleichen Landstraße an einem glitzernden Stausee entlang. Qwara erklärte uns, dass er gut zwanzig Kilometer lang war. Ein gutes Ruderrevier, dachte ich. Aber in diesem Ort dachte vermutlich niemand daran. Das Wasser versorgte die Felder von Clanwilliam, einem hellen, weit verstreuten Dorf aus flachen Bauten, das von giftgrünen Plantagen umgeben war.
Ich fragte nach vorn, was hier angebaut wurde.
»Rooibos-Tee«, antwortete Harrie, sich umdrehend. »Außerdem Wein und Zitrusfrüchte. Clanwilliam gehört zu den ältesten Städten in Südafrika. Hier siedelten schon ab 1732 kapholländische Farmer. Bis eine Feuersbrunst vor hundert Jahren fast alle Häuser zerstörte.«
»Wo sind wir?«, fragte Charlotte. Sie war gerade aufgewacht.
»Gleich in Clanwilliam«, antwortete Harrie.
Charlotte schlug eine Pause vor. Sie wollte auf die Toilette. Wir hielten an einer Tankstelle am Ortseingang und tranken Kaffee. Danach ging es kurvig in die Zederberge hinauf. Bäume gab es keine, nur niedriges Gebüsch.
Nach einer halben Stunde dirigierte Harrie unseren Fahrer nach rechts von der Straße hinunter.
»Och nö«, stöhnte Charlotte.
»Nur kurz«, antwortete Harrie. »Isa hat das noch nicht gesehen. Es gibt nämlich«, wandte er sich an mich, »überall hier in der Gegend Felsenmalereien. Sie stammen aus der Frühzeit der Menschheit.«
Qwara hielt an einem Gasthaus namens Khoisan Kitchen Restaurant. »Das sind meine Vorfahren«, sagte er und deutete auf das Schild. »Ich bin ein Khoisan. Das heißt Mensch. Eigentlich bin ich ein San.«
»Viele Volksgruppen nennen sich selbst Mensch«, bemerkte Harrie. »Zum Beispiel auch die Inuit am Nordpol. Khoisan ist eine Zusammenziehung von Khoikhoi und San«, fuhr er an mich gewandt fort: »Die Khoikhoi waren Viehzüchter und nannten die San, die Sammler und Jäger waren, die vom Boden auflesen. Sie gehören aber eigentlich zur selben Volksgruppe. Die Khoisan sind sozusagen direkte Nachfahren der ersten Menschen überhaupt. Das hier, Isa, ist die Wiege der Menschheit. Hier lebten die ersten Menschen, die aufrecht gingen, mit Waffen jagten und eine eigene Kultur entwickelten. Der Homo sapiens: Intelligent und ... schwarz.«
Allerdings war Qwaras Haut eher haselnussbraun. Zum ersten Mal sah ich den kleinen drahtigen Alten aufmerksam an. Mir fielen die hohen Wangenknochen und das Pfefferkornhaar auf, diese Inseln aus natürlich zusammengezwirbelten Haarbüscheln, zwischen denen man die Kopfhaut sah.
Wir stiegen aus. Es war glühend heiß. Harrie erklärte, dass man hier eine mehrstündige Wanderung von einem bemalten Felsen zum anderen machen konnte. Dafür musste man im Restaurant eine Eintrittskarte lösen. »Aber ganz hier in der Nähe ist ein Felsen, und da gehen wir jetzt hin.«
Charlotte beschloss, ins Restaurant zu gehen, aber Qwara, Harrie und ich marschierten los.
»Heute gibt es nur noch etwa hunderttausend von uns Khoisan«, erklärte mir Qwara. »Die meisten sind als Arbeiter auf den Farmen angestellt.«





























