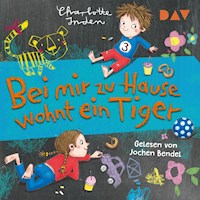18,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 18,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine junge Deutsche, die 1948 am New Yorker Flughafen strandet und als sitzen gelassene War Bride zum Star der Presse wird. Ein US-Soldat, der ein Versprechen gegeben hat und es nicht einhalten kann. Und eine Frau, die sieben Jahrzehnte später hofft, dass sich der Weg zum Glück wiederholen lässt. Dies ist die Geschichte eines Endes, zweier Anfänge und der vielleicht größten Liebe aller Zeiten. Charlotte Inden erhält den DELIA-Literaturpreis 2025 für »Im Warten sind wir wundervoll« »Ein Buch, das mit leisem Zauber und tiefem Gefühl eine poetische Welt erschafft, in der das Verliebtsein kostbar und berührend erscheint. Dieser Roman wurde mit einer sprachlichen Eleganz geschrieben, die eine sanfte und zugleich mitreißende Atmosphäre schafft und damit Herz und Verstand gleichermaßen fesselt und nicht wieder loslässt. Kleine, gut beobachtete Details verbinden sich in dieser Geschichte gekonnt zu berührender emotionaler Tiefe. (...) Ein Roman, der durch seine tiefgehende Empathie und durch die leisen Töne beeindruckt, die doch so laut von der Liebe erzählen. Zum Abtauchen und Anlehnen schön.« Aus der Begründung der DELIA-Fach-Jury, die den Roman aus insgesamt 300 eingereichten Neuerscheinungen des vergangenen Jahres zum Sieger kürte. »Ein außergewöhnlicher Roman – klug gestrickt, mitreißend geschrieben und in jeder Hinsicht wunderschön!« KATHINKA ENGEL »Luise Adler ist verliebt in das Leben und das Leben in sie, darum schafft sie es auch sofort auf die Titelseiten der großen New Yorker Zeitungen. Liebevoll-frech, raffiniert und mit Witz und Tempo erzählt Charlotte Inden von den grandiosen Umwegen der Liebe.« ELISABETH SANDMANN So charismatisch wie Bonnie Garmus' »Eine Frage der Chemie«, so mitreißend wie Susanne Abels »Stay away from Gretchen«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:
www.piper.de
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Im Warten sind wir wundervoll« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.
© Piper Verlag GmbH, München 2024
Covergestaltung: FAVORITBUERO, München
Covermotiv: George Marks / Retrofile RF / Getty Images
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence, München mit abavo vlow, Buchloe
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem E-Book hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen und übernimmt dafür keine Haftung. Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Widmung
I
II
III
1
2
3
4
5
6
7
8
9
IV
1
2
3
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
VI
1
2
3
4
5
6
7
8
VII
1
2
3
4
5
VIII
IX
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
X
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
XI
1
2
3
4
5
XII
1
2
3
4
5
6
7
XIII
1
2
3
4
5
6
XIV
1
2
3
4
5
XV
1
2
3
4
5
XVI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
XVII
XVIII
1
2
3
XIX
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
XX
1
2
3
4
5
XXI
1
2
3
4
5
6
XXII
1
2
3
4
5
6
XXIII
1
2
3
XXIV
1
2
3
4
5
6
7
XXV
1
2
3
4
XXVI
1
2
3
4
XXVII
1
2
3
XXVIII
1
2
3
4
8
XXIX
1
2
3
5
6
XXX
1
2
3
4
5
XXXI
1
2
3
4
5
6
7
XXXII
1
2
XXXIII
1
2
Author’s note
Thanks a lot I (the official part)
Thanks a lot II (the private part)
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
to the one I love
I
Sie hatte noch nie zuvor versucht, ihr ganzes Leben in einen Koffer zu packen.
Sie hatte auch noch nie zuvor einen Reisepass besessen.
Doch hier stand sie nun. Mit dem Koffer in der einen Hand und dem Reisepass in der anderen.
»Are you really coming?«, hatte er in seiner letzten Nachricht an sie geschrieben. »To stay?«
Yes.
II
»Are you alright?«
»Yes«, lügt sie. »I’m only panicking.«
Und sie denkt, während sie versucht, sich unauffällig ein, zwei Tränen von der Wange zu wischen: Kann man das so sagen? Und denkt dann: Warum sagst du das überhaupt? Jetzt wird er nachfragen.
Genau das tut er.
»Flugangst?«, fragt er. Er fragt es in fast akzentfreiem Deutsch.
Beeindruckend, findet sie. Sie selbst sagt mit hörbarem Akzent: »No. It’s much more complicated.«
Das Flugzeug rollt langsam, aber unerbittlich weiter. Das Terminal verschwindet Stück für Stück aus ihrem Blickfeld. Warten sie noch dort? Winken sie?
Sie hebt die Hand und presst sie kurz gegen das dicke Fensterglas.
Sofort nach der Landung, noch auf dem Rollfeld, wird sie ihr Handy einschalten und ihnen allen texten: Bin da! Schöner Flughafen. Alles ist gut.
Und das wird hoffentlich nicht gelogen sein.
Da beschleunigt das Flugzeug plötzlich. Und sie sieht das Terminal nicht mehr.
»Meine Großmutter ist mit dem Fahrrad quer durch Deutschland geradelt«, stößt sie hervor und greift abrupt quer über den leeren Platz zwischen ihnen nach seiner Hand. »Da war der Krieg gerade erst vorbei. Denken Sie nur. Das hat sie getan.«
»Did she really?«, sagt er und schaut auf ihre verschlungenen Hände hinab.
»O ja«, sagt sie. Dann muss sie kurz die Luft anhalten und kann nicht mehr weitersprechen, denn das Flugzeug hebt vom Boden ab. Presst sie in die Sitze. »Da werde ich ja wohl noch ein Flugzeug nehmen können, um mich über den Atlantik fliegen zu lassen«, flüstert sie und umklammert seine Hand wie eine Rettungsleine. »Dachte ich jedenfalls.«
»And so you do«, sagt er sanft. »Open your eyes.«
Sie öffnet die Augen.
»Look«, sagt er.
Und sie blinzelt und sieht dann nicht etwa zum Fenster hinaus und ein letztes Mal auf ihre Heimat hinab, sondern zum ersten Mal in sein Gesicht.
»Oh«, sagt sie.
»Was hat Ihre Großmutter getan, als sie angekommen war?«, fragt er und streicht einmal wie beiläufig mit dem Zeigefinger über ihre Knöchel.
»Sie verlobte sich.«
»Ah«, sagt er. »Big love. Und was werden Sie tun, wenn Sie aus diesem Flugzeug gestiegen sind?«
»Heiraten«, sagt sie und lässt seine Hand voll Bedauern wieder los.
III
1
Ihr Foto schaffte es nicht auf die Titelseite.
Aber ihr Foto schaffte es in die New York Times. In die Post. Und in die Daily News. Und in all die anderen Zeitungen, die im Dezember 1948 in New York so gelesen wurden.
»Jetzt sieh dir das an«, sagte Mr Solomon Newton zu seinem Sohn Benjamin, der gerade sein hastiges Frühstück beendete. »Dieses reizende Mädchen hier. Mit dem Koffer. Steht einsam und verlassen am Flughafen. Armes Ding. Gestrandet. Was soll sie jetzt machen? ›Lovely War Bride‹, schreiben sie. Und sie haben recht. Dieses goldene Haar. Wie die Loreley.«
»Dad«, sagte Benjamin, ohne hinzuschauen. »Wie willst du erkennen, dass sie goldenes Haar hat? Es ist ein Zeitungsfoto. Schwarz-weiß.«
Mr Newton ignorierte das. »Du solltest ihr schreiben«, sagte er. »Deine Dienste anbieten. Die kann sie brauchen. Sonst werden sie das arme Kind zurückschicken.«
»Bitte?«, sagte sein Sohn. »Nein. Ganz sicher nicht.«
»Aber sie ist reizend!«
»Du wiederholst dich.«
»Und braucht Hilfe.«
»Die brauche ich auch. Wie konnte ich nur denken, es sei eine gute Idee, Jura zu studieren? Ich hätte mich wie du für deutsche Lyrik entscheiden sollen. Nichts als Heinrich Heine und goldenes Haar den ganzen Tag.«
Mr Newton kannte dieses regelmäßig wiederkehrende Lamento und ignorierte auch das. »Du wirst ihr nicht schreiben?«
»Nein, sorry, Dad«, sagte sein Sohn, schob seinen Stuhl zurück, klemmte sich die abgegriffene Ledermappe unter den Arm und klopfte seinem Vater im Vorbeigehen freundlich auf die Schulter.
»Dann tu ich’s«, rief Mr Newton ihm nach. »Ich werde schreiben: Mein Sohn, der Anwalt, kann helfen. O ja, ich schreibe.«
Und er tat es.
Er sollte nicht der Einzige bleiben.
2
Idlewild Airport war 1948 noch recht überschaubar.
Kein Jahr alt.
Mit nur einem Terminal.
Aber der verdammt noch mal beste Flughafen der Welt, sagte Bürgermeister La Guardia.
Mit sechs Landebahnen. Lang genug, dass Jumbojets und Militärmaschinen sie anfliegen konnten.
Mit zwölf Fluglinien, die Flüge in alle Welt anboten. Peru? Paris? In Reichweite.
Der Duft der weiten Welt umwehte Idlewild Airport.
Er lag nur fünfundzwanzig Kilometer von Manhattan entfernt und war im Sumpfgebiet der Jamaica Bay errichtet worden. Wer zu Fuß über das Rollfeld lief, konnte das Meer riechen. Und mit salzigen Lippen die Gangway erklimmen.
Wer kein Ticket hatte, stand auf dem Aussichtsdeck und sah den Maschinen beim Starten und Landen zu. Während ein Sternenbanner über dem Tower im Wind schlug.
Früher hatte es hier einen Golfplatz gegeben. Idlewild hatte er geheißen. Ein guter Name. Er hielt sich hartnäckig, auch wenn nun Douglas DC-3s statt Golfbällen über das Marschland flogen.
Offiziell hieß der Flughafen International Airport.
Und wirklich: Er war in diesen Tagen das Tor zu einer anderen Welt.
Vor allem für die War Brides.
Jene junge Frauen aus Europa und dem Pazifikraum, die sich mit in der Fremde stationierten Soldaten verlobt oder verheiratet hatten. Und ihnen jetzt, da die Männer heimwärts zogen, nachreisten. Die Damen wollten in den Vereinigten Staaten von Amerika ein neues Leben beginnen, weit weg von den Nachkriegswirren ihrer Heimat.
Eigentlich war das Einwanderungsgesetz bedauerlich unnachgiebig. Liebe war darin nicht vorgesehen. Aber besondere Zeiten erforderten besondere Maßnahmen. Und waren die Mitglieder der US-Streitkräfte nicht sämtlich Helden? Musste man ihnen da nicht entgegenkommen?
Also machte der Kongress es möglich und entwarf eine Ausnahmeregelung. Den War Brides Act. Er erlaubte für einen kurzen Zeitraum die Einreise der Angetrauten und Verlobten.
Sie kamen in Scharen.
Die meisten per Schiff. Aber einige per Flugzeug. Vor allem jetzt, kurz bevor sich das Jahr dem Ende zuneigte und die Ausnahmeregelung auslief.
Die Zeit drängte.
Noch zehn Tage bis Neujahr.
Noch drei Tage bis Weihnachten.
3
»I’ll be home for Christmas«, sang Rosie, die frisch wie der frühe Wintermorgen über der Jamaica Bay an ihrem Schalter von American Airlines in Terminal eins stand.
Die Stirn weiß wie Schnee.
Die Lippen rot wie Christbaumkugeln.
Und lächelte.
Ernest kannte sie nicht anders als lächelnd.
Vielleicht ist es der Job, dachte er. Aber vielleicht ist es auch einfach nur Rosie.
Ihr Halstuch war lässiger geknüpft als bei den Mädchen der anderen Airlines links und rechts. Die gekonnt aufgedrehten Locken wippten munterer, und ein oder zwei hatten trotz aller Haarspangen so eine Art, ihr frech in die Stirn zu fallen.
»Ich liebe Bing Crosby einfach«, rief Rosie quer über den Gang hinweg. »Sie nicht auch, Ernest?«
Nein, Ernest nicht. Ernest hätte Mr Crosby jederzeit für Charlie Bird Parker im Regen stehen lassen. Der schrieb seine Musik immerhin selbst, Mr Crosby nicht mal seine Texte. Und mit Texten nahm Ernest es sehr genau. Immerhin hatte Ernest von Earnest Books and Papers, der eher Papers denn Books führte, sein Leben lang von einer eigenen Buchhandlung geträumt. Immer gedacht, wie viel friedvoller so ein Laden sein musste im Vergleich zu einer Zeitungsredaktion. Jetzt hatte Ernest einen Flughafen-Zeitungsstand. In einer eingeschossigen Betonschachtel von Terminal, die zwar im Winter kaum beheizt und im Sommer nicht klimatisiert wurde, aber bei Eröffnung mit Salutschüssen und einer Flugschau gefeiert worden war.
War Ernest nicht stolz? War er zufrieden? Schrieb er Briefe nach Hause, in denen stand: Ich bin angekommen?
Ernest McIntry hatte drei Brüder. Alle verheiratet. Alle mit Kindern. Alle angestellt im Familienunternehmen McIntry and Sons. Drillich aus dem Mittleren Westen. Drillich für die Streitkräfte. Im Krieg hatte man gut verdient. Wenn sie etwas lasen, dann kein Buch, sondern die Zeitung. Und wenn sie die Zeitung lasen, dann vor allem den Sportteil.
Ernest las auch den Sportteil. Aber Ernest las zuerst die Titelseite. Dann die Leitartikel. Dann das Feuilleton. Und nach dem Wetter endlich den Sport.
Und er schrieb nach Hause: Habt ihr das Spiel gesehen? Die Cubs könnten es wieder in die World Series schaffen.
Er schrieb nicht: Hört auf mit dem Quatsch, es gibt keinen Fluch. Das ist reine Selbstsuggestion.
Er schrieb auch niemals: Ich bin Pazifist.
Und niemals: Seid Ihr sicher, dass Ihr Geld mit dem Krieg machen wollt?
Er schrieb: Danke für den Kaffee, wie geht es den Kindern, was macht Dads schlimmer Fuß? An Weihnachten muss ich arbeiten, leider.
Ernest konnte sehr diplomatisch sein.
Seine Ex-Frau nannte ihn feige, bevor sie ihn verließ.
»Wenn du meinst«, hatte er geantwortet.
»Ist das alles?«, fragte sie eisig.
»Jawohl«, sagte er.
Sie hatten keine sehr leidenschaftliche Beziehung gehabt.
»Mr Crosby hat eine schöne Stimme«, antwortete Ernest jetzt, diplomatisch. »Kaffee, Miss Rosie?«
Rosie nickte, dass die Locken tanzten.
Ernest wandte den Blick ab, denn immerhin war er Mitte vierzig und Rosie sicher erst kürzlich von der Schulbank gerutscht.
Er holte seine Thermoskanne aus dem Regal, angelte die zwei Becher von dem Bord mit den broschierten Kriminalromanen, goss Kaffee hinein und fügte Zucker hinzu. Viel Zucker.
Manche mögen’s süß, dachte Ernest, während er sorgfältig umrührte. Das wäre ein schöner Filmtitel. Als sie gleichzeitig nach dem Zucker griffen, trafen sich ihre Blicke. Das wäre ein guter Satz für ein Drehbuch. Wie viele Paare wohl bei Kaffee mit Zucker zusammenfanden? Darüber müsste mal jemand eine Geschichte schreiben. Eine Reportage. Sich einen Tag lang beobachtend in ein Diner setzen. Roger hätte eine ganze Seite dafür hergegeben. Nicht für Ernest allerdings, denn Ernest hätte nie über die Liebe geschrieben. Und nicht die Seite eins, die niemals. Aber auf die Eins hatte es ja bis 1945 nicht mal der Holocaust geschafft. Dabei war es die Times, verdammt noch mal.
Doch halt, nicht aufregen.
Ernest hatte schließlich seinen Hut genommen. Und dazu seinen Kaffeebecher gepackt und sein Adressbuch eingesteckt. Damit war er dann aus den Redaktionsräumen spaziert, die Lesebrille noch auf der Nase, ein bisschen resigniert, ein bisschen erleichtert.
Er hatte höflich gegrüßt, das schon.
Er war nicht nachtragend. Er hatte Prinzipien.
Also würde er nicht zurückkehren.
O nein, nie mehr, sagte sich Ernest, während er mit den Bechern die fünf Meter quietschenden Linoleums überquerte, die seine Seite des Terminals von Rosies Seite des Terminals trennten. Nur das ständige Formulieren im Kopf hatte er nicht abstellen können. Das kam so selbstverständlich zu ihm wie das Atmen.
Ernest wich einem Paar mit Reisekoffern aus, sie nervös, er schwitzend. Ein Koffer traf Ernests Schienbein. Heißer Kaffee schwappte über Ernests Handrücken.
»Sorry«, sagte Ernest.
Dachte: Das Terminal wird täglich voller.
Es kamen immer mehr Fluglinien, die immer mehr Schalter brauchten. Und es kamen immer mehr Menschen, die mit diesen Fluglinien fliegen wollten. Und sich bei Ernest Reiselektüre besorgten.
Ein Grund zur Freude, dachte Ernest. Ich sollte es feiern. Mit wem?
Dann stand er vor Rosie.
»Für Sie«, sagte er und überreichte der jungen Frau mit einem kleinen Diener das Heißgetränk.
»Sie sind ein Schatz«, sagte Rosie. Sie sagte das beinah täglich, es ging ihr so leicht über die sorgfältig angemalten Lippen wie ein Guten Morgen, das wusste er wohl, konnte aber nicht verhindern, sich trotzdem daran zu erfreuen.
»Wie läuft Ihr Tag so weit?«, fragte er, während er einen Schluck seines restlichen Kaffees nahm.
»Bestens, danke der Nachfrage«, antwortete sie. »Boston ist durch. Chicago checkt bald ein. Zeit für eine kleine Pause.«
Normalerweise würde sie sich jetzt auf ihren ungepolsterten Hocker sinken lassen, um die Füße zu entlasten und den Rücken zu entspannen. Das war nämlich erlaubt, wenn gerade keine Airline-Kunden vor ihr standen.
Aber heute setzte sie sich nicht. Wie sollte sie auch still sitzen, da es ihr doch ganz offensichtlich nicht einmal gelang still zu stehen? Sie wippte auf den Spitzen ihre kleinen, blanken Absatzschuhe, tat plötzlich gar einen Ausfallschritt. Es wirkte fast, als tanzte sie hinter ihrem Schalter. Bing Crosbys wegen?
Rosie beugte sich über den Tresen näher zu ihm. Ernest sah, dass ihre dunklen Wimpern sich fast so schön bogen wie ihre Locken. Dann hauchte sie, als verrate sie ihm ein Geheimnis: »Es landen gleich welche. Ein ganzer Flieger voll!«
O Gott, dachte Ernest in plötzlichem Begreifen. Sagte aber tapfer: »Großartig!« Nur, um ihr nicht den Spaß zu verderben.
»Nicht wahr?«, jubelte Rosie. »War Brides direkt aus Europa.« In dem Tonfall hätte sie auch sagen könnte: »Orangen, frisch aus Kalifornien!« Es fehlte nicht viel, und sie hätte vor Begeisterung in die Hände geklatscht.
Ernest würgte ein bisschen an seinem Kaffee, während er um eine diplomatische Antwort rang. »Es ist ein schöner Tag, um das erste Mal New York zu sehen«, brachte er schließlich heraus. »Nur drei Grad über null. Aber spektakulär sonnig.«
Da strahlte Rosie, als wolle sie der Sonne Konkurrenz machen.
Ernest hätte jederzeit auf Miss Rosie gewettet.
4
Rosie war verliebt in die Liebe.
Das war sie vielleicht schon immer gewesen. Jedenfalls konnte sie sich nicht daran erinnern, dass es einmal anders gewesen sein sollte.
In der U-Bahn, im Park oder einfach nur, während sie abends mit ihrer Mutter vor ihrem schmalen Backsteinhaus im Village auf der Treppe saß, beobachtete sie, wie die Menschen sich einander zuwandten.
Beobachtete, wie die Hennessys aus Nummer zwölf, zwei Häuser weiter, zu ihrem abendlichen Spaziergang um den Block aufbrachen. Die beiden waren uralt, sicher fast sechzig, aber als sie losgingen, die Straße entlang, über die Betonplatten hinweg, unter den frühlingsgrünen Platanen hindurch bis zum Hudson hinunter, hielten sie sich an der Hand.
Das wollte Rosie auch einmal haben. In ferner, ach so ferner Zukunft. Für den Moment dachte sie eher an etwas mit mehr Leidenschaft.
Einmal beobachtete sie auf dem Weg hinaus nach Idlewild, wie ein feiner Herr im dunklen Mantel einer jungen Frau mit schlanken Fesseln im Bus seinen Platz anbot. Wie sie errötend lächelte. Graziös niedersank. Und dann den Rock nicht ganz nach unten zupfte. Und wie sein Blick tiefer wanderte.
Da sah Rosie weg. Immerhin war das trotz des öffentlichen Ortes doch ein sehr privater Moment.
Ein intimer.
Knisternder.
So etwas wollte Rosie auch erleben.
Und noch mehr.
Küsse, die Sterne vom Himmel regnen ließen und Feuerwerkskörper explodieren.
Sie wusste, es musste die große Liebe geben.
Die Kinos waren schließlich voll davon.
Und Hollywood musste doch wissen, wovon es erzählte.
Die Nacht vor der Hochzeit war Rosies Lieblingsfilm. Bei Casablanca hatte sie geweint, als würde ihr das Herz brechen.
Diese bösen Nazis.
Diese reizende Ingrid Bergman.
Und dann Mr Bogart!
Er war nicht unbedingt ein schöner Mann.
Und auch nicht unbedingt ein junger Mann.
Aber er konnte so herrlich streng sein.
Und so schön die Stirn runzeln.
Es war schwer, dieses Talent bei einem jungen Mann zu finden. Die jungen Männer, die Rosies Weg kreuzten, und es waren nicht eben wenige, tendierten dazu, sie zu bewundern, aber nicht ernst zu nehmen.
Wenn Rosie sagte: »Diese armen Menschen in Europa in ihren zerbombten Städten tun mir so schrecklich leid. Hast du im Kino die Bilder gesehen, die sie im Newsreel zeigen?«, sagten sie: »Ja, wirklich furchtbar. Möchtest du noch eine Coke, Süße?« Oder schlimmer noch: »Darüber musst du dir doch nicht dein hübsches Köpfchen zerbrechen.«
Michael zum Beispiel, der schon zusammen mit ihr zur Schule gegangen war, sagte diesen Satz mit verabscheuungswürdiger Regelmäßigkeit. Jeden Samstag, wenn er sie ausführte, zum Beispiel. Wäre Rosie nicht so furchtbar gerne ins Kino gegangen, wäre er nicht so ein wirklich guter Tänzer gewesen, hätte sie ihm die Freundschaft aufgekündigt.
Aus moralischer Sicht hätte sie es tun sollen.
Aus ökonomischer eher nicht.
Im Rechnen bin ich nämlich sehr gut, dachte Rosie. Manchmal fragte sie sich, meistens daheim vorm Spiegel, ob es nicht besser gewesen wäre, nicht so hübsch zu sein. Nicht so dichtes, glänzendes Haar zu haben. Nicht solch eine Porzellanhaut. Und vor allem nicht so eine Stundenglasfigur, nach der die Männer sich umdrehten. Ob sie nicht zumindest aufhören sollte, sich mit ihrem Äußeren Mühe zu geben? Vielleicht sollte sie es lassen, sich die Haare zu machen. Die Brauen nachzuziehen. Vielleicht. Aber sie brachte es nicht über sich.
Ich bin selbstsüchtig, dachte sie. Oberflächlich. Aber was soll ich tun? Ich bin einfach gerne hübsch. Ich mag es, bewundernd angesehen zu werden. Ich mag es, angelächelt zu werden.
Muss ich das ändern?
Die Entscheidung war ihr erst einmal abgenommen worden, denn zu ihrem Job bei American Airlines gehörte eine gepflegte Erscheinung.
Verstehen Sie, Miss Rosie?
Aber sicher, sage Miss Rosie.
Und wenn Rosie aufgeatmet hatte, dann nur ein kleines bisschen.
Den Job brauchte sie. Jetzt mehr denn je, da Mrs Rosie Fisher, ihre Mutter, nicht mehr in der Fabrik arbeiten durfte.
Die Männer waren zurück aus dem Krieg, zurück in ihren Jobs. Und glücklich darüber.
Die Frauen, die sie vertreten hatten, waren zurück am Herd. Und darüber nicht ganz so glücklich.
»Es war schön, eine Aufgabe zu haben«, sagte Mrs Fisher zu Rosie, als sie eines Abends Makkaroni mit Käse aßen und Radio hörten. »Eine so gut bezahlte. Auch wenn ich natürlich froh bin, dass der Krieg vorbei ist. Ich wieder im Salon aushelfen kann. Und keine Tomaten mehr auf der Feuertreppe ziehen muss. Ich kaufe sie so viel lieber einfach bei Toni.«
Die Damen Fisher liebten Toni und seinen Laden unter der rot-weiß gestreiften Markise. Fast noch mehr als seine Tomaten.
»Du wirst immer eine Aufgabe habe«, sagte Rosie. »Du hast mich.«
»Ach, mein Liebling«, sagte Mrs Fisher da nur. »Aber du bist schon so ganz und gar erwachsen. Schau dich nur an.«
Und das tat Rosie. Immer und immer wieder. Es gab ja auch so viele Gelegenheiten. Spiegel. Spiegelnde Scheiben. Spiegelnde Oberflächen. Und sie alle sagten ihr: Du hast die besten Aussichten, Rosie, eine gute Partie zu machen.
Dann musst du nicht mehr am Flughafen arbeiten.
Dann muss deine Mom sich keine Sorgen mehr um die Zukunft machen.
Aber, sagte eine Stimme in Rosies Kopf, ich bin ja gar nicht auf der Suche nach einer guten Partie.
Ich will mich verlieben.
Rettungslos.
Hoffnungslos.
Mit weniger als welterschütternd werde ich mich nicht zufriedengeben.
5
»Ich beneide diese War Brides ganz schrecklich«, sagte Rosie an jenem Tag Ende Dezember zu Ernest. Und dachte dann, dass ein Geständnis dieser Art eigentlich eher das schützende Halbdunkel des Beichtstuhls von Pater Monaghan erfordert hätte als das unerbittlich ausgeleuchtete Terminal eins.
An der Wahrheit änderte das allerdings nichts: Sie, Rosie Fisher, beneidete diese vom Schicksal gebeutelten Frauen.
Die den Krieg aus nächster Nähe hatten miterleben müssen. Nicht mit dem ganzen Atlantik als Puffer.
Die Bomben hatten fallen hören. Nicht nur als Wiederholung im Newsreel.
Deren Städte in Schutt und Asche lagen.
Ob Ernest jetzt sehr entsetzt war?
Nein, Ernest stand einfach nur da mit seinem Becher in der einen Hand, die andere in seiner Cordhosentasche vergraben, und wartete. Einzig eine hochgezogene Augenbraue verriet so etwas wie gelinde Verwunderung.
»Sie beneiden diese Frauen«, wiederholte er. »Ist es gestattet zu fragen, wieso?«
»Weil sie verliebt sind«, sagte Rosie sehnsüchtig.
»Oh«, sagte Ernest.
»Finden Sie das naiv?«, fragte Rosie. »Kleingeistig? Verabscheuungswürdig?«
»Nein«, sagte Ernest und klang durchaus überzeugend. »Ganz und gar nicht.«
Das hörte Rose gern. Allerdings hörte sie es nur noch mit einem Ohr, denn sie wurde abgelenkt: So viele Männer bevölkerten plötzlich das Terminal. Ganz ohne Gepäck. In Freizeithemd oder Sonntagsstaat. Und in Uniform. Sahen schneidig aus. Wegen der Uniform. Und mutig. Wegen der Uniform. Blieben stehen und warteten Seite an Seite mit den Herren in Zivil. Hatten ja alle gemeinsam gedient. Waren ausgezogen fürs Vaterland und hatten die große Liebe gefunden.
»Hach!«, machte Rosie. Wollte sich eigentlich ans Herz greifen, überlegte es sich dann aber anders und griff nach Ernests Arm, um den Halt nicht zu verlieren, als sie sich auf die Zehenspitzen stellte. Sie schwankte wie eine Christrose im Wind, reckte den hübschen Kopf und hielt zusammen mit einem Terminal voller Männer Ausschau nach der ersten War Bride.
6
Ernest hatte viele War Brides kommen und gehen sehen.
Da war keine, deren Liebesgeschichte sein Herz rühren konnte.
Er wünschte ihnen viel Glück, das sicher.
Aber mehr Leidenschaft brachte er für die ganze Angelegenheit nicht auf.
Oder so dachte er bis zu diesem Tag im Dezember.
»Ich weiß nicht, ob diese jungen Damen wirklich zu beneiden sind, Miss Rosie«, sagte er zu der jungen Frau, die sich auf seinen Arm stützte, auf den Schuhspitzen balancierte und dabei gefährlich instabil wirkte. Sicherheitshalber hielt Ernest seine Hand mit dem Kaffeebecher etwas vom Körper weg. Kaffeeflecken würden Miss Rosies Uniform fürchterlich verschandeln. »Ich fürchte«, sagt er, »manche der Damen weinen sich im Anflug auf New York die Augen aus.«
Rosie sank auf ihre Absätze hinunter. »Sie meinen wegen des Krieges?«
Nein, das meinte Ernest nicht. Er versuchte, sich zu erklären: »Ich fürchte, sie haben Heimweh«, sagte er. »Und Angst.«
»Angst?«, rief Rosie. »Wovor denn, um Himmels willen?«
Das war eine lange Liste. »Vor dem, was kommt«, begann er. »Davor, dass es schiefgeht. Davor, was passiert, wenn es schiefgeht.«
»Aber, Mr Ernest, sie sind doch verliebt!«
Das bezweifelte Ernest ernsthaft.
Dabei wäre es natürlich schön, wenn manche der Damen im kriegszerstörten Europa nicht nur nach einem Rettungsring namens Jim, Bob oder Tom gegriffen hätten, sondern tatsächlich die Liebe gefunden. Er wünschte es ihnen. Er gönnte es ihnen. Ein bisschen Glück nach all dem Leid.
Rosie sog hörbar den Atem ein. Umklammerte seinen Arm noch fester. »Da kommen sie!«
Ja, da kamen sie.
Junge Frauen vor allem.
Hübsche Frauen. Aber auch unauffällige Frauen.
Dünne Frauen vor allem. Denn Krieg bedeutete Hunger.
Es waren blonde und brünette Frauen, die jetzt durch das Terminal schritten. Unterwegs Richtung Ausgang. Richtung neues Leben. Manche beherzt, manche zögerlicher.
Alle beladen mit Koffern und Taschen, mit Rucksäcken und Beuteln und Körben.
Darin ihr ganzes Hab und Gut.
Allein die Vorstellung, dachte Ernest. Was würde ich mitnehmen? Auswählen?
Und war er nicht ein glücklicher Mann, dass er überhaupt wählen konnte? Vielleicht war der ein oder andere Koffer, der gerade ins Terminal eins getragen wurde, so gut wie leer. Schließlich lässt sich nichts einpacken, wenn nichts mehr da ist.
Ernest stellte endlich seinen Becher ab. Er fand, Kaffee zu trinken, während sich das echte Leben in all seiner Dramatik vor ihm ausbreitete, genauso geschmacklos, wie in der Abendvorstellung im Roxy unter der Stuckdecke zu sitzen und Popcorn zu essen, während das Newsreel ein ausgebombtes Berlin zeigte.
Diese Stadt in Trümmern. Mit Straßen ohne Häuser. Mit Häusern ohne Dächer. Keine Stuckdecke weit und breit.
Ernest erkannte, dass ihn die Liebesgeschichten der Frauen vielleicht kaltließen, ihre Schicksale aber nicht.
7
Rosie wandte den Blick nicht eine Sekunde von den War Brides.
Das hier war so viel besser als Liebe auf der großen Leinwand. Das hier war das echte Leben mit Happy End. Obwohl es erstaunlicherweise viel weniger romantisch aussah als bei Mr Bogart und Ingrid Bergman.
»Die beiden da geben sich die Hand wie Fremde«, sagte Rosie enttäuscht zu Mr Ernest. »Schauen Sie nur.«
»Vielleicht fühlen sie sich ja wie Fremde«, sagte Ernest. »Weil sie sich eine Weile nicht gesehen haben. Jahre womöglich. Oder weil sie sich noch gar nicht richtig kannten, als sie beschlossen, den Rest ihres Lebens miteinander verbringen zu wollen.«
Rose war irritiert. Das konnte doch nicht stimmen. Die Liebe schlug schließlich ein wie ein Blitz. Entfachte ein Feuer, das ewig brannte. Und alles war gut.
»Ernest«, sagte sie, »sehen Sie den Großen da? Lang wie ein Baum, Schultern wie ein Bär? Und hier kommt sie. Wie sie lächelt! Und er … O nein, was macht er denn da? Er küsst seine Braut auf die Wange. Auf die Wange!«, klagte Rosie. »Das ist doch kein Kuss unter Liebenden.«
»Was erwarten Sie denn?«, erkundigte sich Ernest mit ehrlichem Interesse. »Einen Kuss wie im Film?«
Ja, genau so einen.
Rosie wartete auf den Moment, in dem sie die Geigen und das Feuerwerk sehen konnte. Und wurde immer ungeduldiger. Zappeliger.
Da legte Ernest seine Hand auf ihre. Die Geste kam so überraschend und war so überraschend willkommen, dass Rosie zu Ernest aufsah, um ihm ein Lächeln mit Grübchen zu schenken. Ihr schönstes also.
Nur bemerkte er es nicht. Konnte es gar nicht bemerken, blickte er doch plötzlich wie gebannt geradeaus.
Er ließ seinen Arm sinken. Rosies Hand griff ins Leere.
»Schauen Sie nur«, sagte Ernest.
Er sagte es voller Staunen.
8
So manche junge Dame hatte sich herausgeputzt.
Vor dem langen Flug die Haare gelegt, die jetzt natürlich ein bisschen zerdrückt waren. Vor der Landung rasch die Lippen nachgezogen.
Manche hatten leuchtende Augen.
Manche waren blass.
Vor Glück, vor Aufregung, vor Schlafmangel, wer konnte das sagen?
Eine strauchelte, als sie das Flugzeug verließ und zum ersten Mal amerikanischen Boden betrat.
Eine erst, als sie Terminal eins erreichte.
Dann kam der Moment der Begegnung.
So lang ersehnt?
Jedenfalls mit Herzflattern.
Manche Damen fielen ihren GIs um den Hals.
Andere hängten sich ihnen an den Arm und ließen gar nicht mehr los.
Wieder andere hielten einfach nur ihre Hand.
Oder auch verlegen Abstand.
Sie alle aber traten schließlich durch die Glastüren von Terminal eins hinaus in ihr neues Leben.
Alle.
Bis auf eine.
9
Fräulein Luise Adler, das Mädchen mit den goldenen Haaren, hatte nicht geplant, tabloid star zu werden. Weder in der Times. Noch in der Post. Noch in den Daily News.
Ihr Plan hatte vielmehr so ausgesehen:
In das Flugzeug steigen.
Nicht abspringen, bevor es startete.
Durchhalten, aushalten den ganzen langen Flug, den ganzen weiten Weg über den Atlantik.
Nicht an das denken, was hinter ihr lag.
Nicht an die denken, die sie vielleicht nie wiedersehen würde.
Nur an ihn.
So weit, so gut. Sie saß. Sogar am Fenster. Das hatte sie nicht gewollt, das war so passiert.
Würde sie Flugangst haben?
Nein.
Sie hatte ihren Bruder im Krieg verloren. Sie hatte ihr Zuhause im Krieg verloren.
Sie, Luise Adler, einundzwanzig Jahre jung, hatte vor nichts mehr Angst. Würde vor nichts mehr Angst haben.
Nie mehr.
Sie hatte keine Angst, als der Flieger abhob. Und sie hatte auch keine Angst, als der Flieger über die Wolken stieg. Als er brummend den Atlantik überquerte, der sich riesig bis unendlich unter ihnen ausbreitete. So blau. So tödlich.
Sie hatte noch nie zuvor das Meer gesehen.
Sie hatte keine Angst davor, abzustürzen. Obwohl sie ja sehr gut wusste, wie leicht ein Flugzeug vom Himmel zu holen war. Wie schnell es den Boden erreichte. Das Geräusch, das es dabei machte. Das Geräusch, das es machte, wenn es zerschellte. Und das Geräusch der Stille danach.
Sie hatte es schließlich schon erlebt.
Aber nein, sie, Luise Adler, hatte keine Angst.
Nicht beim Sinkflug, nicht bei der Landung.
Nicht mal, als sie zum ersten Mal den Fuß auf fremden Boden setzte.
Warum sollte sie auch?
Gleich würde sie ihn wiedersehen. Gleich würde sich die Menge teilen, und er würde dort stehen. Und sein Gesicht würde sich aufhellen, sobald er sie entdeckte.
Ja, die Menge verlief sich.
Der letzte Rock verschwand.
Zurück blieb Luise.
Stand noch eine Weile.
Schwankte nicht.
Stellte ihren Koffer ab und machte sich bereit, zu warten, solange es eben dauern würde.
Mich kriegt nichts klein, dachte Fräulein Luise Adler.
IV
1
Es ist ein Transatlantikflug. Frankfurt – New York. Nonstop. Sie werden viele Stunden nebeneinandersitzen. Nur mit diesem einen leeren Platz zwischen sich.
Die Anschnallzeichen sind erloschen, die Flugbeleiter inzwischen mit ihren Rollwägelchen voller Erdnüsse, Tomatensaft und Ginger Ale unterwegs, da fragt sie mit kleiner Stimme: »Wie war das mit der Flugangst, Mister? Woran merkt man, dass man die hat?«
Er lässt sein Magazin sinken, das er vorgibt zu lesen. »Warum fragen Sie?«, erkundigt er sich und sieht sie an. Er hat lange versucht, sie nicht mehr anzusehen. Etwa zehn Minuten ohne Seitenblick hat er geschafft.
Jetzt entdeckt er, dass sie sehr blass ist. Nicht nur um die Nase. »Was ist los?«
»Ich denke zu viel«, flüstert sie.
»Ist das überhaupt möglich?«
»O ja«, sagt sie.
Das klingt sehr von Herzen kommend, findet er. »Und was denken Sie so?«
»Ich denke: Werde ich ihn noch kennen? Wir haben uns monatelang nicht gesehen! Werde ich sein Zimmer mögen? Werden seine Freunde mich mögen? Werde ich ihm noch gefallen, jetzt, da ich so viele Monate älter bin? Und später, wenn ich graue Haare kriege, die ich nicht färben will, und ein Gebiss, das ich nachts neben seiner Zahnbürste in ein Wasserglas legen muss? Werden wir glücklich werden? Werde ich glücklich sein? Wie soll ich das, wenn seine Freunde mich nicht mögen? Und ich ihm nicht mehr gefalle? All diese Gedanken werden zu einem Karussell, sie drehen sich, alles dreht sich, mir wird ganz schwindelig davon.«
Sie hält sich den Kopf. Ganz fest. So, als müsse sie ihn am Auseinanderspringen hindern.
»Verstehe«, sagt er mitleidig. So viele und so große Gefühle mit auf Reisen zu nehmen, ist nie eine gute Idee. Manchmal verlieren sie sich unterwegs, aber wenn nicht, sind sie das schwerste Gepäck überhaupt.
Sie dort in ihrer Fensterecke schluckt krampfhaft. Und lässt die Hände sinken. Presst sie auf den Magen. »Ich glaube, jetzt wird mir übel. Wo sind denn hier die Spucktüten?«
Sie beginnt, zu suchen. Weil ihre Finger dabei so zittern, reißt er aus dem Paket mit Infomaterial an der Rückenlehne vor sich seine Tüte heraus und reicht sie ihr.
»Die ist auch gut gegen Hyperventilieren«, sagt er freundlich.
»Hyperventilieren? Ich?«, stößt sie hervor. »Ach, Quatsch.« Beginnt aber, zurückgelehnt in ihren Sitz, in seine Papiertüte zu atmen.
Er fragt sich, wie er ein kleines, blasses Gesicht hinter einer Papiertüte, ein Paar vor Anstrengung gerunzelter Brauen so unglaublich anziehend finden kann.
2
Sie versucht, langsam und tief Luft zu holen.
Und dieses Gedankenkarussell anzuhalten.
Ja, können vor Lachen. Wenn sie wüsste, wie, würde sie jetzt nicht dasitzen und sich mit einer Papiertüte vorm Gesicht lächerlich machen. Spucktüte. Nicht Papiertüte. Viel schlimmer.
»Weißt du was?«, sagt er da plötzlich neben ihr. »Du musst springen.«
»Entschuldigung?«
»Abspringen. Du musst von deinem Karussell abspringen.«
Er hat »du« gesagt.
Sie stellt erstaunt fest, dass ihr das gefällt.
»Versuch es«, sagt er drängend. »Spring!«
Okay. Sie lässt die Tüte sinken und schließt die Augen.
Abspringen also, denkt sie. Wie? Oder vielleicht besser: wohin? Ich brauche ein Bild. Eins, an dem ich mich festhalten, in das ich eintauchen kann. Nur welches?
Kaum hat sie das gedacht, fühlt sie sich schuldig.
Sie muss natürlich an ihn denken.
An das letzte Mal, dass sie ihn gesehen hatte, vielleicht?
Sie versucht es: Er, wie er davonging, so groß, dass die Menschen hinsahen, so gut aussehend, dass sie nicht wieder wegsahen. Wie er sich noch einmal umdrehte, bevor er sein Ticket vorzeigte. Hinflug. Ein Rückflugticket hatte er nicht. Sie warf ihm eine Kusshand zu, die er auffing. Die Menschen um sie herum lächelten.
Aber kaum heraufbeschworen, verblasst das Bild, als habe sie es überbelichtet. Sie gibt einen Laut von sich wie ein gequältes Tier.
Ihr Nachbar hört ihn. »Was jetzt?«, fragt er.
Sie schüttelt abwehrend den Kopf, presst die Lider noch fester zusammen und versucht, da, in der Dunkelheit, ein Bild heraufzubeschwören, das sie rettet. Kann nicht verhindern, dass ihr die Brust eng wird.
»Ist hier genug Luft? In dieser Maschine? Muss ja eigentlich, klar. Fühlt sich aber nicht so an.« Sie keucht.
»Oh no«, sagt er alarmiert. »So langsam mache ich mir hier drüben wirklich Sorgen.«
Sie hört, fühlt dann, wie er eine Armlehne hochklappt und sich bewegt. Spürt seine Wärme neben sich, als er einen Sitz aufrutscht. Zu ihr.
Ihre Lider fliegen auf.
»Hey«, sagt er.
Er hat graue Augen.
Sie mag graue Augen.
Er nimmt eine ihrer klammen Hände in seine warmen.
»Ist das okay?«, fragt er.
Ihre Finger kribbeln, wo seine sie berühren. Ist das okay?
Sie nickt, ohne die Antwort auf diese Frage zu kennen.
Er tut einen erleichterten Seufzer. »Jetzt fühle ich mich besser. Was ist mit dir?«
Sie muss lachen. Auch wenn es etwas atemlos gerät.
»Mir geht’s gut«, stößt sie hervor. »Jetzt gerade geht’s mir gut.«
»Fine«, sagt er. »Immer schön weiteratmen.«
3
Sie sitzen eine Weile nur so da. Atmen.
Lauschen dem dumpfen Gedröhn des Flugzeugs. Es dämpft die Geräusche der anderen Passagiere, der Flugbegleiter.
Sie beide sind ganz allein in ihrer Sitzreihe.
Er ist nicht wieder auf seinen Platz zurückgerutscht.
»So«, sagt er schließlich. »Willst du mir von deinem fiancé erzählen?«
»Wem?«
»Von dem Mann, den du heiraten wirst?«
»Oh«, sagt sie. »Nein.«
»Okay«, sagt er. »Und was ist mit dem fiancé deiner Großmutter?«
»Das ist eine lange Geschichte.«
Sie hält die Spucktüte immer noch in der Hand. In der linken. Die rechte liegt auf der Armlehne neben ihm. So nah, dass er versucht ist, wieder danach zu greifen.
Stattdessen sagt er: »Wir haben eine ganze Atlantiküberquerung lang Zeit.«