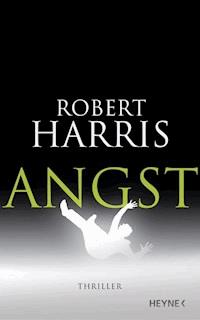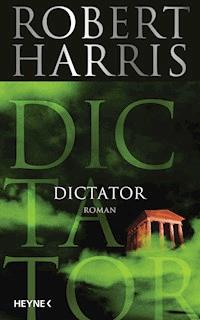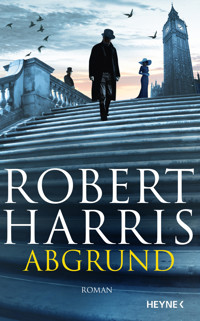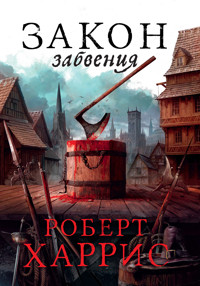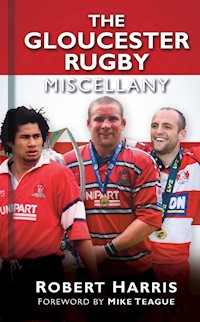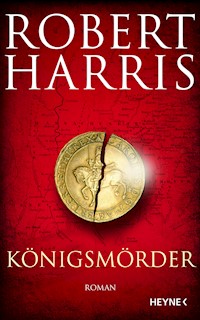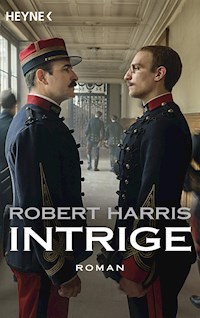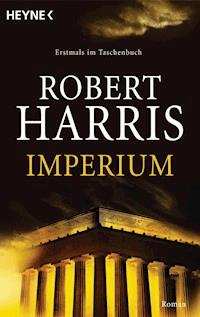
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Cicero
- Sprache: Deutsch
Macht will ein Imperium
„Pompeji“ war ein internationaler Triumph. Robert Harris versteht es wie kein Zweiter, die Antike mit Leben zu füllen und die Gegenwart in einem Roman zu beschreiben, der vor zweitausend Jahren spielt. Im Mittelpunkt von „Imperium“ steht ein gerissener, mit allen Wassern gewaschener Anwalt und geborener Machtpolitiker: Marcus Tullius Cicero.
Ein unbekannter junger Anwalt – hochintelligent, sensibel und enorm ehrgeizig – betritt das Zentrum der Macht. Er hat nur ein Ziel: Er will nach ganz oben. Der Fall eines Kunstsammlers, der vor der Willkür eines skrupellosen und gierigen Gouverneurs fliehen muss, kommt ihm da gerade recht. Der Gouverneur hat einflussreiche und gefährliche Freunde im Senat, und sollte der Anwalt den Fall gewinnen, würde er die gesamte alte Machtclique zerschlagen. An die Niederlage wagt er nicht zu denken, sie könnte ihn das Leben kosten. Eine einzige Rede kann über sein Schicksal und die Zukunft einer Weltmacht entscheiden, doch seine gefährlichste Waffe ist das Wort.
Die Weltmacht am Scheideweg ist Rom. Der Name des jungen Anwalts ist Marcus Tullius Cicero, Außenseiter, Philosoph, brillanter Redner und der erste Politiker modernen Stils.
Ein topaktueller Roman im historischen Gewand.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 673
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
ROBERT HARRIS
IMPERIUM
ROMAN
Aus dem Englischen von Wolfgang Müller
WILHELM HEYNE VERLAGMÜCHEN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel
Imperium
bei Hutchinson, London
Copyright © 2006 by Robert Harris Copyright © 2006 der deutschsprachigen Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München Umschlaggestaltung: Eisele Grafik·Design, München unter Verwendung eines Fotos von © Ched Ehlers/Getty Images Karten: GeoKarta, Heiner Newe, Altensteig; Animagic, A. Hancock, Bielefeld Satz: Christine Roithner Verlagsservice, Breitenaich
ISBN 978-3-641-10832-8V013
www.heyne.de
www.penguinrandomhouse.de
ZUM ANDENKEN AN AUDREY HARRIS (1920–2005) UND FÜR SAM
Inhaltsverzeichnis
TIRO, M. TULLIUS, SEKRETÄR VON CICERO. ER WAR NICHT NUR DER AMANUENSIS DES REDNERS UND SEIN MITARBEITER BEI DESSEN LITERARISCHEN ARBEITEN, SONDERN SELBST EIN NICHT ZU UNTERSCHÄTZENDER AUTOR UND DER ERFINDER DER KURZSCHRIFT, WELCHE ES IHM ERLAUBTE, IN DER ÖFFENTLICHKEIT GEHALTENE REDEN VOLLSTÄNDIG UND KORREKT MITZUSCHREIBEN, UNABHÄNGIG DAVON, WIE SCHNELL DER REDNER SPRACH. NACH CICEROS TOD ZOG SICH TIRO AUF EINEN BAUERNHOF IN DER NÄHE VON PUTEOLI ZURÜCK, WO ER LAUT HIERONYMUS BIS IN SEIN HUNDERTSTES JAHR LEBTE. ASCONIUS PEDIANUS (IN MILON. 38) BEZIEHT SICH AUF DAS VIERTE BUCH TIROS ÜBER CICEROS LEBEN.
Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology, Vol. III, herausgegeben von William L. Smith, London 1851
INNUMERABILIA TUA SUNT IN ME OFFICIA, DOMESTICA, FORENSIA, URBANA, PROVINCILIA, IN RE PRIVATA, IN PUBLICA, IN STUDIIS, IN LITTERIS NOSTRIS …
»Deine Dienste an mir sind nicht zu zählen, im Haus und auf dem Forum, in der Stadt und in der Provinz, in privaten und öffentlichen Belangen, bei meinen Studien und literarischen Arbeiten …«
Cicero in einem Brief an Tiro, 7. November 50 v. Chr.
TEIL EINS
SENATOR
79 v. Chr.–70 v. Chr.
URBEM, URBEM, MI RUFE, COLE ET IN ISTA LUCE VIVE!
»Rom! Bleib in Rom, mein lieber Rufus, und lebe im Licht der Öffentlichkeit!«
Cicero in einem Brief an M. Caelius Rufus, 26.Juni 50 v. Chr.
KAPITEL I
Mein Name ist Tiro. Ich war sechsunddreißig Jahre lang Privatsekretär des römischen Staatsmannes Cicero – eine anfangs aufregende, dann überraschende, später mühsame und schließlich äußerst gefährliche Aufgabe. Ich glaube, dass Cicero während dieser Jahre mehr Zeit mit mir verbrachte als mit jedem anderen Menschen, seine Familie eingeschlossen. Ich war Zeuge privater Zusammenkünfte und Überbringer geheimer Botschaften. Ich brachte seine Reden zu Papier, schrieb seine Briefe und seine literarischen Arbeiten, sogar seine Gedichte. Um dem Strom seiner Worte Herr zu werden, musste ich eine allgemein als Kurzschrift bekannte Technik ersinnen, mit der die Beratungen des Senats auch heute noch protokolliert werden und für deren Erfindung mir kürzlich eine bescheidene Pension bewilligt wurde. Dieser Summe, einigen Erbschaften und mir wohlgesinnten Freunden verdanke ich meinen auskömmlichen Ruhestand. Ich brauche nicht viel. Die Alten leben von Luft, und ich bin sehr alt – fast hundert, heißt es.
In den Jahrzehnten nach seinem Tod bin ich immer wieder gefragt worden, gewöhnlich im Flüsterton, wie Cicero wirklich war. Aber ich habe stets geschwiegen. Wie sollte ich wissen, wer ein Regierungsspion war und wer nicht? Jeden Augenblick war ich auf meine Liquidierung gefasst. Da mein Leben nun fast vorüber ist und ich nichts mehr zu befürchten habe – nicht einmal Folter, würde ich doch in den Händen des Scharfrichters oder seiner Folterknechte kaum eine Sekunde durchhalten –, habe ich mich entschlossen, mit dem vorliegenden Bericht eine Antwort darauf zu geben. Ich werde mich auf meine Erinnerung und die meiner Obhut anvertrauten Dokumente stützen. Da die mir verbleibende Zeit zwangsläufig kurz ist, will ich mich beeilen. Ich werde den Bericht in meiner Kurzschrift verfassen, auf einigen Dutzend Rollen feinsten Papyrus – Hieratica, das Beste vom Besten –, die ich zu diesem Zweck schon seit Längerem gehortet habe. Im Voraus bitte ich um Vergebung für stilistische Mängel und Ungeschicklichkeiten. Auch bitte ich die Götter, dass sie mich zum Ende kommen lassen, bevor das Ende mich ereilt. In seinen letzten Worten bat Cicero mich, die Wahrheit über ihn zu erzählen, und darum will ich mich bemühen. Sollte er dabei nicht immer als Muster an Tugend erscheinen, sei’s drum. Die Macht beschert einem Mann allerlei Annehmlichkeiten, zwei saubere Hände gehören allerdings nur selten dazu.
Und von Macht und dem Mann werde ich erzählen. Mit Macht meine ich die offizielle, die politische Macht – was wir in der lateinischen Sprache als imperium bezeichnen –, die Macht über Leben und Tod, wie sie vom Staat auf ein Individuum übertragen wird. Hunderte von Männern haben nach dieser Macht gestrebt. Aber Cicero war einzigartig in der Geschichte der Römischen Republik, weil ihm beim Griff nach der Macht nichts als sein eigenes Talent zur Verfügung stand. Er entstammte nicht, wie Metellus oder Hortensius, einer der bedeutenden, seit Generationen in der Politik tätigen Adelsfamilien, von deren Reputation er am Wahltag profitieren konnte. Hinter ihm stand nicht, wie bei Pompeius oder Caesar, eine mächtige Armee, die seine Kandidatur unterstützte. Er verfügte nicht wie Crassus über ein gewaltiges Vermögen, das ihm den Weg ebnete. Er hatte nur eines – seine Stimme. Und mit der schieren Kraft seines Willens machte er aus dieser die berühmteste Stimme der Welt.
Ich war vierundzwanzig Jahre alt, als ich in Ciceros persönlichen Dienst eintrat, ein auf seinem Familiensitz nahe Arpinum geborener Haussklave, der Rom nie zuvor gesehen hatte. Er war ein junger Rechtsanwalt, der an nervösen Erschöpfungszuständen litt und sich mit jeder Menge natürlicher Gebrechen herumschlug. Kaum jemand hätte auf meine und auf seine Zukunftschancen besonders viel gegeben.
Zu jener Zeit war Ciceros Stimme nicht das Furcht einflößende Organ, zu dem es später wurde. Sie war schroff, und er neigte zum Stottern. Ich glaube, sein Problem war, dass die in seinem Kopf brodelnde Menge an Worten sich bei nervlicher Anspannung in seinem Hals staute, als ob sich zwei von der nachdrängenden Herde vorwärtsgeschobene Schafe gleichzeitig durch ein Gatter gequetscht hätten. Wie auch immer, der Inhalt seiner Reden war oft zu hochtrabend, als dass sein Publikum ihn verstanden hätte. »Der Gelehrte« oder »der Grieche« wurde er von seinen unaufmerksamen Zuhörern genannt – was keineswegs als Kompliment gemeint war. Obwohl niemand sein rhetorisches Talent anzweifelte, so war seine Konstitution doch zu schwächlich, als dass sie seinem Ehrgeiz ebenbürtig gewesen wäre. Mehrstündige Verteidigungsreden – zu jeder Jahreszeit, oft unter freiem Himmel – beanspruchten seine Stimmbänder derart, dass er nicht selten tagelang heiser und ohne Stimme war. Zudem litt er unter chronischer Schlaflosigkeit und einer schwachen Verdauung. Kurzum: Wollte er, wie es sein sehnlichster Wunsch war, politische Karriere machen, so benötigte er professionelle Hilfe. Also beschloss Cicero, Rom für einige Zeit zu verlassen und zu reisen. Erstens, um seine Kräfte aufzufrischen, und zweitens, um die führenden Lehrmeister der Rhetorik zu konsultieren, von denen die meisten in Griechenland und Kleinasien lebten.
Als Verantwortlicher für die kleine Bibliothek seines Vaters verfügte ich über eine passable Kenntnis des Griechischen, und deshalb bat Cicero seinen Vater – ganz so, als wollte er sich ein Buch aus dem Regal nehmen –, ob er mich ausleihen und mit in den Osten nehmen könne. Meine Aufgabe würde unter anderem darin bestehen, mich um seine Termine zu kümmern, Transportmittel anzuheuern und Lehrer zu bezahlen, wobei geplant war, dass ich nach einem Jahr wieder zu meinem alten Herrn zurückkehren sollte. Am Ende sollte ich, wie so manches nützliches Buch auch, nie zurückgegeben werden.
Am Tag, als wir in See stechen wollten, fanden wir uns im Hafen von Brundisium ein. Das war im sechshundertfünfundsiebzigsten Jahr nach der Gründung Roms, in der Zeit des Konsulats von Servilius Vatia und Claudius Pulcher. Damals war Cicero noch nicht die imposante Gestalt, zu der er später wurde und deren Züge so bekannt waren, dass er nicht einmal durch die ruhigste Straße spazieren konnte, ohne erkannt zu werden. (Was, so frage ich mich, ist nur mit den Tausenden seiner Büsten und Porträts geschehen, die einst so viele Privathäuser und öffentliche Gebäude geschmückt haben? Sind sie wirklich alle zerstört und verbrannt worden?) Der junge Mann, der an jenem Frühlingsmorgen am Kai stand, war schmächtig, hatte einen Rundrücken und einen unnatürlich langen Hals, in dem ein Adamsapfel so groß wie eine Kinderfaust auf und ab hüpfte. Seine Haut war blass, er hatte vorstehende Augen und eingefallene Wangen; kurz, er war das Abbild eines kränklichen Mannes. Ich weiß noch, dass ich dachte: Halt dich ran, Tiro, mach das Beste aus der Reise, lange kann sie nicht dauern.
Zuerst fuhren wir nach Athen, wo er sich das Vergnügen gönnen wollte, an der Akademie Philosophie zu studieren. Als ich ihm zum ersten Mal die Tasche in den Vorlesungssaal getragen hatte und mich wieder entfernen wollte, rief er mich zu sich zurück und fragte, wohin ich denn vorhätte zu gehen.
»In den Schatten zu den anderen Sklaven«, antwortete ich. »Es sei denn, Ihr benötigt noch meine Dienste.«
»Und ob ich die benötige«, sagte er. »Ich habe eine äußerst anstrengende Aufgabe für dich. Ich will, dass du hierbleibst und dir ein klein wenig Philosophie aneignest. Dann habe ich auf unseren langen Reisen jemanden, mit dem ich mich unterhalten kann.«
Also blieb ich, und mir wurde die Ehre zuteil, persönlich Antiochos aus Askalon zu hören, der die drei Grundprinzipien des Stoizismus erklärte – dass nur die Tugend zur Glückseligkeit führe, dass nichts außer der Tugend gut sei und dass man den Gefühlen nicht trauen könne. Drei einfache Regeln, die, würde der Mensch sie befolgen, die meisten Probleme der Welt lösen könnten. Später diskutierten Cicero und ich oft über derartige Fragen, und in der Welt der Gedanken vergaßen wir immer die Unterschiede unserer gesellschaftlichen Stellung. Wir blieben sechs Monate bei Antiochos und zogen dann weiter, um uns dem eigentlichen Zweck unserer Reise zuzuwenden.
Die tonangebende Schule der Rhetorik zu jener Zeit war die sogenannte »asianische« Methode. Eine kunstvolle und blumige Art des Vortrags, voller pompöser Wendungen und klingender Versformen, auf und ab schreitend zelebriert, begleitet von ausladender Gestik. Ihr führender Vertreter in Rom war Quintus Hortensius Hortalus, der allgemein als der herausragende Redner seiner Zeit betrachtet wurde und dessen fantasievolle Beinarbeit ihm den Spitznamen »der Tanzmeister« eingebracht hatte. Um Hortensius’ Methode zu ergründen, legte Cicero besonderen Wert darauf, all seine Lehrmeister aufzusuchen: Menippos aus Stratonikeia, Dionysios aus Magnesia, Aischylos aus Knidos, Xenokles aus Adramyttion – allein die Namen geben eine Ahnung von ihrem Stil. Mit jedem von ihnen verbrachte Cicero Wochen. Er studierte ihre Techniken so lange, bis er glaubte, sie begriffen zu haben.
»Tiro, ich habe genug von diesen gelackten Gockeln«, sagte er eines Abends, während er in dem gedünsteten Gemüse herumstocherte, das er jeden Tag aß. »Kümmere dich um ein Boot, das uns von Loryma nach Rhodos bringt. Wir versuchen etwas anderes, wir schreiben uns in der Schule von Apollonios Molon ein.«
Und so kam es, dass an einem Frühlingsmorgen kurz nach Sonnenaufgang, als das Karpathische Meer so milchig glatt wie eine Perle vor uns lag (man muss mir die gelegentlichen gedrechselten Wendungen verzeihen: Ich habe zu viel griechische Dichtung gelesen, als dass ich den nüchternen lateinischen Stil durchhalten könnte), ein Boot uns vom Festland zu jener altberühmten, zerklüfteten Insel brachte, wo am Landungssteg die stämmige Gestalt von Molon höchstpersönlich wartete.
Molon war ein Rechtsgelehrter, der aus Alabanda stammte und in den Gerichtssälen Roms brilliert hatte. Ihm war sogar die beispiellose Ehre zuteil geworden, im Senat eine Rede in griechischer Sprache halten zu dürfen. Danach hatte er sich nach Rhodos zurückgezogen und seine Rhetorikschule gegründet. Seine Theorie der Redekunst, die das genaue Gegenteil der »asianischen« darstellte, war einfach: Lauf nicht zu viel herum, halt den Kopf gerade, komm schnell zum Punkt, bring deine Zuhörer zum Lachen, bring sie zum Weinen, und wenn du ihre Sympathie gewonnen hast, dann setz dich wieder hin. »Denn nichts«, so Molon, »trocknet schneller als eine Träne.« Das war weit mehr nach Ciceros Geschmack, und so begab er sich ganz und gar in die Hand von Molon.
Molons erste Handlung an jenem Abend war, dass er Cicero eine Schüssel hart gekochter Eier mit Sardellensoße auftischte. Als Cicero fertig gegessen hatte – was nicht ohne Klagen abging –, servierte er ihm noch ein großes, über Holzkohle gebratenes Stück Fleisch und einen Becher Ziegenmilch. »Du brauchst Fleisch auf den Rippen, junger Mann«, sagte er und klopfte sich auf seinen breiten Brustkorb. »Aus einer schwächlichen Rohrflöte ist noch nie ein voller Ton gekommen.« Cicero schaute ihn wütend an, aß seinen Teller aber pflichtschuldigst bis auf den letzten Bissen leer. In jener Nacht schlief Cicero zum ersten Mal seit Monaten durch. (Ich weiß das, weil ich immer auf dem Boden neben seinem Bett schlief.)
Bei Tagesanbruch begannen die Leibesübungen. »Auf dem Forum zu sprechen ist wie ein Wettlauf«, sagte Molon. »Es verlangt Durchhaltevermögen und Kraft.« Er täuschte einen Faustschlag auf Ciceros Brustkorb an, worauf dieser ein lautes Uff! ausstieß, zurückstolperte und fast gestürzt wäre. Molon ließ ihn mit gespreizten Beinen und durchgedrückten Knien Aufstellung nehmen und mit den Fingerspitzen zwanzig Mal den Boden vor jedem Fuß berühren. Dann musste er sich mit dem Rücken auf den Boden legen, die Hände hinter dem Kopf verschränken und, ohne die gestreckten Beine vom Boden zu heben, den Oberkörper aufrichten und wieder senken. Danach befahl er ihm, sich auf den Bauch zu drehen und den Körper ausschließlich mit der Kraft seiner Arme auf und ab zu hieven, wieder zwanzig Mal und auch hier, ohne die Knie zu beugen. Das war das Programm des ersten Tages. An den folgenden Tagen kamen weitere Übungen hinzu, und die Dauer der Übungen wurde ausgedehnt. Cicero hatte einen guten Schlaf, und auch die Mahlzeiten verursachten keine Beschwerden mehr.
Zur eigentlichen Vortragsschulung verließ Molon mit seinem eifrigen Schüler den schattigen Innenhof, ließ ihn in der Mittagshitze ohne Pause einen steilen Hügel hinaufgehen und dabei Übungspassagen rezitieren – üblicherweise eine Gerichtsszene oder einen Monolog von Menander. Ciceros stampfende Schritte verscheuchten die Eidechsen, und die zirpenden Zikaden in den Olivenbäumen waren sein einziges Publikum, während er seine Lunge kräftigte und lernte, aus einem einzigen Atemzug das Maximum an Worten herauszuholen. »Halte die Tonhöhe im mittleren Bereich«, wies ihn Molon an. »Da sitzt die Kraft. Nicht zu hoch und nicht zu tief.« Nachmittags ging Molon mit ihm hinunter an den Kiesstrand, postierte sich achtzig Schritt von Cicero entfernt (die maximale Reichweite der menschlichen Stimme) und ließ ihn zur Ausbildung des Stimmvolumens gegen das Donnern und Brausen der Brandung anreden – das komme, so sagte er, dem Gemurmel von dreitausend Menschen unter freiem Himmel oder dem Hintergrundgeräusch von ein paar hundert schwatzenden Menschen im Senat am nächsten. An derlei störende Geräusche müsse Cicero sich gewöhnen.
»Und was ist mit dem Inhalt?«, fragte Cicero. »Soll nicht in erster Linie die Kraft meiner Argumente zum Zuhören zwingen?«
Molon zuckte mit den Achseln. »Inhalt geht mich nichts an. Denk an Demosthenes: ›Bei der Redekunst zählen nur drei Dinge. Der Vortrag, der Vortrag und noch einmal der Vortrag.‹«
»Und mein Stottern?«
»Auch dein St-stottern intere-ressiert mich nicht«, erwiderte Molon grinsend und zwinkerte mit den Augen. »Nein, im Ernst, Stottern ist interessant, es vermittelt den Eindruck von Ehrlichkeit, das ist von Nutzen. Demosthenes hat selbst leicht gelispelt. Das Publikum identifiziert sich mit solchen Unzulänglichkeiten. Das einzig Öde ist Perfektion. Also, geh jetzt ein Stück den Strand hinunter, und lass hören, ob ich dich noch verstehen kann.«
Und so hatte ich die Ehre, von Anfang an miterleben zu dürfen, wie der eine Meister der Redekunst dem anderen seine Kunstgriffe beibrachte. »Möglichst nicht den Kopf neigen, das macht einen unmännlichen Eindruck. Nicht mit den Fingern schlenkern und immer die Schultern still halten. Wenn du für eine Geste deine Finger brauchst, dann versuch, den gekrümmten Mittelfinger auf die Daumenspitze zu legen und die drei restlichen Finger gerade auszustrecken – genau, so ist es gut. Natürlich muss der Blick immer den Bewegungen der Geste folgen, außer bei einer zurückweisenden Bemerkung: ›Die Götter mögen uns von dieser Plage verschönern‹ oder ›ich glaube nicht, dass ich diese Ehre verdiene‹.«
Alles Schriftliche war verboten. Kein Redner, der diesen Namen verdiente, würde im Traum daran denken, einen Text vorzulesen oder sich mit einem Stapel Notizen zu behelfen. Molon bevorzugte die Standardmethode, um eine Rede einzustudieren: die des imaginären Rundgangs durch das Haus des Redners. »Stell dir den ersten Punkt, den du vortragen willst, im Eingangsbereich vor, den zweiten im Atrium und so weiter. Du wanderst, wie du es gewohnt bist, durchs Haus und weist nicht nur jedem Raum, sondern jeder Nische und jeder Statue einen bestimmten Abschnitt der Rede zu. Achte darauf, dass jede dieser Stellen gut beleuchtet ist, klar umrissen und unterscheidbar. Sonst wirst du herumtappen wie ein Betrunkener, der nach einem Fest sein Bett sucht.«
Cicero war nicht Molons einziger Schüler in jenem Frühling und Sommer. Nach und nach stießen Ciceros jüngerer Bruder Quintus, sein Vetter Lucius und zwei seiner Freunde zu uns: Servius, ein penibler Rechtsanwalt, der Richter werden wollte, und Atticus – der elegante, charmante Titus Pomponius Atticus –, den die Redekunst nicht interessierte, da er in Athen lebte und ganz sicher keine politische Karriere anstrebte, sondern sich einfach gern in Ciceros Gesellschaft aufhielt. Alle staunten über die Veränderungen, die Ciceros Gesundheit und Auftreten erfahren hatten, und an ihrem letzten gemeinsamen Abend – es war inzwischen Herbst geworden und Zeit, nach Rom zurückzukehren – kamen sie zusammen, um mit eigenen Ohren zu hören, wie sich Molons Bemühungen auf Ciceros Redekunst ausgewirkt hatten.
Ich wünschte, ich könnte mich erinnern, worüber Cicero an jenem Abend nach Tisch gesprochen hat, aber leider bin ich der lebende Beweis für Demosthenes’ zynische Behauptung, dass – verglichen mit der Art des Vortrags – der Inhalt nichts zähle. Ich stand diskret im Schatten, außer Sichtweite, und entsinne mich nur noch an die Motten, die wie Aschepartikel um die Fackeln herumwirbelten, an die glitzernden Sterne am Himmel über dem Innenhof und an die Cicero zugewandten, vom Feuerschein geröteten Gesichter der hingerissenen jungen Männer. Allerdings erinnere ich mich noch genau an die Worte Molons, nachdem sich sein Schüler mit einer abschließenden Verbeugung zur imaginären Geschworenenbank wieder gesetzt hatte. Nach langem Schweigen erhob er sich und sagte mit heiserer Stimme: »Ich gratuliere dir, Cicero, du hast mich in Staunen versetzt. Was ich bedauere, ist Griechenland, das Schicksal Griechenlands. Der uns einzig verbliebene Ruhm war der überlegene Rang unserer Rhetorik, und diesen hast du uns jetzt auch genommen. Geh zurück.« Er deutete mit jenen drei ausgestreckten Fingern über die vom Fackelschein erleuchtete Terrasse in Richtung des fernen, dunklen Meeres. »Geh zurück, mein junger Freund, und erobere Rom.«
Na schön. Leicht gesagt. Aber wie stellt man das an? Wie erobert man Rom, wenn einem als einzige Waffe nur seine Stimme zur Verfügung steht?
Der erste Schritt ist naheliegend: Man muss Senator werden.
Um in den Senat zu gelangen, musste man mindestens einunddreißig Jahre alt und Millionär sein. Genauer gesagt: Wenn alljährlich im Quintilis zwanzig neue Senatoren gewählt wurden, die die im abgelaufenen Jahr gestorbenen oder inzwischen zu arm gewordenen ersetzten, hatte man sogar nur für die Kandidatur den Behörden Vermögen im Wert von einer Million Sesterzen nachzuweisen. Aber woher sollte Cicero eine Million nehmen? Sein Vater jedenfalls hatte nicht so viel Geld: Das Anwesen der Familie war klein und mit hohen Hypotheken belastet. Ihm blieben deshalb nur die drei üblichen Optionen: sich die Million zu verdienen, was zu lange dauern würde; sie zu stehlen, was zu riskant war; oder sie zu heiraten, was Cicero kurz nach seiner Rückkehr aus Rhodos tat. Terentia war siebzehn, jungenhaft flachbrüstig, und ihren Kopf zierten kurze, dichte schwarze Locken. Ihre Halbschwester war eine Vesta-Priesterin, Beleg für die hohe gesellschaftliche Stellung ihrer Familie. Wichtiger war, dass ihr zwei Straßenzüge mit Mietwohnungen in den Elendsvierteln von Rom, einige Waldgebiete vor den Toren der Stadt und dazu ein Landgut gehörten. Gesamtwert: eineinviertel Millionen Sesterze. (Ach ja, Terentia: schlicht, distinguiert und reich – was war sie doch für ein Früchtchen! Erst vor ein paar Monaten habe ich sie gesehen, auf der Küstenstraße nach Neapel. Sie saß in einer offenen Sänfte und kreischte ihre Träger an, dass sie sich etwas beeilen sollten. Ihr Haar war weiß und die Haut walnussfarben, aber sonst schien sie sich nicht verändert zu haben.)
Und so wurde Cicero zur gegebenen Zeit in den Senat gewählt – tatsächlich erzielte er, der inzwischen allgemein als zweitbester Rechtsanwalt Roms nach Hortensius betrachtet wurde, das beste Stimmenergebnis. Bevor er seinen Sitz im Senat einnehmen konnte, musste er das obligatorische Jahr Regierungsdienst außerhalb Roms ableisten, was in seinem Fall die Provinz Sizilien war. Sein offizieller Titel war der eines Quästors, der die unterste Stufe in der Ämterlaufbahn darstellte. Frauen war es verboten, ihre Ehemänner auf diesen Dienstreisen zu begleiten, sodass Terentia – sicher zur großen Erleichterung Ciceros – zu Hause blieb. Ich allerdings ging mit ihm, denn inzwischen war ich für ihn zu einer Art verlängertem Arm geworden, den er, ohne darüber nachzudenken, wie seinen eigenen benutzte. Ein Grund für meine Unverzichtbarkeit war, dass ich eine Technik entwickelt hatte, die es mir erlaubte, seine Worte so schnell niederzuschreiben, wie er sie aussprach. Aus kleinen Anfängen – ich kann in aller Bescheidenheit behaupten, das Et-Zeichen erfunden zu haben – schwoll mein System schließlich zu einem Handbuch mit etwa viertausend Symbolen an. Ich fand zum Beispiel heraus, dass Cicero bestimmte Wendungen immer wieder benutzte. Diese reduzierte ich auf einen Strich oder ein paar Pünktchen und erbrachte somit den Beweis für etwas, was die meisten Menschen ohnehin schon wissen – dass nämlich Politiker im Wesentlichen immer wieder das Gleiche sagen. Er diktierte mir, während er in der Badewanne oder auf dem Sofa lag, in einer schaukelnden Karosse oder auf Landspaziergängen. Ihm gingen nie die Worte aus, und mir fehlte es nie an Symbolen, um seine durch die Luft wirbelnden Worte einzufangen und festzuhalten. Wir waren wie füreinander geschaffen.
Doch zurück zu Sizilien. Keine Angst: Ich werde über unsere Arbeit jetzt nicht in allen Einzelheiten berichten. Wie so oft in der Politik war die Tätigkeit nicht nur im Rückblick, nach über siebzig Jahren, sondern auch schon damals langweilig. Der Erinnerung wert und von Bedeutung war die Rückreise nach Rom. Um sicherzugehen, dass er genau in den Senatsferien die Bucht von Neapel erreichte, wenn sich die versammelte Politprominenz in den Mineralbädern Puteolis vergnügte, verschob Cicero unsere Abreise extra um einen Monat, von März auf April. Er wies mich an, ein Boot mit zwölf Ruderern anzumieten, das prächtigste, das ich auftreiben könnte, damit er stilvoll – zum ersten Mal würde er die Toga mit dem purpurfarbenen Saum des Senators der Römischen Republik tragen – in den Hafen einlaufen konnte.
Cicero war davon überzeugt gewesen, in Sizilien derart erfolgreiche Arbeit geleistet zu haben, dass er zu Hause in Rom unausweichlich im Mittelpunkt allen Interesses stehen würde. Auf Hundert stickigen Marktplätzen, unter Tausend staubigen, von Wespen wimmelnden Platanen hatte er unparteiisch und würdevoll römisches Recht gesprochen. Er hatte eine einmalig große Menge Getreide zu einem einmalig niedrigen Preis gekauft und für das Wahlvolk nach Rom transportieren lassen. Seine Reden bei Regierungszeremonien waren Meisterwerke an Taktgefühl gewesen. Er hatte sogar Interesse an den Gesprächen der einheimischen Bevölkerung geheuchelt. Er wusste, dass er gute Arbeit geleistet hatte, und brüstete sich mit seinen Errungenschaften in einem Strom von Berichten an den Senat. Ich muss gestehen, dass ich den Ton seiner Berichte gelegentlich etwas abmilderte, bevor ich sie dem offiziellen Boten übergab, und dass ich ihn darauf hinzuweisen versuchte, dass nicht jeder Sizilien für den Mittelpunkt der Welt hielt. Er nahm jedoch keine Notiz davon.
Ich sehe ihn noch vor mir, wie er bei unserer Rückkehr nach Italien am Bug stand und angestrengt zur Anlegestelle von Puteoli blickte. Was hatte er erwartet? Eine Musikkapelle, die ihn an Land geleitete? Eine Abordnung der Konsuln, die ihm einen Lorbeerkranz überreichte? Sicher, an Land war eine Menschenmenge zu sehen, aber die war nicht seinetwegen gekommen. Hortensius, der schon das Konsulat ins Auge gefasst hatte, veranstaltete auf mehreren farbenprächtig geschmückten Vergnügungsschiffen, die ganz in der Nähe festgemacht hatten, ein Bankett. Die an der Anlegestelle Versammelten waren seine Gäste, die darauf warteten, übergesetzt zu werden. Cicero ging an Land – gänzlich unbeachtet. Verwirrt schaute er sich um, als einigen der Festgäste sein makellos leuchtendes Senatorengewand auffiel. Sie liefen auf ihn zu, und er straffte in freudiger Erwartung die Schultern.
»Senator«, rief einer. »Was gibt’s Neues in Rom?«
Cicero schaffte es irgendwie, sein Lächeln zu bewahren. »Ich komme nicht aus Rom, guter Mann. Ich bin auf dem Rückweg aus meiner Provinz.«
Ein rothaariger, eindeutig schon betrunkener Mann sagte: »Hört, hört, guter Mann! Er ist auf dem Rückweg aus seiner Provinz …«
Der Mann machte sich kaum die Mühe, sein Lachen im Zaum zu halten.
»Was ist so lustig daran?«, fragte ein Dritter, der die Wogen glätten wollte. »Hast du das etwa nicht gewusst? Der Senator kommt aus Africa.«
Ciceros Lächeln war heldenhaft. »Nun ja, eigentlich aus Sizilien.«
Gut möglich, dass es noch eine Weile in diesem Ton weiterging. Ich kann mich nicht erinnern. Als die Leute merkten, dass es hier keine Klatschgeschichten aufzuschnappen gab, trollten sie sich wieder. Kurz darauf erschien Hortensius und geleitete die restlichen Gäste zu ihren Fährbooten. Er hatte zumindest die Höflichkeit, Cicero mit einem kurzen Nicken zu begrüßen, war aber eindeutig nicht gewillt, ihn ebenfalls zu seinem Fest zu bitten. Wir blieben allein zurück.
Ein unbedeutender Vorfall, könnte man meinen, doch Cicero selbst pflegte später zu sagen, dass dies der Augenblick war, in dem sein Ehrgeiz so hart wie Stein geworden sei. Er war gedemütigt worden – gedemütigt von der eigenen Eitelkeit – und hatte auf brutale Art erkennen müssen, wie gering seine Stellung in der Welt war. Lange Zeit blieb er am Ufer stehen, beobachtete das festliche Treiben von Hortensius und seinen Freunden und lauschte den heiteren Flötenklängen, die über das Wasser wehten. Als er sich schließlich abwandte, war er ein anderer Mensch. Ich übertreibe nicht, ich habe es in seinen Augen gesehen. Na schön, schien sein Gesichtsausdruck zu sagen, albert nur rum, ihr Idioten, ich werde mich an die Arbeit machen.
»Ich bin geneigt zu behaupten, meine Herren, dass diese Erfahrung von größerem Wert für mich war, als wenn man mich mit Beifallsstürmen begrüßt hätte. Fortan kümmerte ich mich nicht mehr darum, was die Welt wohl von mir zu hören bekäme: Seit jenem Tag achtete ich darauf, dass man mich täglich zu Gesicht bekam. Ich lebte im Licht der Öffentlichkeit. Ich ging regelmäßig zum Forum. Weder mein Türwächter noch mein Schlaf hinderten irgendwen daran, mich in meinem Haus zu besuchen und mit mir zu sprechen. Auch wenn ich nichts zu tun hatte, hieß das nicht, dass ich nichts tat. Zeit vollkommener Muße war etwas, was ich nicht kannte.«
Erst kürzlich stolperte ich bei der Lektüre einer seiner Reden über diese Passage, für deren Richtigkeit ich mich verbürge. Wie im Dämmerzustand verließ er den Hafen, ging bergauf durch Puteoli und hinaus auf die Überlandstraße,
KAPITEL II
Der Tag, der sich als Wendepunkt erweisen sollte, begann wie jeder andere damit, dass Cicero eine Stunde vor Tagesanbruch als Erster im Haus aufstand. Ich lauschte den dumpfen Schritten auf den Holzbohlen über mir, während er die Übungen absolvierte, die er bei unserem Aufenthalt in Rhodos vor sechs Jahren gelernt hatte. Ich blieb noch kurz im Dunkeln liegen, rollte dann meine Strohmatte zusammen und wusch mir das Gesicht. Es war der erste November, ein kalter Tag.
Cicero wohnte auf dem Esquilin in einem bescheidenen zweistöckigen Haus, das zwischen einem Tempel und einem Wohnblock erbaut worden war. Wenn man sich allerdings die Mühe machte, aufs Dach zu steigen, dann wurde man mit einem herrlichen Ausblick belohnt, der in westlicher Richtung über das dunstige Tal bis zu den großen Tempeln auf dem etwa eine halbe Meile entfernten Kapitolshügel reichte. Das Haus gehörte eigentlich seinem Vater, aber da der alte Herr nicht mehr der Gesündeste war und nur noch selten vom Land in die Stadt kam, hatte es Cicero ganz für sich – zusammen mit Terentia, seiner fünfjährigen Tochter Tullia und zwölf Sklaven: mich, den mir unterstellten Schreibern Sositheus und Laurea, dem Hausverwalter Eros, Terentias geschäftlichem Berater und Privatsekretär Philotimus, zwei Hausmädchen, einem Kindermädchen, einem Koch, einem Diener und einem Türwächter. Dann gab es da noch einen alten blinden Philosophen, den Stoiker Diodotos, der sich gelegentlich aus seinem Zimmer heraustastete und Cicero, wenn es diesem nach einem Disput verlangte, beim Abendessen Gesellschaft leistete. Macht insgesamt fünfzehn Haushaltsmitglieder. Terentia beklagte sich zwar ständig über die beengten Verhältnisse, aber Cicero wollte nicht umziehen, weil er zu jener Zeit immer noch ganz in seiner Rolle als Mann des Volkes aufging und das Haus perfekt zu seinem Ruf passte.
Wie an jedem Tag, so streifte ich mir auch an jenem Morgen als Erstes eine Kordel über mein linkes Handgelenk, an der ein kleines, von mir selbst entworfenes Notizbuch hing. Es bestand nicht aus den üblichen ein oder zwei, sondern aus vier Wachstafeln in Buchenholzrahmen, die sehr dünn und auf beiden Seiten beschreibbar waren und über Scharniere verfügten, sodass ich das Notizbuch auf- und zuklappen konnte. Somit konnte ich während eines Diktats weitaus mehr Text aufnehmen als ein durchschnittlicher Sekretär, dennoch steckte ich mir angesichts Ciceros gewaltigen Redeflusses immer noch ein paar Notizbücher zur Reserve ein. Dann zog ich den Vorhang des Fensters in meinem winzigen Raum auf, ging durch den Innenhof ins Tablinum, zündete die Lampen an und überprüfte, ob alles an seinem Platz war. Auf dem einzigen Möbelstück im Raum, einer Anrichte, stand eine Schale mit Kichererbsen. (Ciceros Name war vom Wort cicer abgeleitet, was Kichererbse bedeutet, und da Cicero glaubte, dass in der Politik ein ungewöhnlicher Name von Vorteil sei, achtete er sehr darauf, die Aufmerksamkeit darauf zu lenken.) Wenn alles zu meiner Zufriedenheit war, ging ich durch das Atrium in den Empfangsraum, wo der Türwächter auf mich wartete. Seine Hand lag schon auf dem großen eisernen Türriegel. Mit einem Blick durch ein schmales Fenster überprüfte ich, ob es schon hell genug war. Wenn ja, gab ich dem Türwächter mit einem Nicken das Zeichen zum Öffnen.
Draußen in der Kälte wartete schon die übliche Menge an Unglücksraben und Verzweifelten. Während sie eintraten, notierte ich mir die Namen. Die meisten waren mir bekannt. Fremde fragte ich nach dem Namen. Die üblichen Versager schickte ich wieder weg. Die unumstößliche Anweisung lautete: »Wenn er wählen darf, lass ihn rein.« Folglich füllte sich das Tablinum schnell mit nervösen Klienten, von denen jeder seinen Teil an des Senators Zeit beanspruchte. Ich blieb an der Tür stehen, bis ich glaubte, dass alle Wartenden hereingekommen waren, und machte gerade den ersten Schritt zurück ins Haus, als ein Mann in Trauerkleidung bedrohlich im Türrahmen auftauchte. Ich scheue mich nicht, zu gestehen, dass er mir mit seinem verstaubten Gewand, den zerzausten Haaren und seinem unrasierten Gesicht Angst einjagte.
»Tiro!«, sagte er. »Den Göttern sei Dank!« Er sank erschöpft gegen den Türrahmen und schaute mich aus blassen, leblosen Augen an. Ich schätze, er muss damals so um die fünfzig gewesen sein. Im ersten Augenblick wusste ich nicht, wer er war, aber da es zu den Aufgaben eines politischen Sekretärs gehört, Gesichtern Namen zuordnen zu können, fügten sich vor meinem geistigen Auge trotz seines Zustandes nach und nach die Teile eines Bildes zusammen: ein großes Haus mit Blick aufs Meer, ein kunstvoll angelegter Garten, eine Sammlung Bronzestatuen, eine Stadt irgendwo in Sizilien, im Norden – richtig, Thermae.
»Sthenius aus Thermae«, sagte ich und streckte die Hand aus. »Herzlich willkommen.«
Es stand mir nicht zu, sein Äußeres zu kommentieren oder ihn danach zu fragen, was er Hunderte von Meilen entfernt von zu Hause zu tun habe, und das unter so offensichtlich üblen Umständen. Ich ließ ihn im Tablinum warten und ging in Ciceros Arbeitszimmer. Der Senator, der an jenem Morgen bei Gericht einen des Vatermordes angeklagten Jugendlichen zu verteidigen hatte und außerdem zur Nachmittagssitzung im Senat erwartet wurde, knetete zur Kräftigung seiner Fingermuskeln einen kleinen Lederball, während ihm sein Diener die Toga anlegte. Er hörte dem jungen Sositheus zu, der ihm einen Brief vorlas, und diktierte gleichzeitig Laurea, dem ich die Grundzüge meiner Kurzschrift beigebracht hatte, eine Botschaft. Als ich eintrat, warf er mir den Ball zu, den ich reflexartig auffing, und bedeutete mir, ihm die Besucherliste zu geben. Er las sie begierig durch, wie jeden Morgen. Wer war ihm über Nacht ins Netz gegangen? Etwa irgendein prominenter Bürger aus einem nützlichen Wahlbezirk? Einer aus Sabatina vielleicht? Oder Pomptina? Oder ein Geschäftsmann, der so reich war, dass er bei den Konsulatswahlen zu den ersten stimmberechtigten Zenturien gehörte? Aber heute handelte es sich nur um die üblichen kleinen Fische, sodass sein Gesicht immer länger wurde, je näher er dem Ende der Liste kam.
»Sthenius?« Er unterbrach das Diktat. »Das ist doch dieser Sizilier, oder? Der Reiche mit den Bronzestatuen? Schätze, wir hören uns mal an, was er will.«
»Sizilier dürfen nicht wählen«, bemerkte ich.
»Pro bono«, sagte er mit unbewegtem Gesicht. »Außerdem hat er Bronzestatuen. Lass ihn als Ersten rein.«
Also holte ich Sthenius, dem Ciceros Standardbegrüßung zuteil wurde – ein Lächeln, das schon zu seinem Markenzeichen geworden war; der männlich kräftige Händedruck mit beiden Händen; der lange, ernste Blick in die Augen. Dann bat er ihn, Platz zu nehmen, und fragte, was ihn nach Rom führe. Nach und nach wurden meine Erinnerungen an Sthenius wieder wach. Zwei Mal, als Cicero zur Anhörung von Streitsachen nach Thermae gereist war, hatten wir in seinem Haus übernachtet. Er war einer der führenden Bürger der Provinz gewesen, doch von der Vitalität und dem Selbstvertrauen von damals war nichts mehr zu spüren. Er brauche Hilfe, sagte er. Er stehe vor dem Ruin. Sein Leben sei in ernster Gefahr. Man habe ihn ausgeraubt.
»Tatsächlich?«, sagte Cicero. Während er mit halbem Ohr zuhörte, schaute er auf eine Urkunde, die vor ihm auf dem Schreibpult lag. Elendsgeschichten wie diese waren für einen beschäftigten Anwalt nichts Besonderes. »Du hast mein Mitgefühl. Ausgeraubt von wem?«
»Vom Statthalter in Sizilien, Gaius Verres.«
Der Senator schaute augenblicklich auf.
Danach war Sthenius nicht mehr zu bremsen. Während es nur so aus ihm heraussprudelte, bedeutete mir Cicero mit einer unauffälligen Handbewegung, dass ich mitschreiben solle. Als Sthenius seinen Redefluss kurz unterbrechen musste, um Luft zu holen, bat Cicero ihn behutsam, doch ein bisschen zurückzugehen, etwa drei Monate, bis zu dem Tag, an dem er den ersten Brief von Verres erhalten habe. »Wie hast du darauf reagiert?«
»Ich war natürlich etwas beunruhigt. Er hat schließlich einen gewissen Ruf. Verres heißt ja Eber, und die Leute nennen ihn den Eber mit der blutverschmierten Schnauze. Ich konnte mich kaum widersetzen.«
»Hast du den Brief noch?«
»Ja.«
»Und in dem Brief hat Verres deine Kunstsammlung explizit erwähnt?«
»Ja, sicher. Er hat geschrieben, dass er davon gehört hätte und dass er sie sich gern anschauen würde.«
»Und wann ist er dann gekommen und hat sich bei dir eingenistet?«
»Schon bald, höchstens eine Woche später.«
»War er allein?«
»Nein, er war in Begleitung seiner Liktoren. Die musste ich auch unterbringen. Leibwächter sind ja immer grobe Burschen, aber so üble Schläger wie die hatte ich noch nie gesehen. Ihr Anführer Sextius ist der offizielle Scharfrichter für ganz Sizilien. Er presst seinen Opfern Bestechungsgelder ab. Wenn sie nicht wollen, dass er pfuscht – sie also vor der Exekution übel zurichtet –, dann müssen sie ihn bestechen.« Sthenius schluckte und atmete schwer. Wir warteten.
»Lass dir ruhig Zeit«, sagte Cicero.
»Ich hatte gedacht, dass er nach der Reise vielleicht erst ein Bad nehmen wollte und dass wir danach zu Abend essen würden, aber keine Rede davon, er wollte auf der Stelle die Sammlung sehen.«
»Ich kann mich an einige außergewöhnliche Stücke erinnern.«
»Die Sammlung war mein Leben, Senator, ganz einfach. Dreißig Jahre Herumreisen und Feilschen. Korinthische und delische Bronzestatuen, Gemälde, Silberzeug – jedes einzelne Stück habe ich selbst begutachtet und ausgesucht. Ich hatte Myrons Diskuswerfer und den Speerträger von Polyklet. Und ein paar Silberbecher von Mentor. Verres hat mir geschmeichelt. Er hat gesagt, dass die Sammlung ein größeres Publikum verdient hätte, sie wäre so gut, dass man sie öffentlich ausstellen sollte. Ich habe mir nichts dabei gedacht, bis ich plötzlich, als wir zusammen auf der Terrasse beim Abendessen saßen, aus dem Innenhof Geräusche gehört habe. Mein Verwalter hat mir ins Ohr geflüstert, dass ein Ochsengespann gekommen sei und Verres’ Liktoren dabei wären, alles aufzuladen.«
Sthenius verstummte. Es war nicht schwer, sich die Schmach für diesen so stolzen Mann vorzustellen: die in Tränen aufgelöste Frau, die verängstigte Familie, die Staubränder an den Stellen, wo einst die Statuen gestanden hatten. Das einzig hörbare Geräusch in Ciceros Arbeitszimmer war das meines kratzenden Griffels auf der Wachstafel.
»Und du hast keinen Einspruch erhoben?«, fragte Cicero.
»Bei wem denn? Beim Statthalter?« Sthenius lachte. »Nein, Senator. Ich war am Leben, oder? Wenn es dabei geblieben wäre, hätte ich den Schmerz über den Verlust heruntergeschluckt, und du hättest nie einen Muckser von mir gehört. Aber die Sammelleidenschaft kann sich zu einer Krankheit auswachsen, und eins kann ich dir sagen: Euren Statthalter Verres hat es schwer erwischt. Erinnerst du dich an die Statuen auf dem Stadtplatz?«
»Und ob ich mich erinnere. Drei exquisite Bronzestatuen. Willst du etwa behaupten, dass er die auch gestohlen hat?«
»Er hat es versucht. Das war am dritten Tag, als er mich gefragt hat, wem die gehören. Ich habe ihm gesagt, dass sie der Stadt gehörten, schon seit Jahrhunderten. Hast du gewusst, dass die Statuen vierhundert Jahre alt sind? Er hat gesagt, dass er gern die Erlaubnis hätte, sie mit in seinen Amtssitz nach Syracusae zu nehmen, natürlich ebenfalls als Leihgabe, und er hat mich gebeten, seinen Wunsch dem Stadtrat vorzutragen. Da habe ich gewusst, was für einen Menschen ich vor mir hatte. Ich habe ihm gesagt, dass ich ihm diesen Gefallen – bei aller Hochachtung – nicht tun könne. Er ist dann noch am selben Abend abgereist, und ein paar Tage später habe ich eine Vorladung für den fünften Oktober bekommen, weil ich der Fälschung beschuldigt worden sei.«
»Von wem kam die Anzeige?«
»Von einem meiner Feinde, Agathinus. Er ist ein Klient von Verres. Mein erster Gedanke war, dass ich das ausfechte. Was meine Ehre angeht, habe ich nichts zu befürchten. Nie in meinem Leben habe ich ein Dokument gefälscht. Aber dann habe ich gehört, dass Verres selbst der Richter sein würde und dass er die Strafe schon festgesetzt hätte. Für meine Dreistigkeit sollte ich vor den Augen der ganzen Stadt ausgepeitscht werden.«
»Und dann bist du geflohen.«
»Noch in derselben Nacht mit einem Boot an der Küste entlang nach Messana.«
Cicero stützte sein Kinn auf die Hand und schaute Sthenius nachdenklich an. Mir war diese Geste bekannt. Er taxierte die Glaubwürdigkeit des Zeugen. »Du sagst, dass die Verhandlung am fünften des letzten Monats war? Hast du in Erfahrung bringen können, was an dem Tag passiert ist?«
»Deshalb bin ich hier. Ich bin in Abwesenheit zu öffentlicher Auspeitschung und fünftausend Sesterzen Strafe verurteilt worden. Aber das ist nicht das Schlimmste. Bei der Verhandlung hat Verres behauptet, dass es neues Beweismaterial gegen mich gebe, diesmal wegen Spionage für die Rebellen in Spanien. Er hat für den ersten Dezember eine neue Verhandlung in Syracusae angesetzt.«
»Aber Spionage ist ein Kapitalverbrechen.«
»Du musst mir glauben, Senator, er will mich ans Kreuz schlagen lassen. Er posaunt das schon überall herum. Ich wäre ja nicht der Erste. Ich brauche Hilfe. Ich flehe dich an, bitte hilf mir!«
Ich hatte den Eindruck, er würde jeden Augenblick auf die Knie fallen und die Füße des Senators küssen. Die gleiche Ahnung hatte wohl auch Cicero, denn er stand hastig auf und fing an, im Zimmer auf und ab zu gehen. »Ich glaube, Sthenius, dein Fall hat zwei verschiedene Aspekte. Bei dem ersten, dem Diebstahl deines Eigentums, kann man ehrlich gesagt wohl nichts machen. Was glaubst du denn, warum Männer wie Verres den Statthalterposten anstreben? Weil sie wissen, dass sie sich im Rahmen gewisser Grenzen alles unter den Nagel reißen können, was sie wollen. Der zweite Aspekt, Missachtung des Rechtsweges, sieht da schon vielversprechender aus.
Ich kenne in Sizilien mehrere Männer mit exzellenten juristischen Fähigkeiten – richtig, einer lebt sogar in Syracusae. Ich werde ihm noch heute schreiben und ihn dringend bitten, mir zuliebe deinen Fall zu übernehmen. Ich werde ihm außerdem darlegen, was meiner Meinung nach zu tun ist. Er soll bei Gericht den Antrag stellen, die anstehende Klage für unwirksam zu erklären mit der Begründung, dass du dich nicht persönlich verteidigen kannst. Sollte das fehlschlagen und Verres das Verfahren durchziehen, soll dein Anwalt nach Rom kommen und die Verurteilung anfechten.«
Aber der Sizilier schüttelte den Kopf. »Wenn ich nur einen Anwalt in Syracusae brauchte, Senator, hätte ich nicht den weiten Weg bis nach Rom gemacht.«
Ich konnte sehen, dass Cicero nicht erfreut darüber war, in welche Richtung sich das Gespräch bewegte. Ein derartiger Fall könnte seine Praxis für Tage lahmlegen, und Sizilier waren – worauf ich ihn hingewiesen hatte – in Rom nicht wahlberechtigt. Pro bono – wie wahr!
»Hör zu«, sagte er mit besänftigender Stimme. »Deine Erfolgsaussichten sind gut. Verres ist offensichtlich korrupt. Er missbraucht deine Gastfreundschaft, er stiehlt, er bringt falsche Beschuldigungen vor. Er plant einen Justizmord. Seine Position ist unhaltbar. Ein Anwalt in Syracusae wird damit leicht fertig – ganz sicher, glaub mir. Wenn du mich jetzt entschuldigen würdest, auf mich warten jede Menge Klienten, außerdem habe ich in einer knappen Stunde einen Termin bei Gericht.«
Cicero nickte mir zu. Ich trat vor und legte eine Hand auf Sthenius’ Arm, um ihn nach draußen zu geleiten. Der Sizilier schüttelte meine Hand ab. »Aber ich brauche dich«, sagte er hartnäckig.
»Warum?«
»Weil ich nur in Rom eine Aussicht auf Gerechtigkeit habe, nicht in Sizilien. Da kontrolliert Verres die Gerichte. Und alle Leute sagen, dass du, Marcus Tullius Cicero, der zweitbeste Anwalt Roms bist.«
»Ach ja, tun das die Leute?« Ciceros Stimme nahm einen sarkastischen Ton an. Er hasste dieses Attribut. »Wenn dem so ist, warum gibst du dich dann mit dem Zweitbesten zufrieden? Warum nimmst du nicht gleich Hortensius?«
»Das wollte ich ja«, sagte Sthenius arglos. »Aber er hat abgelehnt. Er vertritt Verres.«
Ich begleitete den Sizilier nach draußen und ging wieder in Ciceros Arbeitszimmer. Er war allein. Zurückgelehnt saß er auf seinem Stuhl, starrte an die Wand und warf den Lederball von einer Hand in die andere. Juristische Fachbücher lagen unordentlich auf seinem Schreibpult herum. Eins, das er aufgeschlagen hatte, hieß Juristische Verfahrensregeln und war von Hostilius. Ein anderes war Manilius’ Kauf- und Verkaufsverträge.
»Erinnerst du dich an den Besoffenen am Pier von Puteoli? Den mit den roten Haaren? Als wir gerade aus Sizilien eingelaufen waren? ›Hört, hört, guter Mann! Er ist auf dem Rückweg aus seiner Provinz …‹«
Ich nickte.
»Das war Verres.« Der Ball hüpfte von der linken in die rechte, von der rechten in die linke Hand. »Der Bursche bringt noch die gute alte Korruption in Verruf.«
»Mich überrascht, dass Hortensius sich mit ihm einlässt.«
»Das überrascht dich? Mich nicht.« Er hörte auf, mit dem Ball zu spielen. Nachdenklich betrachtete er die Lederkugel, die auf seiner ausgestreckten Hand lag. »Der Tanzmeister und der Eber …« Eine Zeit lang brütete er vor sich hin. »Ein Mann in meiner Lage müsste verrückt sein, wenn er sich in ein Scharmützel mit dem Duo Hortensius/Verres einließe. Und das auch noch wegen einem Sizilier, der nicht mal Bürger Roms ist.«
»Wie wahr.«
»Wie wahr«, wiederholte er. Wegen der seltsam zögernden Art, wie er diese beiden Worte aussprach, frage ich mich allerdings noch heute manchmal, ob er nicht genau in dieser Sekunde eine Ahnung von der Tragweite des Falles bekommen hatte, von der außerordentlichen Palette an Möglichkeiten und daraus resultierenden Folgen, die sich plötzlich in seinem Kopf wie zu einem Mosaik zusammensetzten. Wenn ja, so habe ich es zumindest nie erfahren, denn in diesem Augenblick platzte noch im Nachthemd seine Tochter Tullia herein, um ihm eine ihrer kindlichen Zeichnungen zu zeigen. Sofort gehörte seine ganze Aufmerksamkeit ihr. Er hob sie hoch und setzte sie sich auf den Schoß. »Hast du das gezeichnet? Hast du das wirklich selbst gemacht …?«
Ich ließ die beiden allein und ging ins Tablinum, um den Wartenden mitzuteilen, dass der Senator auf dem Weg ins Gericht sei und jetzt keine Zeit mehr habe. Der immer noch jämmerlich dreinblickende Sthenius fragte mich, wann er mit einer Antwort rechnen könne, worauf ich ihm nur sagen konnte, er müsse sich gedulden wie jeder andere auch. Kurz darauf erschien Cicero mit der kleinen Tullia an der Hand und begrüßte jeden mit Namen (»Die wichtigste Regel in der Politik, Tiro: Vergiss nie ein Gesicht!«). Wie immer war seine Erscheinung makellos: pomadisiertes, glatt zurückgekämmtes Haar, parfümierte Haut, die Toga frisch gewaschen und gebügelt, kein Staubkörnchen auf den rot glänzenden Lederschuhen, das Gesicht braun gebrannt vom jahrelangen Plädieren unter freiem Himmel. Gepflegt, schlank, fit. Kurz: ein glänzender Auftritt. Seine Gäste folgten ihm in den Flur, wo er sein kleines strahlendes Mädchen hochhob und den Anwesenden präsentierte. Dann drehte er Tullias Gesicht zu sich und küsste sie zum Abschied laut schmatzend auf die Lippen. Ein lang gezogenes Ah, vereinzeltes Klatschen war zu hören. Der Abschiedskuss war nicht nur Inszenierung – wenn er allein gewesen wäre, hätte er es nicht anders gemacht, denn sein Leben lang hat er nie jemanden mehr geliebt als seinen Liebling Tulliola. Aber er wusste auch, dass das römische Wahlvolk ein sentimentaler Haufen war, und wenn sich seine väterliche Hingabe herumsprach, würde ihm das jedenfalls nicht schaden.
Und so traten wir an diesem vielversprechenden Novembermorgen hinaus in die zum Leben erwachende Stadt. Cicero ging voraus, ich an seiner Seite, die Wachstafel einsatzbereit; hinter uns Sositheus und Laurea mit den Körben, die die Beweismittel für Ciceros Auftritt bei Gericht enthielten; und um uns herum ein bunt zusammengewürfelter Haufen von etwa zwei Dutzend Bittstellern und Anhängern, darunter Sthenius, die die Aufmerksamkeit des Senators zu erregen versuchten, aber auch schon damit zufrieden waren, sich nur in seiner Nähe aufhalten zu dürfen. Von den Höhen des schattigen, vornehmen Esquilin tauchten wir in den lärmenden, dunstigen Gestank von Subura ein. Die Mietshäuser waren so hoch, dass kein Sonnenstrahl den Boden erreichte, und die schiebenden Menschenmengen rissen immer wieder Lücken in die Schar unserer Begleiter, die es jedoch irgendwie schafften, nie den Anschluss zu verlieren. Cicero war ein bekannter Mann in diesem Viertel, er war ein Held für die Ladenbesitzer und Händler, deren Interessen er vertreten hatte und die ihn schon seit Jahren durch ihre Straßen gehen sahen. Nicht ein einziges Mal verlangsamte er seinen schnellen Schritt, und doch registrierten seine wachsamen blauen Augen jeden geneigten Kopf, jede grüßende Hand, und nie musste ich ihm einen Namen ins Ohr flüstern – er kannte seine Wähler weit besser als ich.
Ich weiß nicht, wie es heute ist, aber damals gab es sechs oder sieben Gerichtshöfe, die fast immer tagten, jeder in einem anderen Teil des Forums. Zur Stunde, wenn sie alle gleichzeitig ihre Sitzungen eröffneten, konnte man sich deshalb kaum rühren, so viele Anwälte und Gerichtsbedienstete eilten geschäftig herum. Das Gedränge wurde noch dadurch verschlimmert, dass dem Prätor jedes Gerichtshofes von seinem Wohnhaus bis zum Forum ein halbes Dutzend Liktoren voranging, die ihm den Weg bahnten, und so wollte es der Zufall, dass an jenem Tag unser kleines Gefolge genau zu jenem Zeitpunkt auf dem Forum einzog, als auch Hortensius, der damals selbst Prätor war, mit seinem Tross dem Senat zustrebte. Wir wurden von seinen Wachen zurückgehalten, damit der große Mann passieren konnte, und bis heute glaube ich nicht, dass Hortensius Cicero mit Vorsatz ignorierte, denn er war ein Mann mit kultivierten, fast femininen Umgangsformen. Ich glaube, er hat uns einfach nicht gesehen. Die Folge war jedoch, dass dem sogenannten zweitbesten Advokaten Roms der freundliche Gruß auf den Lippen erstarb und er dem sich entfernenden Rücken des sogenannten besten Advokaten mit derart tiefer Verachtung hinterherschaute, dass ich mich wunderte, warum Hortensius nicht den Arm hob und sich zwischen seinen Schulterblättern kratzte.
Unser Fall an diesem Morgen wurde vor dem obersten Strafgericht verhandelt, das vor der Basilica Aemilia zusammentrat. Der fünfzehnjährige Gaius Popillius Laenas war angeklagt, seinen Vater getötet zu haben, indem er ihm einen Schreibgriffel aus Metall ins Auge gerammt hatte. Das Podium wurde schon von einer großen Menschenmenge umringt. Ciceros Schlussrede für die Verteidigung stand auf der Tagesordnung. Das war Attraktion genug. Sollte Cicero es nicht schaffen, die Geschworenen zu überzeugen, würde Popillius als Vatermörder verurteilt. Man würde ihn nackt ausziehen, blutig peitschen und dann zusammen mit einem Hund, einem Hahn und einer Schlange in einen Sack einnähen und in den Tiber werfen. Ein Hauch Gier nach Blut hing in der Luft. Als die Zuschauer zur Seite traten, um uns durchzulassen, warf ich einen Blick auf den jungen Popillius, der berüchtigt war für seine Gewalttätigkeit. Seine Augenbrauen bildeten einen durchgehend dicken schwarzen Strich. Er saß neben seinem Onkel auf der Bank, die für die Verteidigung reserviert war, schaute finster und verächtlich in die Menge und spuckte jeden an, der ihm zu nahe kam. »Wir müssen ihn unbedingt freibekommen«, sagte Cicero zu mir. »Schon damit den armen Tieren die Tortur erspart bleibt, mit ihm in einen Sack gesteckt zu werden.« Er bestand immer darauf, dass es nicht Sache des Anwalts sei, sich den Kopf über Schuld oder Unschuld eines Mandanten zu zerbrechen: Das sei Sache des Gerichts. Seine Pflicht sei es lediglich, sein Bestes zu tun. Als Gegenleistung sähen sich die Popilii Laeni, die sich mit vier Konsuln in ihrem Stammbaum brüsten konnten, in der Pflicht, ihn zu unterstützen, wann immer er ein öffentliches Amt anstrebte.
Sositheus und Laurea stellten die Körbe mit den Beweismitteln ab, und ich bückte mich gerade, um den ersten aufzuschnüren, als Cicero sagte: »Spar dir die Mühe.« Er tippte sich mit dem Zeigefinger an die Schläfe. »Die Rede ist hier gespeichert.« Er beugte sich zu seinem Mandanten vor und begrüßte ihn höflich: »Guten Morgen, Popillius. Das haben wir gleich erledigt, glaube mir.« Dann wandte er sich wieder mir zu und sagte leise: »Ich habe eine wichtigere Aufgabe für dich. Gib mir deine Wachstafel. Ich will, dass du zum Senat gehst, den Protokollführer auftreibst und vorfühlst, ob er das hier noch auf die Tagesordnung für heute Nachmittag setzen kann.« Er schrieb schnell. »Sag unserem Freund aus Sizilien noch nichts davon. Das ist nicht ganz ungefährlich. Wir müssen behutsam vorgehen, ein Schritt nach dem andern.«
Erst als ich das Gericht verlassen und das Forum auf dem Weg zum Senat schon halb durchquert hatte, wagte ich, einen Blick auf die Wachstafel zu werfen … dass nach Auffassung dieses Hauses in den Provinzen die Strafverfolgung von Personen, die Kapitalverbrechen beschuldigt werden, in deren Abwesenheit verboten werden sollte. Ich spürte ein Ziehen in meinem Brustkorb, weil ich sofort erkannte, was das bedeutete. Schlau, behutsam und verdeckt traf Cicero Vorbereitungen, seinem großen Rivalen den Kampf anzusagen. Ich überbrachte eine Kriegserklärung.
Im November führte Gellius Publicola den Vorsitz im Senat. Er war ein ungehobelter, köstlich tumber Militärführer der alten Schule. Man behauptete, oder wenigstens behauptete es Cicero, dass sich Gellius, als er zwanzig Jahre zuvor mit seiner Armee in Athen gewesen war, als Schlichter im Streit der philosophischen Schulen angeboten hatte: Er würde eine Konferenz einberufen, auf der sie ein für alle Mal den Sinn des Lebens klären könnten, dann brauchten sie ihre Lebenszeit nicht mit weiteren sinnlosen Debatten zu vergeuden. Ich kannte Gellius’ Sekretär ziemlich gut, und da sich die Agenda für den Nachmittag ungewöhnlich dürftig ausnahm – außer einem Bericht über die militärische Lage war nichts vorgesehen –, setzte er Ciceros Antrag auf die Tagesordnung. »Aber du solltest deinen Herrn vorwarnen«, sagte er. »Dem Konsul ist Ciceros kleine Bosheit über den Philosophenstreit zu Ohren gekommen. Er war nicht sehr begeistert.«
Als ich wieder im Gericht eintraf, war Ciceros Verteidigungsrede schon in vollem Gang. Die Rede gehörte nicht zu denen, die er von mir archivieren ließ, deshalb habe ich unglücklicherweise den Text nicht zur Hand. Ich kann mich nur noch daran erinnern, dass er den Prozess mit einem schlauen Schachzug gewann: Er versprach, dass Popillius im Fall eines Freispruchs den Rest seines Lebens dem Militärdienst widmen würde – ein Gelübde, das sowohl den Ankläger wie auch die Geschworenen und erst recht seinen Mandanten völlig überraschte. Aber der Kunstgriff funktionierte. Im Augenblick der Urteilsverkündung verschwendete Cicero keine einzige Sekunde mehr an Popillius, gönnte sich nicht einmal einen Bissen zu essen, sondern verabschiedete sich umgehend Richtung Senat, der sich im westlichen Teil des Forums befand – im Schlepptau die gleiche Ehrengarde aus Bewunderern wie am Morgen. Ihre Zahl hatte sich sogar vergrößert, da das Gerücht umging, der große Advokat wolle heute noch eine zweite Rede halten.
Cicero behauptete immer, dass die eigentlichen Geschäfte der Republik nicht im Senatssaal, sondern davor, auf dem Senaculum genannten Sammelplatz der Senatoren, betrieben würden, wo diese zu warten hatten, bis die Kammer beschlussfähig war. Diese tägliche Versammlung weiß gekleideter Gestalten, die eine Stunde oder länger dauern konnte, bot eines der faszinierenden Bilder der Stadt. Während Cicero sich unter die Senatoren mischte, gesellte ich mich zusammen mit Sthenius zu der gaffenden Menge auf der anderen Seite des Forums. (Der Sizilier, der Arme, hatte immer noch keine Ahnung, was hier vor sich ging.)
Es liegt in der Natur der Sache, dass nicht alle Politiker es zu Rang und Namen bringen. Von den sechshundert Männern, die damals den Senat bildeten, konnten in jedem Jahr nur acht zum Prätor gewählt werden, und nur zwei konnten das höchste imperium, das Konsulat, erreichen. Mit anderen Worten: Über die Hälfte derjenigen, die jetzt im Senaculum herumstanden, waren dazu verurteilt, nie in ein öffentliches Amt gewählt zu werden. Sie waren das, was die Aristokraten naserümpfend pedarii nannten: Männer, die mit den Füßen abstimmten, die bei jeder Stimmabgabe pflichtbewusst entweder zur einen oder anderen Seite des Raumes gingen. Und doch waren diese Bürger in gewisser Weise das Rückgrat der Republik: Bankiers, Geschäftsleute und Landbesitzer aus ganz Italien; wohlhabend, besonnen und patriotisch; misstrauisch gegenüber der Arroganz und dem Pomp der Aristokraten. Wie Cicero waren sie oft homines novi, neue Männer, die ersten in ihren Familien, die in den Senat gewählt worden waren. Das waren Ciceros Leute. Zu beobachten, wie er sich an jenem Nachmittag zwischen ihnen hindurchschlängelte, war, als beobachte man einen großen Künstler, einen Bildhauer an seinem Steinblock – dem einen legte er sanft die Hand auf den Ellbogen, dem anderen klopfte er kräftig auf die breiten Schultern; bei diesem Mann ein derber Scherz, bei jenem ein feierliches Wort der Anteilnahme, wobei er zur Bekräftigung seines Mitgefühls die verschränkten Hände gegen die eigene Brust drückte. Auch wenn ihn ein lästiger Schwätzer festnagelte, erweckte er den Eindruck, sich alle Zeit der Welt für dessen langweilige Geschichte zu nehmen. Plötzlich jedoch streckte er den Arm aus und hielt irgendeinen vorbeischlendernden Senator auf, entledigte sich der Klette anmutig wie ein Tänzer und ließ ihn mit dem sanftmütigsten Blick der Entschuldigung und des Bedauerns stehen, um den nächsten Kollegen zu bearbeiten. Gelegentlich deutete er in unsere Richtung, und dann blickte sein Gesprächspartner zu uns herüber und schüttelte vielleicht ungläubig den Kopf oder nickte bedächtig, um Cicero seiner Unterstützung zu versichern.
»Was erzählt er da über mich?«, fragte Sthenius. »Was geht hier vor?«
Da ich es selbst nicht wusste, konnte ich ihm diese Frage auch nicht beantworten.
Hortensius hatte inzwischen gemerkt, dass etwas in der Luft lag, aber er wusste nicht, was. Die Tagesordnung war an der üblichen Stelle neben dem Eingang zum Senat ausgehängt worden. Ich sah, wie Hortensius stehen blieb, las – in den Provinzen die Strafverfolgung von Personen, die Kapitalverbrechen beschuldigt werden, in deren Abwesenheit verboten werden sollte – und sich dann verwirrt abwandte. Umgeben von seinem Gefolge saß Gellius Publicola im Saaleingang auf seinem mit Elfenbeinschnitzereien verzierten Stuhl und wartete darauf, dass die Auguren nach Begutachtung der Eingeweide alles für ordnungsgemäß befanden, damit er die Senatoren auffordern konnte einzutreten. Hortensius ging auf ihn zu und breitete fragend die Arme aus. Gellius zuckte mit den Achseln und deutete gereizt auf Cicero. Hortensius drehte sich um und entdeckte seinen Rivalen inmitten einer Traube verschwörerisch tuschelnder Senatoren. Er runzelte die Stirn und gesellte sich zu seinen aristokratischen Freunden: den drei Metellus-Brüdern Quintus, Lucius und Marcus sowie den beiden älteren Exkonsuln Quintus Catulus, dessen Schwester mit Hortensius verheiratet war, und Publius Servilius Vatia Isauricus, der das Konsulat zweimal innegehabt hatte. Sogar beim Niederschreiben der Namen stellen sich mir nach all den Jahren noch die Nackenhaare auf, denn Männer dieses Kalibers – eisern, unnachgiebig, durchdrungen von den alten Idealen der Republik – gibt es heute nicht mehr. Hortensius musste ihnen von dem Antrag erzählt haben, denn langsam drehten sich alle fünf um und schauten zu Cicero. Unmittelbar danach ertönte das Trompetensignal, das den Beginn der Sitzung ankündigte, und die Senatoren begaben sich in den Saal.
Das alte Senatsgebäude war ein kühler, düsterer, höhlenartiger Regierungstempel, den ein breiter, in schwarzen und weißen Fliesen ausgelegter Mittelgang in zwei Hälften teilte. Auf beiden Seiten befanden sich jeweils sechs lange, einander zugewandte Reihen mit Holzbänken für die Senatoren. Auf einem Podium am Kopfende des Raumes standen die Stühle für die Konsuln. Das Licht an jenem Novembertag war fahl und bläulich. Es fiel durch die unverglasten Fenster, die sich direkt unterhalb der Dachbalken befanden, in schmalen Streifen in den Saal. Tauben gurrten auf den Gesimsen und flatterten durch den Raum, wobei sie kleine Federn und auch den einen oder anderen warmen Spritzer Exkremente auf die Senatoren herabfallen ließen. Manche behaupteten, dass es Glück brächte, wenn man während einer Rede vom Vogelkot getroffen würde, andere hielten es für ein schlechtes Omen, und einige wenige glaubten, dass das eine oder andere von der Farbe der Ausscheidungen abhinge. Die Spielarten des Aberglaubens waren so zahlreich wie deren Interpretationen. Cicero nahm davon keine Notiz. Er achtete weder auf die Lage von Schafsgedärm oder die Flugbahn eines Vogelschwarms noch darauf, ob es links oder rechts von ihm donnerte. Für ihn war das alles Unsinn – später allerdings bewarb er sich für einen Sitz im Kollegium der Auguren.
Nach den alten, damals noch befolgten Traditionen blieben die Türen während einer Senatssitzung geöffnet, damit das Volk die Debatten mithören konnte. Die Menschenmenge, darunter auch Sthenius und ich, drängte über das Forum bis zur Schwelle zum Senat, wo ihr ein einfaches Seil Einhalt gebot. Inzwischen hatte Gellius damit begonnen, die Kriegsberichte der Armeeführer vorzutragen. Die Nachrichten von allen drei Fronten waren gut. In Süditalien schlug der unermesslich reiche Marcus Crassus – der, der einmal getönt hatte, kein Mann könne sich reich nennen, wenn er nicht aus eigener Tasche eine Legion von fünftausend Mann unterhalten könne – mit äußerster Härte Spartacus’ Sklavenaufstand nieder. In Spanien räumte Pompeius Magnus nach sechs Jahre andauernden Kämpfen mit den letzten Rebellenarmeen auf. Und in Kleinasien landete Lucius Lucullus einen ruhmreichen Sieg nach dem anderen über König Mithridates. Nach dem Verlesen der Berichte erhoben sich nacheinander Anhänger jedes einzelnen Heerführers, um dessen Taten zu rühmen und die seiner Rivalen auf subtile Weise herabzuwürdigen. Cicero hatte mir erklärt, was dahintersteckte, und ich gab mein Wissen in überlegenem Flüsterton an Sthenius weiter: »Crassus hasst Pompeius und ist fest entschlossen, Spartacus zu schlagen, bevor Pompeius mit seinen Legionen aus Spanien zurückkehrt und den ganzen Ruhm für sich einheimst. Pompeius hasst Crassus und will Spartacus selbst vernichten, weil er Crassus den Triumph nicht gönnt. Crassus und Pompeius hassen beide Lucullus, weil der das attraktivste Kommando hat.«
»Und wen hasst Lucullus?«
»Pompeius und Crassus natürlich, weil die beiden gegen ihn intrigieren.«