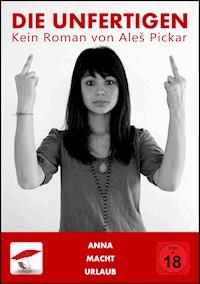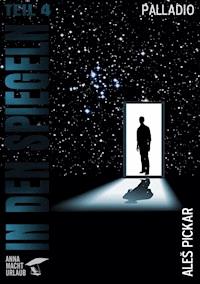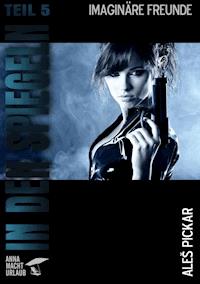Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Anna macht Urlaub
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Auch im 2. Teil von In den Spiegeln stolpert Jan-Marek von einer Katastrophe in die nächste. Doch zuerst lernt er die selbstbewusste Evelyn kennen, die wie ein Wirbelwind in sein Leben stürmt. Die Spur führt nach Hamburg. JMK ist in München mit dem Leben davongekommen. Seine geheimnisvollen Helfer, die sich als Lux Aeterna bezeichnen, verstummen nun. So zieht er in die anonyme Wohnung ein, deponiert das Geld in seinem Gefrierfach und wartet, bis das Schicksal an seine Tür schlägt. In dieser Gesinnung lernt er Evelyn, die charismatische Performance-Künstlerin kennen, die Jan-Marek systematisch zum Vollstrecker ihrer perversen Phantasien macht. Berauscht von neuen Erfahrungen lässt seine Vorsicht nach. Und seine Verfolger betreten erneut die Arena. Die Flucht wird zur Suche und der Flüchtling wird zum Entdecker. Nur langsam heben sich um ihn die Vorhänge der Verschwiegenheit und geben den Blick auf eine atemberaubende Weltbühne frei. Jan-Marek begreift, dass er zwischen die Fronten zweier sich bekriegender Mächte geraten ist. Seine Reise wird nicht nur eine Suche nach jener Wahrheit, die sich hinter unserer Zivilisation verbirgt, sondern ebenso eine Suche nach der eigenen Identität.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 173
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Aleš Pickar
In den Spiegeln
Teil 2
Evelyn
Aleš Pickar
In den Spiegeln
Teil 2 Evelyn
Dieses Werk(Ales Pickar: "In den Spiegeln - Teil 2: Evelyn")unterliegt der Creative Commons Lizenz. Für Sie bedeutet es:
–Sie dürfen das Werk und dessen Inhalt kostenlos downloaden und nutzen.
–Sie dürfen das Werk vervielfältigen, verbreiten und öffentlich zugänglich machen.
–Sie müssen bei Verbreitung des Werks den Namen des Autors/Rechteinhabers in der von ihm festgelegten Weise nennen.
–Die digitale Version dieses Werks bzw. dessen Inhalt darf nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden.
–Die digitale Version dieses Werks bzw. dessen Inhalt darf nicht bearbeitet, abgewandelt oder in anderer Weise verändert werden.
Sonstige Rechtshinweise zu diesem Lizenzmodell finden Sie hier:
www.creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de/legalcode
Support Creative Commons!
www.creativecommons.org
© Ales Pickar 2004
Lektorat: Annika Ernst
Titelillustration: Konrad Bak @ fotolia
Layout & Umschlaggestaltung: Anna macht Urlaub (www.annamachturlaub.de)
Hauptquartier: angelodaemonia.net
ISBN 978-3-9815154-2-8
» INUNSDIEGANZE WELT, DRAUSSENNUR TÄUSCHUNG.«
— Julius Zeyer
»MORALISTDIELETZTE ZUFLUCHTDER LEUTE,
DIE SCHÖNHEITNICHTBEGREIFEN… «
— Oscar Wilde
»Aber ich will nicht zu den Verrückten gehen,« bemerkte Alice.
»Oh, dagegen kannst du nichts tun,« sagte die Katze: »wir sind alle verrückt hier. Ich bin verrückt. Du bist verrückt«.
»Woher weisst du, dass ich verrückt bin?« fragte Alice.
»Du musst verrückt sein,« sagte die Katze, »sonst wärst du nicht hier«.
— Lewis Carroll,
Alice‘s Adventures in Wonderland
Fragment: Der Hyper-Albtraum #23
»Es ist Zeit«, sagt der Mann mit der langen Narbe im Gesicht.
Die Straße riecht nach verbranntem Holz und Fäulnis. Ich passiere einen alten Holzkarren, auf dem sich einige halbnackte Leichen stapeln. Hausgäste. Die Kutschen mit den provisorischen Särgen kommen hier, in die enge Seitenstraße, nicht hinein. Sie warten an der Einfahrt.
Die Nacht schwindet langsam aus den Gassen und weicht dem Grauen des Morgens. Ich folge dem dunklen Mann mit der Narbe entlang der Grenze zwischen Licht und Finsternis. Er trägt einen hohen Zylinder und stützt sich beim Gehen auf seinen eleganten und doch massiven Stock.
Leichter Nebel umhüllt uns. Grauer Nebel. Morgendunst. Wabert er nur in meinen Gedanken, oder wirklich hier, in diesen Straßen?
»Sie sind alle tot?« frage ich, ohne ihn anzusehen.
Der Narbige dreht sich kurz um. »Er muss irgendwie erfahren haben, dass wir kommen. Seine Gefangenen konnte er nicht mitnehmen.«
Ich blicke kurz hoch, heraus aus der Gasse zu dem schmalen Streifen Himmel über mir. Taubenflügel schlagen. Die letzten Sterne verblassen in der Ahnung der kommenden Sonne. Ich entdecke einige neugierige Augen, die aus Fenstern unser Tun beobachten.
»Wir müssen hier aufgeräumt haben, bevor es richtig hell wird«, befiehlt der Narbige seinen Leuten. »Maria und Josef. Was für eine Nacht.«
Am Ende der Gasse bleiben wir stehen. Es sieht aus, als ob die Straße hier früher weiterführte und irgendwann zugemauert wurde.
Die Polizisten sind bereits dabei, die Steine aus der Mauer heraus zu reißen. Sie schlagen mit spitzen Hacken und schweren Vorschlaghämmern gegen die alten Ziegel. Langsam setzen sie die Dunkelheit dahinter frei.
»Wer ist das?« knurrt einer von ihnen und blickt mich an. Die Stimmung ist gereizt.
Der Narbige fordert ihn mit einer kurzen Handbewegung auf zu schweigen. »Ist schon in Ordnung.«
»Wir haben festgestellt, dass Stagnatti hier im Erdgeschoß drei benachbarte Wohnungen gehörten. Angemietet unter falschen Namen...«, erklärt mir der Narbige. »Und die dazugehörigen Keller.«
Bald schon steigen die ersten Polizisten in das in die Wand geschlagene Loch hinein. Wir warten. Nach einigen Minuten kehren sie zurück. Einige taumeln zur Seite und übergeben sich. Ein vertrautes Bild.
Dann greift der Narbige nach einer der brennenden Laternen und tritt über das Geröll, hinein in die dunkle Passage. Ich folge ihm.
Wir steigen eine schmale Steintreppe hinab und passieren verschlossene Türen und Zellen. Am Ende des Gangs flimmert Licht. Es ist ein Raum am Ende des Tunnels. Ein grässlicher Geruch schlägt uns entgegen. Ich sehe Käfige und eiserne Stühle mit Fesseln. Instrumente aus Stahl. Kanülen und große Glasbehälter. Der Narbige hält seine Laterne in die Nähe der massiven Glaszylinder. Körperorgane schwimmen dort im Alkohol.
Der Narbige wendet sich mir kurz zu und blendet mich mit seinem Licht: »Als würde er mit dem Engländer um die Wette töten...«
Ich habe keine Gelegenheit, über seine Worte nachzudenken, denn sogleich betreten wir das Reich des Schreckens. Ein Reich, das ständig seinen Platz verändert und das vielleicht niemals besiegt werden kann. Und wo immer es in Erscheinung tritt, bin ich auch zur Stelle. Doch stets komme ich zu spät. Als wäre es meine Bestimmung, gegen das Böse zu verlieren.
Schweigend beobachte ich die Frau und versuche mich an das Bild zu gewöhnen, um in einigen Augenblicken sachlich und ruhig meiner Arbeit nachgehen zu können. Wir starren sie an, als wäre sie eine furchterregende Statue in einer ägyptischen Krypta. Ein heller Torso inmitten der Finsternis. Es besteht kein Zweifel, dass sie noch nicht lange tot ist. Sie ist blass, doch das Blut ist noch nicht vollständig verkrustet. Insgeheim bin ich froh, dass sie tot ist. Allein die Vorstellung, eine lebendige Frau vorzufinden, der alle Gliedmaßen entfernt wurden, lähmt mich.
Sie liegt auf einem großen, schweren Tisch mit einer Marmorplatte. Es ist schwer zu sagen, ob dieser Tisch mehr eine pathologische oder eine zeremonielle Bestimmung hat. Der flache Kanal zum Abführen des Blutes, der in den Rand der Tischplatte eingelassen ist, mag für beides zweckmäßig sein.
Ich mustere kurz das rechteckige Taschentuch, das über ihren Schoß gelegt worden war.
»Waren das Ihre Männer?«
Der Narbige nickt unmerklich.
»Niemand fasst hier etwas an!« erwidere ich verärgert und reiße mit den Fingerspitzen das Taschentuch weg.
»Mehr Licht hier!« befiehlt der Narbige und nimmt seinen Zylinder ab. Er klemmt sich ein Monokel unter die rechte Augenbraue und bewegt seinen Kopf entlang des geschundenen Körpers. Die Laternen leuchten sein Gesicht seitlich an und lassen die Narbe dunkler und tiefer erscheinen. Dann richtet er sich auf und wendet sich an mich. »Ich dachte, ich hätte schon einiges gesehen... Nun, das ist Ihr Parkett, mein Bester.«
Er tritt zur Seite und lässt mir den Vortritt. Ich betrachte die Frau und denke darüber nach, ob sie hübsch war. Doch jeder Blick in ihr Gesicht scheitert an den aufgerissenen, starren Augen. Langsam schiebe ich eine Hand unter den Rücken der Leiche und hebe den Torso ein wenig auf die Seite. Er ist erstaunlich leicht.
Ich bücke mich und sehe mir den Rücken der Frau an.
»Mehr Licht«, ruft wieder der Narbige und hält seine eigene Laterne über meine Schulter.
Ich lege den Körper wieder auf den massiven Marmortisch zurück. Mit meinem Zeigefinger drücke ich in ihren Bauch und bewege das Kinn ein wenig zur Seite. Dann verschließe ich ihre Augen und prüfe die Augenlider.
»Die Totenstarre ist bereits eingetreten. Ohne die Gliedmaßen ist es für mich schwer einen zuverlässigen Todeszeitpunkt zu benennen. Aber dem ausgetretenen Blut um ihren Mund nach zu urteilen, vielleicht vor drei oder vier Stunden. Die Gliedmaßen wurden viel früher entfernt. Vielleicht vor Tagen oder Wochen.« Ich sehe den Mann mit der Narbe an und schüttle kurz den Kopf. »Aber deswegen haben Sie mich nicht hergeholt.«
»Sie haben übrigens ganz schöne Befugnisse für jemanden, der kein offizieller Ermittler ist«, äußert sich der Narbige mit ausdruckslosem Gesicht. Dann greift er unter sein Hemd und reicht mir ein zusammengefaltetes Blatt Papier. »Es lag neben ihrem Kopf.«
Einer seiner Polizisten schnaubt abfällig und beginnt den restlichen Raum zu untersuchen.
Ich falte das Blatt auseinander und lese die Zeilen.
»DUEINZIGER,INDEMMEINGANZESSEIN
VOLLKOMMENHEITUNDSTOLZUNDRUHEFINDET!
ERFREUTSEH‘ICHDEINANTLITZUNDDENMORGEN;
DENNDIESENACHT,WIEKEIN‘ICHNOCHBESTAND,
DATRÄUMT‘ICH,WENNICHTRÄUMTE,NICHTWIESONST
VONDIR,UNDVONDESVORIGENTAGESMÜH‘N,
VONPLÄNENFÜRDENNÄCHSTENMORGEN,NEIN
ICHTRÄUMTEVONVERBRECHENRUHELOS,
DIEVORHERNIEMEINBUSENNOCHGEKANNT;
MIRWAR,ALSRIEFEDICHTANMEINEMOHR
MIRJEMANDFORTZUGEHNMITSANFTERSTIMME...«
»Es ist an mich adressiert«, erkläre ich knapp.
»Er schreibt Ihnen Briefe?« fragt der Narbige misstrauisch und blickt mich an, als würde er es bereuen, mich mitgenommen zu haben. »Zünftig...«
»Er hat eine Schwäche für ungewöhnliche Formen der Verständigung«, fahre ich fort, wissend, dass diese Unterhaltung eigentlich eine Zeitverschwendung ist. »Er will, dass ich ihn verstehe.«
Der Narbige verzieht das Gesicht, als versuche er ohne Hände eine Fliege von seiner Wange zu verscheuchen. »Und was schreibt er Ihnen...? Für mich war´s nur Kauderwelsch.«
»John Milton.Das verlorene Paradies«, lautet meine Antwort. »Er sagt mir auf diese Weise, dass er nicht mehr wiederkommt.«
Ich mustere gedankenverloren den Torso auf dem Tisch, und jene Stellen, an den sich die Füße und die Hände der Frau befinden sollten.
Inzwischen dringen weitere Polizisten in den Raum. Ich höre, wie sich jemand hinter mir übergibt.
»Ruhe!« ruft der Narbige. »Wer glaubt hier kotzen zu müssen, geht wieder raus und hilft oben bei den Trümmern.«
Ich atme tief durch den Mund. Der Geruch von Desinfektionsmittel und Körperflüssigkeiten droht mich zu betäuben. Stumm deute ich einem der Polizisten, mir die Laterne zu geben. Ich stelle sie auf den Tisch, an jene Stelle, an der normalerweise ihre Knie wären, und ziehe ein Vergrößerungsglas aus meiner Tasche.
Der Narbige zeigt die ersten Anzeichen von Ungeduld.
»Das kann sicher warten bis wir sie in die Leichenhalle gebracht...«
Ich blicke kurz von meinem Vergrößerungsglas hoch. »Er hatte es eilig...«
»Das haben Sie aus dem Starren in ihre...?«
Ich zucke zusammen, denn das vergrößerte Gewebe unter meiner Lupe bewegt sich plötzlich. Ich blicke wieder hin, doch nun brauche ich kein Vergrößerungsglas mehr, um es zu sehen.
»Sie lebt...«, höre ich jemanden hinter mir mit erstickter Stimme hauchen.
Ihre Augen öffnen sich. Als setzten sich plötzlich zwei dunkle Motten auf ihre Lider.
Im Hintergrund höre ich Geschrei und Getrampel. Die Polizisten versuchen zurück in den Tunnel zu flüchten. Doch ich selbst bin erstarrt wie eine Salzsäule. Ich würde gerne zurücktreten, mit ihnen laufen, doch ich kann nicht. Ich bin wie angewachsen. Wie hypnotisiert.
Ihre herben, rissigen Lippen formen Worte. Ich neige meinen Körper nach vorn, um die leise Stimme zu hören.
»Ich habe nicht mehr als meine Liebe«, flüstert sie mir ins Ohr und klingt wie meine Mutter. In meinem Kopf explodieren Sterne.
Auch meine Augen öffnen sich. Ich reiße mich hoch und blicke um mich. Es ist dunkel. Langsam beginne ich die Umgebung zu entschlüsseln. Das Schlafzimmer.
Ich blicke zum Vorhang, an dessen Rändern sich bereits schwaches Licht zeigt. Jemand steht plötzlich über mir. Ich schreie erstickt auf.
»Schreib«, sagt Evelyn bestimmend, doch mit einer Stimme, die Orientierung gibt. Eine Nachttischlampe wird angeknipst und ich sehe Evelyn neben mir sitzen, mit einem Schreibblock in der Hand und einem gespitzten Bleistift. Sie trägt ein schwarzes T-Shirt mit der neonfarbenen Aufschrift: I´m so glamorous I cum glitter.
»Schreib. Denk nicht. Schreib.«
Ich nehme den Block aus ihrer Hand und kratze eilig über das Papier. Der Schlaf, dessen Tentakel noch immer meinen Schädel und meine Augen umschließen, löst sich langsam von mir. Doch mit ihm auch die Erinnerung. Ich spüre, wie der Traum bereits verblasst und zerfällt. Als ich fertig bin, falle ich rückwärts auf mein Kissen und starre schwer atmend an die Decke. Erst jetzt merke ich, dass ich schweißgebadet bin und mich erschöpft fühle, als hätte ich anstelle zu schlafen, die letzten Stunden in einem Bergwerk gearbeitet. Ich blicke nach links und beobachte Evelyn. Sie schläft längst wieder.
2.01 Aurea
Meine Nacht ist vorüber. Isis sei Dank. Nach einer Weile stehe ich auf und schiebe den Vorhang eine Handbreit beiseite. Draußen hatte es geregnet. Die Welt ist wieder genauso grau, wie ich sie zu sehen gewohnt bin. Doch in meinem Kopf lebt noch die Farbe des verkrusteten Blutes und der Geruch von Desinfektionsmittel. Die Bilder sind zerfallen, aber der sinnliche Eindruck bleibt. Mindestens einen Tag lang. Ich taumle in die Küche, um das Wasser für einen Kaffee aufzusetzen.
Es kommt mir vor, als hätte ich schon immer Albträume gehabt, doch ich weiß, dass das eine Selbstlüge ist, denn es gab keinen derartigen Albtraum in meinem Schlaf bevor ich als Kind den Tod in der Prager Kanalisation kennenlernte. Aber da andere Menschen auch schlecht träumen, dachte ich nie, dass das etwas Besonderes sei. Nur sehr langsam begann ich zu begreifen, dass dieser Grusel anders ist, als die Albträume der meisten Menschen, ja sogar anders, als meine eigenen restlichen Träume.
Natürlich habe ich auch gewöhnliche Träume. Manche sind gut, manche sind vermutlich Albträume — doch das nehme ich kaum wahr, denn sie muten an wie karibische Ferienhäuser, verglichen mit jenen speziellen Träumen, die mich ein oder zweimal im Monat aufsuchen.
Als ich einmal mit zwölf oder dreizehn Jahren aus diesen Träumen schreiend und schweißnass im Bett hochfuhr, versuchte mich meine Mutter zu beruhigen. Sie streichelte über mein kreidebleiches Gesicht und erzählte mir, dass es nur meine Einbildung sei und es nichts gebe, wovor ich Angst haben müsste. Ich glaubte ihr kein Wort. Doch ich fürchtete mich davor, mein Verhalten könnte mich sonderbar erscheinen lassen. Ich hatte eine seltsame, tiefe Angst vor Ärzten. So nickte ich nur, wischte mir die Tränen weg und tat so, als wäre ich von ihren Worten überzeugt. Ich fühlte mich in der Nähe meiner Eltern stets allein und hilflos. Ein seltsames Kind.
Mein Vater stand nur daneben und sah mit versteinerter Miene zu, wie ich aufstehen musste, damit meine Mutter das nasse Bettlaken wechseln konnte. So sahen meine feuchten Träume aus. Und mein Vater glaubte, dass das Leben ungerecht sei und deshalb erfuhr er die Ungerechtigkeit jeden Tag. Damals ahnte er noch nicht, was auf ihn durch meinen Bruder Roman zukam. Die Verschwörung der verweichlichten Söhne.
Raven von den Teen Titans und John Constantine aus Hellblazer waren bei diesen wiederkehrenden Traumkrisen viel wirksamere Helfer, aber am Ende war es die bedingungslose Zeit, die mich lehrte, mit mir und meinen Gedanken auszukommen. Jahre vergingen, Psychiater kamen und gingen, zuerst die sozialistischen und dann die kapitalistischen. Ich gewöhnte mich an die seltsamen Bilder in meinem Kopf. Da ich aber mit niemandem über sie sprach, hielt ich ihre Intensität und ihr Detailreichtum für normal. Ich nahm an, dass jeder Mensch plastische Träume voller Blut und Gewalt habe. Man redet nur nicht darüber. Und so wie ich mit fünf Jahren begriffen habe, dass es ein Tabu ist, in der Öffentlichkeit an meinen Genitalien herumzuspielen, begriff ich mit vierzehn, dass die Menschen nicht über ihre Albträume sprechen. Ich übersah vollkommen, dass diese Annahme, diese Überzeugung ein Produkt meiner Einbildung war. Ich glaubte an ein Tabu, wo kein wirkliches Tabu bestand. Aber auch wenn ich darüber gesprochen hätte — was hätte man mir anderes angeboten als noch mehr Psychotherapeuten und rezeptpflichtige Psychopharmaka?
Doch oft stellte ich mir die Frage, ob ich nicht wirklich einen Dachschaden hatte und auf die Hilfe von Fachleuten angewiesen war. Ich ahnte, dass viele seelische Erkrankungen nicht so einfach entdeckt werden können, da der betroffene Mensch dazu tendiert, sie nicht zu sehen und auf die bloße Idee, etwas sei mit ihm in Unordnung, mit Ablehnung und Gereiztheit reagiert. Kein Siebzehnjähriger möchte hören, dass er psychisch krank sei. Es fällt ihm leichter bei einer solchen Bemerkung eine Schlägerei anzuzetteln.
Die Hyper-Albträume waren zugleich aber auch mein Pubertätsritual, meine Entnabelung von der Welt der Heuchler. Ich mochte es damals nicht so verstanden haben, doch es war dieser Grad an Andersartigkeit, der mich wahrnehmungsfähig und empfänglich für die Welt von Paul Lichtmann machte.
Die nächtlichen Erfahrungen verblassten, wie sonstige Träume und Albträume. Ich fand bald heraus, dass das Cannabis hierbei half. Je mehr ich kiffte, desto weniger konnte ich mich am nächsten Tag an die Albträume erinnern. Die Welt mag hier etwas von einer Einstiegsdroge plappern, doch ich erkenne etwas Heiliges, wenn ich es sehe.
Mit dieser Art von Bettnässen hörte ich mit fünfzehn Jahren auf. Es war höchste Zeit. Sicherlich fiel meinem Vater ein Stein vom Herzen. Doch er sprach dieses Thema niemals an. Nachdem diese äußerlichen, peinlichen Symptome meiner Hyper-Albträume nicht mehr auftraten, hielt jeder das Problem für erledigt.
Vor mich hinstarrend stand ich da — der Löffel steckte noch immer in der Kaffeedose. Menschen sehen wohl nie sehr intelligent aus, wenn sie inmitten ihrer Gedanken »einfrieren« und abwesend vor sich hinschauen. In den Tiefen der Vergangenheit, als der Mensch noch um das Feuer kämpfte, mochte dieser Augenblick der Versunkenheit tödlich gewesen sein und ein Ende in den Fängen eines Raubtiers bedeuten. Oder den tödlichen Schlag eines Steinzeitkollegen. Heute lässt man es bei der schroffen Stimme eines Vorgesetzten bewenden, der den Tagträumer von seiner Reise zu fernen Gestaden wachrüttelt. Oder...
Ein mehrfaches Fingerschnipsen vor meinem Gesicht holte mich zurück. Ich sah auf die Kaffeedose in meinen Händen. Ich blickte in Evelyns fragendes Gesicht und lächelte.
»Ich... Ich war in Gedanken.«
Evelyn ist eine tolle Frau. Statt mich zu einem Psychiater zu schleppen, drückt sie mir einen Block in die Hand und sagt: Schreib!
Sie wirkte frisch und vital, als wäre sie bereits seit Stunden wach. Das Vorrecht sportlicher Leute.
Das Wasser blubberte bereits vor sich hin, also nahm ich noch eine zweite Tasse aus dem Regal und beeilte mich damit, Kaffee und Zucker hineinzulöffeln.
Evelyn trug ihren apricotfarbenen Kimono. Sie hatte ihn nicht zugebunden und ich blickte auf die winzige rosarote Brustwarze, die sich unter der Falte des Kimonos rausschälte. Sie bemerkte meinen Blick und folgte ihm. Statt beschämt den Morgenmantel straffer zu ziehen, lächelte sie nur und zog ihn noch weiter auseinander. Sie hatte durchaus einen notorischen Hang zum Exhibitionismus. Eine Art Kontrastprogramm zu einer seltsamen Schüchternheit, die genauso ein Teil von ihr war. In ihr fand eine ewige Schlacht zwischen dem sanguinischen und dem melancholischen Temperament statt. Sie lehnte sich gegen die Küchenzeile und lächelte schelmisch. Ihre Brüste waren klein und hatten ein adoleszentes Flair. Ihre Scham war in der Form eines Kreuzes rasiert. Ihre Haarfarbe änderte sich ständig: von pechschwarz zu schwarz-blau oder schwarzrot, dann wieder schneeweiß oder cremeblond. Ihr blasser, beinahe schneeweißer Körper war übersät mit Tätowierungen. Irische Bekenntnisse auf der Schulter. Seltsamer Flugkörper am Steißbein. Flammen des Fegefeuers die von ihren Fußknöcheln aufstiegen und bereits einen Großteil des Unterschenkels verzehrten.
»Hättest du es lieber, wenn ich große Brüste hätte?« fragte sie mit einem nymphomanisch anmutenden Gesichtsausdruck. »Große, wulstige Titten, in die man sein Gesicht eintauchen kann und deren Brustwarzenhöfe so groß sind, wie Bierdeckel?«
Ich nahm das heiße Wasser und goss es in die Tassen. Mein Mundwinkel zuckte. Sie mochte winzige Brüste haben, doch sie wusste am besten, wie man meine Albträume verscheucht und mich in kürzester Zeit auf andere Gedanken bringt. Meine Mutter konnte das auf jeden Fall nicht so gut.
»Nein. Ich mag deine Brüste, so wie sie sind. Sie geben mir das Gefühl, ein Päderast zu sein, und dir geben sie den Touch eines japanischen Bondage-Stars.«
»Schwein«, antwortete sie und beugte sich zum Kühlschrank, um die Milch heraus zu holen. »Man sollte dich kastrieren.«
Wir nahmen unsere Tassen mit ins Wohnzimmer. Dort saßen wir auf dem Sofa und schlürften den Milchkaffee. Ich verschlafen, sie munter.
»Es ist stets so nahe...«, sagte ich plötzlich. »Alles ist zum Greifen nahe. Es ergibt alles einen Sinn. Als wäre ich jemand anders. Und dann, wenn die Bilder unerträglich werden, zerfällt es zu einer absurden Phantasie. Als ob mein Unterbewusstsein sich im letzten Augenblick einmischen würde, um zu verhindern, dass ich wahnsinnig werde.«
»Also ist es bis zu dem Augenblick, an dem alles surreal wird und du erwachst, irgendwie kein richtiger Traum?«
»So fühlt es sich an«, entgegnete ich, obwohl ich nicht glaubte, dass sie sich wirklich vorstellen konnte, was ich meinte. »Als würde man aus einer Doku plötzlich in einen Horrorfilm wechseln, ohne den Übergang zu merken.«
»Ich sehe schon«, meinte Evelyn. »Wir anderen langweilen uns richtig, wenn wir schlafen.«
Meine kleine Isis stand auf und verschwand im Schlafzimmer. Sie war nur Augenblicke später zurück. Diesmal ohne Kimono, doch in ihren seidenen Jacques-Britt-Boxershorts, einem gelben Unterhemd und schwarzen Tanzschuhen.
Sie legte eine selbstgebrannte CD in meine Bang & Olufsen und schob den Sessel beiseite. Es gab zwei Leidenschaften in Evelyns Welt: Tanz und Sadomasochismus. Doch davon zu sprechen, dass Evelyn diese Leidenschaften besaß, wäre kaum zutreffend gewesen, denn ich gewann zunehmend den Eindruck, dass es umgekehrt war. Diese Leidenschaften besaßen Evelyn. Sie war ihnen ausgeliefert und von ihnen genauso abhängig wie von Wasser und Luft.
Der sanften, doch graduierenden Grooves begannen durch die Wohnung zu pulsieren wie Ozeanwellen. Die Beats brandeten auf meinem Brustkorb und glitten zurück, um dem nächsten Pulsschlag Platz zu machen. Ich kannte Evelyns Musik inzwischen ganz gut. Das hier war Wamdue Project. Deep House. Mit einem Schuss