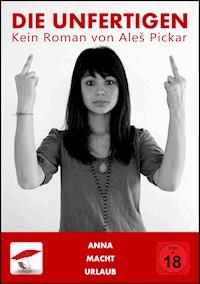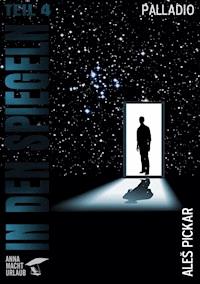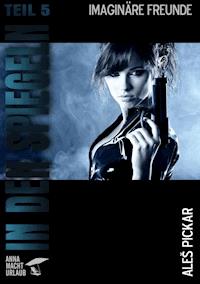8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Periplaneta
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Edition Drachenfliege
- Sprache: Deutsch
Der Himmel zürnt den Völkern Neroês mit Feuer. Doch dies mahnt niemanden zur Einkehr, im Gegenteil. Denn der Westen zieht in den Krieg und im Osten wird weiter intrigiert. Seitdem die junge Zofe Kemi die umstürzlerischen Pläne von des Königs Schwägerin erlauschte, wird sie unerbittlich gejagt. Derweil gelingt es dem gefangenen Feldherrn Gellen, sich gegnerisches Vertrauen zu erschleichen. Und während im kalten Norden ein seltsamer Magier dem Licht befiehlt, erblickt Prinzessin Linederion im Süden einen weißen Wal am Firmament. Schwerter kreuzen sich, Blut wird vergossen und Unschuld zerstört. Die einen sind erfolgreich im Ränkespiel, den anderen geschieht Entsetzliches und auch jene, die sich in Sicherheit wähnen, unterliegen einem Irrtum. Denn alles folgt einem viel größeren, klug gesponnenen Plan … DIE ZWÖLF KRONEN ist nach DIE LAUTLOSE WOGE und DIE DUNKLE WUNDE das dritte Buch der KALION-Reihe. Aleš Pickar erschafft mit KALION ein facettenreiches, geheimnisvolles und vor allem düsteres Epos zwischen High-Fantasy und dystopischer Science-Fiction. www.kalion.de
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 572
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
periplaneta
Arakenuma! Nisa-a´hrab-ere schalutûm-ko dê?
Vîl-galo mesteituma avatnisa-ûm dogô …
Mein König! Wo bist du in herber Not?
Wenn unter deinen Aufgaben ich einsam zusammenbreche …
aus Karven: Klage den Edlen
ALEš PICKAR: „KALION. Die zwölf Kronen – 3“ 1. Auflage, Dezember 2018, Periplaneta Berlin, Edition Drachenfliege
© 2018 Periplaneta - Verlag und Mediengruppe Inh. Marion Alexa Müller, Bornholmer Str. 81a, 10439 Berlin www.periplaneta.com
Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, Übersetzung, Vortrag und Übertragung, Vertonung, Verfilmung, Vervielfältigung, Digitalisierung, kommerzielle Verwertung des Inhaltes, gleich welcher Art, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlags.
Die Handlung und alle handelnden Personen sind erfunden. Jegliche Ähnlichkeiten mit realen Personen oder Ereignissen wären rein zufällig.
Projektleitung, Lektorat: Marion Alexa Müller Coverkonzept, Kartografie, Sprache: Aleš Pickar
Grafik, Satz, Layout: Thomas Manegold
print ISBN: 978-3-95996-052-6 epub ISBN: 978-3-95996-053-3
Aleš Pickar
KALION
Die zwölf Kronen
Dirie keltos
Der betende König
Wahrlich, König Belkar vermisste seine Kinder. Doch wem konnte sich ein Oberhaupt mit seiner Seelenqual anvertrauen? Wer wäre schon dem Herzschmerz eines Königs gewachsen? Seine Königin, die edle Kalimon, war vor Jahren an einer Krankheit verstorben. Für lange Zeit war sie die Einzige, der Belkar seine Gedanken und Gefühle schenken konnte. Der Hof und das Volk erwarten einen Herrscher ohne Wankelmut. Streng und bestimmend. Und so behielt nach Kalimons Abschied Belkar, Herr aller Herren, seine Empfindungen für sich.
All dies blieb mir nicht verborgen. Der König hatte mir stets vertraut und ich übertreibe nicht, wenn ich hervorhebe, dass er mich mehr als nur einmal seinen Freund genannt hatte.
Heute haben viele bereits vergessen, weshalb ein so liebender Vater seine junge Tochter einem fremdländischen Oberhaupt zur Frau gab. So lasse mich darüber berichten.
Denn dies waren andere Zeiten und wer zu jung ist, um sich an die Jahre nach dem Krieg zu erinnern, kann kaum verstehen, in welchen Nöten wir uns damals befunden haben. Zu viele Ernten hatten unter dem Krieg gelitten. Zu viele Männer waren nicht zurückgekehrt. Zu viele Dörfer sind geschliffen worden und zu viele Kornspeicher abgebrannt. Doch am schwersten wog die Müdigkeit der Menschen gegenüber den Belangen des Krieges. Die Generäle, die einst für ihren König die mächtige Armee von Kendaré angeführt hatten, kämpften nun mühevoll gegen Ungehorsam und Überdruss in den Reihen der Krieger.
Als Tamaré sich an uns wandte, war es Satvârya Romordes, der dem jungen König des Südwestens die offene Hand entgegen hielt. Das neue Bündnis sah den Tausch von wertvollen diplomatischen Geiseln vor – namentlich Prinz Tevôj und Sanuhims Schwester Kitalda. In einer mündlichen Vereinbarung wurde beschlossen, zu einem unbestimmten Zeitpunkt Prinz und Prinzessin miteinander zu verheiraten und damit die Allianz zusätzlich zu stärken. Im Frühling des Jahres 375 erreichte Tevôj das Reich von Tamaré. Kitalda trafen im Sommer desselben Jahres in Kendaré ein. Beide waren sich nie begegnet.
Nur einen Monat später trug Romordes dem König seinen nächsten Plan vor. Diesmal sollte mit dem Reich Ximanté ein Bund geschlossen werden. Die Ximanti verfügten zwar über keine große Armee, doch ihre Reiter waren gefürchtet.
So hatte Romordes damals einen weiteren Geiseltausch angestrebt: Linederion gegen Lykon, den ebenfalls noch sehr jungen Prinzen von Ximanté. Doch Fedion, der Erste Ratgeber des ximantischen Königs Êtrimen, soll ihm deutlich gemacht haben, dass die Tradition des Geiseltausches für die Ximanti keine Bedeutung habe und sie solche Allianzen nur mittels der Ehe respektieren konnten.
Für eine kurze Weile stand auch im Gespräch, Prinzessin Linederion mit dem mächtigen Prinzen und Thronfolger Tikred zu verheiraten. Ein Ergebnis, das für Kendaré recht günstig gewesen wäre, da es Linederion schließlich zur Königin von Ximanté gemacht hätte.
Doch Tikred war eben kein gewöhnlicher Prinz. Sein alter Vater mochte noch auf dem Thron sitzen, der Sohn indes regierte bereits weitgehend das Land. Der tatkräftige Thronfolger zeigte kein Interesse an einer politischen Hochzeit und es gab im ganzen Reich Ximanté niemanden, der ihn dazu hätte zwingen können.
So drängte Fedion die Kendari darauf, dass die Hochzeit mit Lykon, Tikreds jüngeren Bruder, ausgerichtet werden solle. Dies wurde von vielen Ratgebern als eine günstige Partie gedeutet. Romordes hatte seinem König die neuen Pläne unterbreitet.
Zur Überraschung aller lehnte seine Hoheit, König Belkar, ab. Ich saß damals am Tisch, als dies besprochen wurde. Der Reichstruchsess hatte Mühen, sich zu beherrschen. Er hatte bereits Monate in diese Übereinkunft gesteckt.
Ich behaupte nicht, ich hätte damals alle Gedanken unseres Königs gekannt. Mein Gefühl und meine Erfahrung sagen mir allerdings, dass seiner Hoheit insgeheim die Vorstellung missfiel, seine Tochter in solch einer Endgültigkeit aus der Hand zu geben. Er wollte die aufbegehrende Prinzessin sicherlich ein wenig maßregeln, gar erziehen, doch nicht fürs Leben strafen. Dass Lykon kränklich war und als ein Schwächling galt, blieb dem König von Kendaré nicht verborgen. Ohnehin wollte er sein Herzblut nach weniger als zwei Jahren wieder zurückhaben.
Nicht mit einem der Söhne, sondern mit Êtrimen solle sie verheiratet werden, hatte der Herrscher erklärt.
Niemals vergessen werde ich den überraschten Blick von Romordes, als der König dies vorschlug.
‚Der Vater?!‘, rief damals der Reichstruchsess aus. ‚Er ist sechzig Jahre älter als sie!‘
Genau dies sei der Grund, hatte ihm seine Hoheit erklärt. Die Ehe würde somit nicht von übermäßig langer Dauer sein. Und nur so könne er, König Belkar, sicher sein, dass die Ehe nicht vollzogen würde.
Die Hochzeit einer Prinzessin mit einem Herrscher von so hohem Alter war zwar nicht unerhört, doch wenig alltäglich war dies durchaus. An Getuschel und Gekicher hatte es hierbei nicht gemangelt.
Der Reichsvogt des Rechts und der Sitten wurde somit beauftragt, Nachforschungen anzustellen, um die Eheschließung als unbedenklich zu bescheinigen. Als ich hierzu das gesiegelte Dokument erhielt, erteilte ich in meiner Stellung als Oberster Verweser des Reiches die Zustimmung zur Hochzeit.
Im Nachhinein wurde ich dafür oft getadelt. Aber es entsprach nicht meiner Stellung und Aufgabe, den Bericht des Ratgebers Kalpur zu hinterfragen. Seine Käuflichkeit war uns damals noch nicht bekannt.
All dies ist deshalb von Interesse, da in den vergangenen Jahren oft erzählt wurde, dass es die verschlagene Ostris war, die dem Reichstruchsess die Idee eingeflüstert hatte, Linederion mit dem greisen Pferdekönig zu verheiraten. Doch ich habe mit eigenen Ohren gehört, dass es Belkar selbst war, der dies vorschlug.
Hier zeigte sich der Weltgeist meines Herren Belkar, die Klarheit seiner Gedanken. Wie sehr sie ihn alle unterschätzt haben. Gar tattrig haben sie ihn genannt. Doch Belkar wusste damals um die finsteren Pläne seines Neffen und dessen verschlagener Mutter. Zu mächtig war das Haus Levan, angeführt von dem greisen Fürsten Nian. Immerfort haben sie Ränke geschmiedet und zum Vorteil ihres Hauses gehandelt. Darum hatte er seine beiden Kinder vor den Verrätern im Palast in Sicherheit gebracht. Er allein harrte nun auf dem Thron aus, bereit für seinen letzten Kampf um die Zukunft der Krone.
So war es erneut Romordes, der die Reise angetreten hatte, um die Schreibfeder des Königs zu führen. Ich saß daneben, als Belkar am Abreisetag seinen Neffen ermahnte, die Unversehrtheit und Jungfräulichkeit seiner Tochter bei den Verhandlungen ausdrücklich anzusprechen.
Als Wochen später der Truchsess zurückgekehrt war, berichtete er seinem Onkel, dass Êtrimen zwar durch Belkars Sorge geschmeichelt sei, aber den weiblichen Reizen spätestens seit der Geburt seines jüngeren Sohnes Lykon – siebzehn Sommer zuvor – nicht mehr zusprach.
Ich weiß, dass König Belkar stets ein gewisses Unbehagen behielt. Er verriet mir einmal, er würde sich täglich bei der Hoffnung ertappen, die Ereignisse mögen sich etwas beschleunigen, auf dass er seine Tochter bald wiedersehe. Ein Gefühl, das ihn, den großherzigsten Mann der jemals gelebt hatte, tief beschämte, wünschte er doch Êtrimen keinen baldigen Tod. So begab sich unser Herrscher um so häufiger in den Palasttempel des Arkron, wo er einsam opferte und um das Heil seiner Tochter betete.“
aus „Ränke, Fehden und Verschwörungen – meine Jahre als Oberster Verweser“ von Bansatar Orsin. Original aufbewahrt in der Königlichen Bibliothek von Denroen Tai
„Ich kann nur empfehlen, Bansatars schwulstige Erinnerungen mit gewisser Vorsicht zu genießen. Sein endloses Salbadern dient doch zumeist nur der Absicht, sich möglichst oft selbst in den Mittelpunkt des Geschehens zu setzen. Und seine Besessenheit für das unangekratzte Vermächtnis von König Belkar ist für eine wahrheitsnahe Historik höchst bedenklich.“
Eine Notiz am Deckblatt des Manuskripts.
Urheber unbekannt.
Im Wald gilt das Gesetz des Waldes
Kendaré
Das schattenreiche Dickicht lichtete sich und kühler Wind umwarb Kemi und Airo, während sie auf Molis Rücken immer weiter gen Norden getragen wurden. Die Sträucher am Waldrand waren mit Raureif überzogen, der triste Himmel wolkenverhangen.
Airo hatte bei Händlern eine alte Decke erworben, die Kemi wie einen Mantel um ihren Leib geschlungen trug, der Saum flatterte hinter ihnen im Wind. „Es wird schneien“, sagte Airo. „Schnee am Neujahrstag bringt Glück und Segen.“
Sie trafen kaum noch Reisende an. Nur gelegentlich überholten sie gemächlich trottende Kolonnen aus Händlern, die mit Pferdekarren in ihre Heimatorte zurückkehrten und zumeist in Gedanken versunken auf einen fernen Punkt zwischen den Ohren ihrer Pferde starrten. Die Eile von Airo und Kemi löste Verwunderung aus, denn hier im Norden des Reiches gab es nur wenig, das Hast begründen würde.
Das bekümmerte die beiden nicht. Sie ritten, als ob nur die Welt vor ihnen bestand und alles, das sie hinter sich ließen, sich in Luft auflöste und der Vergessenheit anheimfiel. Die Muskeln und Sehnen der jungen Stute waren kraftvoll wie ein Sturmwind über dem Terime-Meer und trugen sie unaufhaltsam ihrem Ziel entgegen. Der junge Pferdezüchter gönnte seiner prächtigen Stute so viele Verschnaufpausen, wie ihre Lage es ihnen erlaubte. Denn ihre Häscher folgten ihnen unerbittlich. Tarams Bande trieb eine hartherzige Wut an, vermengt mit einer unbändigen Grausamkeit. Sie überfielen Schmieden und Pferdeställe, schlugen und töteten ihre Bewohner und griffen sich bei jeder Gelegenheit Nahrung und frische Pferde. Doch selbst ausgeruhte Tiere konnten Moli nicht einholen.
Für Kemi und Airo waren ihre Verfolger widrige schwarze Punkte in der Landschaft, die dann erschienen, wenn sie einige Zeit länger als angebracht ruhten und dann über ihre Schulter sahen. Kemi hatte sich stumm an die Hoffnung geklammert, dass die Verfolger schon bald aufgeben würden.
Airo glaubte dies keinen Augenblick. Dieses Mädchen, dessen Brust sich den meisten Teil des Tages gegen seinen Rücken drückte und deren Kinn oft auf seiner Schulter ruhte, hatte einen Mord im Palast beobachtet und – was noch schlimmer wog – sich verdächtig gemacht, die Pläne der darin verwickelten Edelleute erlauscht zu haben. ‚Es sind Reiche wegen weniger gestürzt‘, dachte Airo schwermütig. Gegenüber Kemi gab er sich jedoch zuversichtlich. Er wusste, dass sie Gefahr lief, mutlos zu werden und dass sie ihre Verfassung nur mit schierem Willen zusammenhielt. Und die Hoffnung, dass er sie nach Arkat Andoriam bringen würde, war der Faden in dieser schlechten Naht.
In Sichtweite eines Turms, der hoch über ihnen aus dem bewaldeten Felsen ragte, hielten die beiden an. Nur wenig Schritte entfernt sprudelte eiskaltes Wasser aus dem Felsen und wurde zu einem Bach.
„Der Wachturm von Quarat Yong“, erklärte Airo. „Wir werden hier rasten.“
Kemi glitt aus dem Sattel und fröstelte, während sie auf dem Boden die kalten, von Zweigen zerkratzten Beine streckte. „Ein kwantarischer Name“, sagte sie. „Es kann nicht mehr weit sein.“
„Als der Wachturm erbaut wurde, gab es Kendaré noch nicht“, erzählte der Junge, während er sein Pferd striegelte. „Wir werden noch eine Weile reiten müssen, um die Grenze zu erreichen, falls sie überhaupt markiert ist. Doch damals verlief sie genau hier. Sibelin und Kwantaré waren da noch Erzfeinde.“
„Heute ist Sibelin der Diener und Kendaré der Herr …“, überlegte Kemi laut.
Airo füllte den Ledereimer mit Wasser und hielt ihn Moli unter die Nüstern. „So streng siehst du die Gegebenheiten? Ich dachte, der Fürst von Sibelin ist halber Kendari.“
„Doch König im eigenen Reich nennen, darf er sich nicht.“
„Kaum hast du die kendarischen Palastmauern verlassen, schon hältst du dich für eine Freiheitskämpferin deines Volkes“, stichelte Airo, während die Stute aus dem Ledereimer trank. „Ich denke aber, dass die Sibeliner unter den schützenden Fittichen Kendarés durchaus zufrieden sind.“
Kemi verzog das Gesicht und ging zur Quelle, um dort zu trinken.
„Wir wissen so wenig über unsere Ahnen“, philosophierte Airo. Gedankenverloren starrte er, mit dem Kopf im Nacken, auf den Turm. Dramatische Wolken zogen hinter der zerklüfteten Ruine vorbei, als seien sie Teil der Hetzjagd auf die beiden Freunde. „Es gibt nur wenige Schreiber und Geschichtenerzähler in dieser Gegend. Alles scheint in der Dunkelheit des Waldes zu versinken und als Legende wiedergeboren zu werden.“
Kemi trocknete ihr Gesicht am Deckensaum und kam zu ihm. „Wie lange ist es noch zur Grenze?“
„Zwei Stunden“, antwortete Airo, während er Molis Kopf streichelte.
Eine Gorkonische Stunde entsprach dem Sechzehntel eines Tages. Auf Ledonisch hieß die Stunde Duslek, das sich von Dusai telek ableitete, dem sechzehnten Teil. Gezählt wurde die Uhrzeit vom Morgengrauen bis Morgengrauen, so dass Mittag auf die fünfte, Abend auf die neunte und Mitternacht auf die dreizehnte Stunde fiel.
„So bringe mich zur Grenze und kehre zurück“, sagte Kemi und blickte den Jungen eindringlich an.
„Die Wette gilt bis Arkat Andoriam“, erwiderte Airo. „Beraube mich nicht meines Sieges.“
„Vergiss die Wette, Airo!“, drängte Kemi. „Es ist zu gefährlich und ich habe dich da hineingezogen. Bin ich erst mal in Sibelin, ist es unwahrscheinlich, dass sie mir folgen werden. Du musst heim zu deinen Pferden.“
Airo setzte sich auf eine Grasböschung am Wegesrand und kaute in gewohnter Manier an einem langen Strohhalm. „Würdest du wirklich glauben, dass die Bande dir nicht nach Sibelin folgen wird, würdest du darauf bestehen, dass wir beide so schnell wie möglich über die Grenze reiten und somit vorerst in Sicherheit sind. Du, ich und Moli. Doch du glaubst nicht, dass sie an der Grenze haltmachen. Welche Grenze auch? Du sagtest es selbst. Sibelin ist mehr ein Teil von Kendaré, denn ein eigenes Reich. Die Häscher kümmert nur ihre Aufgabe. Und ich kann nicht eher ruhen, bis eine bewaffnete sibelinische Patrouille unser Pferd geleitet.“
Kemis Lider zitterten und ihre Augen füllten sich mit Tränen. „Ich möchte nicht, dass dir meinetwegen etwas passiert“, flüsterte sie mit brüchiger Stimme.
„Sei unbesorgt“, tröstete sie Airo. „Der halbe Weg ist hinter uns und Moli ist frisch wie je und eh.“
Sie wischte sich die Tränen ab und blickte ihn hoffnungsvoll an. „Nichts kann deine Zuversicht brechen, Airo.“
„Das kommt daher, weil ich dir verheimlicht habe, dass ich ein großer Zauberer bin, der die Zukunft sehen kann.“ Er grinste schelmisch.
Kemi lachte auf. Ihre Augen waren noch rot vom Weinen und die Tränen hatten sich mit dem Staub der Straße auf ihren Wangen vermischt. „Wie sieht denn meine Zukunft aus?“, fragte sie und schnäuzte sich.
„Ich sehe ein Bankett“, erklärte er. „Edle Herren und Damen haben sich versammelt, um bei Musik und Tanz zu speisen und zu feiern. Sie heben die Kelche auf dich und wünschen dir Gesundheit.“
Kemi legte sanft die Hand auf Airos Brust. „Niemand erwartet mich in Sibelin. All unsere Hoffnung liegt darin, dass dieses Pferd schneller ist, als alle anderen und dass ich in den Straßen von Arkat sicher bin vor den Schurken aus dem Süden.“
„Moli wird uns schon hinbringen“, meinte Airo und tätschelte die Stute. „Sie weiß, was auf dem Spiel steht.“
Kemi zog die Decke enger um sich und trat fröstelnd an die Stute heran. „Danke“, sagte sie leise und küsste das Tier auf den Hals. Zu ihrer Überraschung schnaubte Moli unruhig und stampfte aufgeregt mit den Hufen.
„Ruhig, Mädchen“, sagte Airo mit besänftigender Stimme und griff nach den Zügeln.
Kemi fuhr erschrocken herum. Sie schrie auf. Äste knackten und Blätter raschelten, während die Männer langsam aus dem Wald traten.
Airo hielt die Zügel in der Hand und drückte Kemi an sich.
‚Wir waren zu langsam‘, schoss es Airo durch den Kopf.
Tarams Männer hatten am Abend zuvor einen Holzfäller mit seinem Karren auf der Straße getroffen und ihn gezwungen, sie in sein Haus zu führen. Ein Dach über dem Kopf kam ihnen gelegen. Sie ließen sich bewirten und machten deutliche Anspielungen darauf, was mit seiner Frau und dem halbjährigen Kind in der Wiege geschehen würde, täte die Familie nicht wie geheißen.
Beskasch schielte unentwegt nach der jungen Mutter, doch weder er noch die anderen waren in der Stimmung für ihre üblichen Übergriffe. Zu sehr fixierte sich ihr Streben auf die entschwindende Beute und zu sehr brannte die unermessliche Wut über das stete Entkommen dieser Beute in ihnen. Sie wollten, dass es endlich vorbei war. Sie wollten den jungen Reiter von seinem Pferd zerren, ihm unverzüglich die Kehle durchschneiden und ihn im Gras verbluten lassen. Und dann würden sie endlich dieses sibelinische Miststück zu fassen kriegen. Das Bild ihres abgehackten Armes schwebte wie ein gemeinsamer Wunschtraum über dem Speisetisch, an dem ihnen die Frau des Holzfällers das karge Essen servierte.
„Ich will das Pferd haben“, sagte Taram mürrisch in die Stille. Sein heiles Auge war gerötet vor Müdigkeit. „Ich möchte verstehen, weshalb es so schnell ist.“
„Das Essen ist widerlich“, bemängelte der dicke Jagu und blickte traurig in seine Holzschüssel. Sie waren Missetäter, doch solche, die in Denroen Tai durchaus auf großem Fuß lebten. „Das schlechteste Neujahrsessen meines gesamten Lebens.“
„Das Pferd ist schnell, weil die beiden kaum etwas wiegen“, meinte der junge Kilkawân.
„Auch ein Pferd ohne Reiter müsste bereits umgefallen sein“, belehrte Beskasch seinen Zögling. „Sie sind den ganzen Tag gegen Norden geprescht. Mit Pausen so kurz, dass da ein normales Tier kaum zu Atem käme. In Schigma Levan könntest du mit dem Pferd ins Renngeschäft einsteigen.“
„Ich kriege sicherlich Ausschlag“, jammerte Jagu vor sich hin.
Sintarek warf den Holzlöffel auf den Tisch und stand so abrupt auf, dass die Frau des Holzfällers erschrocken zusammenzuckte. Wortlos stieß er die Hüttentür auf und trat in die Nacht hinaus.
Beskasch warf Taram einen kurzen Blick zu, nahm noch einige Löffel des Eintopfs zu sich und wischte mit dem Handgelenk seinen Mund ab. Dann richtete er sich langsam auf. „Erzählt mir nicht, ihr besitzt keinen Wein. Für besondere Anlässe sicher doch“, wandte er sich an das verängstigte Ehepaar. „Zur Feier des Tages oder wenn wieder ein Balg rausgepupst wird.“ Er deutete auf die Wiege. „Na los, bringt den Wein“, sagte er knapp und trat ebenfalls vor die Tür.
Der hagere Sintarek stand nicht weit entfernt. Im Mondlicht konnte Beskasch den langen schmalen Dolch in seiner Hand sehen. Sintarek hatte sich die Axt des Holzfällers genommen und benutzte sie als Schleifstein für seine Klinge.
„Was ist dein Problem?“, fragte Beskasch und stelle sich neben ihn.
Der offensichtlich wütende Mann antwortete nicht und schärfte schweigend seine Waffe.
„Bist du beleidigt, weil Tararn dich vorhin fast erwürgt hat?“ Beskasch schnaubte grinsend. „Sei kein Weichling.“
Sintarek hielt inne. Er blickte Beskasch an und seine Augen blitzten auf.
„Er hat mir mal die Spitze seines Messers gegen das Weiße in meinem Auge gedrückt“, rief Beskasch. „Ich war hundertfach sicher, dass ich es an diesem Tag verlieren würde …“ Dann lachte er auf, beseelt von dieser Erinnerung. „Ich schätze“, erzählte er amüsiert, „er hat im letzten Augenblick erkannt, dass es lächerlich wäre, wenn wir beide eine Augenklappe tragen würden.“
Sintarek schien von diesem Scherz nicht angetan zu sein. Er warf die Axt fort und hielt die blass schimmernde Klinge vor Beskaschs Gesicht. „Ich war in der Westend-Gilde“, zischte er. „Der einzige Grund, weshalb ich mich Taram angeschlossen habe, war das Geld und die Tatsache, dass seine Männer unter dem Schutz des Palastes stehen. Ich bin ein Silet brisk. Schicke mich, um inmitten eines Freudenhauses einen Mann aus dem Verkehr zu ziehen und sie werden noch einen Tag später dabei sein, all seine Wunden zu zählen. Doch das hier? Das ist nichts für eine schnelle Klinge. Mieser Fraß, kalter Wald und vierzehn Stunden am Tag einen Scheiß Sattel im Schritt? Und all das, um eine kleine Hure bis nach Sibelin zu jagen? In Denroen Tai feiern sie heute bis in den Morgen! Und wenn wir die Schlampe nicht finden? Wie werde ich dastehen, wenn sich das herumspricht? Wenn meine alten Jungs sich darüber beim Wein auslassen?“
„Siehst du, hier ist der Fehler“, erwiderte Beskasch und trat näher an Sintarek heran. Er ignorierte den Dolch vor seinem Gesicht, als wäre er gar nicht da. „Du stellst mitten in der Nacht all diese Überlegungen an. Darüber, was deine alten Jungs denken werden. Darüber, wozu deine Klinge gut ist und wozu sie viel zu fein sei. All das Denken. Taram zahlt dich nicht fürs Denken. Taram zahlt dich, damit du tust, was er dir sagt und dir dabei vorzugsweise mit allen Zähnen auf deine Zunge beißt.“ Beskasch wandte sich ab und schlenderte betont unbesorgt zurück zum Haus. Sintarek konnte in der Dunkelheit nicht sehen, dass er den Schaft seines Dolchs umklammerte und dass seine Ohren wachsam auf das Knacken von Zweigen unter Sintareks Füßen lauschten. Doch der Messerstecher machte keine Bewegung und musterte nur schweigend Beskaschs Rücken.
Ihre Nacht war unruhig und kurz, denn die kleine Hütte bot nur wenig Gemütlichkeit für sechs Männer. So brachen sie noch vor Sonnenaufgang auf.
Während Taram in morgendlicher Bärbeißigkeit sein Pferd sattelte, fielen sanft erste Schneeflocken auf seine Schultern und sein Haar. Er schnaubte zufrieden. Er hatte gestern gesehen, dass das Mädchen barfüßig auf dem Pferd saß, mit nur wenig am Leib. Wie lange würde sie durchhalten? Er griff in die große Satteltasche und zog seinen Schulterpelz heraus. Er warf ihn sich um und verschloss die Bronzespange auf seiner Brust.
Sie ritten schweigend, denn es gab nichts mehr zu sagen. Nun galt es, die Aufgabe zu erfüllen und nach Denroen Tai zurückzureiten. Sie würden sich dort bis zur Besinnungslosigkeit besaufen und auf diese Weise vergessen, dass ein junges Ding aus Sibelin sie derart an der Nase herumgeführt hatte.
‚Verdammtes Pferd. Ich muss es haben!‘ Tarams Hände umklammerten fest die Zügel, während sein Gesicht die Wand aus Schneeflocken zerteilte.
Am späten Nachmittag erreichten sie die ersten Ausläufer des nördlichen Waldrands. Ein imposanter alter Turm ragte dort wie eine graue Nadel aus dem kantigen Felsen hervor. Am Wegesrand darunter schien es eine größere Lichtung zu geben.
Der voranreitende Taram sah als Erster die Gestalten. Er hob stumm die Hand und deutete seinen Männern, wachsam zu sein. Noch hatte man sie offensichtlich nicht bemerkt. Taram blinzelte angestrengt, um besser zu erkennen, mit wem er es zu tun hatte. Dann schien er plötzlich die Lage zu begreifen und trat unsanft seinem Pferd in die Seiten. „Mir nach!“, rief er und sprengte los.
Die Männer folgten ihm, obwohl sie noch nicht so recht verstanden, worum es ging. Doch ihre Gemüter begrüßten ein Ende der Lethargie und der reizlosen Verfolgungsjagd.
Auf der Lichtung unter dem Turm standen die Sibelinerin und ihr Begleiter. Sie umklammerten sich gegenseitig, der junge Mann hielt das unruhige Pferd am Zügel.
Die vier Männer, die sie umstellt hatten, waren wahrhaft finstere Gesellen. Sie waren unrasiert und langhaarig, ihre Kleidung strotze vor Dreck. Einer von ihnen hielt eine lange Speerspitze an den Hals des jungen Mannes, während die anderen gerade wegen einer gehässigen Bemerkung in lautes Gelächter verfielen. Doch dann hielten sie zeitgleich inne und rissen ihre Köpfe herum. Sie blickten überrascht auf die heranstürmenden Männer. Ohne ein Wort zu wechseln, verteilten sie sich sogleich über die Lichtung.
Taram rauschte heran wie ein Donnerschlag und bremste in einer großen Staubwolke sein Pferd. Er sprang aus dem Sattel und riss sein Schwert hervor. „Ich werde nur bis drei zählen“, rief er. „Dann sollten eure schmutzigen Gesichter wieder im Gebüsch verschwunden sein!“
„Nicht so eilig“, rief einer der vier Straßenräuber – offensichtlich der Anführer. Er war ein hagerer Mann mit verfilzten Haaren und kleinen Narben im Gesicht. Einige seiner Vorderzähne fehlten. „Lô-seran kasar seran-ere – im Wald gilt das Gesetz des Waldes.“
Tarams Gefolgsleute glitten entschlossen und mit gezückten Waffen aus den Sätteln.
„Ihr seid Seran-ere orei und ich respektiere das“, rief Taram. „Doch wir haben seit zwei Tagen unser Augenmerk auf dieser Beute und werden nicht mit leeren Händen heimkehren.“
„Niemand kann dies bezeugen, außer euch“, lachte der drahtige Filzkopf und deutete mit der Spitze seiner Waffe auf Taram. „Ihr reitet besser weiter. Denn dies ist unser Wald und nichts Gutes kann euch treffen, wenn ihr bleibt.“
„Gib nur den Befehl“, flüsterte Beskasch, als er an Tarams Seite trat. Er suchte sich bereits einen Gegner für seine Klinge aus.
Kemi und Airo blickten bestürzt zwischen den beiden Gruppen hin und her.
„Ihr habt selbst genug Pferde und wir haben keins“, rief der Rothaarige.
„Ich sage euch was“, sagte Taram und spitzte die Lippen. „Nehmt den Jungen und macht mit ihm, was ihr wollt. Sicher ist er einiges an Lösegeld wert. Und wir, die in der Überzahl sind, nehmen das Mädchen und das Pferd. Das scheint mir angemessen …“
„Denkst du, ich bin ein Narr? Das Pferd ist mehr wert, als wir im ganzen Jahr erbeuten könnten. Und die Frau …“ Er grinste fratzenhaft und fuhr nervös mit der Zungenspitze in seiner Wange hin und her. „Die Frau kommt uns sehr gelegen. Außerdem seid ihr fünf Mann und wir sind vier. Nennst du das eine ordentliche Überzahl?“
Taram blickte zu Beskasch zu seiner Linken und drehte den Kopf weit nach rechts, um mit seinem Auge auch Golkai anzusehen, der zu seiner Rechten stand. „Bringen wir es zu Ende“, brummte er. „Damit wir endlich nach Hause gehen können.“
Die Gegenseite schien nichts anderes zu erwarten, denn beide Parteien stürzten sich aufeinander und ergaben sich in einem wilden Reigen aus Stechen und Treten.
Airo drückte seinen Rücken gegen Molis Seite und zwang so das Pferd auszuweichen. Nach einigen Schritten griff er nach Kemis Oberarm und zog sie zwischen sich und die Stute.
„Schnell, in den Sattel!“, zischte er leise und setzte seinen Fuß in den Steigbügel. Mit einer einzigen Bewegung schwang er sich hoch. „Steige auf meinen Spann!“ Airo zog sie hastig am Ellbogen hoch. Ohne abzuwarten, ob Kemi sicher saß, trieb er Moli bereits an. Sie schossen davon.
Nur wenig später blickte ihnen Taram hinterher. Von seiner Klinge tropfte noch das Blut eines Waldräubers. Er sah sich um. Ihre verstörten Pferde hatten sich über die Lichtung verteilt. Der junge Kilkawân lief ihnen hinterher und sammelte sie eilig ein.
Die vier Waldräuber lagen alle tot im Staub. Beskasch blieb bei einem von ihnen stehen und trat wütend mit der Ferse gegen seinen Schädel. Nach einer Weile brach der Knochen unter seinem Fuß. Es klang wie eine geknackte Nuss. Sintarek stand etwas abseits und befühlte zischend seine Seite. An seinen Fingerspitzen klebte Blut.
Am südlichen Ende der Waldstraße erschien ein massiger Reiter. Es war Jagu auf seinem Kaltblutpferd. „Was habe ich verpasst?“, fistelte er mit pfeifender Lunge.
Sintarek ging ihn wortlos an ihm vorbei und wischte zornig seine blutige Hand an Jagus Pferd ab.
Taram fühlte sich wie im Fieber. Er sah die Männer an, die erbost ihre Schwerter in den Boden stießen und zu Quelle gingen, um sich abzukühlen und sich das Blut abzuwaschen. Er sog tief Luft ein und kämpfte darum, sein Gemüt zu beruhigen. Heute Morgen hatte er noch gehofft, dass die Sibelinerin vielleicht Pause machte und sie somit den Abstand deutlich verkürzten. Doch so hatte er sich das Aufeinandertreffen nicht vorgestellt.
Er beobachtete seine Männer, die mit angespannten Nackenmuskeln vom Bach zurückkehrten. Ein finsteres Sturmgewitter tobte in ihren Brustkörben. Sie mussten die Frau bald zu fassen kriegen, wenn diese Bande nicht wie ein Vulkan ausbrechen sollte. Sie alle waren wie Wölfe auf einer Blutfährte. Ihre Geduld durfte nicht überspannt werden. Denn sollten sie nicht bald die Beute zwischen den Kiefern spüren, würden sie sich gegeneinander wenden. Es gab einen Punkt, an dem seine Autorität sie nicht mehr würde bändigen können.
„Ich war mal hier“, brummte Taram. „Vor Jahren. Unweit von hier ist eine Stadt, Monas Lei.“ Er seufzte nachdenklich. „Als diese Straße hier gebaut wurde, wählte man dafür jenes Gelände, das sich am besten für große Eisenfuhren eignete. Es gibt viel kürzere Wege nach Monas Lei, die eben nur beschwerlicher sind. Und spätestens bei ihrem Ritt auf die Vier Schwestern schnappen wir sie.“
Kilkawân hatte inzwischen die Pferde eingesammelt und die Männer stiegen auf.
„Und du versuche, Schritt zu halten“, fauchte der Anführer Jagu an. „Wir hätten deine Axt gebrauchen können.“
Sintarek ritt eng an dem verdutzten Jagu vorbei und warf ihm einen eisigen Blick zu, während er einen alten Fetzen gegen seine Rippen presste. „Ich mache das nicht ewig mit“, murmelte Sintarek unauffällig zu Golkai. „Ich reite wegen dieser Schlampe nicht bis in das Nordmeer hinein.“
Der Schweigsame sah ihn an und überlegte eine Weile. „Wir warten ab, wie der Tag verläuft“, äußerte er sich schließlich und trieb sein Pferd an.
Der Magier und der Krieger
Sayan
Draußen war es bewölkt, doch in südwestlicher Richtung, tief über dem Horizont flammten nebelhafte Lichter hinter der geschlossenen Wolkendecke auf. Es war ein lautloses Schauspiel, düster und fremdartig.
„Metafâr“, sagte Harada Dei. „Als junger Mann habe ich aus nächster Nähe erlebt, wie das Feuer südlich von Demené Megar ins Wasser stürzte. Hunderte Einschläge. Es fühlte sich wie eine Ewigkeit an. Die anschließenden Sturmwellen hatten den Hafen überflutet und viele Menschen getötet.“
„Schrecklich“, flüsterte der Magier und zog seine Mütze tiefer über die Ohren.
„Was befindet sich dort?“, fragte Harada.
„Es fällt viel zu weit südwestlich, um Demené zu treffen. Doch ich vermute, dass die Gesteinsbrocken in der Bucht von Elganôr einschlagen, oder gar über der westlichen Gorkonai.“
„Möge ihnen Gatmon gnädig sein.“
Sie beobachteten wortlos die fernen Lichtblitze, jeder in seinen eigenen Gedanken versunken. Am Ende war das letzte himmlische Geschoss aufgeglüht. Es blieb nur die dunkelgraue Wand aus tiefhängenden Wolken. Fast zeitgleich fing es zu schneien an.
Dem Magier fröstelte. „Ich gehe wieder rein“, sagte er knapp, noch immer von dem kosmischen Schauspiel bestürzt.
„Ich werde noch eine Weile über den Strand wandeln“, erklärte Harada.
Seit zwei Jahren lebte der alte Kenseti-Meister nun auf der Insel. Jeden Tag unternahm er einen ausgedehnten Spaziergang entlang der Küste, bis zu einem zerklüfteten Felsausläufer, der das Ufer unterbrach. Dort zerschlugen sich die eisigen Wellen und schleuderten mit lautem Dröhnen die schäumende Gischt gen Himmel. Der Ozean roch hier nach den Eisbergen, die in Sichtweite vorbeidrifteten. In den Felsen konnte man Nester mit Möweneiern finden. Weiter nördlich ließen sich am Strand immer wieder auch Robben blicken. Sie waren die einzigen regelmäßigen Besucher dieses kalten Eilands, von einigen Walen abgesehen, die von Zeit zu Zeit an der Küste vorüberzogen.
Er kam hierher an den Strand, um nachzudenken. Es waren keine tiefen und keine vielschichtigen Gedanken. Sein Blick war auf den endlos anmutenden Strich gerichtet, der den dunkelgrauen Ozean von dem hellgrauen Himmel trennte. Noch offenbarte sich ihm nicht, welchen Pfad sein Schicksal einschlagen sollte.
Er, Harada Dei, einst ein geachteter Weiser des demenäischen Volkes, galt als tot. Dass er dennoch hier saß, atmete und seinen Gedanken nachgehen konnte, musste somit eine besondere Bedeutung haben.
Sein Retter hielt nur wenig von solchen Überlegungen. „Alles nur der Zufall“, pflegte der Magier in seinem unsicheren Ledonisch zu sagen. „Sîra-led deli.“
Harada verdankte dem Zauberer sein Leben. Und dass dieser noch recht junge Mann ein mächtiger Magier war, daran bestand für Harada kein Zweifel. Er war schließlich in einem hoffnungslosen Zustand hier angekommen, dem Tod geweiht. Das unheilbare Aghet hatte Haradas Leben eingefordert. Doch dann geschahen wundersame Dinge.
Vor Haradas Ankunft lebte der Zauberer allein auf seiner Insel. Eines Tages hatte er vom steinigen Strand aus das kleine Segelschiff gesehen und sich mit einem seltsamen Boot, das weich und hart zugleich war, in das kalte Meer gestürzt, um Harada zu retten. Durch die Brandung hindurch hatte er den Kenseti-Meister auf die Insel gebracht und den fast leblosen Körper in seinen rätselhaften Bau geschleppt.
Erge edriss – das Haus des Lichts – hatte Harada die ungewöhnliche Heimstatt später genannt.
Hier wurden an dem Todkranken unzähligen Riten und Zaubereien vollzogen, während sein Geist unentwegt zwischen Bewusstsein und Ohnmacht hin und her wanderte. Sogar für diesen mächtigen Beschwörer schien es nicht leicht gewesen zu sein, den von der Gorkonenkrankheit zerfressenen Leib zu retten.
Doch Harada genas.
Er erinnerte sich an den ersten Tag, an dem er mit Gewissheit wusste, dass dies nicht seine letzte Reise gewesen sein sollte. Das Ipokûn würde warten müssen. Er hatte sich noch sehr schwach gefühlt, konnte sich aber ein wenig aufsetzen und mit eigenen Händen die warme Schale mit der Suppe halten. Der Magier saß in seiner Zauberwerkstatt nebenan und befahl dem Licht. Bereits in den Tagen zuvor hatte Harada dies inmitten seiner Fieberträume wahrgenommen. Nun, da sich sein Geist größerer Wachsamkeit erfreute, stellte er fest, dass nichts davon eingebildet war.
Harada hatte zuvor noch nie einen Magier getroffen. Zumindest keinen Vertreter dieser gefürchteten Zunft, der diesen Titel auch wirklich verdiente. Denn viele waren lediglich Hochstapler oder Giftmischer.
Während Harada hungrig die Suppe schlürfte, beobachtete er den seltsamen Mann, dessen Fingerspitzen Licht bewegen und gestalten konnten. Der Zauberkundige Erschuf rätselhafte Bilder und brachte sie wieder zum Verschwinden. Der einsame Herr der Insel war viel jünger als Harada, kaum vierzig Jahre alt. Sein Haar war kurz und schlecht geschnitten. Eitelkeit schien ihm fremd zu sein, denn seine Kleidung war schmutzig und alt. Harada hatte angenommen, ein so mächtiger Hexer würde einen goldbestickten Umhang tragen, oder wenigstens einen eindrucksvollen Hut. Zwar war seine Kleidung an manchen Stellen mit unbekannten Zeichen und Symbolen bedeckt, die vermutlich einen Schutzzauber darstellten, doch das einteilige blaugraue Gewand ohne Saum und Kragen war überall mit Nadel und Faden ungelenk ausgebessert. Es wirkte eher ärmlich und eines Zauberers unwürdig.
Mochte das Erscheinungsbild des Magiers auch wenig beeindruckend sein, das Haus des Lichts war es in jeder Hinsicht. Es gab Harada unzählige Rätsel auf und offenbarte ihm viele wundersame Dinge, die allesamt belegten, dass dieser merkwürdige Mann eben kein Hochstapler war.
‚Er erweckt dasKalidôrzum Leben‘, hatte Harada gedacht.
An diesem Tag richtete der Kenseti-Meister seine ersten Worte an den Magier. „So kannst du die Krankheit heilen.“ Haradas Worte klangen, als hätten sie bereits eine längere Unterhaltung geführt.
Der Magier blickte von seinem schimmernden Zauberwerkzeug hoch und lächelte. „Es geht dir besser. Gut! Du hast zum Glück einen starken Leib. Ein anderer wäre unter meinen Händen verstorben.“ Er klang, als wäre er selbst von seinem Erfolg überrascht.
„Könntest du auch den anderen helfen? Viele leiden an dieser Krankheit.“
Der Magier lächelte noch immer, doch er strich verunsichert über sein kurzes Haar. „Ich habe keinen Umgang mit den Völkern des Südens.“
Harada schwieg. Er bohrte nicht weiter nach. Zumindest nicht an diesem ersten Tag seiner Genesung. Er war noch zu schwach und das Sprechen hatte ihn ohnehin ermüdet. Der Zauberer hatte sicherlich seine Gründe, sich von den manchmal so tollwütigen Völkern Neroês fernzuhalten. Es gereichte ihm zur Ehre, dass er nicht in ihrer Mitte lebte und mit seinen Zaubersprüchen Reichtümer und Macht anhäufte.
In den darauffolgenden Wochen kehrten die Kräfte des alten Kenseti-Kämpfers zurück und er begann seine langen Spaziergänge entlang des Kieselstrands. Er war nun ein dem Tod entronnener Mann, dessen Gesundheit sich jeden Tag besserte. Sein Leben, sein gesamtes Dasein entsprach einer unbeschriebenen Schriftrolle.
Harada saß auf einem Felsen und blickte nachdenklich auf das wogende Meer. Er war noch immer überwältigt von diesem Geschenk des Lebens und er spürte, dass er nun eine Verpflichtung hatte, dieses Geschenk an andere weiterzugeben. Er wollte den Zauberer dafür gewinnen, seinen Landsleuten im Kampf gegen die entsetzliche Seuche zu helfen. Aber er wusste auch, dass er seinen Retter dazu nicht drängen konnte. Der Magier musste selbst erkennen, dass Haradas Ankunft auf dieser eisigen Insel ein Wink höherer Mächte war.
Früher oder später würde er ihn zu den Menschen führen, auf dass er den Leidenden half. Doch um ihn zu überzeugen, musste Harada mehr von seiner Welt verstehen. Und das würde Zeit und Geduld erfordern.
Kemis Heimkehr
Kendaré / Sibelin
Bereits am Vormittag vereinte sich ihr Weg mit der Straße aus Schigma Levan. Auf dieser zerfurchten, stark befahrenen Straße holperten die Rohstoffkarawanen aus dem Süden. Händler beförderten Zinn, Kupfer und Silber aus der Beyul-Ebene nach Monas Lei. Und Kohle. Nirgendwo in Kendaré wurde so viel Kohle gebraucht, wie in Monas Lei, wo die Feuer Tag und Nacht brannten, wo Gießer und Schmiede mit ihren hitzeerprobten Armen das Eisen schmolzen und den Stahl härteten. Neroês Durst nach Metall war unersättlich.
Monas Lei galt als der eiserne Arm des Reiches Kendaré. Die Stadt hüllte sich tagtäglich in beißende Rauchwolken, die, einem schwarzen Schleier gleich, die Sterne verdeckten. Die Hüttenstadt lag eingebettet in ein flaches Tal und ein Reisender aus dem Süden erreichte zuerst eine flache Anhöhe. Von dort sah Monas Lei aus wie ein riesiger, schmutziger Hufabdruck auf einem überschneiten Weg. Die Straßen muteten schäbig und speckig an. Obwohl letzte Nacht Schnee gefallen war, konnte doch keine Flocke die schwarzen Dächer dieser Stadt erreichen. Die Hitze und der Rauch sorgten dafür.
Zur rechten Hand konnte man die Straße zu den Bergwerken sehen. Gleichmütige Kaltblutpferde zogen hier in langer Reihe große Holzwagen mit eisenhaltigem Gestein zu den Öfen am Stadtrand.
„Ich habe noch nie so große Karren gesehen“, flüsterte Kemi. „Der eine hat sogar acht Räder.“
„Arme Pferde“, meinte Airo nur.
Kemi hatte die letzten Jahre in der größten Stadt der Welt verbracht und hektische Schreie und das endlose Knarzen von eisenbeschlagenen Holzrädern auf Kiesel und Schotter waren ihr nicht fremd. Doch Airo lebte im Wald und seine einzigen Freunde waren die Pferde. Monas Lei musste ihm wie ein wahrhaft verfluchter Ort erscheinen, an dem das Leben nicht lebenswert war.
„Was nun?“, wollte Kemi wissen. „Diese Stadt macht mir Angst, aber sie wird uns ein gutes Versteck sein.“
Airo schüttelte den Kopf. „Sie lassen hier auch Mörder und Sträflinge arbeiten. Verräter laden das Eisenerz ab und Diebe müssen das Feuer anfachen. Wir wären dort nicht sicher“, erklärte er entschieden. „Doch unsere Verfolger sind aus dem gleichen Holz geschnitzt. Bedenke nur, wie groß ihre Versuchung sein wird haltzumachen.“
„Sie werden annehmen, dass auch wir nicht widerstehen konnten, uns eine Weile aufzuwärmen“, fuhr Kemi fort.
„Sie sind durstig nach Wein und nach den Armen einer Hure. Monas Lei hat genug von beidem.“
Kemis Arme schlangen sich fester um Airos Bauch.
„Siehe dort, im Norden hinter der Stadt“, sagte er und zeigte in die Ferne. „Der Berg mit den vier Gipfeln – die Vier Schwestern.“
Kemis Blick folgte seinem ausgestreckten Arm und sie erkannte trotz schlechter Sicht die Umrisse eines Bergmassivs. „Tiua menmei!“, rief sie. „Ich kenne den Berg aus meiner Kindheit!“
„Dort ist der An-ji-Pai, ein Pass umgeben von scharfkantigen Felsen und dunklen Schluchten. Wenn wir ihn überquert haben, sind wir in Sibelin.“
„Lass uns weiterreiten, Airo“, flüsterte sie. „Moli ist unruhig, denn sie riecht den Schweiß der geschundenen Pferde. Sie spürt das Verderben an diesem Ort.“
Airo wendete die Stute und eiligst bogen sie in einen verschneiten, schmalen Pfad ein, der oberhalb um die Talsenke von Monas Lei herumführte.
Kemi und Airo mochten unterschiedlicher Herkunft sein und ungleiche Muttersprachen haben, doch sie beide beteten nun zu Arkron, den manche auch den Gott der Gerechtigkeit nennen, auf dass ihre Verfolger ihrer menschlichen Schwäche unterlägen und der Verführung der schmutzigen Stadt nachgeben würden. Kemi gönnte ihnen aus vollem Herzen eine Pause und stellte sich geradezu vor, wie diese groben, verschlagenen Männer die nächste Runde Wein bestellten und flanierende Huren an den Hüften packten, um sie lachend zu sich zu ziehen. Die beiden jungen Leute dagegen preschten dahin, gegen einen eisigen Wind, der Tränen im Gesicht gefrieren ließ und auf den Wangen schmerzte.
Moli, dieses wundersame Pferd, zeigte erste Anzeichen einer Erschöpfung. Sie schüttelte ihren Kopf, als wollte sie einen Albtraum verscheuchen und Airo spürte, wie die Hufe weniger sicher ihren Weg an Steinbrocken vorbeifanden. Zugleich musste er sie immer wieder bremsen, da sie sich unnötig verausgabte. Es schien, als sehnte auch die Stute das Ziel herbei. Als spürte sie, dass ein Ende ihrer Flucht in Sicht war.
Als am Nachmittag das Licht vom ausdruckslos grauen Himmel zu schwinden begann, erreichten sie den Bergpass unter den Vier Schwestern. Der An-ji-Pai war ein karger Ort ohne Bäume. Jemand hatte einige der Felsbrocken beiseite geräumt und eine Hütte gebaut, die vermutlich als Grenzposten gedient hatte. Nun war das Dach eingestürzt und die Wände halb zerfallen. Es war eine triste Stätte und weder in Kemi noch in Airo kam Euphorie auf.
„Sieh nach oben!“, rief Kemi und klopfte Airo auf den Rücken. Im schwindenden Tageslicht zeichneten sich undeutliche Umrisse im Felsmassiv ab.
„Was ist das?“, wunderte sich der Junge, während Moli schwer schnaufte und ihr Atem sich in Dampfschwaden auflöste.
„Eine Erinnerung an die Könige von Eskalion, die einst all diese Länder beherrschten“, erklärte Kemi. „Kwantar und Sibelin waren lange im Krieg miteinander, doch Eskalion machte sie beide zu ihren Lehen und hier wurde der Frieden besiegelt.“
„Ich wünschte, es wäre heller“, meinte Airo, während er mit dem Kopf im Nacken und mit zusammengekniffenen Augen etwas zu erkennen versuchte.
Vor langer Zeit hatten die Bewohner dieser Region eine riesige Gestalt in den Berghang geschlagen. Ein Relief, das sich aus dem Felsen zu erheben schien. Sturm, Frost und Hitze hatten Jahrhunderte lang dazu beigetragen, den Stein zu schleifen – und doch ließen sich noch immer Schultern und Kopf erkennen und eine mächtige Brust darunter, die seit Generationen gegen den kalten Ostwind aufbegehrte.
„Du hast es geschafft, Airo“, flüsterte Kemi schließlich. „Ich kenne jemanden in Arkat Andoriam. Moli kann dort ganze Wochen rasten und sich den Bauch vollfressen.“
„Wir sind noch nicht am Ziel“, erwiderte Airo und wendete das Pferd. Sie blickten zurück auf den sich zwischen den Vier Schwestern schlängelnden Pfad, den sie gerade zurückgelegt hatten. Trotz der Dämmerung erkannten sie die heranstürmenden Reiter. Von hier aus sahen sie wie ein Rudel Wölfe aus, die eine Blutfährte aufgenommen hatten. Es schien sie nicht mehr zu stören, ob die Pferde unter ihnen an Erschöpfung starben.
„Sie haben in den letzten drei Tagen mindestens zwei Mal die Tiere gewechselt“, rief Airo wütend. Er trieb die geplagte Stute an. Sie überquerten das öde Felsplateau und folgten auf der Nordseite der Bergformation wieder dem Pfad. Er zog sich in langengezogenen Kehren kreuz und quer über den breiten Berghang und endete unten auf der Straße nach Arkat Andoriam. Kemi und Airo hatten bereits drei Viertel des Hangs hinter sich gelassen, als plötzlich das Geräusch von fallenden Felsbrocken und Geröll sie erreichte.
Airo sah hoch. Einer der Reiter war aus der Gruppe ausgebrochen und trieb sein Pferd direkt über das Geröllfeld. Es knickte ein und der Verfolger überschlug sich, doch er klammerte sich an die Zügel und kletterte wütend wieder in den Sattel.
Als Beskasch schließlich auf ihrer Höhe den Pfad erreichte, hatte er ihnen durch sein Manöver den Weg abgeschnitten. Er schrie sein Pferd an und trat es zornig mit den Fersen. Im schwindenden Abendlicht konnten sie seine Gesichtszüge nicht mehr erkennen, aber es schien ihnen, als ob seine Augen geradezu glühten.
Airo zog Molis Zügel nach rechts, so dass sie sich quer zum Bergpfad stellte. Es sah aus, als ob der Verfolger durch sie hindurchreiten würde. Starr zitternd umklammerte Kemi Airos Oberkörper und schloss die Augen. Ihr Herz überschlug sich vor Furcht.
Der junge Pferdezüchter riss behände seinen Bogen aus der Sattelhalterung und spannte einen Pfeil ein. Er schoss ihn sogleich ab. Kemi hatte nie zuvor erlebt, dass er das Pferd mit harten Fersen gelenkt hatte, doch nun sprang die Stute in den steilen Hang hinein und kam ganze drei Schritte hoch, bevor das Geröll unter ihren Hufen wegrutschte. Sie kippten alle drei zur Seite, aber der Hang war zu steil, um hier von einem Fall zu sprechen. Die Stute trat mehrmals ins Leere, fand jedoch im Rutschen wieder Halt. Airo neigte sich zur anderen Seite und unterstützte so das strauchelnde Tier. Sie achteten kaum auf den vorbeirasenden Beskasch, dessen tiefer Schrei an das Grölen eines verwundeten Bären erinnerte. Kleine Kieselsteine, abgeschlagen durch die Hufen seines schwarzen Hengstes prasselten ihnen ins Gesicht. Für einen kurzen Augenblick spürten sie die Hitze des fremden Pferdes und den versprühten Schaum aus seinem Maul.
Airo hatte die Stute sogleich wieder unter Kontrolle und sie ritten hastig zur letzten Kurve vor der deutlich breiteren Hauptstraße. Auf ebener Fläche hätten die Verfolger erneut keine Chance mehr, mit dem schnellsten Pferd dieses Landes Schritt zu halten.
Sie hörten Beskaschs Fluchen hinter ihnen. Er schien fieberhaft sein Ross zu wenden. Er schrie vor Schmerzen. Der Pfeil hatte ihn getroffen. Airo konnte nur nicht sehen, wohin.
Als sie endlich die Straße erreichten und der kalte Wind sie erneut in seine Armee nahm, schöpften sie neue Hoffnung. Die Schleife, mit der Kemi die wärmende Decke um ihre Schultern befestigt hatte, löste sich. Wie eine vom Wind weggerissene Fahne wurde sie von einer Böe erfasst und verschwand im Dunkeln.
Sie ritten durch die Finsternis, auf Molis Gespür vertrauend und wagten es nicht, über ihre Schultern zu blicken. Wie lange würde die Stute noch durchhalten, fragte sich Airo. Ihre Verfolger saßen offensichtlich auf frischen Pferden. Es war ein ungleicher Wettlauf auf Leben und Tod.
Airo tätschelte den Hals der Stute. „Noch ein wenig, Moli“, murmelte er. „Noch ein wenig, meine treue Moli!“
Und da auf einmal, als wären ihre Gebete zu Arkron erhört worden, erblickten sie vier kleine Lichter vor ihnen. Sie flackerten durch die Äste und Büsche. Airo stemmte sich in die Steigbügel, neigte sich vor und hob sich eine Handbreit aus dem Sattel.
„Lasse mich mit ihnen reden“, rief Kemi mit brüchiger Stimme über seine Schulter. „Du hast genug getan …“
Airo bremste schließlich die schnaufende Stute, und schon waren sie umgeben von vier uniformierten Soldaten auf Pferden.
„Gute Männer von Sibelin, helft uns!“, sagte Kemi auf Kwantarisch. „Ich bin eine Tochter von Arkat und die Männer hinter uns sind Meuchelmörder aus Denroen Tai.“
Die vier starrten sie überrascht an. Doch dann fasste sich ihr Anführer. Er ritt zu dem nächstbesten Baum, klemmte seine Fackel in eine enge Astgabelung und zog sein Schwert. „Bleibt hinter uns“, sagte er knapp, während seine Gefährten es ihm gleichtaten. Inzwischen konnten auch sie das Geräusch der Hufe aus der Dunkelheit hören. „Son-ho! – Ruhig bleiben!“, rief der Hauptmann, während sich die vier Reiter nebeneinander ordneten.
Kemi kreischte auf, als sie den Speer erblickte, der plötzlich aus dem Rücken des Soldaten herauswuchs. Airo erfasste sofort die Lage und riss die Zügel zur Seite. Er trieb Moli voran, während hinter ihnen ein Kampf ausbrach. Ihre Verfolger schienen wie eine Erdbebenwoge zu sein. Je länger sie andauerte, um so mehr an Wut und Kraft nahm sie auf und es schien nichts zu geben, das sie bremsen konnte.
Doch die tapfere Stute hatte keine Geschenke mehr zu vergeben. Benommen und ausgelaugt stolperte sie vor sich hin und schien kaum den Kopf hochhalten zu können. ‚Wir sind verloren‘, dachte Airo. Die Schritte des Pferdes verlangsamten sich, bis schließlich zum ersten Mal sein Vorderfuß einknickte.
Zur selben Zeit, gänzlich unerwartet, brachen die Wolken auf. Der Stille Mahner befand sich beinahe im Vollmond und flutete zusammen mit der Schlange des Lichts das Gebiet mit seinem silbernen, sanften Licht. Es mutete wie ein Wunder an. Als ob nun Gatmon, der Gott des Wetters und der Wolken seine Würfel ebenfalls ins Spiel warf.
Sie befanden sich vor einer breiten Schlucht, tief unten murmelte unsichtbar ein Fluss. Eine lange Hängebrücke führte darüber. Auf der anderen Seite erhob sich ein schroffer Berg, der die Straße zu einem Umweg zwang. Der linke Berghang schien in der Nacht zu glühen.
„Dahinter ist die Stadt“, rief Kemi. „Arkat Andoriam ist auf der anderen Seite. Ich kann das Meer schmecken!“
Airo blickte besorgt über die Schulter. „Steig ab!“, befahl er. „Ich möchte, dass du auf die andere Seite rennst.“
Sie rutschten eilig aus dem Sattel. Kemi blickte ihn mit weit aufgerissenen Augen an. „Du musst mit mir kommen!“
„Wir werden es nicht schaffen, Kemi“, schrie Airo. Hektisch löste er die Schnallen an den Sattelgurten. Bald schon zerrte er alles von Molis Rücken und küsste sie auf den Hals. „Lauf, Moli, lauf!“ Er schlug ihr auf die Hüften. Doch das erschöpfte Pferd trabte nur einige Schritte und blieb mit gesenktem Kopf stehen.
„Du musst über die Brücke, Kemi!“, rief Airo erneut, während er den Pfeilköcher auf seinen Rücken warf. Er riss seinen Dolch aus dem Gürtel und reichte ihn der Sibelinerin. „Schneide auf der anderen Seite die Seile der Brücke durch. Ich kann dir Zeit verschaffen!“
„Ich gehe nicht ohne dich rüber!“, flehte sie ihn weinend an.
„Und ich gehe nicht ohne mein Pferd“, erwiderte Airo und riss einen Pfeil aus dem Köcher. Einen Atemzug später zischte das Geschoss durch die Dunkelheit.
Auch Tarams Männer hatten nun fast die Hängebrücke erreicht. Sie hielten noch immer die Schwerter in der Hand. Das Blut auf den Klingen sah im Mondlicht schwarz aus.
Kemi wandte sich ab und rannte. Weder die Tiefe unter ihr noch das unruhige Schwanken der Bretter unter ihren Füßen wurde ihr bewusst. Sie rannte und rannte, den Dolch noch immer in der Hand.
„Ich will das verdammte Pferd!“, rief Taram und sprang aus dem Sattel. Er hastete ebenfalls auf die Brücke.
Beskasch Pferd stolperte und überschlug sich beinahe. Der Reiter wurde aus dem Sattel geschleudert, kam jedoch inmitten der Bewegung wieder auf die Beine und schlug Airo den Bogen aus der Hand. Seine Verletzung machte ihn ungenau und unbeherrscht. Er holte aus, um sein Schwert in die Brust des Jungen zu rammen, doch Airo verlor den Halt und strauchelte rückwärts. Von einem Augenblick auf den nächsten war er verschwunden.
„Was zum …!“ Beskasch starrte überrascht auf den Abgrund, enttäuscht darüber, dass er den Übeltäter, der ihm einen Pfeil in die Schulter geschossen hatte, nicht eigenhändig töten konnte. Ein abgebrochener Stumpf ragte noch immer wie ein hölzerner Finger aus seinem Fleisch.
Auf der anderen Seite der Brücke blieb Kemi für einen Augenblick stehen. Sie musterte ratlos die Verankerungen der Hängebrücke, erkennend, dass sie keine Zeit mehr hatte und niemals rechtzeitig all die dicken Seile würde durchschneiden können. Ergriffen von Panik rannte sie, ihre nackten Füße wurden von scharfen Kieselsteinen aufgerissen, die Straße nach Arkat Andoriam entlang. Der Berghang war dicht mit kleinen Bäumen und Gebüschen bewachsen. Kemi stürzte sich in das Dickicht. Nach wenigen Schritten stolperte sie über etwas und spürte einen stechenden Schmerz an ihrem Bauch. Sie hatte sich mit dem Dolch verletzt und ihn zugleich verloren. Schluchzend kämpfte sie sich auf die Beine und lief strauchelnd und taumelnd weiter durch die Finsternis. Tränen liefen über ihre schmutzigen Wangen, sie wurde von Zweigen gepeitscht.
Als sie schließlich aus dem Waldstück wieder herausbrach, stockte sie für einen Augenblick. Sie starrte wie betäubt auf Arkat Andoriam, ihre Geburtsstadt. Die Türme waren mit unzähligen Feuern beleuchtet und der Palast des Fürsten Andor erschien ihr wie der schönste Anblick ihres Lebens. Der Mond spiegelte sich schimmernd in dem kalten Terime-Meer, während ein Schiff seine Lichtstrahlen durchkreuzte.
Ein dumpfer Schlag traf sie von der Seite. Benommen kämpfte sie sich auf alle vier hoch. Sie spürte die kalte Walderde in ihren verkrampften Händen. Doch dann ereilte sie ein Tritt in den Bauch, als wäre sie von einem Baumstamm getroffen und sie überschlug sich. Erschöpft blieb sie auf dem Rücken liegen, während die Dämonen sich über sie neigten und die Götter sich machtlos abwandten.
Taram stand abseits, während Beskasch und die Männer sich auf das Mädchen stürzten. Er hatte die Männer allen Widrigkeiten zum Trotz im Zaum gehalten. Aber nun waren sie nicht mehr seine Männer. Sie waren wilde Tiere, voller Zorn und Hunger. Bestien, die erst dann wieder zu Menschen wurden, wenn ihre Tollwut herausgeschwitzt war. Verhärtet und doch ein wenig erschrocken über die Grausamkeit seiner Bande, trat Taram einige unsichere Schritte zurück und beobachtete das gespenstische Geschehen im Mondschein.
Abseits zu stehen, war der Preis, den er dafür zahlte, sie die restlichen Tage für seine Schmutzarbeit zu benutzen. Und deshalb musste er sie in diesem Augenblick gewähren lassen, ungeachtet dessen, welche unmenschliche Abscheulichkeit ihre tierischen Gemüter hervorbringen würden.
Ihr Körper war schlaff und regungslos. Ihr Blick war in eine unsichtbare Ferne gerichtet, den Kopf zur Seite gedreht, während die Männer sich in ihrem Schoß abwechselten.
Beskasch schnürte seine Hose wieder zu und ohne sich damit aufzuhalten, sie zuerst zu töten, griff er nach seinem Schwert und schlug ihr den Unterarm ab.
„Hey!“, fauchte der junge Kilkawân, der gerade in den sich windenden Körper eingedrungen war und nun von einer Fontäne aus Blut getroffen wurde. „Kannst du nicht warten, bis ich fertig bin?“
Beskasch beachtete seinen Zögling nicht und brachte den abgetrennten Unterarm zu seinem Anführer. Seine Augen schienen aus ihren Höhlen zu quellen. „Hier ist ihre beschissene Hand! Können wir jetzt nach Hause gehen?!“, brüllte er.
Taram griff schweigsam nach dem blutigen Stumpf, sagte jedoch nichts. Er fühlte, dass seine Männer noch nicht gänzlich befriedigt waren. Noch immer konnte sich ihre Tollwut auch gegen ihn wenden.
Plötzlich raschelte es im Gebüsch. Beskasch und Taram fuhren herum, doch da war die vertraute Silhouette des beleibten Jagu.
„Du kommst wie immer zu spät“, sprach Taram leise.
Der verschwitzte Mann kam keuchend angelaufen und musterte die nackte Kemi, die auf dem blutgetränkten Gras lag.
„Ihr habt nicht gewartet!“, rief er vorwurfsvoll.
„Sie ist ja noch nicht tot, du fette Kröte“, fauchte Sintarek und stieß ihn in Kemis Richtung.
Jagu warf sich auf den nackten, geschundenen Körper, den blutenden Armstumpf ignorierend. Kilkawân, der danebenstand und sich seine Hose wieder zuband, brach in ein fieberhaftes Gelächter aus. Mit gerunzelter Stirn beobachtete Taram den nackten Hintern von Jagu, der im Mondlicht wie ein riesiger Kürbis aussah.
Unerwartet geriet plötzlich Leben in den nackten Körper. Kemi kreischte auf. Ohne Vorderzähne und mit blutendem Zahnfleisch erschien ihr weitaufgerissener Mund, als wäre sie eine finstere Kreatur aus den Tiefen der Erde. Sie riss brüllend Jagu den Dolch von seinem Gürtel und stieß ihn unaufhörlich in seinen Hals. Noch mehr Blut spritzte über den Schauplatz, während Jagu sich mit der Pluderhose zwischen seinen Knien abrollte und mit einem gurgelnden Röcheln beide Hände gegen seinen Hals presste. Das Blut entwich zwischen seinen Fingern und rann unaufhaltsam entlang seiner Unterarme.
Eine neue Welle der Wut durchfuhr die Männer. Beskasch hielt sich die Fäuste vor den Magen und schrie kurz wütend dem Himmel entgegen, als würde er die Götter anklagen. „Zeit, diese ganze Scheiße zum Ende zu führen!“, fauchte er. Ohne das Blut zu beachten, warf er sich auf Kemi und versuchte, ihren Arm zu packen und ihr den Dolch zu entreißen. Die Klinge drang durch seine Handfläche. Ein langer kehliger Schrei entwich seiner Kehle. Endlich gelang es ihm, seine Hand zu befreien und der besinnungslos um sich schlagenden Kemi das Messer abzunehmen. Den stechenden Schmerz übergehend, legte sich Beskasch mit seinem Körpergewicht auf den zuckenden und sich heftig windenden Leib und presste die blutende Linke gegen ihre Kehle. Mit der Rechten stach er unentwegt zwischen ihre Rippen, so lange, bis die Bewegungen nachließen und ihr unmenschlich anmutendes Kreischen langsam in einem rauen Gurgeln erstarb.
Sintarek hatte sich währenddessen ins Gebüsch gestürzt und kehrte mit einem langen Ast zurück. Beskasch riss ihm das armdicke Holz aus der Hand und stieß den hageren Mann in Kemis Richtung.
Sie schien noch bei Bewusstsein zu sein. Ihr Kopf kippte zur Seite. Sie schien regungslos auf die nächtliche Stadt zu blicken, die hier auf diesem Berghang so nah wirkte, als könnte man sie mit gestrecktem Arm berühren.
Taram wandte sich ab. Er hob einen Fetzen vom Boden auf, den seine Männer zuvor von Kemis Leib heruntergerissen hatten, und wickelte die abgehackte Hand darin ein. Dann schritt er langsam zur Straße, um auf der anderen Seite der Schlucht nach diesem wundersamen Pferd zu suchen.
Arkat Andorjam
Sibelin
Unweit von ihnen schrien Krähen auf, als wollten sie Zeugnis ablegen. Die Männer stiegen von ihren Pferden ab. Der Morgennebel lichtete sich bereits. Es war windstill und jeglicher Schall klang befremdlich rau.
„Es ist da oben“, durchbrach einer der Bauern die trockene Stille, während Fürst Andor nachdenklich über leicht verschneite Gräser und Felsbrocken den Hang hochstieg. Er trug schwarze Stiefel, die nun mit jedem Schritt schmutziger wurden. Sein langer, dunkelblauer Umhang war mit Stickereien aus silberfarbenen Fäden verziert und seine Brust wurde geschmückt von dem Wappen von Sibelin: ein Adler mit ausgebreiteten Schwingen.
„Wer tut etwas so Abscheuliches?“, flüsterte Hofmarschall Koltok und starrte mit aschfahler Miene auf den Pfahl. Im Palast nannten ihn einige „Koltok den Blassen“ – doch hier, an diesem tristen Morgen schien seine Haut geradezu aus Kreide zu bestehen.
Viele waren mitgegangen. Die Wachhabenden und die Würdenträger. Sogar der Hafenmeister kam herbeigeeilt. Sie waren in Pelzmäntel und Umhänge gehüllt und fröstelten trotzdem in der Kälte. Der frische Schnee knirschte unter ihren Schuhen. Einige hielten Taschentücher vor den Mund, unvorbereitet auf diesen traurigen Anblick.
„Seit dem Krieg niemand“, erwiderte der Fürst und trat näher. Er kniete sich neben den geschundenen Leib und fegte langsam den frischen Schnee von den blutleeren Wangen. Dann griff er zaghaft nach dem Holz, das eine einzelne Männerhand nicht umklammern konnte. Er wandte seinen Blick ab und verzog leicht das Gesicht, während er es mit beiden Händen entfernte und fortwarf.
Die Edelleute starrten einige Atemzüge lang den Pfahl an, beschämt, sich gegenseitig anzublicken. Das Holz rollte noch eine Weile dumpf den Hang herab und blieb schließlich liegen, nur drei Schritte von den Stiefeln von Hafenmeister Wangdula entfernt.
Sie alle sahen nun zurück zu Andor. Ihre Mienen verrieten eine Mischung aus Entsetzen über ein Verbrechen, das direkt vor ihrer Tür geschah und Bewunderung für die Gefasstheit ihres Fürsten.
Andor zog das zerrissene Unterhemd des Mädchens herab und bedeckte so ihren Unterleib. Dann stand der Fürst wieder auf und löste langsam die Schnalle auf seiner Schulter. Er nahm den kostbaren Umhang ab und legte ihn über die Tote.
„Weshalb haben sie ihre Hand abgetrennt?“, fragte Wangdula und kratzte sich nachdenklich hinter dem Ohr.
„Vielleicht war sie eine Diebin und jemand wollte sie bestrafen“, überlegte Jarimon.
„Oder vollbrachte Arbeit belegen und so den versprochenen Lohn erhalten“, erwiderte Andor leise, ohne den Fragenden anzusehen.
Jarimon stellte sich neben ihm. Der Truchsess von Sibelin war einen Kopf kleiner als der hochgewachsene Fürst und so musste er zu ihm hochblicken. „Wie sollte man ein Opfer an der Beschaffenheit seiner Hände erkennen, Andor?“
Einige der Männer hoben überrascht die Augenbrauen. Wie alle redete Jarimon den Herrscher nur mit „Hoheit“ oder „Mein Fürst“ an. Dass die alten Freunde, beide in ihren Vierzigern, sich hinter verschlossenen Türen beim Namen ansprachen, konnten sich viele denken, doch es war nichts, das der Hofstaat allzu oft bezeugen konnte.
Der Fürst ging behutsam um die Leiche herum und kniete sich erneut hin. Er nahm das starre Handgelenk der Toten und wischte den Schnee, den Schlamm und das Blut hinweg. Er deutete auf die Zeichnung auf dem Handrücken. „Das Opfer war eine von uns, mit Mai-Har-Do auf den Handrücken. Doch sie lebte in einer Welt, in der dies auffiel und somit zur Erkennung ausreicht.“
„Die Täter wären also keine Sibeliner“, sagte Jarimon.
„Zumindest kann man das über die Auftraggeber sagen, falls die abgetrennte Hand als Beweis der vollführten Aufgabe gelten soll“, erklärte Andor.
„Sie könnte eine Dirne gewesen sein“, meinte Wangdula und verschränkte zufrieden über seinen Gedanken die Hände auf dem Bauch. Als Hafenmeister war er so einiges gewohnt und nahm den entsetzlichen Anblick leichter als die Aristokraten. „Monas Lei ist nur anderthalb Tage entfernt. Ihr Zuhälter ist ihr bis hierher gefolgt und hat sie getötet. Dabei verlor er selbst das Leben.“
„Wenn sie eine Hure ist, hat sie vermutlich in deinem Hafen gearbeitet“, erwiderte Jarimon und warf einen kurzen Blick auf das graue Terime-Meer, das sich hinter der Stadt ausbreitete.
Der Fürst trat einige Schritte zurück von diesem grausigen Schauplatz und schob den Schnee zur Verwunderung der anderen mit dem Handschuh und dem Stiefel in einem großen Kreis um die Leiche beiseite. Die anderen beobachteten ihn gebannt. Nur Jarimon schien zu begreifen und tat dasselbe, nur in die andere Richtung. Der ungenaue Kreis aus Matschschnee und nasser Erde wurde nie fertig, denn Jarimon unterbrach jäh das Tun seines Fürsten.
„Hier!“, rief er. „Ich denke, das ist, was du suchst.“
Andor trat an seine Seite und ging in die Hocke. Er fegte weiter Schnee beiseite.