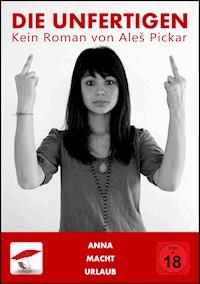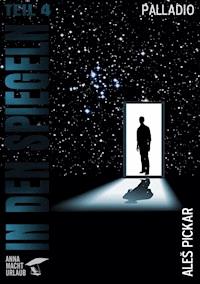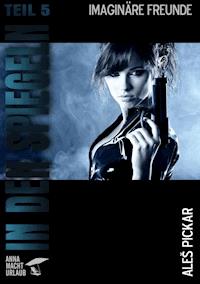7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Periplaneta
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Unter dem gebrochenen Glanz des Stillen Mahners am Firmament dräut großes Unheil. Denn die Peleori schlagen die Kriegstrommeln – was niemand so recht ernst nehmen will. Das Volk vergnügt sich weiterhin sorglos in Arenen und Freudenhäusern, nur ein zierliches Mädchen, dem die Göttin Niobe erschienen ist, predigt Enthaltsamkeit. Die eigensinnige Prinzessin Linederion trifft nach langer Reise auf ihren Bräutigam, allerdings ist der Herrscher des Ostreichs anders als erwartet. Währenddessen treibt Tausende Meilen entfernt die Schwägerin des Königs Belkar ihre umstürzlerischen Pläne voran. Doch alle Mächtigen des rauen Kontinents Neroê entsenden in diesen Zeiten heimlich Spitzel, Assassine und Legaten. Wer kann es da wagen, zwischen ehrlicher Hingabe und eilfertiger Dienstbeflissenheit, zwischen Freund und Feind zu unterscheiden ... Aleš Pickar erschafft mit KALION ein facettenreiches, geheimnisvolles und vor allem düsteres Epos. Die dunkle Wunde ist der zweite Teil einer Reise in eine rätselhafte und raue Welt und ein spannender Roman, der mit den Normen des High-Fantasy-Genres bricht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 530
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
periplaneta
Serantuma´ra, ridatuma´ra Kondiuma dan deri´kardum. Sarmatuma mon schatê, Kwittauma brisk schatê Saretuma duk astarîm-tika
Dein ist der Wald und dein ist das Schilf,
An dem dein Pferd beherzt trinkt.
Dein Bogen ist stark, Dein Pfeil ist schnell,
Dein Herz schlägt für die Getreuen.
Hymne an Niobe
ALEš PICKAR: „KALION. Die dunkle Wunde – 2“ 1. Auflage, Juni 2017, Periplaneta Berlin, Edition Drachenfliege
© 2017 Periplaneta - Verlag und Mediengruppe Inh. Marion Alexa Müller, Bornholmer Str. 81a, 10439 Berlin www.periplaneta.com
Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, Übersetzung, Vortrag und Übertragung, Vertonung, Verfilmung, Vervielfältigung, Digitalisierung, kommerzielle Verwertung des Inhaltes, gleich welcher Art, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlags.
Die Handlung und alle handelnden Personen sind erfunden. Jegliche Ähnlichkeiten mit realen Personen oder Ereignissen wären rein zufällig.
Projektleitung, Lektorat: Marion Alexa Müller Coverkonzept, Kartografie, Sprache: Aleš Pickar
Grafik, Satz, Layout: Thomas Manegold Schlusskorrektur: Vanessa Franke
Spezial-Schrift: „Ballers“ font designed by Matthew Napolitano, published by Graffiti Fonts
print ISBN: 978-3-95996-042-7 epub ISBN: 978-3-95996-043-4
E-Book-Version: 1.1
Aleš Pickar
KALION
DIE DUNKLE WUNDE
Argul katros
periplaneta
Von greuelichem Untier
In Neroê sind Ungeheuer nicht gänzlich unbekannt. Immer wieder kehren Seeleute und Händler von jenseits der bekannten Welt mit Geschichten über Begegnungen mit furchtbaren Wesen zurück, gegen die kein Schwert und kein Pfeil etwas zu verrichten vermag.
Aber auch die Heimat ist nicht frei von fremdartigen Gefahren. Viele Bewohner von Kendaré entsinnen sich noch der Zeit, als im Südosten die rätselhaften Ghol aus dem Urwald traten und gnadenlos Mensch und Vieh in den umliegenden Dörfern überfielen und zerrissen. Deren blasse, krötengleiche Haut und ihr kalter, ausdrucksloser Blick dürften den Menschen am Aptoloe unvergessen sein.
Erst durch die Ankunft der Reiterei von der Königshöhe, geführt vom jungen König Belkar und seinem kriegerischen Bruder Tarzim, konnte dem greuelichen Plünderungszug der Bestien Einhalt geboten werden. Doch auch heute noch stellen die Ghol für die Händlerkarawanen zwischen Kendaré und Mandalé eine unberechenbare Gefahr dar.
Aus dem Edrion Masakar weiß man von Begegnungen mit einem Ungeheuer, das halb Bär und halb Affe ist und dessen Arme und Krallen so stark sein sollen, dass sie mühelos einen Menschen in zwei Hälften reißen können.
An der Grenze zu den unwirtlichen Takala-Sümpfen nördlich von Kendaré wird von fauchenden Echsen erzählt, die so groß sind, dass man sie nachts leicht mit einem Felshügel verwechseln kann.
Und südlich von Golte soll in einer schwer erreichbaren Höhle der Pangul Sarx, die „Rotklaue“, leben - ein grässlicher Drache, den jeder ximantischer Prinz vor der Thronbesteigung aufsuchen muss. Kehrt er von dieser Reise lebend zurück, darf er die Krone von Ximanté tragen. Außer den Königen des Steppenreiches hat diesen Drachen jedoch noch niemand gesehen.
Auf Demené wurde angeblich ein riesiges Insekt beobachtet, so groß wie ein Pferd, und einer Libelle nicht unähnlich. Während meines Aufenthalts auf der Insel beteuerten unzählige Inselbewohner, eine solche Drachenfliege über der Stadt Kilkara gesichtet und sich vor ihrem lauten Fluggeräusch furchtbar geängstigt zu haben.
Doch nirgendwo begegnen dem Menschen größere und gefährlichere Ungetüme als in der Weite des Ozeans. So berichten Seeleute unabhängig voneinander vom Katilân, einem riesigen Kraken, der größer als ein Segelschiff ist. Seine Arme seien so dick wie Bäume und zerbrächen Schiffsmasten, als wären sie lediglich Essstäbchen. Es wird angenommen, dass es sich bei diesen Monstern der Tiefe um Weibchen handelt, weil sie zumeist mit einer Schar kleinerer, vermutlich männlicher Bestien gesichtet werden. Selbst diese seien groß genug, um einen erwachsenen Menschen zu verschlingen. Wie viele Seeleute fanden bereits so in den Tiefen der See ihren kalten, grässlichen Tod?
Die seltsamste Erzählung, die mir zugetragen wurde, handelte von einer Erscheinung, die man mir als den fliegenden Walfisch beschrieb. Solche stummen Ungetüme sollen weit im Westen, in der Ranah Kelîd gesichtet worden sein. Es ist zwar nicht überliefert, dass jene Ungeheuer, welche den blauen Himmel scheinbar für den Ozean halten, jemals einen Menschen angriffen, doch ihr Auftreten allein scheint Furcht und Schrecken zu verbreiten.
Viele dieser Berichte mögen nur dem prahlerischen Geist von Wichtigtuern entsprungen sein. Aber ich blickte aufrichtigen Zeugen in die Augen und ich hörte im Klang ihrer Stimme, wie sehr diese Erinnerungen sich wie Narben auf ihren Seelen eingezeichnet hatten.
Doch mögen derlei Ungeheuer dem Menschen auch überlegen sein, eine Begegnung mit ihnen bleibt höchst selten. Auf meinen ausgedehnten Reisen, die mich von Mandalé bis nach Argasch geführt haben, hatte ich nur selten Begegnungen mit unbegreiflichen Erscheinungen. Die größte Gefahr eines Reisenden ist noch immer der Mensch.
Aus der Neroantiga („Betrachtungen über Neroê“) von Artos Tamerlan
(Original aufbewahrt in der Bibliothek von Sarangar)
Drughal stehe uns bei
Gorkonai
Sechzehn – sechzehn! Neuer Aufschlag!“, rief der Schiedsrichter. Die Spieler mühten sich wieder auf die Beine, reichten den noch Liegenden die Hände und zogen sich gegenseitig hoch.
Auf den Zuschauerbänken saßen rund fünfzig Leute, die Hände in den weiten Ärmeln ihrer langen Mäntel. Die meisten waren Beamte, die in ihrer Mittagspause hierher kamen, um sich außerhalb der Verwaltungsgebäude über Politik unterhalten zu können. Der elfte Monat war angebrochen, doch das miese Wetter schien niemanden abzuhalten. Sie waren Demenäer und Kälte steckte ihnen im Blut.
Es war nur ein Übungsspiel. Der Wettkampf mit Dakara stand bald an und so waren die Dalmisch-Spieler jeden Tag auf dem Feld. Es wehte ein kühler Wind und es wirbelten sogar ein paar Schneeflocken durch die Haare der Athleten. Doch solange es nicht stürmte, wurde täglich trainiert.
Anfangs ärgerten sich die Älteren darüber, dass die jungen Demenäer so viel Gefallen an diesem gorkonischen Spiel fanden und so wenig Interesse zeigten für die althergebrachten Wettbewerbe, wie dem Geschwindigkeitsholzhacken, dem Ringen oder dem Tauziehen. Doch mit der Zeit entdeckten auch die Alten – wenn auch heimlich – die Freude an Dalmisch. Denn ein gutes Glücksspiel war etwas, dem die Demenäer selten widerstehen konnten.
In der Sklaverei war ihnen der Besitz von Geld verboten gewesen und so fühlte sich für sie eine gute Wette wie ein berauschendes Stück Freiheit an. Nur die etwas zugeknöpften Goru-Schan verurteilten solche Ergötzungen, ohne jedoch gegen sie vorzugehen. Auch nach drei Jahren der Freiheit waren sie noch immer neu für die Demenäer und niemand mochte der erste Miesmacher sein, der begeisterte Menschen in ihre Schranken verwies.
Bei Dalmisch spielten zwei Mannschaften zu je vier Mann. Es gab noch einen neunten Spieler, so dass der Anzahl der Götter entsprochen wurde – doch dieser war unparteiisch. Der Schaanti hatte innerhalb des Spiels die Wahl, sich wechselseitig für eine Mannschaft zu entscheiden und auf diese Weise den Ausgang des Spiels zu beeinflussen. Jede Runde begann damit, dass der Unparteiische den Ball in einem möglichst hohen Bogen in das Spielfeld katapultierte. Da die Art des Einwurfs im Regelwerk nicht beschrieben war, benutzte ein geübter Schaanti vorzugsweise den Fuß. Während die Lederkugel über die Köpfe flog, brach unter den acht Spielern ein tumultartiger Wettkampf aus. Tritte, Faust- und Ellbogenschläge waren zwar verboten, doch es durfte gedrängelt, gestoßen und gezogen werden. Wer in dieser knappen Zeit den Boden mit etwas anderem berührte als mit seinen Fußsohlen, schied für diese Runde aus und musste liegenbleiben. Kurz bevor der Ball wieder herniederkam, ordneten sich die noch stehenden Spieler auf dem Feld, um ihn auf der Brust oder auf dem Fuß anzunehmen. Von da an durfte ihn der Spieler nur noch einmal mit dem Knie berühren. Der Kniestoß wurde meistens dazu verwendet, den Ball dem Torschützen zuzuspielen, der ihn entweder mit den Handgelenken oder mit dem Fuß annahm und im selben Zug auf das Tor schoss.
Das Tor bestand aus zwei sehr langen Balken, die in den Boden eingelassen waren und sich auf halber Strecke überkreuzten. Dem Torschützen stand es frei, den Ball entweder durch das untere oder das obere Dreieck zu befördern. Für das untere Dreieck gab es einen Punkt, oben dagegen zwei Punkte. Verfehlte man das Tor, oder ließ im Verlauf des Angriffs das Leder zu Boden fallen, galt die Runde als ergebnislos. Der Ball ging dann zurück an den Unparteiischen, der einen neuen Einwurf startete.
Menketes, der Bürgermeister von Kanvä, und Ratsherr Sentel hatten fern aller anderen auf einer leeren Sitzreihe platzgenommen. Der Bürgermeister interessierte sich nicht für Dalmisch. Doch die Wiedereinführung des Spiels in der neuen Gorkonai war eine der Maßnahmen, die Lakriel seit seiner Ernennung zum Verbindungsbeamten zwischen Demenäern und Gorkonen umgesetzt hatte. So ließ sich Menketes gelegentlich bei den Trainingsspielen blicken, um zu zeigen, dass er hinter Lakriel stand. Hinzu kam, dass dies ein idealer Ort war, um sich fern aller Spitzel und Späher in politischen Dingen auszutauschen.
„Der junge Quindan macht einen sehr gefassten Eindruck“, stellte Sentel fest.
Quindan saß am Rande des Spielfelds in einer Loge, die er sich mit Freunden und Schmeichlern teilte und verfolgte gebannt das Spiel. Karvelâns Sohn war nicht nur ein leidenschaftlicher Anhänger des Dalmisch, sondern unterstützte die Mannschaft von Kanvä bereits seit einem Jahr mit Geld und Einfluss, mit dem Ziel, sie zu Landesmeistern zu machen. Ein hehres Versprechen, denn die „Schneeleoparden“ aus Kanvä belegten meist nur den vierten oder fünften Platz. Die Favoriten waren die „Hasen“ aus Edon und die „Vulkane“ aus Dakara. Doch das hatte vor dem Aufstand gegolten und nach dreijähriger Unterbrechung war dies nun die erste Meisterschaft unter der neuen Herrschaft. Alles war somit möglich.
„Für jemanden, der den grausamen Tod seines Vaters ansehen musste?“, erwiderte Menketes. „Jeder geht mit Trauer anders um. Doch wer weiß, was in diesem Wald vorgefallen ist.“
„Zweifelst du seinen Bericht an?“
„Der Junge war stets ein Taugenichts. Als der alte Karvelân noch lebte, fand ich es amüsant, da der Sohn den alten Knochen so schön zur Weißglut treiben konnte.“
„Der Felsbrocken ist hier wirklich weit vom Berg gerollt“, stimmte ihm Sentel zu.
„Ich habe Mühen, auch nur ein Wort von dem zu glauben, was diesem verwöhnten Rüpel über die Lippen kommt.“
„Karvelâns Leibwächter wurden doch getrennt befragt und bestätigten seine Geschichte vollständig“, wunderte sich Sentel.
„Du meinst diese beiden Leibwächter?“ Menketes zeigte auf die andere Seite der Zuschauerränge, wo zwei unrasierte Männer in teuren Pelzmänteln saßen und sich jeweils eine junge Frau gegen den Brustkorb drückten.
„Bei Arkron“, rutschte es Sentel heraus. „Du hast recht.“
Menketes lächelte. „Und ich dachte, dir entgeht gar nichts.“
„In letzter Zeit, so scheint es mir, entgeht mir eine Menge. Auf meinem Tisch stapeln sich die Vorgänge“, klagte Goru Sentel. „Ich komme kaum dazu, auf Einzelheiten zu achten.“
Der Unparteiische hatte inzwischen erneut den Ball in die Luft getreten. Sogleich brach auf dem Spielfeld die übliche Rauferei aus. Als der Ball sich wieder dem staubigen Boden näherte, stand nur noch ein Spieler auf den Beinen. Da er nun keinen Anspielpartner für den Torstoß hatte, erlaubten die Regeln, dass er selbst versuchte zu treffen. Doch hierzu durfte er die Lederkugel nur einmal berühren. Der Spieler sprang in die Luft und riss das Bein hoch. Er trat den Ball blind hinter sich und landete hart auf dem Rücken. Der Ball flog durch das obere Dreieck.
Einige Beamte applaudierten anerkennend.
„Stell doch mehr Gehilfen ein“, riet Menketes.
„Die meisten Berichte sind nur für meine Augen bestimmt“, wandte Sentel ein. „Außerdem ist es nicht einfach, tüchtige Demenäer für Tätigkeiten anzuwerben, die weder mit Schädelspalten noch mit Beischlaf zu tun haben.“
„Dann müssen wir mehr Gorkonen einstellen.“
„Du weißt, was Yukela sagt. Der Aufstand besteht aus zwei Schritten und die Bezwingung der Gorkonen war nur der erste.“
„Ich kenne die Reden, Sentel. Es ohne die Hilfe der einstigen Unterdrücker zu schaffen, ist der zweite Schritt. Doch sollte man wirklich solche Leitsätze über das Wohl der eigenen Leute stellen?“
„Yukela denkt so.“
„Ich denke, es ist manchmal wichtiger, einfach voranzukommen, anstatt auf Grundsätzen zu beharren und dabei auf der Stelle zu treten.“
„Du kannst es Yukela beim nächsten Treffen der Goru-Schan erzählen“, sagte Sentel und erlaubte sich ein seltenes Lächeln.
„Gatmon behüte“, brummte der Bürgermeister. „Es gibt im Augenblick ohnehin dringlichere Probleme. Wie zum Beispiel Nelei Deirea.“
„Wenn ich schon diesen Namen höre“, ereiferte sich Sentel mit gedämpfter Stimme. „Warum kann sie nicht einmal in unserem Sinne handeln? Gibt es keinen Kerl in diesem Land, der Mann genug ist, sie zu heiraten?“
Menketes sagte nichts und dachte sich seinen Teil. Der Bericht aus Dipa Eleition ließ viele Fragen offen. Und dem Bürgermeister war nicht entgangen, dass sich die Berichtschreiber mehr daran störten, dass eine Frau diese Taten begangen hatte, als an den Ursachen, die dazu geführt hatten.
„Meine Leute haben sie im Hafen von Sarangar gesichtet. Auf einem Schiff, das nach Tavanna aufbrach“, erzählte Sentel mit einem verschwörerischen Unterton. „Ich habe bereits einen Boten losgeschickt, mit einem umfänglichen Schreiben von Magister Tevelkân.“
„Warum wollen wir eigentlich, dass sie zurückkommt, wenn sie stets so ein Ärgernis ist?“, überlegte Menketes laut.
„Wäre sie klanglos verschwunden, würde ich dir zustimmen. Aber sie hat das ganze Kloster abgebrannt und damit die Stadtkasse von Dipa Eleition ruiniert. In den Straßen redet man wieder einmal von nichts anderem als von Nelei.“
„Was ist mit den tamarischen Hochstaplern? Es ist mir nicht entgangen, dass sie in den Erklärungen der Goru-Schan noch keine Erwähnung gefunden haben.“
Sentel räusperte sich und strich nervös über seine unförmige Frisur. „Das wird auch nicht geschehen.“
Menketes zog überrascht die Augenbrauen hoch. „Ist das euer Ernst? Ihr wollt den Leuten den Grund für Neleis Tat vorenthalten?“
„Aber natürlich, Menketes“, flüsterte Sentel nervös. „Über Ursachen zu sprechen, verwirrt die Menschen nur. Und was schlimmer wiegt: Man würde uns als Narren verspotten. In anderen Reichen gelten wir ohnehin als Einfaltspinsel, doch dieses Gelächter würde durch die Jahrzehnte hallen.“
Menketes dachte über Sentels Worte nach und rieb sich mit der Hand nachdenklich die Stirn. „Das Geschwätz der Straße hatte mich nie gekümmert. Doch wäre es dann nicht um so wünschenswerter, wenn sie in Tavanna bliebe?“
„Wir müssen doch Herr der Lage bleiben, Bürgermeister“, widersprach ihm Sentel nachdrücklich. „Die befreiten Frauen aus Dipa Eleition schweigen aus Scham. Dessen haben wir uns versichert. Aber wer weiß, wem sich Nelei bereits anvertraut hat. Solche Schauergeschichten dürfen nicht die Ohren unserer Landsleute erreichen. Das Volk könnte schnell ein paar von uns aufknüpfen. Wir sind keine Fürsten. Unsere eigenen Krieger haben uns in die Ämter erhoben.“
Menketes schnaubte kurz und lächelte ungläubig. „Und dann?“, fragte er. „Ihr wollt sie doch nicht bestrafen? Oder gar einsperren?“
„Arkron behüte!“, rief Sentel aus. „Nein, wir haben hierzu eine Sitzung abgehalten und eine ganz andere Lösung ausgearbeitet.“
„Da bin ich gespannt.“
Ratsherr Sentel neigte sich etwas zur Seite, um dem Ohr des Bürgermeisters näher zu sein. „Nun, Yukela kann behaupten, was sie möchte, doch Nelei gehört nicht an den Küchenherd. Sie gehört an die Spitze einer Armee. Unserem Volk mangelt es nicht an tapferen Schwertern, doch es mangelt uns an tüchtigen Anführern. Und nun, da Karvelân tot ist und die Nachrichten aus Peleor wenig Erfreuliches bringen …“
Menketes lachte herzlich auf. „Ihr wollt Nelei Karvelâns Amt geben? An der Spitze aller demenäischen Krieger? Ich wünschte, ich wäre dabei gewesen, um Yukelas Gesicht zu sehen, als dieser Vorschlag unterbreitet wurde.“
Sentel musste nun auch lächeln, wenn auch mit der zu erwartenden Zurückhaltung. „Nun, sie war in der Tat etwas blass und fächerte sich unentwegt Luft zu.“
Menketes Lachen erstarb langsam und er nickte nachdenklich. „Alles in allem ist das keine schlechte Idee“, stimmte er zu und blickte Sentel an. „Du hast die besten Ohren im ganzen Reich. So sage mir, was der Westen im Schilde führt. Welche Nachricht bringen deine Späher aus Erat Lei und aus Diara?“
Sentel zögerte eine Weile. Er blickte in die Richtung des Dalmisch-Spiels, doch Menketes wusste, dass er es nicht ernsthaft verfolgte.
„Die Nachrichten geben allen Grund zur Sorge“, antwortete Sentel mit gesenkter Stimme. „Ich denke, es wird Krieg geben. Peleor wird nicht länger warten und zusehen, wie wir erstarken. Doch es sollen sich Männer aus Argasch am Hof von Krisdarhûl aufhalten. Es ist von einem Bündnis die Rede. Ich werde darüber heute Abend in der Sitzung berichten und darauf pochen, dass wir unauffällig Truppen ausheben.“
„Unauffällig Truppen ausheben?“, wunderte sich Menketes. „Das ist ein Widerspruch in sich.“
„Wie ich herausfand, hatte der alte Karvelân damit bereits vor Wochen begonnen und Truppenverstärkungen nach Hoé geschickt. Zur Erklärung hatte er angegeben, dass sich seit den Tagen des Aufstands in einigen Gebieten zu viele Truppen angesammelt hätten, während sie in anderen Städten zu wenig seien. Seine Maßnahme ziele lediglich darauf ab, hier einen gesünderen Ausgleich zu schaffen. Ich vermute, dass er das Volk erst nach den Fröhlichkeiten des Neujahrsfestes über die wahren Gründe in Kenntnis setzen wollte.“
„Er war ein alter Knochen, doch sein Bauchgefühl war beispiellos“, meinte Menketes und stand auf. „Ich werde heute Abend in der Sitzung darauf pochen, dass wir auch Boten nach Denroen Tai senden. Wir müssen endlich ein Bündnis mit den Kendari schließen und uns ihrer Hilfe versichern. Es sollte in König Belkars Interesse sein, eine schützende Hand über die Gorkonai zu halten.“
„Drughal stehe uns bei“, flüsterte Sentel. „Kendari beschützen Demenäer. Yukela wird vor Wut einen Federkiel durchbeißen.“
Das Stadttor von Hoé
Gorkonai
Empala blickte auf die gewaltigen Mauern und die dahinter emporragenden Türme. Lange, schmale Fahnen wehten feierlich auf den Dächern, als wüsste man in der Stadt nichts von all dem Leid, das sich auf dem Lande abspielte. Es war ein kühler Morgen und der Wind brachte aus der Bucht von Elganôr den salzigen Geruch der See. Sie hatte sich auf einer kleinen Anhöhe einen Sitzplatz ausgesucht, abseits der vielen Menschen, die auf der gerodeten Ebene vor dem Haupttor lagerten.
So sah es in jenen Tagen vor allen großen Städten der Gorkonai aus: belagert von Scharen abgezehrter, hungriger Gestalten, die darauf hofften, ihre missliche Lage zu verbessern. Sie alle hatten Gräuliches erlebt, denn seit Monaten war es ihr Schicksal, umherzustreifen und der Gnade ihrer neuen Herren ausgeliefert zu sein.
Es waren Wochen vergangen, seit Nelei, die demenäische Kriegerin, sie aus der Gefangenschaft der falschen Mönche befreit hatte. Empala hatte sich seitdem in den Wäldern herumgetrieben und sich nachts auf Gutshöfe geschlichen, um dort Nahrung zu stehlen. Dies waren lebensgefährliche Unterfangen und sie ergatterte selten mehr als eine Handvoll Zwiebeln oder einige Kartoffeln.
Wer im Wald schlafen musste, Wölfe und Bären zu fürchten hatte und auf Feldern heimlich Rüben klaute, lebte nicht sehr lange. Denn die Bauern waren extrem grausam. Die meisten, die sie beim Stehlen erwischten, wurden zu Tode geprügelt und nicht selten den Schweinen zum Fraß vorgeworfen.
In den drei Jahren seit der Abschaffung der Sklaverei waren die Ernten karg. Hinzu kam, dass es keine Feldsklaven mehr gab. Die neuen Grundstückbesitzer mussten nun die Arbeiter bezahlen. Doch der Lohn war äußerst gering und überstieg so gut wie nie jenen Betrag, den die Goru-Schan vorgeschrieben hatten.
Die städtischen Verwaltungen setzten wiederum den Landwirten zu. Sie pressten aus ihnen hohe Steuern und zögerten nicht, bei geringen Verfehlungen ihren Grund zu beschlagnahmen.
Empala war einige Tage einer Händlerkolonne gefolgt und kam schließlich vor den Mauern von Hoé an. Hier lebten bereits andere traurige Gestalten, Bettler und Landstreicher, die allesamt von einem Einzug durch das Tor träumten. In den Städten gab es Nahrung und Zuflucht. Man erzählte sich auch, dass einige Gorkonen einflussreich geblieben seien, da man sie brauchte, um das Reich vor dem Zusammenbruch zu bewahren. Und jene Gorkonen würden, so sagte man, Menschen helfen, die in Not waren.
Doch die Torwächter durften keine Bettler und Landstreicher hindurchlassen und waren sehr streng. Wenn es allerdings einem von ihnen gelang, sich Zutritt zu verschaffen, machte sich kaum jemand die Mühe, den Eindringling zu behelligen. So wurde man von einem Landstreicher zu einem Stadtbettler. Geduldet, unbeliebt, doch auch nützlich für großzügige politische Gesten. Wer nicht beim Stehlen erwischt wurde und den Uniformen aus dem Weg ging, konnte auf diese Weise lange über die Runden kommen.
Hoé war einst die reichste Stadt an der gorkonischen Westküste gewesen. Ihren Reichtum verdankte sie allerdings nicht einem blühenden Handel, denn sie befand sich abseits der großen Handelsstraße zwischen Dakara und Sarangar. Vielmehr hatten sich hier die betagten Reichen und Erfolgreichen niedergelassen, um ihren Lebensabend im Kreise Gleichgesinnter zu verbringen, umgeben von Kunst und Philosophie.
In den Tagen des Aufstands hatten die wütenden Rebellen unter Karvelân und Nelei Deirea auf dieser gerodeten Ebene vor dem Haupttor die verweichlichten und aus der Übung gekommenen Stadtmilizen überrannt und mühelos die Stadt gestürmt. Mochten andernorts die Gorkonen zeitig Reißaus genommen haben, die Anwohner von Hoé gaben sich stolz und eigensinnig. So sei das wütende Morden innerhalb von Hoé schlimmer gewesen als in anderen Städten. Viele Ortsansässige, einst geachtete Handelsfürsten, ehemalige Beamte und Regierungsvertreter fanden sich am Ende eines Strickes, sachte in der kühlen Seebrise baumelnd. Nur die Angesehensten wurden vorerst verschont und endeten später vor Tribunalen, um ihnen anschließend öffentlich auf Bühnen die Kareta einzusetzen und das Gift einzugießen.
Auch andere Städte blieben von solchen Gemetzel nicht verschont. Empalas Vater war in Sarangar Steuereintreiber gewesen. Während des Aufstands hatte sich der Gorkone einer Miliz gegen die aufständischen Sklaven angeschlossen. Nach der Kapitulation der Hafenstadt war er somit einer der 185 Soldaten und Beamten, die man von den beiden mächtigen Hafentürmen in den Abgrund stieß.
Damals war Empala mit ihrer Mutter aus der Stadt geflohen. Gorkonen wurden in jenen Tagen aufgegriffen und in behelfsmäßige Lager oder dunkle Kerker gesteckt. In den ersten Monaten nach dem Aufstand befand sich das gesamte Land im Chaos. Niemand zählte all die Morde und Vergehen, die in diesen Tagen geschahen. Niemand schrieb Berichte über all die Grausamkeiten. Nicht selten töteten sich Gorkonen gegenseitig. Mancher hatte einen Sack Zwiebeln mit seinem Leben bezahlt, andere hatten das Durcheinander genutzt, um alte Rechnungen zu begleichen.
Viele Gorkonen hatten Banden gebildet und umherstreifend ihre Umgebung malträtiert. Vor demenäischen Kriegern zogen sie feige den Schwanz ein, doch hatten sie keine Bedenken, ihr eigenes Volk zu berauben. Zu tief war die Vorstellung verankert, dass sie ein Anrecht auf Untergebene und Sklaven hatten. Sie hatten sich nur unwillig vor den Demenäern verneigt, doch kaum waren sie aus dem Blickfeld ihrer Bezwinger, drangsalierten sie ihresgleichen.
Empala und ihre Mutter hatten sich nach dem Aufstand einer Schar Flüchtlingen angeschlossen. Sie waren dem Verhungern nahe und schleppten sich gen Westen. Sie verbanden mit der Richtung keine Erwartungen und Vorstellungen. Zu benommen waren ihre Sinne, um klar über ihr Ziel nachzudenken. Weder in Peleor noch in Ximanté konnten sie mit einem warmherzigen Willkommen rechnen. Doch das Grenzgebiet der drei Reiche war nur eine endlose Hügellandschaft. Klare Grenzlinien waren hier unbekannt.
Als sie in die Gewalt einer der herumstreunenden Banden geraten waren, fehlte es ihnen an Kraft, um mehr zu tun, als sich zu fügen. Doch zu ihrem Erstaunen hatte man ihnen zu essen gegeben. Einer der Männer, der vor dem Aufstand Metzger gewesen war, hatte an dem Mädchen mit den schmutzigen Wangen Gefallen gefunden. Doch Empalas Mutter war es für viele Tage gelungen, seine Aufmerksamkeit auf sich selbst zu lenken. In den Nächten hatte Empala ihr tränenbenetztes Gesicht unter einem alten Mantel verborgen, während kaum weiter als drei Armlängen entfernt der alte Fettwanst auf ihrer Mutter gelegen und heiser vor sich hingehechelt hatte.
Sie wurden Zeugen abscheulicher Dinge, sahen, wie Wehrlose, die am Waldrand erschlagen und erstochen wurden und Baumreihen, von deren Ästen tote Diebe baumelten. Mutter und Tochter hatten Vergewaltigungen am Straßenrand gesehen und kaum noch beachtet. Das eigene Überleben wurde zu einem dumpfen Drang. Darüber hinaus gab es keine Wünsche und keinen Willen.
Der alte Metzger war jedoch schon bald in einen Zwist mit einem anderen Räuber geraten. Klingen blitzten im flackernden Licht des Lagerfeuers auf. Der Rest der Bande hatte es nicht weiter beachtet.
Der Metzger mochte ein lüsternes Schwein sein, doch für wenige Tage war er ein Beschützer für die beiden Frauen gewesen. Nach dem Streit hatte er hechelnd unter einem Baum gesessen und seine Hand gegen die Seite gepresst. Zwischen seinen Fingern quoll dunkles Blut heraus.
„Empala“, hatte er benommen geflüstert und seinen Arm nach ihr ausgestreckt. Das Mädchen war nur zwei Schritte entfernt gesessen, gehüllt in eine Decke und hatte in seine kleinen, zugeschwollenen Augen gestarrt, als ein dumpfer Schlag auf seinen Kopf donnerte. Empala hatte hochgeblickt und ihre Mutter erkannt. Sie stand mit einem kräftigen Holzscheit in der Hand über dem Metzger und schlug immer wieder gegen dessen Schädel. Sein Kopf war nach vorn gekippt, als würde er auf den gewaltigen Bauch starren. Seine Hand hatte sich von der Wunde gelöst und ließ das Blut frei fließen.
„Er kann uns nicht mehr beschützen“, hatte ihre Mutter gesagt. „So müssen wir uns keinen Augenblick länger als nötig mit seiner Gegenwart abfinden.“
Sie hatte seine Taschen durchsucht und alles an sich genommen. Es war sogar etwas Geld dabei gewesen. Sie hatten sich leise davongeschlichen. Niemanden schien es gekümmert zu haben.
Empala hatte damals ihre Mutter als stark empfunden. Sie fühlte sich beschützt. Doch sie konnte nicht ahnen, dass dies die letzten Tage sein sollten, die sie mit ihrer Mati erleben würde.
Auf einer Wiese am Waldrand hatte sich ein größeres Lager gebildet. Flüchtende Gorkonen, vom Schicksal und Zufall hierher getrieben, hatten sich dort zusammengefunden. Die meisten wirkten teilnahmslos und entmutigt. Dies war mehr als nur die gängige Erschöpfung und der elende Hunger.
„Mir gefällt es hier nicht“, hatte Empala ihrer Mutter zugeflüstert. „Es ist, als ob wir auf einem Friedhof sind, wo die Toten alle noch leben.“
Drei Tage später hatte nachts ein Angriff stattgefunden. Diesmal waren es Demenäer. Allesamt junge Männer und sogar einige Frauen waren auf Pferden in das Lager gestürmt. Sie hatten Schutzpanzer und Helme getragen und waren mit Schwertern und Äxten bewaffnet gewesen. Sie hatten ausgesehen, als würden sie in eine Schlacht ziehen. Doch Empala wusste aus Erzählungen, dass dies lediglich ein Spiel war. Ehemalige junge Sklaven, die ihre Wut entluden und ihre Peiniger straften. Monate später hatten die demenäischen Verwaltungsräte solche Übergriffe an den Gorkonen verboten, doch in den frühen Tagen des Umbruchs waren sie an der Tagesordnung gewesen.
Empala hatte nur verschwommene Erinnerungen an diese Nacht. Da war das Bild ihrer Mutter, wie sie dastand, während eines der Lagerfeuer ihre rechte Gesichtshälfte beleuchtet hatte. Sie hatte sich zu Empala gedreht und ihre Lippen bewegten sich, als wollte sie etwas sagen. Im nächsten Augenblick schlug von oben eine Axt gegen ihren Kopf. Der Reiter war an ihnen wie ein dunkler Schatten vorbeigeschossen. Es war alles so schnell gegangen.
Jemand hatte Empala an den Schultern gepackt und sie mitgezerrt. Sie muss benommen mitgegangen sein, denn als sie endlich hochgeblickt hatte, hatten sie sich bereits im Wald befunden. Die Männer um sie herum hatten Mönchskutten getragen. Und jener, der sie an den Schultern gehalten hatte und den sie später als Vater Dival kennenlernen würde, hatte sie angeblickt und ihre Wange gestreichelt. „Woher kommst du, Mädchen?“, hatte er gefragt.
„Woher kommst du, Mädchen?“, sagte jemand über ihr.
Aus ihren Erinnerungen gerissen, blickte Empala hoch.
Der Unbekannte war in ein schlichtes Gewand gekleidet, das sauber und ohne Risse war. Zu ihrer Überraschung roch sie sogar einen Hauch von Seife. Seine Wangen waren ein wenig unrasiert, doch das Haar war kurz und säuberlich gestutzt. Er mochte keine vierzig Jahre alt sein. Seine Hände ruhten auf einem Wanderstock, in den Zeichen und Symbole geschnitzt waren.
„Ich komme aus Sarangar“, sagte sie. „Doch das ist schon lange her.“
„Und wie ist dein Name?“
„Ich heiße Empala, Herr.“
„Ich grüße dich, Empala. Mein Name ist Danquan.“
„Du bist ein Demenäer“, sagte Empala leise. Ihre Finger hatten unauffällig den Zipfel ihres Beutels umklammert, als rechnete sie damit, sogleich aufspringen und flüchten zu müssen.
Dem lächelnden Mann schien es nicht entgangen zu sein. „Ja. Doch mache es mir nicht zum Vorwurf“, erwiderte er. „Vergib mir meine unumwundenen Worte. Du siehst hungrig aus und so vermute ich, dass du nicht hier sitzt, um die Aussicht zu genießen.“
Sie blickten beide auf die Stadt. Jenseits der Stadtmauer erhoben sich die drei Anhöhen, auf den Hoé einst erbaut worden war. Auf jeder Erhöhung befand sich ein Tempel, während die Stadt sich in Jahrhunderten um diese Hügel ausgebreitet hatte.
„Sie ist eine der prächtigsten Städte der Welt. Viele der Statuen wurden von Eion dem Steinmetz geschaffen. Die schönsten Gebäude sollen auf seinen Entwürfen beruhen. Sicherlich würdest du dir das gerne aus der Nähe ansehen …“
Empala blickte ihn misstrauisch an.
„… und etwas gegen den Hunger tun“, fuhr Danquan fort.
„Die Wächter weisen Bettler und hungrige Menschen ab“, entgegnete Empala.
„So komme mit mir“, forderte sie Danquan auf. „Kein Tor verschließt sich denen, die den Willen der Götter fordern.“
„Du bist ein Priester?“ Empala musterte misstrauisch sein Gesicht.
„Nein. Ich bin ein Freund der Götter und ein Freund der Menschen. Meine Schultern sind die Brücke, über welche die Liebe zwischen Göttern und Menschen hin und zurück wandelt.“ Er hielt ihr seine Hand hin. „Komme mit uns. Nur so lange, bis du in der Stadt bist. Dann kannst du selbst entscheiden, welchen Pfad du nimmst.“
Empala war inzwischen aufgestanden und fegte den Staub der Straße von ihrer zerschlissenen Kleidung. Sie hatte genug „Priester“ gesehen und erlebt, um diesem Mann mit äußerstem Misstrauen zu begegnen. Doch falls er die Wahrheit sagte und die Stadt ihm offen stand, konnte sie dieses Angebot nicht ausschlagen.
Sie folgte ihm zu seiner Gefolgschaft, die unweit des breiten Hafentors am Strand lagerte. Es mochten beinahe hundert Menschen sein und alle wirkten gutgelaunt. Einige von ihnen standen auf, blickten Empala an und senkten im Gruß ihren Blick.
„Welchem Gott bist du geweiht?“, fragte Danquan.
„Meine Familie opferte Arkron und Gatmon.“
„Der Gott der Weisheit und der Gott der Sprache“, sagte Danquan. „Deine Anwesenheit ist ein Segen für uns.“
Empala wunderte sich über seine Worte. Niemand außer ihren Eltern hatte sie jemals als einen Segen bezeichnet. Vielleicht sagte dieser Mann es nur, um sie einzulullen. Doch für den Augenblick wollte sie mitspielen, um dieses Tor und seine gestrengen Wächter zu überwinden.
Danquans Gefolgschaft war ein bunter Haufen aus Gorkonen und Demenäern. Einige waren mit alten Schwertern bewaffnet, doch die meisten schienen ehemalige Bürger der gorkonischen Städte zu sein. Viele Alte waren dabei, doch auch junge Männer und Frauen, die Empala allesamt freundlich ansahen.
„Freunde, dies ist Empala. Sie wird unser Gast sein. Gebt ihr zu essen und zu trinken.“
„Willkommen in der Scha-Qur“, sagte ein Jüngling unweit von ihr. Er brach ein großes Stück Brot ab und hielt es ihr entgegen.
„Scha-Qur?“, fragte Empala und blickte erneut zu Danquan.
„Die Familie“, erklärte der Anführer. „Der Pfad zu den Göttern. Wir unterscheiden nicht zwischen Gorkone, Demenäer oder Kendari. Wir sind gekommen, um die Tempel der Gorkonai in ihrem alten Glanz erstrahlen zu lassen. Wie in jener Zeit, bevor die Makhai ihren Glauben verraten und dem Fortschritt geopfert haben. Wir sind gekommen, um den Menschen Halt zu geben. Um das Zeitalter der Gier und des Krieges zu beenden. Wer mit uns wandelt, steht unter unserem Schutz. Herkunft und Vergangenheit zählen für uns nicht, denn es heißt: Ein jeder Mensch ist von den Göttern verlassen. Unser aller Geschick ist das Leid, denn ein jeder von uns ist eine Waise. Das macht uns zu Brüdern und Schwestern.“
Empala nahm das Brot aus der Hand des jungen Mannes und biss wortlos hinein.
„Ich heiße Malôr“, sagte er. „Ich bin ein Bäcker.“
Sie musterte neugierig sein krauses Haar. Andere Mitglieder der Gruppe traten heran und legten allerlei Essbares vor sie hin.
„Woher kommst du, Empala?“, erkundigte sich Malôr.
„Aus Sarangar. Auch du bist ein Gorkone …“
„Viele von uns sind es. Mein Vater stammt aus Edon. Du bist zu jung, um allein zu reisen. Sind deine Eltern verschollen oder gar tot?“
„Sie sind nicht mehr da“, sagte sie leise.
„So hast du auch keine anderen Angehörigen in Sarangar, zu denen du gehen kannst?“
„Lasst sie doch essen“, tadelte Danquan. „Wir brechen bald auf, also macht euch bereit!“
„Ich habe in der Dunkelheit gelebt“, flüsterte Empala. „Hinter Mauern, wie ein Tier im Käfig. Ich kann nicht mit dieser Schande zu meinen Verwandten zurückkehren. Sie würden mich nicht nehmen.“
„Wir haben viele junge Menschen bei uns, die ihre Familie verloren haben. Wir sind nun die Familie“, erklärte Danquan, während er halb abgewandt den Aufbruch überwachte.
Seine Gefolgsleute sortierten ihr Hab und Gut, wedelten mit Decken und Tüchern, um den Sand abzuschütteln und schnürten ihre Schuhe. Kurz darauf standen sie in Grüppchen bereit, bis die Prozession mit Danquan an der Spitze aufbrach.
„Wie bist du freigekommen?“, fragte Malôr und warf sich seinen Beutel über die Schulter.
„Die Göttin Niobe ist mir zu Pferde erschienen. Sie hat eigenhändig meine Peiniger getötet und mir das Tor zur Freiheit aufgeschlagen.“
„Habt ihr das gehört?“, murmelte jemand hinter ihr.
Es dauerte nicht lange und die ersten von ihnen erreichten das Tor. Empala war in der Nähe von Danquan und Malôr geblieben, welche die Schar anführten. Nun lösten sich die beiden Männer aus der Prozession und traten vor die Wächter.
„Wir sind die Familie, die Kinder der Neun, Boten der Liebe“, verkündete Danquan mit kräftiger Stimme.
„Ihr seid weder Bürger dieser Stadt, noch Kaufleute“, wandte der Torhüter ein. Das Schlupftor ging auf und weitere Wächter kamen heraus und postierten sich vor dem Durchgang.
„Wir sind willkommen, wo wir eintreffen“, sagte Danquan. „Denn wir bringen den Segen der Götter, in deren Licht wir wandeln.“
„Wir haben schon Tempel und Priester“, gab der Wächter abfällig zurück. „Kommt wieder, wenn ihr Geld oder Waren habt.“
Danquan wandte sich an seine Gefolgsleute und machte eine auffordernde Armbewegung. Sie stimmten alle in einen summenden Tempelgesang ein. Es war die Hymne an Arkron. „Wir sind weder Diebe, noch sind wir eine Bedrohung für die Stadt. Wir nehmen Geschenke, wenn die Menschen sie geben. Wir verbleiben einige Tage, besuchen die Tempel und wandern weiter. Alles was wir hinterlassen, ist das Wort der Neun.“
Empala stand inmitten des Chors und beobachtete alles genau. Danquan schien gerissen zu sein. Niemand würde einer Gruppe Schaden zufügen, die gerade die Hymne an Arkron sang. Der Wächter flüsterte einem anderen Soldaten etwas zu, der sogleich durch das Schlupftor verschwand.
Bald schon trat der Kommandant der Stadtwachen heraus. Er war ein drahtiger Mann mit kräftigen Kieferknochen und einem kantigen Kinn. Er hatte wohl gerade gegessen, denn er kaute noch immer an dem letzten Bissen. „Ich habe dein Wort, dass ihr keinen Aufruhr veranstaltet und niemanden bedroht?“, fragte er unumwunden.
„Gesang, Gebet und Gnade sind unser Geschäft“, erklärte Danquan.
„Einige von euch haben auch Schwerter“, wandte der Kommandant ein.
„Die Reisen zwischen den Städten erfordern das“, erläuterte Danquan. „Doch wir sind gerne dazu bereit, sie deinen Männern auszuhändigen.“
„Nicht nötig“, brummte der Kommandant und warf dem wachhabenden Offizier einen kurzen Blick zu.
„Zu Befehl, Kommandant Waidan“, sagte dieser und gab einem Soldaten ein Zeichen. Bald schon öffneten sich mit einem lauten Knirschen die breiten Torflügel. Empala lachte leise und sah sich erstaunt die Deckenmalerei im Inneren des Torbogens an, während sie voranschritt.
Die immer noch singenden Scha-Qur trugen sie wie der Strom eines Flusses durch die Stadt. Sie hätte nun ohne viel Aufwand in einer der Seitengassen verschwinden können, so wie sie es sich vorgenommen hatte. Doch dann blickte sie Danquan an, der seine Arme im Takt der Musik bewegte. Dies waren keine Menschen, die sie in ein dunkles Zimmer sperren würden, mit einem Seil um den Hals. So zog sie lieber mit der Prozession, wie ein beseeltes Stück Treibgut.
Zum ersten Mal seit einer sehr langen Zeit musste sie sich nicht um das Morgen sorgen.
Die Bäder von Kanvä
Gorkonai
Lakriels Leben war ein ständiges Wechselbad der Gefühle. Aus den Reihen der Gorkonen fand er zwar viel Zuspruch und in den vorangegangenen Monaten hatte sich der Demenäer mit einigen von ihnen sogar angefreundet. Trotzdem hätten ihn die meisten der Gorkonen insgeheim gerne wieder mit einem Sklavenhalsband bestückt.
Auch seine Landsleute waren ihm nicht immer gewogen und beäugten ihn mistrauisch. Nicht nur, weil er den ungezwungenen Umgang mit Gorkonen pflegte, sonder vor allem, weil auch junge Demenäerinnen leicht seinem Charme verfielen. Sogar die Goru-Schan betrachteten ihn gerne mit einem gewissen Ekel, als hätten sie erst beim Kauen des Brots den Schimmelfleck bemerkt. Lakriel empfand dies als ungerecht, denn der Ältestenrat war es schließlich, der das Amt des Verbindungsbeamten erfunden und auf ihn übertragen hatte.
Aber solche Erfahrungen zogen sich durch sein Leben wie ein roter Faden. Sein Vater war kurz nach seiner Geburt im Meer ertrunken und seine Mutter hatte früh erkannt, dass ihr Junge mit dem feingeschnittenen Gesicht nur wenig zu der herben Kriegerkultur ihres Volkes passte. Seine leuchtend blonden Haare waren nicht nur im Norden unbeliebt. Auch die Tamari sagten blonden Menschen nach, lasterhaft und tückisch zu sein. Und im östlichen Reich Mandalé sah man in ihnen sogar ein böses Omen und tötete sie noch im Säuglingsbett.
Bei den Kendari hingegen galten blonde Kinder als Segen und auch die Gorkonen liebten helles Haar. Ihre Gelehrten hatten behauptet, dass einst ganze Landstriche ausschließlich mit blonden Menschen bevölkert gewesen wären. Ob dies stimmte, konnte niemand mit Gewissheit sagen. Nach dem Aufstand der Sklaven verfolgte niemand mehr diesen Forschungszweig.
Doch in den alten Tagen passte Lakriels Erscheinung herausragend gut in das Suchbild der gorkonischen Sklavenjäger. Denn unmännlich anmutende Knaben erzielten in Dakara hohe Preise. Die Erfahrung zeigte, dass es den Patriarchen der gorkonischen Familien leichter fiel, einen weibischen Zeugungssklaven im Haushalt zu dulden als einen muskulösen, zotteligen Hünen.
Lak-Rael, wie er in seiner Muttersprache Tukwantar hieß, hatte seine Kindheit in der Gesellschaft von Frauen verbracht. Seine Mutter scheute den demenäischen Kriegerstand nicht weniger als die gorkonischen Sklavenjäger. Beide Gruppen hatten die Angewohnheit, durch Dörfer und Siedlungen zu streifen und dort den Nachwuchs auszulesen.
Doch selbst ein flüchtiger Blick auf den achtjährigen Lak hätte genügt, um zu wissen, dass dieses Kind nicht im Kreise axt- und schwertschwingender Recken gedeihen konnte.
Die findige Witwe hatte ihr Kind in das Frauenhaus genommen, wo sich die Spinn- und Webstuben befanden. Sie ließ ihn sogar die Kleidung von Mädchen tragen und lehrte ihn das Spinnen von Fäden aus Wolle und Flachsfasern. Lak verbrachte viele Tage seines jungen Lebens auf dem Boden sitzend, in einer langen Reihe aus Frauen, und walkte mit seinen Füßen das Tuch. Später erlernte er auch die Arbeit hinter einem Webstuhl und das Sticken. Er hatte sich langes Haar wachsen lassen und manch eine Frau, die ihm täglich begegnet war, vergaß nach einer Weile, dass er ein Junge und kein Mädchen war.
Doch der im Kreise von Frauen aufwachsende Lak kam in dieser Zeit auch zu einer erstaunlichen Einsicht: Er erkannte, dass es Frauen gab, die der Raubeinigkeit demenäischer Männer nur wenig abgewinnen konnten und in einem sanften, nachdenklichen Jungen viel mehr einen Spiegel ihrer Sehnsüchte fanden. Seine Jahre im Frauenhaus waren von unzähligen Liebeleien und sinnlichen Abenteuern geprägt – nicht selten mit Frauen, die sogar das Alter seiner Mutter übertrafen.
Irgendwann begann sein Kehlkopf zu wachsen und seine Stimme hatte sich so stark verändert, dass ihn niemand mehr mit einer Frau verwechseln konnte. Lak warf die Frauenkleidung fort. Nur wenig später erreichte ihn die Nachricht vom Aufstand ihrer Leidensbrüder auf dem Festland im Süden. Bald schon tauchten die ersten Rückkehrer auf und berichteten von ihrer Pein und ihren Erlebnissen in der Welt der Gorkonen. Lak-Rael erfreute sich wie alle anderen am Sieg der Demenäer. Doch erweckten die Erzählungen auch ein Fernweh in ihm. Was manch ein Rückkehrer als eine verkommene Kultur beschrieb, regte die Fantasie des jungen Mannes an und faszinierte ihn insgeheim.
So brach er nur ein Jahr später auf und war einer der wenigen, die entgegen dem Strom der Rückkehrer aus der alten Heimat in die gebrochene Gorkonai reisten, um dort beim Wiederaufbau zu helfen. Unter dem Banner der Sternenaxt wollte er sein Glück finden. Aus Lak-Rael wurde Lakriel. Er lernte in beeindruckender Eile das Tuledon und seine rasche Auffassungsgabe erweckte die Aufmerksamkeit der neuen Anführer, die nur kurz zuvor das blutige Schwert und den runden Schild abgelegt hatten, und sich nun Beamte, Verwalter und Magistrate nannten. Sie waren ungehobelte Männer des Nordens, die ein Reich übernommen hatten, das berühmt für feine Kunst und tiefgründige Forschung war.
Es war Men-Quai-Ti, den die Gorkonen Menketes nannten, der die Befähigungen des jungen Mannes erkannte. Der neue Bürgermeister der Stadt Kanvä brauchte jemanden, auf den die Gorkonen nicht mit Abscheu und Angst reagierten. Lakriels Erscheinungsbild und seine manierliche Art, sich zu kleiden, passten hervorragend zu den Gorkonen. Hinzu kam, dass Lakriel weder ein Sklave der Gorkonen, noch an den Blutbädern des Aufstandes beteiligt gewesen war. Er war ein unbeschriebenes Blatt für die gorkonische Bevölkerung der Stadt und erhielt durch diesen Umstand leichter Zugang zu ihren Gedanken. So wurde er zum ersten Verbindungsbeamten zwischen den Goru-Schan und den Gorkonen.
Auch in Kanvä bewährte sich Lakriels Wirkung auf alle Frauen, die sich nicht von struppigen Kämpen angezogen fühlten. Seine Liebesgeschichten wurden oft genug zum Stadtgespräch. Nicht selten zum Verdruss der Goru-Schan. Doch wer wollte schon öffentlich den populären Lakriel rügen?
Menketes wurde sein Freund und Mentor. Mindestens einmal in der Woche besuchte Lakriel den betagten Häuptling und plauderte mit ihm über Neuigkeiten. Oder hörte geduldig seinem Tadeln zu.
„Ich hätte es wissen müssen!“, zeterte auch diesmal der alte Bürgermeister, mehr zum Schein als in ernstem Unmut. „Da glaube ich, dass endlich jemand diese verrückte Frau zu sich nimmt und vielleicht gar heiratet und dann stellt sich heraus, dass ihr wie Geschwister zusammenlebt? Wäre es wirklich eine solche Überwindung gewesen, das Lager mit einer Frau wie Nelei zu teilen?“
Lakriel blickte auf seine Hände. Sie saßen in Menketes‘ bescheidenem Häuschen unweit des Parks und tranken Tee, gewürzt mit Nelken und Ingwer.
„Wir waren Freunde“, erklärte Lakriel verlegen. „Wir sind Freunde. Wir haben den Menschen nie etwas vorgemacht.“
„Das muss man heute auch nicht“, brummte Menketes. „Die Straße erfindet ihre Geschichten selbst.“
„Nelei und ich hatten eins gemeinsam, Otar. Wir beide verweilen nicht so gerne in der Gesellschaft des eigenen Geschlechts. Ich fühle mich in der Gegenwart von Männern selten wohl und Nelei ist in der Frauenwelt gänzlich untauglich.“
„Eine seltsame Seele hast du“, raunzte der Bürgermeister leise.
Ein Diener des Bürgermeisters kam leise herein und hockte sich vor den Kamin. Er stapelte Holz auf, legte Späne hinzu und schlug alsbald mit einem Feuerstein gegen einen langen Stift aus Kalidôr-Stahl. Bald schon knisterte ein kleines Feuer.
Menketes trank schweigend einen Schluck Tee und musterte den Diener, der sich nun über die Feuerstelle beugte und durch Pusten den Brand anfachte.
„Es gibt Neuigkeiten, die ich dir persönlich mitteilen wollte, bevor du sie von der Anschlagtafel am Eingangstor zum Versammlungssaal erfährst“, äußerte sich Menketes schließlich und stellte den Teebecher hin.
„Was hat sie nun schon wieder getan?“, fragte Lakriel prompt.
„Sie hat …“, begann Menketes und besann sich auf seine Worte. „Mein Sohn, Dipa Eleition ist ein Betrug.“
„Betrug? Was hat sie getan?“
„Sie hat die Betrüger alle getötet.“
Sie schwiegen eine Weile und Lakriel blickte erneut auf seine Hände. Er war kein schüchterner Mann. Seine Verlegenheit kam nur in der Gegenwart von Menketes an die Oberfläche.
„Hast du jemals die Bäder des Eion ausprobiert?“, fragte der Bürgermeister.
Lakriel sah überrascht hoch. „Das Badehaus ist wieder in Betrieb? Ich wollte schon immer mal in den Genuss kommen.“
„So komm“, forderte ihn Menketes auf. „Nimm die Freuden des Lebens, wie sie kommen. Unterwegs erzähle ich dir alles über Dipa Eleition.“
Sie verließen das Haus des Bürgermeisters und Lakriel war wieder einmal darüber erstaunt, wie sehr Menketes seinem Alter zum Trotz ein strammes Tempo vorgeben konnte. Sie durchquerten den Park, dessen verdorrte Grasflächen mit braunrotem Laub bedeckt waren.
„Du hast nie gesehen, wie es hier vor dem Aufstand war“, erzählte Menketes. „Sogar im Winter war der Park gepflegt. Jeden Tag strömten hier ganze Rotten von Sklaven aus, die nur für Laub und Unkraut zuständig waren. Es gibt keine Schönheit ohne Sklaverei.“
Der junge Beamte kniff die Augen zusammen. Der schneidende kalte Wind störte ihn. Er schob eine lange Haarsträhne hinter sein Ohr und blickte den Bürgermeister misstrauisch an. „Kaum anzunehmen, dass das dein Ernst ist“, meinte er. „Kann denn ohne Sklaverei keine Schönheit entstehen?“
„Sieh dich selbst an“, rief Menketes. „Die Frauen sind vernarrt in dich und blicken dir heimlich nach. Doch würdest du Jahre in einer Waldhütte verbringen und dich wie unsere Vorfahren von schlecht gebratenem Fleisch ernähren, glaubst du, du würdest so aussehen? Wie viel Zeit verbringst du mit der Pflege deines Aussehens? Wie oft stehst du vor diesem berühmten Spiegel? Wärest du nicht der Sklave deines Erscheinungsbildes, wie könnte es aufrechterhalten werden?“
Lakriel lächelte und schüttelte leicht den Kopf. „Ich ehre deine Worte, Menketes. Aber ist es denn Sklaverei, wenn ich einen Lohn für meinen Aufwand erhalte?“
„Einen Lohn?“
„Die Gunst der Frauen.“
„Sklaverei ist immer ein Teil unseres Lebens. Doch der innere Aufstand ist eine Wahl, die jeder von uns treffen kann. Nelei versteht dies besser als du.“
„Ich würdige deine Weisheit, Menketes. Doch vergib mir meine Ungeduld. Ich muss wissen, was sich im Haus der Erwartung ereignet hat. Weshalb nennst du die Priester Betrüger?“
Menketes erzählte seinem jungen Freund, was er über Dipa Eleition wusste. Als sie beim Badehaus, das sich am südlichen Rand des Parks befand, ankamen, war Lakriel in ein missmutiges Schweigen versunken.
Die Einrichtung schien geschlossen zu sein, doch gab es in jede Himmelsrichtung einen gewölbeartigen Eingang. Sie gingen um das quaderförmige Gebäude herum. Die Farbe der aufgesetzten, blauen Kuppel blätterte an vielen Stellen ab und auch sonst war das Gebäude in einem erbärmlichen Zustand. Welkes Gras wucherte aus den Fugen und flatterte im Wind. Erst vor dem dritten Eingang stießen sie auf zwei Wachen. Sie erkannten Menketes und traten beiseite.
Bereits im Eingang schlug ihnen eine Welle aus Wärme entgegen.
„Ich habe heute Morgen veranlasst, dass die Bäder in Betrieb genommen werden. Die großen Becken sind zwar leer, doch wir sind nicht hier, um zu schwimmen.“
„Weshalb sind wir hier?“, fragte Lakriel beiläufig, während er sich um seine eigene Achse drehte und die Wandmalereien des Saals bewunderte.
„Wir sind hier, weil jeder Demenäer einmal im Leben von einem Gorkonen eine Massage kriegen sollte“, sagte der Bürgermeister und ging voran.
Sie betraten einen kleineren Raum, der von unzähligen Wandlampen beleuchtet wurde. In der Mitte standen mehrere Steinbänke.
„Hier entledigt man sich seiner Kleidung“, erklärte Menketes
„Ich kann immer noch nicht glauben, was Nelei widerfahren ist“, äußerte sich Lakriel, während sie ihre Gewänder ablegten. „Die Goru-Schan schulden ihr eine Entschuldigung.“
„Dafür müsste der Ältestenrat wissen, wo sie ist. Und auch dann würden Worte der Abbitte nur sehr mühsam über ihre Lippen kommen. Außerdem hat Haradas Tochter viele noble Landsfrauen der Blöße und dem Gespött ausgesetzt. Hätte sie es nicht etwas leiser und taktvoller angehen können?“
„Wer? Nelei?“ Lakriel seufzte trübsinnig.
Eine Frau betrat den Raum. Lakriel schätzte sie auf um die vierzig. Verdutzt starrte er die nackte Frau an. Sie legte zwei Paar Bastsandalen vor ihre Füße und verschwand schweigend wieder.
„Das ist Endemoia“, brummte Menketes. „Ihr Ehemann betrieb dieses Badehaus. Sie war für die Sklaven zuständig, die hier arbeiteten.“
Lakriel blickte schweigend auf die geschlossene Tür, durch welche die entblößte Frau verschwunden war.
„Sprich deine Gedanken aus“, forderte ihn Menketes auf.
„Ich habe täglichen Umgang mit Gorkonen. Es behagt mir nicht, sie in einer so unwürdigen Lage zu sehen.“
„Das sagst du, weil du nie gesehen hattest, wie tausende Demenäer in einer unwürdigen Lage gehalten wurden.“
„Ich bin mir der Verbrechen bewusst, die an unserem Volk begangen worden sind. Doch sollten wir nicht besser sein als sie?“
„Vielleicht“, erwiderte Menketes. „Und vielleicht sollten wir sie alle abschlachten. Das ganze übriggebliebene Volk. Auch das alte Reich Eskalion ist spurlos verschwunden. Die Bahn der Gestirne ändert sich nicht, nur weil ein Volk verlorengegangen ist.“
„Ich weiß, dass du nicht so denkst“, widersprach Lakriel leise.
„Wir sind mit unseren Aufgaben hoffnungslos überfordert, mein Freund. Wir können nicht einmal ein Badehaus betreiben. Wir müssen dafür Frau Endemoia und ihren Ehemann Bram aus ihrer engen, schäbigen Hütte am Stadtrand holen, in der sie nun leben müssen.“
„Weshalb lässt du sie nackt herumlaufen?“
„Damit du sehen kannst, wie Würdelosigkeit aus nächster Nähe aussieht. Viele Gorkonen ließen unsere versklavten Frauen nackt im Haushalt herumlaufen, nur aus hämischem Vergnügen.“
„Ich bin nicht in weltfremdem Prunk aufgewachsen, Otar. Ich weiß das.“
Die beiden nackten Männer standen sich gegenüber.
Menketes lächelte und schlug Lakriel auf die Schulter. „Auch wir sind nun nackt, mein Sohn“, bemerkte er. „Weshalb ist unsere Nacktheit nicht unwürdig, doch Endemoias Nacktheit durchaus?“
„Weil wir eine Wahl haben. Das Unwürdige kommt mit dem Zwang“, antwortete Lakriel. Menketes prüfte ihn oft mit philosophischen Fragen.
„Komm mit, Junge. Ein heißes Bad wird deine Laune heben.“
Sie stiegen in die Bastsandalen und begaben sich in den nächsten Raum. Hier schwebten dichte Nebelschwaden und das Licht der Öllampen wirkte verwaschen. Die feuchte Luft roch nach Tierfett. Erneut ging eine Tür auf und Endemoia trat herein. Sie trug gefaltete Badetücher. Ihr ebenso entkleideter beleibter Mann folgte mit einem Tablett, auf dem sich eine Karaffe und zwei Becher befanden. Lakriel musterte die beiden.
„Sehen sie für dich noch immer würdelos aus?“, fragte ihn Menketes, als wären Endemoia und Bram nicht im Raum.
Lakriels Blick wanderte unbewusst über seine eigenen nackten Beine. Er schüttelte den Kopf.
„Natürlich nicht“, betonte Menketes. „Wir sind nun alle nackt. In diesem Raum müssten die beiden wiederum bekleidet sein, um wie Sklaven oder Diener auszusehen.“
„Ich bin mir nicht sicher, ob ich verstehe, was du mir damit sagen willst.“
„Ein jedes Ding muss in seinem Zusammenhang zu anderen Dingen betrachtet werden. Allein für sich stehend hat es keine Bedeutung“, sagte Menketes und stieg langsam in eines der kleineren Becken. Er begleitete dies mit einem genussvollen „Aaaah“ und bequemte sich schließlich in eine Ecke. „Worauf wartest du?“, rief er Lakriel zu.
Der junge Beamte folgte ihm. Das heiße Wasser umfloss seine blasse Haut und seine langen blonden Strähnen bewegten sich wie Seegras auf der dampfenden Oberfläche. Er schloss die Augen und versank. Nun spürte er die wohltuende Wärme an jedem Punkt seines Körpers. Als er wieder auftauchte, stieß er sich sanft ab und driftete in die gegenüberliegende Ecke des kleinen Beckens.
„Ich habe noch nie etwas so Angenehmes gespürt“, flüsterte er.
„Über achtzig Sklaven waren früher nötig, um diese Anlage zu betreiben“, sagte Menketes. Er nahm eine Handvoll Wasser und goss sie sich über den Kopf.
„Weshalb bezahlt man sie nicht, damit sie hier wieder arbeiten?“
„Weil keiner weiß, wo sie sind. Wer hier einst als Sklave gedient hat, schwor, diese Kammern nie mehr zu betreten. Nach dem Aufstand sind viele zurück nach Demené. Andere zogen nach Sarangar, um im Hafen nach ihrem Glück zu suchen.“ Menketes wandte sich den beiden nackten Gorkonen zu. „Ihr könnt gehen!“, rief er streng und richtete sich auf. Das Wasser reichte ihm bis zur Brust. Der Bürgermeister stapfte langsam zum Beckenrand, wo das Tablett mit den Gefäßen stand. „Ich will, dass du das hier ausprobierst.“ Er goss beide Becher voll.
Lakriel nahm das kleine Gefäß entgegen und fühlte überrascht die Kühle in seiner Handfläche.
Er blickte hinein. „Da ist Eis drin“, sagte er.
„Es nennt sich Eistee“, erklärte Menketes. „Die gorkonischen Gelehrten haben herausgefunden, wie man Eis herstellt. Es gibt hier einen Raum, in dem aus verschiedenen Stoffen und Flüssigkeiten Eis hergestellt werden kann. Ungeachtet dessen, wie warm es draußen sein mag.“
Lakriel kostete das Getränk. „Es ist erstaunlich. Mein Körper spürt Hitze. Mein Magen spürt Kälte. Und es ist, als wäre es die beste Verbindung zweier Empfindungen, die es auf der ganzen Welt gibt.“
„Mit dem Untergang der Gorkonen könnte all dieses Wissen für immer verloren sein. Oder zumindest für viele Generationen, bis ein neues Volk sich durch außergewöhnlichen Wissensdurst auszeichnet.“
„Wir können von ihnen lernen. Wir müssen von ihnen lernen“, sagte Lakriel mit fester Stimme.
„Um von ihnen zu lernen, müssen wir dafür sorgen, dass sie uns nicht mehr hassen. Dass sie uns nicht mehr fürchten.“
„Ein langer Weg, ich weiß“, stimmte ihm Lakriel zu. „Doch es ist meine Aufgabe, sie davon zu überzeugen, dass ein Zusammenleben möglich ist.“
„Die einstigen Sklaven sind nicht von derselben Art wie die Landsleute auf der Insel. Viele kehren zurück, doch sie haben häufig Schwierigkeiten, sich an die alte Lebensweise zu gewöhnen. Die Sklaverei verändert den Menschen von Grund auf. Nun, da wir dieses Joch abgeschüttelt haben, gilt es, sich den Folgen zu stellen. Die ehemaligen demenäischen Sklaven und die Demenäer in unserer Heimat sind nur noch dem Namen nach ein Volk.“
Lakriel hielt sich am Beckenrand fest und ließ seinen Körper waagerecht schweben. „Das Wasser ist salzig“, bemerkte er versunken.
Menketes runzelte die Stirn. „Die Gorkonen meinten, dass Salze im Badewasser heilsam für die Haut sein können. Insbesondere im Alter. Hörst du mir noch zu?“
„Verzeih“, flüsterte Lakriel und stellte sich wieder auf seine Füße.
„Wir sind es, die aufhören müssen, die Gorkonen zu hassen. Ist der Hass verschwunden, können wir zu einem Volk verschmelzen.“
Lakriel gluckste. „Ob ich das jemals erlebe? Demenäer und Gorkonen – ein Volk. Wie dieses Volk wohl heißen wird? Gemenäer vielleicht – oder Dorkonen gar!“
„Genieße nur deine Späße“, brummte Menketes. „Doch denkst du, die Schmähungen in Dipa Eleition wären unter gorkonischer Aufsicht passiert?“
„Hewan weischi!“, rief Lakriel aus. Der kwantarische Ausdruck bedeutete einen Zustand, in dem beide Parteien eines Streitgesprächs die jeweils gegenüberliegende Position einnehmen. „Ich schlage seit zwei Jahren die Trommel für eine größere Annäherung mit den Gorkonen.“
„Und vermutlich wirst du sie noch weitere zehn Jahre schlagen müssen“, erwiderte Menketes. „Doch diese Zeit haben wir vielleicht nicht mehr. Sentel mag manchmal etwas einfältig erscheinen, doch er hat einige sehr tüchtige Schnüffler und Kundschafter in allen großen Häfen.“
Lakriel gluckste und spritzte vergnügt eine kleine Wasserfontäne aus seinem Mund.
„Ich sagte dies nicht, um dich zu unterhalten.“
Lakriel erkannte den Ernst in der Stimme seines Mentors. Er wischte sich das salzige Wasser aus dem Gesicht.
„Es wird Krieg geben, Junge. Ich spüre es nicht nur in meinen Knochen. Die Aussagen von Sentels Spionen sind unmissverständlich.“
„Die Kendari?“
„Nicht die Kendari“, erwiderte Menketes verstimmt. „Der Westen wird kommen.“
„Wann? Wer?“
„Die Trommeln von Peleor werden geschlagen. Und sie haben Unterstützer aus den Tiefen der kalten Wüste.“
Lakriel starrte ihn verdutzt an. „Was … Was werden wir tun?“
„Unsere Landsleute sind noch immer trunken von dem Nektar des Sieges. Sie glauben, es gäbe keine Gefahr und keine Übermacht, mit der sie nicht fertig werden.“
„Doch nicht du …“
„Die Peleori würden uns aufreiben. Sie würden wie Heuschrecken über uns herfallen. Drei Jahre sind seit dem Großen Krieg vergangen und wir sind nicht ansatzweise im Stande, dieses Land zu verteidigen. Und bei den ersten Anzeichen für eine Niederlage würden Tausende unserer Leute nach Demené fliehen. Einigkeit mit den Gorkonen, die Wiederbelebung der gorkonischen Armee, das wäre die einzige Möglichkeit, die Peleori vor Sarangar aufzuhalten. Doch wie gesagt, wir haben nicht mehr genug Zeit, um mühsam die Demenäer und die Gorkonen aufeinander einzuschwören.“
„Was wird nun geschehen?“, fragte Lakriel.
„Ich werde dich in geheimer Mission nach Kendaré senden.“
Lakriels Kinnlade sank merklich nach unten. Er löste sich vom Beckenrand und trat durch das heiße Wasser näher an Menketes heran.
„Belkar und ich sind uns einmal begegnet. Der König achtet mich. Du musst den Tiger von Kendaré davon überzeugen, uns zu beschützen“, flüsterte der Bürgermeister.
„Was ist mit den Goru-Schan?“
„Die lautstärksten Gegner dieser Idee waren Karvelân und Yukela. Und Karvelân ist nicht mehr unter uns. Somit überlasse den Rat mir.“
„Wir sprechen von kendarischen Truppen auf diesem Boden!“, entgegnete Lakriel. „Unsere Landsleute werden denken, dass wir lediglich einem neuen Herrn die Tore öffnen.“
„Deine Sorge ist der König von Kendaré. Denn er wird dir sein Mitgefühl und seinen Zuspruch anbieten. Doch du musst echte Zusagen nach Hause bringen, nicht das Bedauern eines Herrschers. Die Kendari tragen noch immer den Ruf einer unbesiegbaren Macht. Ihre Armee ist aber geschwächt. Wir alle hatten zu wenig Zeit, uns von den gorkonischen Gräueln zu erholen. Doch in Gemeinsamkeit könnten wir Stärke finden.“
Lakriel runzelte die Stirn und versank wieder bis zum Kinn im Wasser. „Du hast sehr viel Vertrauen in mich“, stellte er nachdenklich fest.
Menketes lächelte den jungen Mann an. „Du wirst schon zurechtkommen. Seit fast zwei Jahren arbeitest du daran, die Sympathien der Gorkonen für uns zu gewinnen. Manche sagen, dies wäre die undankbarste Aufgabe, die einem demenäischen Beamten jemals zuteilwurde. Ich würde sagen, du bist erprobt genug, um mit dem größten Herrscher der bekannten Welt zu verhandeln. Und wenn du nicht trödelst, bist du zum Dalmisch-Finale am Neujahrsfest wieder da. Nun lass uns in den Massageraum gehen. Die Dame Endemoia wartet schon.“
Die Wiedergeborene
Gorkonai
Magistrat Ting überhörte nicht nur das Knarren der Tür, sondern auch die selbstbewussten Schritte von Kommandant Waidan, der in die Mitte des Zimmers ging und dort wortlos stehenblieb. Ting war in die Papierrollen auf dem Tisch versunken und blickte erst nach einer ganzen Weile abwesend hoch.
„Ah, Kommandant Waidan!“, rief Ting aus, beinahe, als wäre er überrascht. „Setz dich, setz dich!“
Waidan nahm wortlos Platz. Seine Rüstung knarzte dabei laut. Der Kommandant ließ die linke Hand auf seinem Schwertknauf ruhen, während er seine rechte auf dem Oberschenkel ablegte. Er war kein großer Freund solcher Treffen, doch sein Rang verlangte ihm ab, sich regelmäßig mit dem Magistrat zusammenzusetzen und monatlich dem Bürgermeister Bericht zu erstatten.
Bürgermeister und Magistrat, beide schauten auf ihn herab, als wäre er nur ein Werkzeug, das sie nach Belieben einsetzen konnten. Eine törichte Einstellung, denn der Kommandant kontrollierte die bewaffneten Streitkräfte der Stadt. An jedem beliebigen Morgen könnte Waidan aufwachen, aufstehen, etwas frisches Wasser gurgeln und dann die Herrschaft über Hoé übernehmen. Es erstaunte ihn, wie sehr die Goru-Schan dieses Detail verdrängten und ihn behandelten, als wären er und seine Krieger bezahlte Söldner.
Dabei war für Waidan die Zeit der Umwälzungen und Krisen noch lange nicht vorbei. Unter seinem Panzerhandschuh war die Stadtmiliz von Hoé bereit, jederzeit zuzuschlagen und jede Rebellion im Keim zu ersticken. Die Gorkonen waren einst zu nachlässig gewesen, um den Aufstand der Demenäer zu verhindern. Er würde einen solchen Mangel an Sorgfalt nicht zulassen.
„Wer sind diese Leute, Waidan? Wer sind diese Leute?“ Ting reichte ihm eine der Papierrollen.
Der Kommandant griff nach ihr, gerade noch sanft genug, ohne dass es aussah, als würde er ihm das Papier aus der Hand reißen. Er hielt den Bericht mit beiden Händen und las. „Ihr Anführer heißt Danquan. Er ist einer von uns“, erläuterte Waidan kurz darauf.
„Einer von uns, Kommandant?“
„Ein Demenäer.“
„Ein Demenäer?“, wunderte sich der Magistrat. „Wie viele Anhänger hat er denn?“
„Es waren über hundert, als er kam. Nun dürften es beinahe tausend sein.“
„Tausend?“ Ting blickte ihn entsetzt an. „Das findest du sicherlich beunruhigend.“
„Sie horten keine Waffen und reden den ganzen Tag nur von göttlicher Liebe. Ich bin nicht besorgt.“
„Die Stadt zu kontrollieren, bedeutet, alle Belange des Lebens zu kontrollieren. Dazu gehört auch der Glaube. Wir haben genug eigene Priester und Tempeldiener. Wir brauchen keinen Nachwuchs.“
Sie sprachen Ledonisch miteinander. Das Tukwantar mochte beiden die Muttersprache sein, doch sie hatten weder ein Leben auf Demené gekannt, noch eignete sich Kwantarisch allzu gut, um über die Verwaltungsbelange einer gorkonischen Stadt zu sprechen. Tuledon war somit die Verwaltungssprache der gesamten Gorkonai geblieben.
„Ich verwehre an den Toren nur jenen den Zutritt, die eine Bedrohung darstellen. Diese Leute stellen keine dar.“
„Noch nicht!“
„Bhanur-agran schar. Bhanur-nelei neschar“, erwiderte Waidan. „Ich bin der Kommandant der Stadtwache. Nicht der Kommandant der Zukunft.“ Mit dem Bürgermeister hätte er nicht so geredet. Doch der Magistrat hatte ihm nichts zu befehlen, außer in seiner Funktion als des Bürgermeisters Mund.
„Der Bericht sagt deutlich, dass der Anführer eine Rede vor dem Tempel des Arkron abgehalten hat, wo er verkündete, dass Glaubensfragen nicht der Stadtverwaltung obliegen, sondern zukünftig dem Tempel selbst vorbehalten sein sollen.“
„Ich hatte zwanzig Mann bei der Kundgebung. Es gab keine aufrührerischen Rufe und jeder verhielt sich gesittet. Die meiste Zeit haben sie gesungen.“
„Und du denkst, Gesang ist harmlos?“, rief Ting aus.
„Meine Männer sind ausgebildet, um gegen Waffen zu kämpfen, nicht gegen Tempelhymnen. Wenn du mir sagst, ich soll die Scha-Qur verhaften, da sie eine Bedrohung für die Goru-Schan darstellen, dann werde ich es tun.“