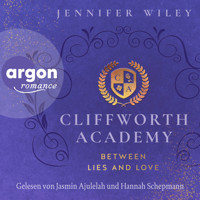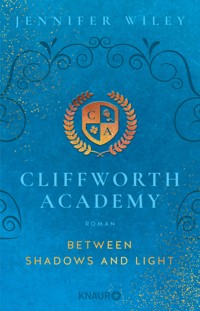9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Lullaby University
- Sprache: Deutsch
Ein geheimer Wunsch führt Hazel an die Lullaby University am wunderschönen Modoc National Forest in Kalifornien – und zum charismatischen Lewis … »In jedem Atemzug nur Du« ist der erste Liebesroman der einfühlsamen College-Romance-& New-Adult-Reihe »Lullaby University« von Jennifer Wiley. Mit dem Studienbeginn an der Lullaby University wird für Hazel ein Traum wahr. Nach ihrer Lungentransplantation hat sie sich gezielt dort beworben – und nicht nur, weil es eine Top-Uni für ihr Wunschfach Umweltwissenschaften ist … Über den für sie wichtigsten Grund, warum sie an der Lullaby University ist, spricht sie mit niemandem – bis sie Lewis kennenlernt. Seine ruhige, verlässliche Art beeindruckt sie so sehr, dass sie sich ihm anvertraut. Lewis verspricht, sie zu unterstützen – doch auch er trägt eine Last, von der sie nichts ahnt. Beide kommen sich näher und näher, bis sie eine Entdeckung machen, die sie auseinanderreißt … Jennifer Wiley hat mit ihrem ersten Band an der Lullaby University einen berührenden Liebesroman geschrieben. Intensiv und voll atemberaubender Naturschönheit des Modoc National Forest, für dessen Erhalt und Schutz Lewis und Hazel im Rahmen ihres Studiums der Umweltwissenschaften an der LBU alles geben. Der 2. College-Liebesroman innerhalb der zwei Bände umfassenden New-Adult-Reihe, »In jedem Augenblick ein Wir«, dreht sich um Lewisʼ Bruder Jasper und die perfektionistische Lou – und um eine ganz besondere Abmachung. »Eine einfühlsame Liebesgeschichte, die unter die Haut geht, ein atemberaubendes Setting und wichtige Themen. Alles, was ich mir von einem New-Adult-Roman wünsche!« Carina Schnell, SPIEGEL-Bestsellerautorin, über »In jedem Atemzug nur Du«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 530
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Jennifer Wiley
In jedem Atemzug nur Du
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Mit dem Studienbeginn an der Lullaby University wird für Hazel ein Traum wahr. Nach ihrer Lungentransplantation hat sie sich gezielt dort beworben – und nicht nur, weil es eine Top-Uni für ihr Wunschfach Umweltwissenschaften ist … Über den für sie wichtigsten Grund, warum sie an der LBU ist, spricht sie mit niemandem – bis sie Lewis kennenlernt. Seine ruhige, verlässliche Art beeindruckt sie so sehr, dass sie sich ihm anvertraut. Lewis verspricht, sie zu unterstützen – doch auch er trägt eine Last, von der sie nichts ahnt. Beide kommen sich näher und näher, bis sie eine Entdeckung machen, die sie auseinanderreißt …
»Eine einfühlsame Liebesgeschichte, die unter die Haut geht, ein atemberaubendes Setting und wichtige Themen. Alles, was ich mir von einem New-Adult-Roman wünsche!«
Carina Schnell, SPIEGEL-Bestsellerautorin
Inhaltsübersicht
Hinweis zu sensiblen Inhalten
Widmung
Playlist
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Danksagung
Liste sensibler Inhalte / Content Notes
Bei manchen Menschen lösen bestimmte Themen ungewollte Reaktionen aus. Deshalb findet ihr am Ende des Buches eine Liste mit sensiblen Inhalten.
Für meine Familie, die immer an meiner Seite ist.
Und vor allem für meinen Papa, dessen bedingungslose Liebe ich noch über den Tod hinaus jeden Tag spüre. Ich bin sicher, dass du bei der Erfüllung dieses Traums irgendwie deine Finger im Spiel hattest …
Playlist
Brooke Waggoner – I Am Mine
Shelly Fraley – Life Begins
Amy Stroup – Just You
Bess Rogers – What We Want
Katie Herzig – Lost and Found
Haley Klinkhammer – Landslide
The Saint Johns – Your Head and Your Heart
Gregory Alan Isakov – San Luis
Matthew Barber – You and Me
Catherine MacLellan – The Long Way Home
Tristan Prettyman – Say Anything
Jules Larson – You Know It’s True
Mariah McManus – Say It Again
Brooke Annibale – Under Streetlights
Kapitel 1
Lewis, hör verdammt noch mal auf, sauer auf mich zu sein! Ich kann nichts dafür, und das weißt du auch.«
Ich stehe wie erstarrt vor dem dreistöckigen roten Holzhaus und sehe zu dem offenen Fenster im ersten Stock. Wie ein Eindringling, der fremde Gespräche belauscht, auch wenn der weiße Briefkasten bereits meinen Namen trägt. Der Impuls, einfach abzuhauen, macht sich in mir breit, doch ich rühre mich nicht von der Stelle. Mein gelber Koffer steht ebenso verloren vor der Haustür wie ich selbst.
»Du willst es einfach nicht verstehen.«
»Ich? Du bist doch derjenige, der mir die Ohren volljammert und sich selbstbemitleidet. Hör auf, die Schuld bei mir zu suchen. Dein Versagen hast du dir selbst zuzuschreiben, Lewis. Weil du es einfach nicht gebacken bekommst!«
Irgendwo in der Ferne singt ein Vogel. Vielleicht ein verzweifelter Versuch, diesen Streit zu übertönen, der jedoch in dieser Sekunde noch lauter wird.
»Du bist ein arrogantes, selbstverliebtes Arschloch, Jasper. Schon immer gewesen!« Unwillkürlich halte ich die Luft an. »Ich weiß genau, dass du dich für etwas Besseres hältst.«
»Nun, in diesem Fall war ich besser, Bruderherz.« Jaspers Stimme wird schneidender, mein Unbehagen wächst. Ich wäre gerade gerne überall lieber als hier, und das nach rund acht Stunden Anfahrt. »Und ich habe keine Lust, mir jedes Mal aufs Neue dein Gejammer darüber anzuhören. Du bekommst nicht, was du willst? So ist das Leben, werde endlich erwachsen, und nerv mich nicht immer damit!«
Eine Sekunde lang ist es bedrohlich ruhig. Zu ruhig. Dann zerreißt ein »Du kannst mich mal!« die Stille.
Eine Tür wird krachend zugeschlagen, aus dem Fenster dringt ein Fluch. Unschlüssig sehe ich zu dem weißen Fensterrahmen hoch. Mein Blick fällt dabei auch auf die majestätischen Kiefern, die sich hinter dem roten Holzhaus erheben. Das Bild einer Idylle, die ebenso wenig zu dem Streit passt wie die Euphorie, die ich bis eben noch verspürt habe, endlich in Lullaby angekommen zu sein.
In diesem Moment wird die Haustür aufgerissen, und jemand stürmt heraus. Ich reagiere zu spät, kann nicht mehr ausweichen und spüre den Zusammenprall unserer Schultern schon wenige Sekunden später. Ein leises Keuchen von beiden Seiten, dann trifft mich sein Blick. Buchstäblich. Tiefblaue Augen, umrandet von dichten, dunkelbraunen Wimpern hinter einer runden Brille mit Goldgestell. Seine dunkelblonden, lockigen Haare, an einigen Stellen ausgeblichen vom Sommer, sind nach hinten gestylt. Nur eine einzige Locke fällt ihm ins Gesicht.
»Sorry«, murmele ich, selbst nicht sicher, ob ich damit meine, dass ich im Weg rumgestanden oder ihren Streit mit angehört habe.
Er blinzelt. Sein Zorn weicht ein wenig, dafür erkenne ich nun etwas wie Unsicherheit in seinem Blick. Doch ich kann es nicht näher ergründen.
»Nichts passiert«, sagt er. Seine Stimme, eben noch laut und kraftvoll, klingt nun deutlich zurückhaltender.
Ich öffne den Mund, um etwas zu erwidern, doch er richtet bereits sein Shirt, das durch unseren Zusammenstoß etwas verrutscht ist, nickt mir zaghaft zu und läuft den Kiesweg entlang. Weg von dem Haus, kein Blick zurück.
»Lewis! Warte!« Sein Bruder taucht an der Tür auf. Aber zu spät.
»Schon weg«, sage ich gepresst.
Verwirrt mustert er mich, als würde er mich jetzt erst wahrnehmen. Auch er hat blondes Haar, trägt es jedoch in einem Man Bun. Auf seinem rechten Arm entdecke ich unzählige Tätowierungen, die unter seinem T-Shirt-Ärmel verschwinden, wobei ich sicher bin, dass sie darunter noch weitergehen. Ein Schriftzug ragt aus dem Kragen den Hals hinauf. Der Streit hat Röte in seinem Gesicht hinterlassen. Wäre ich von meinem Bruder als arrogantes Arschloch betitelt worden, wäre ich wohl auch ziemlich durch den Wind. Zumal das Ganze vor Zuschauern stattgefunden hat. Mit dem Gefühl, fehl am Platz zu sein, trete ich von einem Fuß auf den anderen. So habe ich mir meinen Start in Lullaby nicht vorgestellt.
Jaspers Stimmung schlägt jedoch sofort um. Ein wirklich breites Lächeln taucht auf seinen Lippen auf, als er meinen Koffer entdeckt, der noch immer verlassen auf dem Kiesweg steht. »Du musst Hazel sein. Ich bin Jasper Branson, einer deiner neuen Mitbewohner. Sorry für eben. Komm doch rein.«
Ich nicke. Für einen kurzen Moment bin ich sprachlos, was so gut wie nie vorkommt. Doch dann straffe ich die Schultern und betrete das rote Holzhaus.
Ich finde mich direkt in einem offenen Raum wieder. Rechts erstreckt sich ein großer Wohnbereich mit einem Kamin, Sesseln, einem kleinen Tisch mit zwei Stühlen und einer Couch. Auf dem dazugehörigen Couchtisch liegen Stoffreste und Nähnadeln. Ob einer meiner neuen Mitbewohner näht? Das könnte praktisch sein, weil ich selbst bisher nicht mal einen simplen Knopf annähen kann. Links vom Wohnbereich befindet sich eine dunkelrote Küche, die durch einen großen Esstisch aus Holz abgerundet wird. Daneben gibt es zwei geschlossene Türen und eine Treppe aus Chrom, die in die oberen Stockwerke führt. Was aber vor allem meine Aufmerksamkeit auf sich zieht, ist die silberne Rutschstange, die direkt neben der Treppe angebracht ist. In der Broschüre der Lullaby University stand, dass sie ein Überbleibsel aus den Zeiten ist, als das hier noch ein Feuerwehrhaus war, bevor es irgendwann von der Uni aufgekauft und zu einem Wohnhaus umfunktioniert wurde.
Jasper folgt meinem Blick. »Ziemlich cool, oder? Du kannst sie gerne ausprobieren.«
»Dann darf man da runterrutschen?«, frage ich etwas ehrfürchtig.
»Klar.« Jasper grinst breit. Er wirkt absolut sympathisch, kein bisschen wie das eingebildete Arschloch, auf das ihn sein Bruder eben noch getauft hat. »Mache ich so gut wie jeden Tag. Die anderen nutzen aber meistens die Treppe.« Er sieht hoch, dann holt er tief Luft. »Lou! Corey! Hazel ist da!«
Bis gerade dachte ich, wir wären allein, doch ein Poltern ertönt, und kurz darauf werde ich von zwei überschwänglichen Küssen auf die Wange begrüßt.
»Corey St. James, dein zweiter Mitbewohner.« Ich komme kaum dazu, mir seine dunklen Afrolocken, seinen lichten Schnurrbart oder seine schlanke Figur genauer anzusehen, denn er gibt mir einen weiteren Kuss auf die rechte Wange, ehe er Jasper anblickt. »Wo ist denn ihr Gepäck? Noch draußen? Willst du das vielleicht mal reinholen, oder was?«
»Du hast recht.« Jasper verschwindet aus dem Haus.
»Hattest du eine lange Fahrt?«, fragt Corey. »Mr Peterson hat uns nur mitgeteilt, dass du später mit dem Studium beginnst als die anderen Erstsemester. Und wir haben erst gestern Abend erfahren, dass du heute kommst.«
»Ja, es war alles etwas chaotisch die letzten Wochen.«
»Wir freuen uns auf jeden Fall, dass du da bist. Lullaby wird dir sicher gefallen.« Corey klopft mir auf die Schulter. Dabei rieselt etwas Erde von seinen Händen auf meine Turnschuhe. »Sorry. Ich war gerade im Garten, hatte keine Zeit, mir noch die Hände zu waschen. Ich bin unser hauseigener Experte für ökologische Anpflanzung, musst du wissen.«
»Was pflanzen wir denn an?«
»Möhren, Zucchini, Kopfsalat, Rucola, Brechbohnen, Kürbis – was das Herz begehrt. Ich habe uns Hochbeete angelegt. Bei Gelegenheit zeige ich dir alles.«
»Aber nicht jetzt, Corey. Wir wollen Hazel ja nicht gleich überfordern«, wirft Jasper ein, der mit meinem Koffer zurück ins Haus gekommen ist.
»Ich könnte mir vorstellen, dass dir das mit deinem lautstarken Streit ohnehin schon wunderbar gelungen ist«, ertönt plötzlich eine Frauenstimme am oberen Ende der Treppe. Das muss Lou sein. »Das war nicht ganz der Empfang, den ich mir für dich vorgestellt hatte. Aber schön, dass du da bist.« Sie winkt mir zu, während sie herunterkommt. Ihre blonden schulterlangen Haare wippen bei jeder Bewegung mit, ebenso wie ihre drei langen Ketten, die sie über einer weißen Bluse und einer High-Waist-Jeans trägt. Doch ich habe nur Augen für ihr einnehmendes Lächeln und ihre unzähligen Sommersprossen, wie ich sie in dieser Anzahl noch nie an einem Menschen gesehen habe.
»Alles in Ordnung?«, fragt sie Jasper. »Das klang heftig.«
»Ich habe mich wohl etwas hinreißen lassen.«
»Nicht nur du«, sagt Corey. »Ich wusste gar nicht, dass Lewis so ausflippen kann. Sonst ist er ja nicht gerade ein Freund von vielen Worten.« Corey schüttelt den Kopf, dann sieht er zu mir und den anderen. »Aber genug von den zwei Streithähnen. Jetzt geht es um Hazel und ihr neues Zuhause.« Er hakt sich bei mir unter. »Zeit, dir dein Zimmer zu zeigen.«
»Ich mache erst mal einen Tee«, schlägt Lou vor. »Du magst doch Tee, oder? Dazu vielleicht ein paar Cookies? Ich habe erst letzte Nacht welche gebacken.«
»Tee ist toll«, erwidere ich. Lou geht sofort zur Küchenzeile, um den Wasserkocher anzuschmeißen.
Ich wende mich an Corey, der mich bereits die Treppe hinaufführt. »Sie backt nachts?«
»Ständig. Ihre Beschäftigungstherapie … wobei ich mich echt frage, wie sie es schafft, tagsüber die Augen offen zu halten, denn dann ist sie auch immer auf Achse. Komitees, Lerngruppen …«
»Mal abgesehen von ihren persönlichen Ambitionen und ihren stundenlangen Sessions an der Nähmaschine«, wirft Jasper ein, der ein paar Stufen vor uns ist und meinen Koffer trägt. Dann sind die Nähnadeln auf dem Couchtisch wohl von ihr.
»Ja, Lou ist irgendwie ein ziemliches Arbeitstier. Aber dafür ist immer frisches Gebäck im Haus.«
»Und sie backt fantastisch«, ergänzt Jasper.
Die Treppe führt uns über die erste Etage direkt unter das Dach. »Das ist das Zimmer von Lou«, sagt Corey und deutet auf eine geschlossene Tür. »Ihr teilt euch die obere Etage, Jasper und ich sind darunter. Leider habt ihr hier kein Bad, das ist ein Stockwerk tiefer, aber dafür einen schöneren Ausblick auf den Modoc National Forest.«
Jasper stellt meinen Koffer vor der anderen Tür ab, die offen steht.
»Das ist dein Zimmer. Ich würde sagen, du schaust dir erst mal alles in Ruhe an und lässt es auf dich wirken. Du musst ziemlich erledigt sein.«
»Und wie«, stoße ich aus. Genau in diesem Moment spüre ich die bleierne Müdigkeit in meinen Knochen. Acht Stunden in Bus, Bahn und Taxi in den ungemütlichsten Sitzpositionen und dazu eine kurze Nacht, weil ich vor Aufregung nicht schlafen konnte, liegen hinter mir. »Aber gleichzeitig bin ich auch viel zu nervös, um jetzt zur Ruhe zu kommen«, sage ich. »Ich hoffe, ich habe nicht zu viel verpasst und finde noch Anschluss. Zu spät zu kommen, ist an der Lullaby University nicht gerade die Regel, oder?«
»Eher nicht«, antwortet Jasper und bestätigt damit meine Befürchtung. Ich bin die Extrawurst, die sicher für Gesprächsstoff sorgt. »Aber an der LBU sind eigentlich alle ganz locker und nett. Du wirst schon sehen.«
»Außerdem sind wir ja auch noch da. Bei Red helfen wir uns gegenseitig«, sagt Corey und wirkt dabei aufrichtig.
»Das ist gut«, erwidere ich. Ich hatte schon Sorge, als eine der Stipendiatinnen des renommierten Red-Programms Konkurrenzkämpfe zu erleben.
»Komm einfach nach unten, sobald du willst. Lou hat dann sicher den Tee und die Cookies für dich. Sie kümmert sich gut … zu gut, wenn du meine immer enger werdenden Hosen fragst.«
»Meine auch.«
Corey schnaubt amüsiert. »Jasper, bei deinem Sportpensum, das du immer absolvierst, nimmst du niemals zu.«
»Ich habe zugenommen, seit Lou hier lebt.«
»Stimmt, dein kleiner Finger ist etwas aus der Form geraten.«
Den beiden zuzuhören, hat etwas von einer ganz persönlichen Comedy-Nummer. Wie beim Tennisspiel sehe ich zwischen ihnen hin und her. Ihre Energie ist ansteckend, aber gleichzeitig bin ich auch viel zu überfordert von allen Eindrücken, als dass ich sofort mitmischen könnte.
»Okay, okay. Ich denke, das klären wir später«, sagt Jasper. »Kümmere dich lieber mal um dein Gemüse, sonst habe ich nachher nichts, aus dem ich die Suppe kochen kann.«
»Bin schon dabei. Hazel hat ja auch erst mal alles, was sie braucht.« Corey sieht zu mir. »Richtig?«
»Klar, danke euch«, sage ich.
Jasper kratzt sich etwas unbeholfen am Hinterkopf, bis Corey ihn anstupst. Er nickt mir aufmunternd zu, dann gehen die beiden die Treppe hinunter. Coreys Stimme wird leiser, während er irgendetwas von seiner Gartenarbeit erzählt, und plötzlich umgibt mich die Ruhe, nach der ich mich sehne. Nach einem Moment nur mit mir und meinen Gedanken.
Mein Zimmer ist klein und verwinkelt. Direkt unter dem Fenster steht ein Schreibtisch mit Blick auf den Kiefernwald. Corey hat nicht untertrieben, als er gesagt hat, die Aussicht wäre schön. Kurz verschlägt es mir den Atem, als ich das Fenster weit öffne, um den Kiefernduft hereinzulassen. Augenblicklich dringt Vogelgezwitscher zu mir durch. Ansonsten höre ich nichts, sehe nichts. Nur Grüntöne und ein Stückchen freien Himmel über dem Modoc National Forest, der an Lullaby angrenzt und bald Teil meiner Studienzeit sein wird. Absolute Natur, absolut friedvoll. Ein Kontrastprogramm zum vierhundert Meilen entfernten San José mit Meeresbuchten und Hochhäusern.
Nur widerwillig löse ich mich davon und sehe mir das schwarze, verschnörkelte Bettgestell an, das auf der anderen Seite des Zimmers steht. In der hintersten Ecke befindet sich eine Kleiderstange. Ein paar eingerahmte Fotos von Pflanzen zieren die Wand daneben. Ich weiß nicht, ob sie von einer ehemaligen Bewohnerin sind oder ob sie zur Einrichtung gehören, aber sie gefallen mir. Sie erinnern mich an Sauerstoff. Ans Leben.
Nachdenklich stelle ich meinen Rucksack ab und nehme meine Mappe heraus, in der sich die Unibroschüre und mein Studienausweis befinden. Aber das ist es nicht, was meine Aufmerksamkeit fordert, sondern mein kleines schwarzes Notizbuch, das ich daraus hervorziehe. Behutsam lege ich es auf den Schreibtisch und setze mich, halte kurz inne, um die kleine Brise, die durch das offene Fenster dringt, willkommen zu heißen. Genau wie meine Gedanken, die ich während der gesamten Fahrt hierher zurückhalten konnte. Ich öffne das Notizbuch und falte den Zeitungsartikel auf, den ich zwischen die Seiten geschoben hatte.
Drei Studentinnen verunglücken bei Autounfall
Dienstag, der 3. November 2020.
Drei Studentinnen der renommierten Lullaby University gerieten am frühen Abend in ein Unwetter und kamen von der Straße ab. Der Wagen prallte gegen einen Baum, alle drei Studentinnen erlagen ihren Verletzungen noch in derselben Nacht im nahe gelegenen Krankenhaus. Die Studierenden und Lehrenden der Universität sowie die ganze Stadt Lullaby trauern. Hunderte von Kerzen und Blumen wurden auf dem Campus niedergelegt. Der Bürgermeister Jackson Fridge hat angekündigt, die Glocken des Rathauses zu Ehren der Verstorbenen läuten zu lassen.
Es gibt keine Bilder der Studentinnen, nur diesen kleinen Text, gequetscht auf die untere Reihe einer zwei Jahre alten Tageszeitung. So nichtssagend, und doch verrät er mir alles. Genug, um hierherzukommen. Genug, um zu wissen, dass eine von ihnen der Grund ist, wieso ich überhaupt hier sein kann.
Unwillkürlich lege ich eine Hand auf meinen Brustkorb, spüre, wie er sich hebt und senkt. Wie die Lungenflügel arbeiten, mich mit Sauerstoff versorgen. Meine Lunge. Ihre Lunge. Die Lunge von Ms X. In meinem Kopf heißt sie so, stellvertretend für ihren echten Namen, den ich nicht kenne.
Ich weiß über Ms X nur drei Dinge:
Sie hatte einen Unfall, nach dem sie für hirntot erklärt wurde.
Sie war an der Lullaby University.
Ohne ihre Organspende wäre ich vermutlich längst nicht mehr am Leben.
Kapitel 2
Mit dem Handy in der Hand laufe ich durch das alte Feuerwehrhaus, hin und her, von der Couch zum Esstisch zur Treppe, meinen Blick starr auf den durchgestrichenen Kreis in der rechten Ecke des Displays geheftet. Absolutes Funkloch.
»Kein Balken in Sicht?«, fragt Corey, der gerade den Tisch für das Abendessen deckt. Die Suppe, die Jasper mit dem Gemüse aus dem Hochbeet zubereitet hat, köchelt bereits auf dem Herd. »Versuch es mal da vorne am Kamin, da habe ich manchmal Glück.«
Ich befolge seinen Rat, habe jedoch kein Glück, weshalb ich mich weiterhin nicht bei meinen Eltern melden kann. In ihrer Vorstellung liege ich sicher schon verletzt im Straßengraben.
»Hoffentlich findet Lou gleich die Zugangsdaten fürs WLAN«, seufze ich und gebe es auf, mein Handy in sämtlichen Positionen in die Luft zu halten.
»Wird sie«, sagt Corey, der gerade die Teller platziert. »Lou ist ein Organisationsfreak, sie muss nur erst den dicken Ordner mit all den Unterlagen durchgehen, aber sie hat alles fein säuberlich abgeheftet.«
»Ganz recht«, antwortet Lou, die am Ende der Treppe auftaucht, in der Hand einen vielversprechenden Zettel. »Hab alles gefunden: Passwort und Zugangsberechtigungscode.«
»Super, danke.« Ich nehme den Zettel entgegen und tippe die Daten in mein Handy, während Lou Corey dabei hilft, das Besteck aus einer der Schubladen zu holen. Kaum dass ich mich ins WLAN einwähle, geht schon ein Videocall meiner Mom ein. Das war ja klar.
»Hey«, sage ich, als ich ihn annehme. Das Gesicht meiner Mutter erscheint auf dem Display, viel zu nah, sodass ich beinahe jede Pore sehen kann.
»Hey?«, fragt meine Mutter etwas zu schrill. »Ich habe schon fünfmal angerufen. Von meinen Nachrichten ganz zu schweigen.«
Lou und Corey sehen amüsiert zu mir. Sicher halten sie meine Mutter jetzt für eine Glucke.
»Entschuldige«, sage ich zähneknirschend und drehe mich ein wenig ins Licht, damit sie mich besser sehen kann, »aber hier ist ein riesiges Funkloch. Meine Mitbewohnerin musste erst die Zugangsdaten fürs Internet heraussuchen.«
»Ein Funkloch? Das gefällt mir nicht. Was machst du im Notfall? Ich habe dir doch gleich gesagt, dass dieses Lullaby viel zu abgeschieden liegt. Die nächste Klinik ist meilenweit entfernt, und jetzt hast du nicht mal Empfang.«
»Ganz ruhig, Mom. Erstens: So weit ist es nicht bis zur Klinik. Und zweitens: Notrufnummern gehen in der Regel auch ohne Empfang.«
Mir ist die Aufmerksamkeit von Corey und Lou mit jedem Wort bewusst. Meine Mutter reagiert wieder einmal über. Etwas beschämt nicke ich den beiden zu und gehe hoch in mein Zimmer. Zum Glück hält die Verbindung.
»Außerdem hat die Uni sicher irgendwo Festnetztelefone«, fahre ich fort, kaum dass ich die Zimmertür hinter mir geschlossen habe. »Abgesehen davon, dass meine Ärztin fußläufig zu erreichen ist. Also mach dir bitte keine Sorgen.«
»Okay, okay, du hast recht. Das war eine Spur zu viel.« Ein Knacken ertönt, kurz drauf wackelt das Bild, als das Handy abgestellt wird. Nur wenige Sekunden später kann ich meine Mutter endlich vollständig sehen und habe freien Blick auf ihre braunen Augen und die kleine Stupsnase, die mir auch bei meinem Spiegelbild begegnen. Ihre schwarz-grauen Haare trägt sie heute in einem Dutt. Sie seufzt schwer. Auf ihren Lippen zeichnet sich ein kleines Lächeln ab, auch wenn es erschöpft wirkt.
»Ich muss mich nur noch an die neue Situation gewöhnen.«
»Ich weiß.«
So oft haben wir darüber geredet, und so oft habe ich mir die Bedenken meiner Eltern angehört. Ihre Einwände, weil sie mich nach meiner Transplantation in ihrer Nähe wissen wollten. Nur das Stipendium und die Tatsache, dass ich Umweltwissenschaften studieren wollte und es sich bei der LBU um die beste Uni in Sachen Umweltschutz handelt, konnte sie umstimmen.
Wir haben gemeinsam mit der Klinik und mit der Ärztin hier gesprochen. Ich bin vorbereitet aufgebrochen. Das wissen sie ebenso wie ich, aber sie bleiben eben besorgte Eltern.
»Zu Thanksgiving komme ich wie geplant nach Hause«, sage ich. »Bis November ist es doch gar nicht mehr so lange.«
Bevor meine Mutter antworten kann, ertönt eine tiefe Stimme.
»Lass mich auch mal ins Bild. Na komm schon, ich will mit meiner Tochter sprechen.«
Ich lache leise. »Hey, Dad.«
Mein Vater taucht auf, seine Halbglatze noch ein wenig verschwitzt, weil er scheinbar gerade von seiner wöchentlichen Tennisstunde kommt. »Maus. Wie geht es dir? Wie war die Fahrt? Wie ist Lullaby?«
Sofort lächle ich bei dem Spitznamen, den mein Dad mir gegeben hat, als ich zwei Jahre alt war.
»Mir geht’s gut. Lullaby würde dir gefallen. Du glaubst gar nicht, wie still es hier ist. Kein Autolärm, keine Flugzeuge. Nur Vogelgezwitscher und ein sanfter Wind, der nach Kiefern duftet. Und ich habe auf dem Weg hierher keine einzige Baustelle gesehen.«
»Was? Hier ist schon wieder eine neue. Ich bin heute Morgen deswegen zehn Minuten zu spät bei der Arbeit gewesen.«
»Das würde dir hier sicher nicht passieren. Und dieser Wald … ich kann ihn direkt von meinem Fenster aus sehen. Warte.« Ich drehe das Handy, sodass die Kamera die Kiefern erfasst. »Siehst du das?«
»Das sieht wundervoll aus.«
»Ich will es auch sehen«, beschwert sich meine Mutter und kommt wieder ins Bild.
»Ich mache ganz viele Fotos und schicke sie euch.«
»Auf jeden Fall.«
»Hast du die anderen schon mit philippinischen Spezialitäten verwöhnt?«
»Mom, ich bin doch gerade einmal zwei Stunden hier. Da reiße ich bestimmt nicht sofort die Küche an mich. Aber ich werde ihnen schon noch zeigen, was du mir beigebracht hast.«
Unten höre ich Jasper lachen.
»Ich fürchte, ich muss jetzt Schluss machen. Einer von meinen Mitbewohnern hat gekocht, das will ich an meinem ersten Abend nicht verpassen.«
»Klar, das solltest du dir nicht entgehen lassen«, sagt mein Dad. »Genieß es.«
»Und melde dich, so oft du kannst«, schiebt meine Mutter hinterher.
»Versprochen. Grüßt Gavin von mir.«
Meine Eltern winken in die Kamera. »Pass auf dich auf. Wir hören uns.«
Heimweh keimt kurz in mir auf, und doch lächle ich tapfer und lasse mir nichts anmerken, weil das Moms Sorge um mich nur wieder anfachen würde.
»Macht’s gut.«
Ich lege auf und atme tief durch, aber die Tränen schwimmen dennoch in meinen Augen. Es ist verrückt, denn ich will um jeden Preis hier sein. Ich bin glücklich, und doch wird mir jetzt erst bewusst, dass rund vierhundert Meilen zwischen meinen Eltern, meinem kleinen Bruder und mir liegen. Es belastet mich ebenso wie die Lügen, die zwischen uns stehen. Wenn sie auch nur die geringste Ahnung hätten, warum ich wirklich hier bin, hätten sie mich vermutlich nie fahren lassen.
Ich sammle mich wieder und gehe runter in die Küche, wo die anderen bereits am Tisch sitzen, vor ihnen dampfende Schüsseln. Mit einem unsicheren Lächeln setze ich mich an den freien Platz und begutachte die Tomatensuppe.
»Alles in Ordnung?«, fragt Corey. »Deine Mutter klang ziemlich panisch.«
»Ja, alles bestens. Sie ist nur etwas nervös, weil ich so weit weg studiere.«
Wir beginnen zu essen. Die Suppe schmeckt herrlich intensiv, sie ist cremig, und ich liebe die Konsistenz. Jasper reicht einen Brotkorb herum.
»Du kommst aus San José?«, fragt Lou. »Mr Peterson hat so etwas erwähnt.«
»Genau. Meinen Eltern wäre es lieber gewesen, wenn ich mir ein Community College vor Ort gesucht hätte.«
»O ja«, Corey nickt. »Meine Eltern waren am Anfang auch nicht so begeistert mit meiner Uniwahl. Aber inzwischen haben sie sich damit abgefunden, dass sie mich nicht mehr so oft zu Gesicht bekommen.«
»Und wie hast du das geschafft?«, will ich wissen.
»Mit meinem unfassbaren Charme.«
»Und seiner unglaublichen Bescheidenheit«, ergänzt Jasper grinsend. Er ist der Einzige von uns, der nicht aufrecht auf dem Stuhl sitzt, sondern ein Bein locker angewinkelt hat.
»Ignoriere die beiden«, sagt Lou. »Das geht den ganzen Tag so.«
»Ist doch erfrischend«, erwidere ich. Immerhin vertreiben sie das Heimweh mit ihrer guten Laune.
»Hast du gehört? Wir sind erfrischend«, wiederholt Jasper.
»Nur wenn man euch nicht ständig zuhören muss.«
»Ach komm, Lou.« Jasper lehnt sich zu ihr. »Du liebst es doch, wenn wir so sind.«
Sie lächelt verschmitzt. »Nun gut, ein bisschen vielleicht. Alles andere wäre wohl langweilig.«
Corey dippt sein Brot in die Suppe, dann sieht er zu mir. »Also, Hazel. Nicht viele treten das Studium neun Tage zu spät an. Sehr geheimnisvoll. Was steckt dahinter?«
Ich lege meinen Löffel ab. »Leider ist das Ganze nicht so spannend, wie du vielleicht denkst. Ich war in einer Klinik.«
»Fehlt dir etwas?«, fragt Lou besorgt.
Ich entscheide mich für den direkten Weg. Besser mit offenen Karten spielen. »Ich habe eine Stoffwechselerkrankung namens Mukoviszidose.«
»Mukoviszidose«, wiederholt Lou leise. »Davon habe ich schon mal gehört.«
»Es ist ein Ungleichgewicht im Salz-Wasser-Haushalt meiner Zellen. Das heißt, die Schleimschichten, die um die Organe liegen, haben bei mir zu wenig Wasser und werden zäh«, spule ich die Definition meiner Krankheit ab, als wäre es das Suppenrezept von Jasper. »Das betrifft vor allem die Bauchspeicheldrüse, die Leber und die Lunge.« Bloß nicht zu viele Emotionen, damit die drei sich nicht sorgen. Oder mich zu mitfühlend ansehen. So wie jetzt gerade. Taktik verfehlt.
»Das klingt übel«, murmelt Corey. »Und in der Klinik versuchen sie, das zu verhindern?«
»Verhindern können sie es nicht, aber zumindest die Symptome lindern.«
Kurz ist es still am Tisch, und ich hasse alles an dieser Stille. Das ist die fehlende Normalität, die ich befürchtet hatte.
»Aber jetzt bin ich hier, mir geht es gut, und im Großen und Ganzen könnt ihr einfach wieder vergessen, was ich euch gerade erzählt habe. Ich will nicht die kranke Studentin sein, sondern einfach nur Hazel, okay?«
»Gut«, sagt Jasper, zieht jedoch eine Augenbraue nach oben. »Aber was genau heißt, im Großen und Ganzen?«
Also dann doch die volle Bandbreite an Erklärungen. »Ihr werdet mich vermutlich häufiger mit Desinfektionsmittel sehen«, sage ich, immer noch um eine unbekümmerte Miene bemüht. »Wenn ihr einen Infekt habt – und sei es noch so eine kleine Erkältung –, wäre es gut, wenn ich das sofort weiß und entsprechend auf Abstand gehen kann. So was kann für mich gefährlicher werden als für gesunde Menschen.«
»Okay. Kriegen wir hin.«
»Ansonsten ist da noch die Ernährung.« Ich seufze. Ein Thema, das mit meiner Transplantation zu tun hat, nicht mit meiner Mukoviszidose, aber nach außen hin lasse ich mir diese Unwahrheit nicht anmerken. »Ich darf bestimmte Lebensmittel nicht essen. Eine ziemlich lange Liste, ehrlich gesagt. Wir können gerne vereinbaren, dass ich für mich selbst einkaufe und koche, damit hätte ich kein Problem.«
»Quatsch«, sagt nun Lou. »Gib uns diese Liste, und wir halten uns daran. Hier kochen und essen wir immer zusammen, sofern es unsere Zeit zulässt. Wir nehmen auch auf Coreys Erdnussallergie Rücksicht, warum sollten wir das dann bei dir nicht machen?«
»Weil ihr auf noch ganz andere Sachen verzichten müsstet als nur Erdnüsse. Es betrifft zum Beispiel Walnüsse, Pistazien, Sprossen, Trockenobst, rohe Pilze und mehr.«
»Ganz egal.« Sie sieht fragend zu den Jungs. »Oder?«
»Klar, einfach her mit der Liste. Die können wir dahinten ans Infoboard pinnen.« Jasper deutet auf ein Gitter neben dem Kühlschrank, an das verschiedene Notizen geheftet sind. Terminübersichten, daneben Einkaufslisten und Stundenpläne.
»Sind diese Terminpläne für Red?«, frage ich, froh, die Aufmerksamkeit auf etwas anderes lenken zu können.
»Ja. Mr Peterson gibt uns immer Monatspläne mit den Terminübersichten. Eigentlich bekommen wir alles digital, aber Lou besteht darauf, die Pläne auszuhängen.« Jasper rollt theatralisch mit den Augen, als wäre das eine massive Einschränkung seines Alltags.
»Weil ich euch zwei Chaoten kenne. Was ihr nicht täglich seht, vergesst ihr.«
»Wir?«, fragt Corey entrüstet. »Niemals.«
»Wieso muss ich euch dann immer an die Termine erinnern?«
»Bequemlichkeit«, lacht Jasper.
»Ihr würdet auch wirklich blöd aus der Wäsche gucken, wenn ich es nicht mehr tun würde.«
»Du lässt uns doch nicht hängen, oder? Das würdest du uns nicht antun.«
»Überlege ich mir noch«, entgegnet Lou trocken und beißt in ihr Brot. Jasper und Corey tauschen Blicke, dann beginnen alle drei zu lachen. Die Aufregung rund um meinen Start in Lullaby legt sich ein wenig, nun, wo ich hier bin und erlebe, wie ausgelassen die Stimmung zwischen meinen Mitbewohnern ist. Ich kann es kaum erwarten, ein richtiger Teil davon zu sein. Nur die Nervosität wegen der Studien- und Stipendiumsinhalte bleibt. Das Red-Stipendium ist ein renommiertes Programm, das den Teilnehmenden großartige Chancen bietet, ihnen aber auch einiges abverlangt.
»Wann bekomme ich denn meinen Plan?«
»Das wird nicht lange dauern. Du hast sicher in den nächsten Tagen einen Termin beim Dekan.«
Tatsächlich habe ich bereits eine entsprechende Mail bekommen. Darin fand sich nicht nur mein Stundenplan für die Vorlesungen, sondern auch Termine mit meinem Tutor und mit Mr Peterson. »In zwei Tagen, soweit ich weiß.«
»Dann gibt er dir eine Einweisung, bevor du deine ersten Extraaufgaben für Red bekommst.«
Ich nehme ein Stück Brot, um es in die Suppe zu tunken. »Dieses Stipendium mit all seinen Anforderungen ist noch etwas furchteinflößend«, gebe ich zu.
»Ach, keine Angst. Wir waren alle nervös bei unseren ersten Aufträgen, aber man gewöhnt sich schnell daran.«
»Ich für meinen Teil würde mir sogar mal wieder eine Herausforderung wünschen«, sagt Jasper. Er schiebt seinen Teller von sich und winkelt sein Bein erneut an, als würde er damit seine lockere Einstellung unterstreichen wollen.
»Sag das besser nicht zu laut«, meint Corey.
»Die meisten Aufträge sind Pressetermine, wenn ich Mr Peterson richtig verstanden habe?«, frage ich. Als der Dekan mir bei einem unserer Telefontermine das Programm und meine Aufgaben erklärt hat, war ich gedanklich so bei Ms X, dass ich viele Infos sofort wieder vergessen habe.
»Fototermine, Interviews, manchmal auch Videoaufnahmen«, spult Jasper herunter. »Meistens präsentieren wir einfach die Arbeit an der LBU. Manchmal ist auch eine persönliche Note gewünscht, sodass wir mehr von unserem normalen Unileben zeigen.«
»Und dann gibt es da noch die Unternehmer«, ergänzt Corey.
»Die führen wir herum, zeigen ihnen den Campus und bringen sie so – im besten Fall – dazu, mit der Uni zusammenzuarbeiten.«
»Finanzspenden«, erklärt Jasper auf meinen fragenden Blick hin. »Die LBU wird zu fast neunzig Prozent aus Spenden finanziert. Sie geben uns Geld, dafür können sie sich damit brüsten, sich für Nachhaltigkeit einzusetzen.«
»Aber ist das nicht Greenwashing?« Erst neulich habe ich einen Bericht darüber gelesen, dass Unternehmen sich ein vermeintlich umweltfreundliches Image verpassen, ohne die eigentliche Arbeit dafür zu leisten.
»Keine Sorge, Mr Peterson schaut sich die Firmen, die mit uns kooperieren wollen, ganz genau an«, sagt Lou.
»In solchen Sachen kannst du der Uni vertrauen«, meint auch Corey. Eigentlich hätte mich alles andere auch gewundert. Selbst wenn ich mich in vielerlei Hinsicht recht unvorbereitet fühle, weiß ich zumindest eins mit Sicherheit: Die Lullaby University ist eine der Vorzeige-Unis der USA, wenn es um Umweltschutz und die entsprechenden Forschungen geht. Schlechte Recherche bei Kooperationen können sie sich vermutlich kaum erlauben.
»Du bist für Umweltwissenschaften eingeschrieben, oder?«, fragt Lou.
Ich nicke, weil mein Mund voller Suppe ist.
»Genau wie ich«, sagt Jasper.
Hastig schlucke ich hinunter und versenge mir fast den Gaumen. »Das trifft sich gut. Wenn ich mal Fragen habe oder beim Lernen nicht weiterkomme, dann kenne ich jemanden, der das alles schon durchgenommen hat.«
»Wobei ich beim Lernen immer auf Lou setzen würde«, sagt Corey. »Sie lernt so organisiert wie kein anderer Mensch.«
Jasper grinst. »Ein Lernkarten-Monster.«
Lou zieht eine Augenbraue hoch. »Die dir damit schon oft geholfen hat, also sag besser nichts dagegen.«
»Würde ich doch nie tun.«
»Dann studiert ihr alle Umweltwissenschaften?«
»Nein, ich bin in Landschaftsökologie«, antwortet Corey.
»Ich studiere Umweltmanagement«, sagt Lou.
»Es gibt nur diese drei Studiengänge, oder?«, frage ich und gehe im Geist noch mal sämtliche Informationen durch, die ich über die LBU habe. Ausgelegt auf Umweltschutz, drei Studiengänge in vier Jahrgängen. Insgesamt vierhundert Studierende – und ich bin nun eine davon. Es fühlt sich immer noch ein wenig surreal an.
»Genau«, beantwortet Lou meine Frage. »Als die Uni vor dreißig Jahren gegründet wurde, war sie noch deutlich kleiner. Damals gab es nur ein paar Studierende mit dem Schwerpunkt Umweltwissenschaften, aber mit der Zeit sind immer mehr Kooperationen und Forschungsschwerpunkte dazugekommen.«
»Und was macht man beim Umweltmanagement?«, frage ich Lou.
»Wir lernen, wie die gesetzlichen Vorgaben in Sachen Umweltschutz aussehen und wie ein Unternehmen entsprechend agieren kann.«
Jasper legt einen Arm um sie. »Lou wird irgendwann ein nachhaltiges und fair produzierendes Modelabel gründen.« Mir entgeht nicht, dass sich Lous Haut unter den dichten Sommersprossen rosa färbt. Schwer zu sagen, ob es an der Aufmerksamkeit oder an Jaspers Arm auf ihrer Schulter liegt.
»Wir stehen schon in den Startlöchern, um Werbung zu machen«, sagt Corey.
»Das könnte ich sicher auch gut. Meine Mutter sagt immer, dass ich jeden überzeugen kann, wenn ich einmal anfange zu quatschen.«
Lou lächelt mich an. »Noch ist es nur ein Traum«, erwidert sie und fährt sich etwas unbeholfen über ihre weiße Carmen-Bluse, die in Kombination mit ihrer High-Waist-Jeans ihre Silhouette betont.
»Es wird großartig laufen bei deinem Talent«, sagt Jasper, der kurz ihre Schulter drückt, ehe er den Arm wegzieht. »Das prophezeie ich dir schon seit Monaten.«
»Du solltest ihre Entwürfe sehen, Hazel. Lou wird richtig Karriere machen«, bekräftigt Corey. »Genau wie ich. Der berühmteste Gemüseanbauer der Welt. Mit meinen Tomaten gewinne ich sicher bald Preise.«
»Ich weiß nicht«, meint Jasper. »Manchmal sehe ich dich eher als Comedian.«
»Schön, dass du meinen Humor so schätzt, aber ich denke, das mit dem Gemüse würde mich mehr erfüllen.«
»Hauptsache, du hast ein Ziel«, sagt Jasper und greift nach seinem Wasserglas.
Ich verkneife mir ein Grinsen. In der WG zu leben wird definitiv Spaß machen.
Am nächsten Morgen betreten Lou und ich gemeinsam den Campus, der von unserem Wohnhaus aus nur ein paar Gehminuten entfernt liegt. Vier Flachdachgebäude aus Holz verteilen sich über ein weitläufiges, von Kiefern übersätes Gelände, auf dem in regelmäßigen Abständen kleine Holzbänke und -tische aufgestellt sind. Es ist laut und wuselig, viele der vierhundert Studierenden scheinen auf dem Weg zu ihren Vorlesungen zu sein. Ich scanne beinahe hektisch die Menschen, die Bäume, die kleinen Vögel in den Baumkronen und die Gebäudekomplexe. Dabei fühle ich mich gleichermaßen überfordert und euphorisch.
»Wow. Das fühlt sich so nach … Uni an«, sprudelt es aus mir heraus. Ich habe den Campus zwar schon auf diversen Fotos gesehen, aber wirklich hier zu sein, ist eine ganz andere Nummer. »Stimmt es, dass die anderen Studierenden direkt hier auf dem Campus wohnen?«
»Tun sie. In jeder der Bauten gibt es Vorlesungsräume und einen Wohnblock. Gebäude B hier vor uns ist am größten, dort findest du dann auch das Büro von Mr Peterson, die Mensa und ein Lernfoyer.«
»Da sind wir bei Red ja relativ weitab vom Schuss, oder?«
»Wir haben den weitesten Weg zu den Vorlesungen. Aber dafür befindet sich neben unserem Wohnhaus direkt das Forschungslabor eins.«
»Dieses kleine Holzhäuschen?« Es ist mir gestern bei meiner Ankunft aufgefallen, ich hatte es aber mehr für einen zu groß geratenen modernen Geräteschuppen gehalten.
Lou winkt im Vorbeigehen einigen Leuten zu, dann richtet sie ihre Aufmerksamkeit wieder auf unser Gespräch. »Wir haben drei davon. Die beiden anderen befinden sich direkt neben dem Gebäude A, wo die Erstsemester untergebracht sind. Na ja, außer dir als Stipendiatin vom Red-Programm natürlich.«
Ich wusste zwar, dass mit dem Stipendium Besonderheiten verbunden sind, aber dass wir in einer derartigen Sonderposition sind, war mir nicht bewusst. Irgendwie beängstigend und cool zugleich.
»Das Labor neben unserem Wohnhaus nutzen eigentlich nur die Leute aus den fortgeschrittenen Semestern für ihre Forschungen«, erklärt Lou weiter. »Für Lehrveranstaltungen werden die Labore zwei und drei genutzt.«
»Was wird da gemacht?«, frage ich und sehe mich nach einem der beiden Häuschen um, doch ich erkenne nur Holzbänke, Tannen und das Gebäude A, auf das wir zusteuern.
»Da werden unter anderem Proben aus dem Modoc National Forest analysiert.«
Darüber habe ich gelesen. »Um festzustellen, inwieweit der Tourismus Auswirkungen auf die Natur hat, richtig?«
»Genau. Du wirst auch noch das Vergnügen haben. Die Probenanalyse gehört zu den Grundkursen.«
Wir erreichen Gebäude A, in dem die meisten Vorlesungen für Umweltwissenschaften stattfinden, und weichen dabei einigen Studentinnen aus.
»Hey, Lou«, sagt eine von ihnen. »Kommst du später mit in die Mensa?«
Lou nickt ihr zu. »Halte mir einen Platz frei, ja?«
»Du kennst hier echt viele Leute«, entfährt es mir.
»Das liegt an den ganzen Gremien und Komitees.«
Ich habe keine Ahnung, welche Gremien Lou meint, aber sie stößt schon die Flügeltür zum Gebäude auf und fegt damit alles andere aus meinem Kopf.
Pflanzenkübel zieren den langen, breiten Flur. An den Wänden hängen eingerahmte Fotografien, die Momentaufnahmen des Unialltags zeigen: ein paar Leute mit Probebehältern, ein paar mit Müllbeuteln und Greifzangen, offenbar im Forest aufgenommen. Auf einem der Bilder werden gerade neue Bäume gepflanzt. Unwillkürlich denke ich an Ms X. In meiner Vorstellung hat sie noch kein Gesicht, sie ist nur ein Phantom. Eine dunkle Silhouette, die darauf wartet, von mir eine Identität zu bekommen. Trotzdem versuche ich, sie mir bei all diesen Aktivitäten vorzustellen. War hier ihr Platz? Ist sie ebenso über den Campus gegangen wie Lou gerade, von allen gekannt und geliebt? War sie wirklich ein Teil von alldem? Ich schlucke bei dem Gedanken, doch ich komme nicht dazu, ihm länger zu folgen. Lou bleibt so plötzlich stehen, dass ich fast in sie hineinlaufe.
»Da wären wir.« Sie deutet auf eine Doppelschwingtür, die zu einer Seite offensteht und den Blick auf einen Hörsaal freigibt. »Umweltbiologie bei Dr. Livings. Sie ist klasse, es wird dir sicher gefallen.«
»Danke fürs Bringen.«
»Kein Problem. Wenn du in der Mittagspause Gesellschaft möchtest, findest du mich in der Mensa.«
»Danke«, sage ich noch mal. »Vielleicht schaue ich vorbei. Mal sehen, wie es läuft.«
»Super. Dann muss ich jetzt auch los. Bis später.«
Lou verlässt das Gebäude, um zu ihrem eigenen Vorlesungssaal zu gehen. Ich hingegen trete durch die Schwingtür. Dr. Livings, eine Frau mit ergrautem Dutt und einer kleinen silbernen Brille, steht bereits an ihrem Pult, spricht jedoch noch mit einem Studenten. Ich husche an ihnen vorbei und suche nach einem freien Platz. Die meisten hier sind bereits in Gespräche verwickelt. So fühlt es sich also an, die Nachzüglerin zu sein und noch niemanden zu kennen, während die anderen schon neun Tage Zeit hatten, sich untereinander zu vernetzen. Konzentriert sehe ich mich um und entdecke eine Studentin in der letzten Reihe. Sie ist die Einzige, die allein sitzt. Ihren Kopf zieren dunkelrote Kopfhörer, und sie trommelt mit einem Stift auf den Tisch. Ihre brustlangen Braids schwingen bei jeder ihrer Bewegungen ein wenig mit.
»Entschuldige?«
Ich tippe sie an, sie sieht auf. Ihre Augen sind bronzefarben und warm, ihre Haut braun, und auf ihren Lippen liegt ein zaghaftes Lächeln, als sie mich mustert. Mit einer Handbewegung nimmt sie die Kopfhörer ab, aus denen laute Gitarrenklänge zu hören sind.
»Kann ich mich vielleicht neben dich setzen?«
»Na klar.« Sie nimmt ihre Tasche vom Platz neben sich und schaltet ihre Kopfhörer aus, dann mustert sie mich neugierig. »Dich sehe ich hier zum ersten Mal.«
»Ich bin Hazel.«
»Reese«, stellt sie sich vor. »Am Vormittag Studentin, nachmittags Aushilfskellnerin im Hopes’ Inn, dem besten Diner der Stadt … und dem einzigen.« Ihre offene Art ist mir direkt sympathisch.
»Ist das Essen dort gut?«
»O ja, hervorragend. Unser Koch Wade ist der Hammer. Er macht wirklich alles selbst – jede Soße, jeden Dip. Er weiß von jedem Lebensmittel, wo es herkommt. Kann ich wirklich empfehlen.«
Ich mustere Reese, die gar nicht wirkt, als wäre sie im ersten Semester. Eher, als wären diese Kleinstadt und die Uni schon lange Teil ihres Lebens.
»Kommst du hier aus Lullaby?«, frage ich.
»Wieso? Wirke ich so auf dich?« Reese schmunzelt. »Eigentlich bin ich auch erst vor zwei Wochen hergezogen. Mein Cousin Shawn studiert aber auch hier, dadurch kenne ich mich schon ein bisschen aus.«
Der Student, der sich mit Dr. Livings unterhalten hat, setzt sich auf einen Platz. Einige Nachzügler kommen in den Raum, der sich immer mehr füllt.
»Dann ist dein Cousin in den höheren Semestern?« Es muss schön sein, jemanden aus der Familie hier zu wissen.
»Im dritten Jahr. Er hat mir auch meinen Job im Diner beschafft. Zum Glück. Jobs sind hier echt Mangelware. Zu viele Studierende auf zu kleinem Raum.«
Den Eindruck hatte ich auch, als das Taxi mich hergebracht hat. Lullaby wirkte wie ein Schuhkarton, bei dem ich mir kaum vorstellen konnte, wie eine Uni mit vierhundert Leuten darin Platz finden sollte. Und doch sitze ich nun hier, inmitten dieses Kartons, in meiner ersten Vorlesung.
»Die Stadt ist ziemlich winzig, oder?«
»Ein Diner, ein Supermarkt, ein Rathaus samt Archiv, eine Allgemeinärztin, vierhundert Studierende, rund einhundert andere Anwohner und viele Touristen.«
»Okay«, lache ich. »Das ist winzig.«
Dr. Livings räuspert sich, offenbar ein Zeichen, dass sie gleich beginnen wird, denn die Gespräche werden weniger. Auch Reese verstaut ihre Kopfhörer in ihrer Tasche und fährt ihr Tablet hoch. Ich nehme eine kleine Tube aus meinem Rucksack und desinfiziere mir die Hände, bevor ich meine eigenen Sachen heraushole: Laptop, Notizblock, Wasserflasche. Der beißende Geruch des Desinfektionsmittels steigt zu mir hoch. Reese sieht mich fragend an, doch ich komme nicht dazu, ihr irgendetwas zu erklären.
»Willkommen in der Vorlesung Umweltbiologie eins«, sagt unsere Professorin. »Heutiges Thema: Ökosysteme und deren nachhaltige Nutzung.« Ihre Stimme klingt wie ein Reibeisen.
Ich sehe nach links. Reese hat ihre Mitschriften aus der letzten Vorlesung aufgerufen, und ich komme mir unnütz vor, weil ich sie verpasst habe. Kurz werde ich nervös.
Angestrengt versuche ich mich darauf zu konzentrieren, wie Dr. Livings davon spricht, dass die Ökosysteme in zwei Hauptkompartimente zusammengefasst werden können: erstens die Atmosphäre wie Wärmeenergie und Wasser und zweitens der Boden mit all den Nährstoffen und Pflanzen. Dennoch bleiben Hunderte von Fragen in meinem Kopf, die Reese zu bemerken scheint.
Ohne ein Wort zu sagen, schiebt sie ihr Tablet nach rechts, damit ich ihre Notizen mitlesen kann. Ich nicke ihr dankbar zu.
»Wenn wir nun die beiden Hauptkompartimente betrachten, wo genau liegt dann das Problem für uns Menschen?«, fragt Dr. Livings. Ein Dutzend Hände schnellen in die Höhe.
Dr. Livings nickt einer Studentin aus der ersten Reihe zu.
»Die atmosphärischen Teile des Ökosystems stehen uns nahezu unbegrenzt zur Verfügung«, rasselt sie herunter.
»Jeannie Pitt«, murmelt Reese. »Die wusste schon letzte Vorlesung alles.« Es klingt beinahe, als würde Reese das persönlich nehmen.
»Der Boden kann jedoch durch natürliche Erosionen verloren gehen«, spricht Jeannie weiter. »Außerdem greifen wir Menschen in diesen Teil des Ökosystems ein.«
»Zum Beispiel wie?«
Wieder schnellen ein paar Hände nach oben, diesmal auch meine. Es ist der erste Moment, in dem ich mir nicht vollkommen verloren vorkomme. Das Leben als Studentin hat hiermit offiziell begonnen.
»Durch Landwirtschaft«, sagt Jeannie.
Dr. Livings nickt und nimmt einen Jungen aus der vorletzten Reihe dran.
»Versalzung.«
Dr. Livings sieht zu mir.
»Schadstoffe«, sage ich und versuche, nicht zu triumphierend zu gucken. »Pestizide, zum Beispiel.«
»Und durch unsere Bebauungen«, ergänzt eine Studentin rechts von uns. »Durch Asphalt und Beton wurde Boden unbrauchbar gemacht.«
»Richtig«, sagt Dr. Livings. »Wir stören damit das natürliche Gleichgewicht. Durch eine Überdüngung treten vermehrt Nitrat und Phosphor in das Grundwasser.«
Ich beginne, mir Notizen zu machen. Die Dozentin gliedert die Eingriffe des Menschen in Landwirtschaft, Ausrottung von Tierarten, Umweltverschmutzung, Ausbeutung von natürlichen Ressourcen und Kernenergie. Am Ende der Vorlesung habe ich fünf Seiten vollgeschrieben, und ich schwanke bei dem Thema zwischen Interesse und Betroffenheit. Kein leichter Stoff.
»Ich habe einen Krampf in der Hand.« Reese lässt ihren Stift fallen, mit dem sie sich Notizen im Tablet gemacht hat. Um uns herum packen die Ersten ihre Sachen zusammen und verlassen den Raum.
»War es letzte Woche auch so viel?«
»In allen Fächern«, bestätigt Reese meine Befürchtung.
»Na super, und ich habe alles verpasst. Ich wusste, dass es ein Fehler war, später zu kommen.«
Reese packt ihr Tablet in den Rucksack und sieht zu mir. »Ich kann dir meine Notizen geben.«
»Echt? Das wäre wirklich klasse.«
Wir verlassen den Kursraum, weichen anderen Studierenden aus und passieren erneut Pflanzen und Fotografien, aber diesmal habe ich kaum Zeit, alles auf mich wirken zu lassen. Die Gänge sind zu voll. Zum Glück kennt Reese den Weg. »In der Mittagspause muss ich zu meiner Mitbewohnerin für unser wöchentliches Meeting«, sagt sie. »Aber ich kann dir die Notizen gerne nach der Uni geben. Vielleicht willst du im Diner vorbeischauen? Ich habe nachher eine Schicht.«
Reese biegt ab.
»Ich muss vorher noch ein paar Erledigungen machen«, sage ich atemlos und versuche, Schritt zu halten. »Aber danach komme ich gerne.«
»Cool. Sind auch nur so zehn Minuten Fußweg vom Campus aus. Einfach immer der einzigen Straße folgen, bis du den Supermarkt erreichst. Direkt daneben ist dann das Hopes.«
Wir finden den Raum für den Physik-Grundkurs, wo wir uns wieder in die letzte Reihe setzen. Reese holt erneut ihr Tablet hervor. Ihre Finger trommeln auf den kleinen Tisch vor uns. Sie scheint viel Energie zu haben.
»Wieso hast du Meetings mit deiner Mitbewohnerin?«, nehme ich den Faden wieder auf. »Versteht ihr euch etwa nicht?«
»Geht so«, sagt Reese unbekümmert, aber etwas an der Art, wie sie das Wort ausspricht, lässt mich aufhorchen. Als wäre sie weitaus unglücklicher mit der Wahl ihrer Mitbewohnerin, als sie es zugeben will. »Wir schlagen uns nicht gegenseitig die Köpfe ein, aber Keyla ist ziemlich launisch, und das verträgt sich überhaupt nicht mit meiner Sturheit.«
Die Reihen vor uns füllen sich. Die gleichen Leute, die auch schon in Umweltbiologie waren.
»Wie sieht es bei dir aus?«, will Reese wissen.
»Ich habe echt Glück. Als ich für Red angenommen wurde, hatte ich keine Ahnung, was mich erwarten würde. Streng genommen weiß ich das in Bezug auf die Aufgaben immer noch nicht. Aber meine Mitbewohner sind wirklich klasse.«
»Du bist bei Red?« Reese pfeift anerkennend. »Elite also.«
»Na ja, so würde ich es vielleicht nicht nennen«, erwidere ich. Immerhin habe ich im Grunde keine Ahnung von dem, was ich hier tue. Dieser ganze Bewerbungsprozess war mehr Glück als Verstand.
»Und ob«, sagt Reese. »Es gibt doch pro Jahrgang nur einen Platz. Ich hab’s nicht mal versucht, mich da zu bewerben – so strebsam bin ich nicht. Obwohl so ein Vollstipendium für die gesamte Unizeit schon der ultimative Jackpot wäre.«
»Wenn ich den Dekan am Telefon richtig verstanden habe, gilt das Stipendium aber nur für ein Jahr«, sage ich stirnrunzelnd.
»Auf dem Papier schon. Aber mein Cousin Shawn meint, dass sie immer verlängert werden, weil der Dekan für die Öffentlichkeitsarbeit Beständigkeit braucht. Solange du deine Aufgaben erledigst, wirst du bis zum Ende deines Studiums versorgt sein. Glaub mir. Du hast wirklich den Jackpot geknackt.« Reese lächelt mir zu, aber ich sehe das kleine Zucken ihrer Mundwinkel, als wäre das ein Problem, vor dem sie selbst gerne Ruhe hätte. Ich frage jedoch nicht nach. Wenn mich meine Mutter eins gelehrt hat, dann, dass Finanzen nie ein gutes Thema sind, um sich kennenzulernen. Schon gar nicht, wenn die Ausgangssituationen unterschiedliche sind, wie es mir scheint.
»Ehrlich gesagt bin ich mir überhaupt nicht sicher, ob ich das alles wirklich hinbekomme. Red, aber auch das Studium«, gebe ich zu. »Ich hatte zwar gute Noten an der Highschool, aber wenn ich mir die Vorlesungen so ansehe, habe ich noch viel zu lernen.«
»Das schaffst du«, sagt Reese aufmunternd. »Zur Not machen wir zwei eine Lerngruppe auf. Ich versorge uns mit Essen vom Hopes, und du bekommst vielleicht Lerntipps von deinen Mitbewohnern – immerhin haben sie die Prüfungen schon bestanden, oder? Dann rocken wir das Ding.«
Sie wirkt dabei so überzeugt, dass sie mich mit ihrer Zuversicht ansteckt. Das kleine Zucken ihres Mundwinkels ist schon wieder verschwunden. Übrig ist nichts als ehrliche Sympathie.
»Weißt du, Reese? Ich bin wirklich froh, dass ich mich neben dich gesetzt habe.«
Kapitel 3
Die Kleinstadt Lullaby besteht aus dunklen Holzhäusern mit großen Fensterfronten, die von jeder Menge Kiefern gerahmt werden. Sie überragen die Häuserdächer und legen trotz der spätsommerlichen Sonne alles in Schatten – die Läden mit Tafelschildern, die Häuserfassaden voller Lichterketten. Den dunklen Feldern auf den Dächern nach zu urteilen, wird hier viel mit Solarenergie betrieben. Nur eine einzige Straße führt – genau wie Reese gesagt hat – innerhalb von zehn Minuten zum Ortskern, in dem auch das Stadtarchiv steht.
Ich habe ein düsteres, vielleicht feuchtes Kellergewölbe erwartet, nicht jedoch eine großzügige Eingangshalle mit rotem Läufer und einer Aussicht auf Dutzende Bücherregale aus dunklem Holz, die bis hoch an die Decke reichen. Es ist ein Ort, an dem ich mich augenblicklich wohlfühle. Ich gehe auf einen der Computer zu, die, aufgestellt in Reih und Glied, an zehn Einzeltischen stehen. Die vordersten Plätze sind frei, also besetze ich den ersten Computer und breite meine Sachen aus: mein schwarzes Notizbuch, meine Trinkflasche und einen Rohkostriegel, den ich aus dem Bio-Supermarkt habe. Der einzige Riegel dort ohne Walnüsse.
Ich versuche, mich in das digitale Archiv einzuloggen, doch immer wieder verwehrt mir der PC den Zugriff.
Etwas hilflos blicke ich mich um und entdecke in der Nähe des Eingangs einen Infoschalter. Der Mitarbeiter dort hat mir den Rücken zugekehrt, in der Hand ein Buch, in dem er blättert. Ich gehe auf ihn zu, trete dicht an das dunkle Holz des Tresens heran.
»Entschuldige?«
Er dreht sich um und sieht mich an. Die Augen sind noch so dunkelblau wie bei unserer ersten Begegnung. Lewis Branson steht vor mir, eine einzelne Locke fällt ihm erneut in die Stirn. Ich registriere genau den Moment, in dem er mich wiedererkennt. Seine Augenbrauen schnellen für eine Sekunde in die Höhe, sein Mund öffnet sich einen Millimeter, während sein Blick über meine braunen Augen und zu meinen schwarzen Haaren schweift, die ich heute zu einem hohen Pferdeschwanz gebunden habe.
»Ich … ich bin gestern in dich reingerannt«, stellt er fest, in seiner Stimme ein sanftes Stottern.
»Ja«, hauche ich und muss mich erst einmal räuspern. »Ich bin Hazel, die Neue bei Red. Aber das hast du dir bestimmt denken können, wenn du meinen Koffer gesehen hast. Wobei du es ja ziemlich eilig hattest, daher weiß ich nicht, ob du drauf geachtet hast«, sage ich und registriere in diesem Moment, dass ich zu viel plappere. Ihn ausgerechnet hier wiederzusehen – damit habe ich nicht gerechnet.
»Ich hoffe, ich habe dir dabei nicht wehgetan?« Mir entgeht nicht, dass er jedes Wort einzeln und mit Bedacht ausspricht. Nicht wie ich, die ihre Sätze eher herunterrasselt und dabei Wörter und Endungen verschluckt.
»Nichts passiert. Alles noch dran.«
»Gut.« Ein vorsichtiges Lächeln. Für einen Augenblick sieht er so aus, als würde er mehr sagen wollen. Dann besinnt er sich jedoch und schluckt lediglich. »Was kann ich für dich tun?«
»Wie komme ich denn ins digitale Archiv?«
»Ah, dafür brauchst du einen Code. Moment.« Er wühlt in einer kleinen Schachtel, dann zieht er ein Kärtchen hervor, auf dem eine Buchstabenkombination steht. »Wähl dich damit ein, dann sollte es funktionieren.«
»Und dann komme ich auch an die archivierten Zeitungsartikel?«
Sofort mustert er mich etwas neugieriger, nicht mehr so zurückhaltend wie zuvor. »Was genau suchst du denn?«
Ich versuche, gelassen zu wirken, keine Miene zu verziehen. »Ich wollte mich einfach ein bisschen über Lullaby informieren.«
»Mit Zeitungsartikeln?« Er runzelt die Stirn.
Ich lächle, lasse mir meine Unsicherheit nicht anmerken, auch wenn in meinem Inneren alles in Aufruhr ist. »Mal sehen, was ich so finden kann. Danke für deine Hilfe.«
Ich greife nach dem Zettel mit dem Code, als ich mich umdrehe, um zurück zu meinem Platz zu gehen.
»Du … du wirst nicht alle Zeitungsartikel digital finden«, sagt er, etwas lauter als zuvor, damit ich ihn noch hören kann. Ich bleibe stehen, sehe wieder zu ihm. »Manchmal sind nur Nummern hinterlegt. Das bedeutet, dass sie nicht digitalisiert wurden und du sie händisch in den Regalen suchen musst. Wir sind hier noch nicht so modern. Auch wenn die LBU den Bürgermeister immer wieder darum bittet, das zu ändern.«
»Danke für den Hinweis«, sage ich, dann gehe ich zurück an den PC. Mit ein paar Klicks bin ich im Archiv. Zunächst starre ich nur auf die Tastatur, plötzlich unsicher, was ich eigentlich eingeben soll. Dann entscheide ich mich dazu, erst mal nur nach dem Datum zu suchen.
03.11.2020
Leider gibt es wahnsinnig viele Treffer. Was bitte kann in einer kleinen Stadt wie Lullaby schon los sein, dass ein normaler Dienstag im November so viele Schlagzeilen bringt? Doch es sind nicht nur Zeitungsartikel, die mir angezeigt werden. Auch Polizeimeldungen, veröffentlichte Texte der LBU, ich entdecke sogar Jaspers Namen unter einem davon. Gestern hätte ich ihn am wenigsten als Vorreiter bei Red eingeschätzt. Da war ich wohl etwas zu voreingenommen.
Ich beginne, die Ergebnisse zu filtern, und gebe hinter dem Datum noch Unfall ein. Sofort erscheinen drei Ergebnisse. Darunter der Zeitungsartikel, der sich schon in meinem Besitz befindet. Die anderen beiden Artikel gibt es nicht digital, ich finde nur Nummerierungen, die Lewis erwähnt hat.
Verstohlen sehe ich zu ihm. Er lehnt am Infoschalter, weiterhin das Buch in der Hand. Mit der anderen rückt er sein Brillengestell zurück auf die Nase. Er sieht gut aus, wie er so dasteht, in nachdenklicher Pose, noch immer die Locke im Gesicht. Es wäre vermutlich einfacher, wenn ich ihn um Hilfe bitten würde, die Artikel zu finden. Dennoch entscheide ich mich dagegen. Ich passiere ein paar Regalreihen, gehe Buchstabe für Buchstabe durch, bis ich Z finde. Von Zahlen jedoch keine Spur.
»Kann … kann ich dir helfen?«
Lewis steht plötzlich hinter mir, sieht mich etwas zögernd an.
Sein ganzes Auftreten strahlt absolute Ruhe aus, die sich in diesem Moment wohltuend auf meine Nerven legt. Ich bin viel zu angespannt.
»Ich suche Z1120 und Z1220.«
»Zeitungsartikel sind in diesen Ordnern hinterlegt.« Er zeigt auf dunkelrote, voluminöse Einbände unweit von uns. »Leider sind sie nicht immer sortiert. Wir werden etwas suchen müssen.«
»Wir?«
»Es ist mein Job, anderen zu helfen«, sagt er leise. »Selbst wenn es nur um Infos über Lullaby geht. Wobei ich nicht weiß, was die Zeitungsartikel von 2020 dabei bringen?«
»Woher weißt du, dass sie von 2020 sind?«
»Wegen der Zahlen«, erklärt er schlicht.
»Ich habe gesehen, dass ein paar Leute von Red etwas in Zeitungen veröffentlicht haben. Kann nicht schaden, sich vor meinen ersten Aufträgen etwas zu informieren.« Erstaunlich, wie leicht es mir fällt, zu lügen. Als hätte ich es in den letzten zwei Jahren perfektioniert. Lewis scheint sich mit der Antwort zufriedenzugeben, er hört jedenfalls auf, mich neugierig zu mustern, und konzentriert sich stattdessen auf die Suche nach den richtigen Ordnern.
»Arbeitest du hier schon länger?«, frage ich, während ich die staubigen Regalbretter durchsehe.
»Seit meinem Studienbeginn.«
»Dann bist du auch an der LBU?«
»Wie die meisten, die hier in Lullaby leben«, sagt er. Nun spricht er leiser, als wäre es ihm unangenehm, selbst zum Gesprächsthema zu werden. »Ich bin im zweiten Jahr.«
»Und wie klappt das so mit dem Nebenjob? Das Studium frisst doch sicher viel Zeit, oder?«
»Die meisten, die kein Stipendium haben, arbeiten neben der Uni. Hier im Archiv ist die Arbeit ganz angenehm, es gibt auch immer wieder Phasen, in denen es ruhig ist … dann kann ich nebenbei lernen.« Sein Stottern nimmt ein wenig zu, seine Hand vergräbt sich in der Hosentasche. Ein Funkeln tritt in seine Augen. Weitere Worte, die ausgesprochen werden möchten, tanzen dahinter. Ich sehe sie ganz deutlich und würde sie wirklich gerne hören. Aber er dreht sich weg, sucht das nächste Regal ab, spricht sie nicht aus.
Ich will gerade etwas erwidern, um das Gespräch weiter anzukurbeln, als er einen Ordner aus dem Regal zieht. Z1120.
»Du hast ihn gefunden«, platzt es etwas zu euphorisch aus mir heraus. »Klasse.«
»Z1220 auch. Direkt daneben. Ich helfe dir tragen.« Er nimmt den dickeren der beiden Ordner und geht zu meinem Tisch, wo er sie direkt neben meinen Sachen ablegt.
Innerlich stöhne ich über mich selbst. Mein Notizbuch offen herumliegen zu lassen, während niemand erfahren soll, wieso ich nach Lullaby gekommen bin, ist einfach nur naiv. Verstohlen blicke ich mich um, doch die Leute, die hier sind, wirken zum Glück nicht, als hätten sie gerade Kenntnis von meinem Geheimnis bekommen.
»Wenn du sonst noch etwas brauchst … melde dich einfach«, sagt Lewis und geht zurück zum Schalter.
Eine Frau, vielleicht vier oder fünf Jahre älter als ich, ist reingekommen und bedient sich an einem kleinen Aufsteller für Flyer, die für die Sehenswürdigkeiten hier in der Gegend werben. Offenbar eine Touristin, die wegen des Modoc National Forest hier ist. Ich habe gelesen, dass Lullaby sehr beliebt ist. Lewis berät die Frau kurz, seine Hände in seiner Hosentasche vergraben, die Schultern eingezogen. Immerhin liegt es nicht an mir, und er ist bei allen wohl etwas introvertiert.
Hinter mir kichern zwei Studentinnen an einem der Nebentische, die ich in meiner Vorlesung gesehen habe und die scheinbar Lewis beobachten und über ihn tuscheln. Es ist eindeutig, dass ihnen gefällt, was sie sehen. Klar, er sieht gut aus. Eindeutig sogar. Die Art, wie seine Locken ihm ins Gesicht fallen, und die tiefen dunkelblauen Augen, die ich zwar von hier aus nicht sehen kann, aber die sich geradewegs in mein Gedächtnis gebrannt haben. Ich starre ein wenig zu lange auf ihn, bis mir einfällt, dass ich gerade kurz davor bin, endlich mehr Informationen zu erhalten, und ich mich wieder auf die Ordner konzentriere. Ich bin keinen Deut besser als die kichernden Studentinnen aus meinem Jahrgang.
Ich öffne Z1120, Staub wirbelt mir augenblicklich entgegen. Meine Hand greift nach meinem Desinfektionszeug, das sich immer in einem Zipperbeutel in meiner Tasche befindet. Erst nach dem Desinfizieren der Hände gehe ich Seite für Seite die Zeitungsartikel durch.
Schnell finde ich heraus, dass es sich um Artikel vom November 2020 handelt, alle nach Datum sortiert, sodass ich vorblättere, bis ich zum dritten November gelange.
Stadt trauert um Silvia G., Kenna H. und Jill N.
Nach dem tragischen Unfalltod dreier Studentinnen trauert die ganze Stadt. Blumen, Gedenkkränze und Kerzen erinnern daran, dass Silvia G., Kenna H. und Jill N. zu früh verstorben sind und der Stadt, und vor allem der Uni, fehlen werden.
Der Dekan der LBU, Michael Peterson, hielt am frühen Morgen gemeinsam mit dem Bürgermeister Jackson Fridge eine Rede für die Bürger*innen, die sich zu Hunderten auf dem Platz vor dem Rathaus versammelten. Er sprach den Verstorbenen seinen höchsten Respekt aus. »Diese jungen Damen waren ein Teil unserer Zukunft, alle drei begabte und engagierte Studentinnen, die mehrfach im Namen der Uni an Projekten gearbeitet haben. Ihr Tod ist nicht nur ein Verlust für Lullaby und die LBU, sondern für alle, die sich fortwährend für den Umweltschutz einsetzen.«
Vornamen. Keine Nachnamen, aber ein Anfang. Mein Herz schlägt mir fast bis zum Hals, während ich sie in mein Notizbuch schreibe.
Silvia G.
Kenna H.
Jill N.
Kurz betrachte ich das Foto, das Mr Peterson vor einem Rednerpult am Rathaus zeigt, von den besagten Kerzen und Blumen umrandet. Der Dekan sieht etwas anders aus als auf jüngsten Fotos, hat etwas weniger Gewicht, dafür mehr Haar.
Ich schlage den Ordner zu und nehme mir den nächsten vor. Dabei schweift mein Blick automatisch wieder zum Infoschalter, genau in dem Moment, als Lewis mich ansieht. Kurz zögert er, als er die große Flasche Desinfektionsmittel vor mir bemerkt, doch ich sehe nur kurze Verwunderung. Ich kann es ihm nicht verübeln, vielleicht denkt er, ich hätte eine Bakterienphobie. Auf die Idee, dass ich, neunzehn Jahre alt und objektiv betrachtet gesund und munter wirke, vor zwei Jahren eine doppelte Lungentransplantation hatte, um gegen die Folgen meiner angeborenen Stoffwechselkrankheit zu kämpfen, kommen die wenigsten. Eigentlich niemand.
Die Suche im zweiten Ordner geht wesentlich langsamer voran, weil die Zeitungsartikel alle vom Dezember 2020