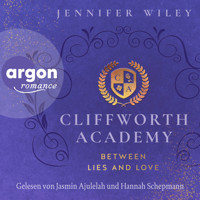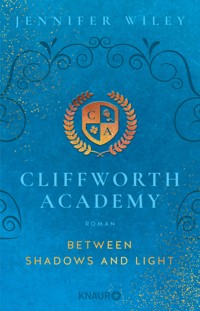11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: New York Love Songs
- Sprache: Deutsch
Kann Milo die Nacht erhellen, vor der Ivy seit Jahren flieht? Jennifer Wileys Rockstar-Romance »Like Fire in the Night« erzählt die berührende Liebesgeschichte zwischen der gefeierten jungen Sängerin Ivy und dem Journalisten Milo, der ihr dunkles Geheimnis enthüllen soll. Über Nacht wird die 21-jährige Musikerin Ivy Cohen ein Star. Plötzlich will ganz New York wissen, wer die Frau mit der rauen Stimme privat ist. Der junge Journalist Milo Harrison erhält den Auftrag, sich in Ivys Umfeld einzuschleusen und möglichst viel über sie herauszufinden. Für Milo rückt damit die Lösung seines größten Problems in greifbare Nähe: Liefert er seinem Auftraggeber eine echte Enthüllungsstory, kann er endlich die Geldeintreiber loswerden, die ihm wegen der Schulden seines Vaters im Nacken sitzen. Doch Milo hat nicht damit gerechnet, wie verletzlich Ivy hinter ihrem sexy Bühnen-Ich ist. Und auch nicht mit der düsteren Vergangenheit, der sie zu entkommen versucht. Während die Gefühle zwischen Milo und Ivy stärker werden, geraten beide immer tiefer in den Sog von Ivys Geheimnis … Mitreißende Rockstar-Romance, die mitten ins Herz trifft Ein New-Adult-Liebesroman voll großer Emotionen und funkensprühender Flirts, der so unter die Haut geht wie ein guter Rocksong. Entdecke auch die anderen New-Adult-Romane von Jennifer Wiley: - In jedem Atemzug nur Du (Lullaby University 1) - In jedem Augenblick ein Wir (Lullaby University 2) - Cliffworth Academy – Between Lies and Love (Dark Academia Romance, Band 1) - Cliffworth Academy – Between Shadows and Light (Dark Academia Romance, Band 2)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 425
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Jennifer Wiley
LIKE FIRE IN THE NIGHT
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Kann Milo die Nacht erhellen, vor der Ivy seit Jahren flieht?
Über Nacht wird die 21-jährige Musikerin Ivy Cohen ein Star. Plötzlich will ganz New York wissen, wer die Frau mit der rauen Stimme privat ist.
Der junge Journalist Milo Harrison erhält den Auftrag, sich in Ivys Umfeld einzuschleusen und möglichst viel über sie herauszufinden. Für Milo rückt damit die Lösung seines größten Problems in greifbare Nähe: Liefert er seinem Auftraggeber eine echte Enthüllungsstory, kann er endlich die Geldeintreiber loswerden, die ihm wegen der Schulden seines Vaters im Nacken sitzen. Doch Milo hat nicht damit gerechnet, wie verletzlich Ivy hinter ihrem sexy Bühnen-Ich ist. Und auch nicht mit der düsteren Vergangenheit, der sie zu entkommen versucht.
Während die Gefühle zwischen Milo und Ivy stärker werden, geraten beide immer tiefer in den Sog von Ivys Geheimnis …
Mitreißende Rockstar-Romance, die mitten ins Herz trifft!
Weitere Informationen finden Sie unter: www.droemer-knaur.de
Inhaltsübersicht
Content Note – Hinweis
Widmung
Zitat
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Danksagung
Liste sensibler Inhalte/Content Notes
Bei manchen Menschen lösen bestimmte Themen ungewollte Reaktionen aus. Deshalb findet ihr am Ende des Buches eine Liste mit sensiblen Inhalten.
Für die Queen Taylor Momsen, deren Songs mir auch in den dunkelsten Stunden Inspiration und Kraft geben – und ohne die die Idee zu Like Fire in the Night nie entstanden wäre.
Haunted by echos of forgotten days,
the weight of silence presses me down.
Fragments of hope scattered like ashes,
once vibrant, now dulled by relentless void.
(Haunted by Ivy Cohen)
Kapitel 1
Memories at a Bargain Price
In dem Schaukasten vor mir liegen unzählige Erinnerungsstücke. Die meisten werden wohl nicht mehr eingetauscht werden, auch wenn die Uhren, Ketten und Armbänder noch geduldig darauf warten, wieder abgeholt zu werden.
Eine meiner Erinnerungen befindet sich gerade in nikotingelben Fingern, die die Uhr meines Vaters hin und her drehen. Der Mann vor mir brummt nachdenklich. Schwer zu sagen, ob dieses Brummen nun einen Geldsegen für mich bedeutet oder nicht. Ich kann nur hoffen, dass er seine Entscheidung schnell trifft, weil ich von dem penetranten Tabakgestank in diesem Laden allmählich Kopfschmerzen bekomme.
»Da ist ein Kratzer«, sagt der Mann und hält mir die goldene Uhr entgegen.
Er braucht ihn mir nicht zu zeigen, immerhin habe ich den Kratzer mit sieben Jahren selbst verursacht. Ich hatte mir die Uhr unbedingt nehmen müssen, obwohl mein Vater mir damals immer verboten hatte, damit zu spielen. Zu kostbar war dieses Erbstück für ihn. Zehn Monate vor meiner Geburt war mein Grandpa gestorben, und ich kenne meinen Dad nur mit dieser Uhr. Er hat sie immer getragen. Jeden einzelnen Tag der letzten dreiundzwanzig Jahre. Diese Uhr hat alles miterlebt, die guten wie die schlechten Tage. Die Hoch- und Tiefphasen.
Das hier ist dann wohl das tiefste Tief.
Das Ende der Erinnerung.
»Der Kratzer mindert natürlich den Wert«, murmelt der Pfandleiher. »Einhundertfünfzig Dollar kann ich dir anbieten.«
»Was?« Die Kopfschmerzen gleichen nun kleinen Nadeln, die sich in mein Hirn bohren und damit jeden einzelnen hoffnungsvollen Gedanken zum Platzen bringen. »Aber die Uhr ist aus Gold.«
»Ist auch nicht mehr so viel wert wie früher. Einhundertfünfzig ist mein letztes Angebot. Ob du es annimmst oder nicht, ist deine Sache.«
Er lächelt müde, vermutlich weil er genau weiß, dass ich es annehmen werde. Würde ich das Geld nicht dringend brauchen, wäre ich schließlich nicht hier.
»Dann einhundertfünfzig«, seufze ich.
Die nächsten zehn Minuten leiert er Bedingungen herunter. Er redet von Zinsen und von einer allgemeinen Aufbewahrungsdauer, aber ich höre nur mit einem Ohr zu. Weder Dad noch ich werden diese Uhr wieder einlösen können.
Mein Magen verkrampft sich, während ich mir vorstelle, wie mein Grandpa sich im Grab umdreht. Aber wenn es stimmt, was man über den Tod sagt und die Menschen, die gehen, einen trotzdem niemals ganz verlassen, kann ich nur darauf hoffen, dass er es verstehen wird. Dann hat er gesehen, was ich gesehen habe, und dann weiß er, dass mir nichts anderes übrig bleibt, als Dad zu helfen und diese Uhr für ihn zu verkaufen.
Der Pfandleiher ist fertig mit seinem Monolog und reicht mir endlich die abgezählten Scheine, die ich einrolle und in die Innentasche meiner Jacke steckte. Das Bündel ist winzig.
Einhundertfünfzig Dollar sind letztendlich nur ein kleiner Regentropfen in einer ausgewachsenen Dürre.
Mein Apartment in Kings Country empfängt mich mit einer beruhigenden Stille. Neben mir wohnt eine alte Dame, die kaum das Haus verlässt und die höchstens mal zu laut fernsieht, dafür aber ab und zu jemanden braucht, der ihren Wasseranschluss überprüft. In den neun Monaten, in denen ich hier lebe, habe ich schon drei Mal versucht, ihr zu helfen. Die Hausverwaltung kümmert sich einfach nicht genug. Dafür ist die Miete von zweitausend Dollar für Brooklyn-Verhältnisse erschwinglich.
Ich knipse die Stehlampe an, die ich vor vier Monaten auf dem Brooklyn Flea gekauft habe. Die meisten meiner Möbel sind Secondhand, was Dads Finanzlage und meinem eher schlecht bezahlten Job in der Redaktion von Current Flash geschuldet ist. Während meines Journalistikstudiums hatte ich mir etwas mehr Luxus vorgestellt als einen Raum mit vierundzwanzig Quadratmetern, auch wenn immerhin ein eigenes Badezimmer dazugehört. Aber nun liebe ich dieses kleine Reich und die Möbel, die ich in mühevoller Handarbeit abgeschliffen und neu lackiert habe und die somit ihren ganz eigenen Charme besitzen.
Ich lege die Scheine, die ich vom Pfandleiher bekommen habe, in eine kleine Holzschachtel auf meinem Bücherregal.
Eigentlich bräuchte ich dringend ein zweites, weil das hier aus allen Nähten platzt, aber der Platz im Apartment ist mit Couch, Abstelltisch, Bücherregal, Apothekertisch, Doppelbett und Nachttisch und der integrierten Küchenzeile mehr als ausgereizt. Mehr geht nicht. Mich von Büchern zu trennen, geht allerdings auch nicht, deswegen stapeln sich inzwischen auch welche vor dem Regal. Lyrik neben Märchen, Thriller neben Fantasyromanen. Zwischendrin ein paar Klassiker und Ratgeber zu kreativem Schreiben. Auf dem obersten Regalbrett ist ein signierter Ball von Derek Jeter platziert, direkt daneben steht ein Foto von Mom und mir. Wir tragen beide weiße Yankee-Shirts und Kappen, und ich habe einen dieser Schaumstoffdaumen. Dabei lächeln wir in die Kamera – ich ein wenig zahnlos, Mom dafür mit ihrem makellosen Julia-Roberts-Lachen.
Was Mom wohl über die Pfandleiher-Pleite denken würde? Oder über diese ganze verkorkste Situation mit Dad und meinen Versuchen, ihm zu helfen?
Auf meinem Smartphone wartet bereits eine Nachricht von ihm, aber ich bringe es nicht über mich, ihm zu sagen, welch traurige Ausbeute ich beim Pfandleiher gemacht habe. Er hat eine Arbeitsschichtim Sicherheitsdienst vor sich und ist ohnehin erschöpft, schließlich arbeitet er vormittags auch noch als Reinigungskraft. Die schlechten Nachrichten sollte ich ihm wohl auch besser persönlich übermitteln.
Ich antworte ihm, dass ich morgen vorbeikomme, und wünsche ihm eine erfolgreiche Schicht, ehe ich den Flugmodus aktiviere. Brooklyn versinkt bereits in der zunehmenden Dämmerung und läutet damit meine liebste Zeit ein. Die, in der ich für eine Stunde alle meine Sorgen, Gedanken und Probleme vergessen kann.
Ich sehe zu meinem antiken Apothekertisch – dem Herzstück meiner Wohnung und mein liebster Ort, um meiner Kreativität nachzugehen, seit ich ihn auf dem Bushwick Market entdeckt und nachlasiert habe. Darauf befinden sich mindestens zehn Notizzettel, die ich gestern Abend geschrieben habe. Ideen und Skizzen, die darauf warten, in meinen Fantasyroman eingearbeitet zu werden.
Im Kühlschrank finde ich Pizzareste von gestern, mit denen ich mich an den Tisch setze und den Laptop aufklappe. Dann beginne ich zu schreiben und versinke in meiner eigenen Welt.
Wenn ich früher in das Haus meiner Eltern gekommen bin, hat es immer nach Jasmintee gerochen. Mom hat ihn sich jeden Tag in der Küche aufgegossen und ist in ihr Büro gegangen, um zu schreiben, nur um dann Stunden später den kalten Tee vorzufinden, dessen Existenz sie über ihrer Arbeit vergessen hatte. Während der Duft ihrer Haare oder der Klang ihres Lachens drei Jahre nach ihrem Tod immer weiter in die Ferne rücken, ist der Jasmintee etwas Greifbares. Manchmal koche ich mir beim Arbeiten selbst welchen, einfach um ihr noch mal nah sein zu können.
Wenn ich jetzt Dads Haus in Brooklyn betrete, empfängt mich hier kein Tee, sondern abgestandene Luft.
Irgendwo im Nachbarhaus brummt Bassmusik, weil die Nachbarschaft sich in den letzten Jahren ebenso verändert hat wie die Atmosphäre in diesem Haus. Es sind dieselben braunen Möbel, dieselbe dunkelblaue Tapete und dasselbe dunkle Parkett, und doch wirkt alles anders. Weniger lebendig. Als wären sieben Jahre voller Krankheit und Leid in die Wände gesickert.
Ich finde Dad schlafend in dem Sessel, in dem auch Mom immer gesessen hat, um sich zu erholen. Eine Wolldecke, die er sich um die Beine gelegt hat, ist verrutscht und hängt nun auf dem blauen Teppich, den wir für Mom gekauft haben, weil sie durch die Chemo immerzu kalte Füße hatte.
Tränen schießen mir in die Augen, aber ich lasse sie nicht zu. Dad soll sich erholen und nicht mitbekommen, wie sehr ich mich sorge.
Wie konnte ich nur übersehen, was in diesen Wänden vor sich ging? Wieso habe ich nicht gemerkt, dass Dad nach dem Tod von Mom nicht mehr auf die Beine kam?
Ich hätte ihn einfach viel öfter besuchen sollen, anstatt nur zwischen Arbeit und Freizeit anzurufen, immerzu kurz angebunden. Sicher hätte ich dann früher erkannt, dass es nicht bei seinen gelegentlichen Abenden vor den Spielautomaten in der Bar um die Ecke geblieben ist.
Ich hebe die Decke auf und lege sie ihm wieder über die Beine, ohne ihn zu wecken. Ihm bleiben nur noch ein paar Stunden bis zu seiner nächsten Schicht, und er braucht den Schlaf.
So leise ich kann, gehe ich in die Küche.
Eierschalenfarbene Wände mit Familienfotos heißen mich willkommen, während ich aus meinem Rucksack ein paar Dosensuppen hervorhole. Keine Ahnung, ob es Dad zwischen seinen zwei Jobs überhaupt noch zum Einkaufen schafft. In seinem Kühlschrank finde ich jedenfalls nichts außer einem halben Glas Mayonnaise und einem Salatkopf.
Ich gieße mir ein Glas Wasser ein und öffne meinen Laptop. Vor drei Wochen waren Dad und ich zusammen bei einem Schuldenberater, der uns empfohlen hat, jede seiner Ein- und Ausgaben in einer Exceltabelle festzuhalten, um nicht den Überblick zu verlieren. Mir war schon zu diesem Zeitpunkt klar gewesen, dass diese Tabelle eher niederschmetternd als motivierend sein würde, doch das ernüchternde Ergebnis schockierte mich trotzdem mehr als gedacht.
So viele rote Zahlen, zu wenig grüne.
Ich trage die einhundertfünfzig Dollar ein, die ich vom Pfandleiher bekommen habe, und verbuche damit endlich mal wieder ein Einkommen. Demgegenüber stehen 50000 Dollar Schulden durch Kreditkartenüberziehungen und Zahlungsrückstände. Der Schuldenberater hat gesagt, dass Dad damit fast in der Norm liegen würde, immerhin würden die meisten Leute von Gehaltsscheck zu Gehaltsscheck leben und Schulden anhäufen. Er war zuversichtlich, dass Dad durch seinen zweiten Job genügend Geld reinbekommt, um das Haus behalten zu können.
Würde er die zweite Kostenaufstellung sehen, wäre sein Optimismus vermutlich sofort verpufft. Noch mal 50000 Dollar Schulden, und zwar bei Leuten, bei denen man besser nicht in der Kreide stand. Ich war kurz davor, es dem Schuldenberater zu beichten, aber ich wollte Dad nicht in die Pfanne hauen.
Die roten Zahlen verschwimmen vor meinen Augen, und trotzdem starre ich weiter darauf, als würden sie mir eine Lösung zurufen. Die Wahrheit ist, dass ich mir seit zwei Monaten, seit ich von den Schulden erfahren habe, über kaum etwas anderes den Kopf zerbreche als das und trotzdem kein richtiger Ausweg in Sicht ist.
»Milo?« Im Wohnzimmer knarzt der Sessel. »Bist du das?«
»Ich bin in der Küche, Dad.«
Sein Gang ist schwerfälliger geworden. Die Doppelschichten und die Nickerchen auf dem Sessel, weil er so erledigt ist, dass er es nicht hoch ins Schlafzimmer schafft, zehren an ihm.
»Du hättest mich wecken können.«
»Und dich um die wenigen Stunden Schlaf bringen, die du jeden Tag bekommst?« Ich schüttle den Kopf.
Dad begutachtet derweil die Dosensuppe, die ich auf der Anrichte stehen gelassen habe.
»Ich wollte mir sowieso noch mal die Lage angucken.«
Seine Miene verfinstert sich. »Ich wünschte, wir könnten uns mal wieder mit anderen Dingen beschäftigen.«
Erschöpft lässt er sich auf dem zweiten Barhocker nieder und fährt sich über den dichten, grauen Bart. Manchmal erschrecke ich richtig, wenn mir auffällt, wie alt Dad geworden ist. Auf früheren Bildern konnte ich mit den dunkelbraunen verwuschelten Haaren als sein Klon durchgehen. Inzwischen sind seine Haare jedoch ergraut und licht.
»Wie viel hast du für meine Uhr bekommen?«, fragt er, und mein Herz wird schwer. Dad seufzt sofort. »So wenig, hm?«
»Ich habe gar nichts gesagt.«
»Dein mitleidiger Blick war Antwort genug.«
Ich seufze ebenfalls. »Hundertfünfzig Dollar. Und das war kein Mitleid, sondern Sorge.«
»Tja.« Dad steht auf und geht zur Anrichte, um die Dosensuppe zu öffnen. »Die Sorgen sind nicht unbegründet. Ich habe gestern mit Carl gesprochen und ihn nach einem Vorschuss gefragt.«
»Keine positiven Nachrichten?«
Dad schüttelt den Kopf. »Wo soll er das Geld hernehmen? Der Sicherheitsfirma geht’s schließlich auch nicht gut, da kann Carl seinen Angestellten nicht noch irgendwelche Gehälter vorstrecken. Aber … na ja, nach all den Jahren hatte ich trotzdem gehofft, es würde sich was machen lassen.«
Seine Hände zittern, als er die Suppe in die Mikrowelle stellt. Es lässt mich jedes Mal hilflos zurück, ihn so emotional und ausgelaugt zu sehen. Langsam fühle ich mich schon genauso gebrochen wie er.
»Das wird schon«, versuche ich ihn aufzumuntern, obwohl wir beide wissen, dass die Hoffnungslosigkeit uns umkreist wie Geier. Immerhin geht es hier nicht nur um die Sorge, Dad könnte unser Haus verlieren. Es geht um sein Leben. Wortwörtlich. Ich habe schließlich die Hämatome auf Dads Bauch gesehen.
»Ich bin ein toter Mann«, bricht es aus ihm heraus, als hätte er meine Gedanken gehört. »Jaxon wird niemals akzeptieren, dass ich nur dreizehntausend Dollar habe. Er wird es mich büßen lassen. Ganz sicher. Ich bin geliefert.«
Ich habe Dad immer für einen klugen Mann gehalten. Für jemanden, der sich nicht in illegale Machenschaften hineinziehen lässt. Schon gar nicht in Sportwetten. Aber altbekannte Thesen und Gleichungen gehen plötzlich nicht mehr auf, wenn Trauer und Einsamkeit sich ausbreiten. Als hätte Moms Krebs sich nicht nur durch ihren Körper, sondern auch durch Dads Urteilsvermögen gefressen.
»Wann ist dieses Treffen noch mal?«, erkundige ich mich.
»In zehn Tagen. Keine Ahnung, wie ich bis dahin noch 37000 Dollar aufbringen soll. Es ist einfach unmöglich.«
Er hat recht. Selbst wenn ich mich doch noch entscheiden würde, meine Wohnung aufzugeben, würde das nichts nutzen. Was sind schon zweitausend Dollar Miete im Vergleich zu 37000 Dollar Schulden?
»Lass mich mit ihm reden«, sage ich nicht zum ersten Mal. Schon seit drei Wochen, seit mir klar wurde, dass wir die Schulden nicht fristgerecht begleichen können, habe ich Dad darum gebeten, mit dem Mann sprechen zu dürfen, der diese immensen Summen von ihm fordert. Nur wollte Dad nie etwas davon wissen.
»Er könnte dich umbringen, Milo! Ich kann nicht zulassen, dass du in die Schusslinie gerätst.«
»Und ich kann nicht zulassen, dass sie dich noch mal so zurichten!«
Das Piepen der Mikrowelle unterbricht mich.
Bewusst atme ich ein und aus, um wieder Kontrolle in mich und meine Stimme zu bringen. Um die Angst fortzuschieben. Dann stehe ich auf und hole die Suppe aus der Mikrowelle und stelle sie vor Dad ab. Er verschlingt sie, als hätte er seit Tagen nichts Warmes mehr gegessen. Vielleicht aus Zeitmangel. Wie lang kann ein Mensch, der bereits über fünfzig ist und ein kaputtes Knie hat, zwei Arbeitsschichten am Tag aushalten?
»Wir werden das Geld nicht rechtzeitig auftreiben«, sage ich nachdrücklich. »Du steckst also schon bis zum Hals in der Scheiße, und das Einzige, was uns bleibt, ist ein Kompromiss. Wir müssen mehr Zeit herausschlagen.«
»Das kann ich versuchen.«
»Wir wissen beide, dass ich besser in so etwas bin. Du hast immer gesagt, ich hätte Anwalt werden sollen, weil ich so gut verhandeln kann. Weißt du nicht mehr?«
»Natürlich weiß ich das noch. Aber mit Leuten wie Jaxon Hernandez verhandelt man nicht.«
»Von Leuten wie Jaxon Hernandez leiht man sich auch kein Geld«, erwidere ich und bereue es sofort wieder. Vorwürfe bringen uns nicht weiter. Er musste sich schon genug davon anhören.
Wieso hast du nichts gesagt?
Wieso hast du nicht legale Wege genutzt, um zu wetten?
Wieso hast du dir so viel Kohle von irgendeinem vorbestraften Geldwäschetypen geliehen?
Wieso, wieso, wieso?
Aber genauso gut könnte ich solche Fragen an mich richten.
Wieso habe ich nicht gesehen, dass es Dad schlechter ging?
Wieso habe ich ihn nach Moms Tod nicht öfter besucht?
Wieso, wieso, wieso?
»Dad, bitte.« Ich nehme seine Hand. »Lass es mich versuchen. Lass mich zu diesem Treffen gehen.«
Er blinzelt mich an, eine Träne läuft ihm über die Wange.
»Was haben wir für eine Alternative?«, versuche ich es weiter. »Mehr als diesen Versuch haben wir doch nicht mehr.«
»Ich weiß.« Seine Hand drückt meine. Er wirkt so unfassbar müde. »Aber versprich mir, dass du auf dich aufpasst. Mit Typen wie Hernandez ist nicht zu spaßen.«
»Versprochen«, lüge ich, obwohl wir doch beide wissen, dass das außerhalb meiner Kontrolle liegt.
Kapitel 2
Who Are You, Miss Cohen?
An einem guten Tag brauche ich von meinem Apartment ungefähr fünfundzwanzig Minuten bis zum Büro. Ich habe Glück, dass ich mich mit meiner dunkelblauen Suzuki SV650 meist mühelos an den Autos und Bussen vorbeischlängeln und somit der New Yorker Rushhour entfliehen kann.
Auch heute überhole ich wartende Autos. Die Sonne durchbricht die Wolken und haucht der Skyline von Manhattan zusätzliche Magie ein. Die meisten bewegen sich darauf zu, sie wollen alle über den East River, aber ich biege ab und bleibe in Brooklyn. Schließlich halte ich vor einem unscheinbaren Gebäude in der Imlay Street.
Das bräunliche Haus und die Lagerhaus-Idylle auf der gegenüberliegenden Straßenseite geben kaum Hinweis darauf, dass sich im Inneren die Redaktion von Current Flash befindet. Nur ein kleines, etwas verblasstes Schild am Hauseingang erinnert daran.
Im Eilschritt betrete ich das Gebäude, begrüße den Pförtner, der wieder einmal am iPhone hängt und nur einen müden Blick für mich übrighat, und fahre dann in den dritten Stock. Die Tür quietscht, als ich eintrete, und so sichere ich mir gleich die Aufmerksamkeit der anderen.
Howard, unser Praktikant, ist der Erste, der mich begrüßt. Egal, wie oft ich ihn sehe und wie oft er seine Brille zurechtrückt: Sie sitzt immer schief auf der Nase.
Er winkt mir über einen der Pappaufsteller hinweg zu, die unsere Arbeitsplätze voneinander abtrennen und so etwas wie Privatsphäre suggerieren, obwohl wir trotzdem jedes Nasenkratzen und Räuspern der anderen hören können.
»Guten Morgen.« Meine Arbeitskollegin Priya kommt mit einem frischen Kaffee auf mich zu. Ihre langen schwarzen Haare fallen ihr wieder einmal seidig über die Schultern.
»Guten Morgen.« Verwirrt sehe ich mich um. Es ist viel zu ruhig hier. »Wo sind Hillary und Paolo?«
»Die sind auf einem Außentermin, für ein Interview mit Alexis Heart.«
Ah. Die Millionenerbin, die auf der Upper East Side eine Kosmetikfirma eröffnet hat. Heute dreht sich vermutlich alles um sie. Roter Teppich, Paparazzi, It-Girls. All die Sachen, mit denen ich eigentlich nie etwas zu tun haben wollte.
Ich wollte immer in einer großen Redaktion arbeiten, vorzugsweise in einer hektischen Geschäftigkeit hinter meterhohen Fensterfronten mit Blick auf Manhattan. Die Realität besteht aus einer Seitenstraße mitten in Brooklyn, meinem cholerischen Chef Steven und einer Welt, in der ich mit fünf anderen Leuten dem neusten Klatsch und Tratsch hinterherlaufe, der mich kein bisschen interessiert. Trotzdem würde ich gerne anstelle von Paolo und Hillary dieses Interview führen, weil es bedeuten würde, mal mehr zu leisten als stumpfsinnige Recherchearbeiten.
»Dann sind es wohl nur wir drei heute«, sage ich zu den anderen.
»Und Steven«, ergänzt Priya und sieht automatisch zu dem einzigen Arbeitsplatz mit richtigen Wänden. »Er hat nach dir gefragt und wollte wissen, wann du kommst.«
»Döm, döm, döm«, macht Howard. »Hast du was ausgefressen?«
Ich stelle mir die gleiche Frage. Unser Chef braucht normalerweise morgens mindestens eine Stunde und viel Kaffee, ehe er uns Anweisungen geben und Gespräche führen kann. Und wenn er dann jemanden hereinruft, handelt es sich eigentlich immer um Paolo und Hillary, die beide schon viel länger hier sind und auf deren Expertise er scheinbar mehr setzt.
»Keine Ahnung«, sage ich mit trockener Kehle. »Aber ich schätze, ich werde es gleich herausfinden.«
Priya schürzt die Lippen. »Viel Glück.«
Steven sitzt mit seiner obligatorischen »Grumpy in the Morning«-Kaffeetasse an seinem Schreibtisch. Als ich die Stelle frisch angetreten hatte, habe ich mich über diesen Spruch noch amüsiert, aber Steven ist wirklich kein Morgenmensch.
Er sieht zu mir auf, und seine Halbglatze glänzt im Licht der Deckenlampe. »Harrison. Schließ die Tür hinter dir.«
Priyas neugieriger Blick verschwindet hinter der geschlossenen Tür, dann trete ich näher an Stevens Schreibtisch. »Du wolltest mich sprechen?«
Steven steht unter einem Ächzen auf und zeigt auf den ovalen Besprechungstisch zu seiner Linken. »Setz dich.«
Ich bemühe mich um einen entspannten Gesichtsausdruck, aber die Nervosität wuchert trotzdem wie ein Pilz in mir. Ich kann nur inbrünstig hoffen, dass Steven keine schlechten Nachrichten für mich hat. Nach einem ganzen Monat voller Probleme habe ich einfach keine Energie, um noch mehr Mist zu verkraften, und ich darf diesen Job – beschissen oder nicht – auf keinen Fall verlieren.
Steven sitzt mir nun gegenüber und mustert mich auf eine besorgniserregende Art und Weise. Noch nie habe ich dieses erwartungsvolle Blitzen in seinen Augen gesehen. Und … ist das ein halb lächelnder Mundwinkel?
»Du hast in deinem Lebenslauf angegeben, dass du im letzten Jahr deines Studiums als Barkeeper gejobbt hast. Stimmt das?«
Perplex blinzle ich. »Ja, ich war für ein Jahr jedes Wochenende im Red Moon, einer Bar Downtown.«
»Dann kannst du Drinks mixen? Oder hast du das inzwischen verlernt?«
»Das würde ich immer noch hinbekommen. Aber ich verstehe nicht …«
Stevens Mundwinkel verziehen sich zu einem ausgewachsenen Lächeln, das mich ehrlicherweise verstört. In den vergangenen sechs Monaten habe ich ihn nicht einmal lächeln sehen.
»Heute ist dein Glückstag, Harrison, denn ich gebe dir eine einmalige Chance.«
Verwirrt kratze ich mich am Hinterkopf. »Was für eine Chance?«
»Wie klingt ein Großauftrag für dich? Inklusive fetter Bonuszahlung.«
Ich richte mich ein wenig auf. Dads dunkelrote Exceltabelle schiebt sich vor mein inneres Auge.
»Worum geht es dabei?«, frage ich vorsichtig. Ich bin nicht mal sicher, ob ich ihn richtig verstanden habe oder nicht doch in irgendeinem Tagtraum festhänge, um nicht mit unschönen Wahrheiten konfrontiert zu werden.
Das Tablet, das Steven mir zuschiebt, fühlt sich jedoch verdammt echt an. Darauf ist ein Foto zu sehen.
»Es geht um sie.«
Eingehend betrachte ich das Bild einer Sängerin. Das Erste, was mir auffällt, ist ihre sexy Version eines Grunge-Looks, der eindeutig von den 90ern inspiriert wurde, obwohl die Frau sicher erst Anfang zwanzig ist. Ihre gefühlt meterlangen Beine stecken in schwarzen Boots und Kniestrümpfen, zu denen sie ein schwarzes Minikleid aus Spitze kombiniert hat. Ihre platinblonden Haare reichen ihr bis zu den Hüften.
»Wer ist das?«
»Hast du die letzten Monate auf dem Mond gelebt?«
Nein, nicht auf dem Mond. Nur auf einem Berg aus Problemen und Familienkrisen. Irgendwo zwischen Trauer und viel zu vielen Schuldgefühlen.
»Das ist Ivy Cohen.«
»Ivy«, murmle ich und krame in meinem Kopf. »Hat Priya nicht irgendwelche Informationen über sie gesammelt?«
Ich erinnere mich noch daran, wie Priya bei einem Mittagessen vor zwei Monaten ein paar Worte darüber verloren hat.
»Sie ist eine Sängerin und tritt hier irgendwo in New York auf, richtig?«
»In der Bronx, in einem Club namens Silverside.«
»Ja, genau.«
Jetzt erinnere ich mich lebhafter an die gemeinsame Mittagspause: Priya aß einen Salat, ich einen Hotdog, und sie hat irgendetwas davon erzählt, Informationen über den Club herausfinden zu müssen. Aber noch während dieser Ausführungen hat mein persönliches Drama begonnen und fast alles von ihren Erzählungen ausgeblendet. In meinem Kopf ist nur noch der Anruf vom Krankenhaus und die Mitteilung, dass mein Dad eingeliefert wurde. Diese Mittagspause fand genau zwei Stunden vor dem Moment statt, in dem ich endlich herausgefunden habe, wieso Dad so ausgebrannt wirkte. Danach wurde mir klar, wie sehr ich als Sohn versagt hatte.
»Ivy Cohen tritt seit vier Monaten im Silverside auf«, bringt Steven mich zurück ins Hier und Jetzt. »Nur einen Monat nach ihrem ersten Auftritt ist ein Video eines Konzertbesuchers viral gegangen, und jetzt rasten alle aus wegen ihr. Sie ist quasi über Nacht zum Star geworden.«
Sofort mustere ich das Foto etwas interessierter. Nach New York verirren sich viele Menschen, die berühmt werden wollen, aber die wenigsten schaffen es wirklich. Schon gar nicht so schnell.
»Was genau heißt das?«, hake ich nach. »Wie berühmt ist sie?«
»Berühmt genug, um einen Exklusivvertrag bei Sony Music unterschrieben zu haben. Sie hat letzte Woche ihre erste Single veröffentlicht und bricht damit sämtliche Streamingrekorde. Das erste Album wurde bereits angekündigt.«
»Und das hat sie wirklich innerhalb von nur drei Monaten geschafft?«
»Tja. Sie ist ein Phänomen.« Steven sinkt tiefer in seinen Stuhl, der bedrohlich knarzt. »Ihre Fangemeinde nennt sich schon Cohearts und flutet das Internet. Ihre Texte, die sie angeblich alle selbst schreibt, sind sehr melancholisch. Richtig deeper Scheiß.«
»Worüber singt sie?«
»Hör es dir selbst an.«
Steven nimmt sich das Tablet und öffnet ein Video von einem ihrer Auftritte. Es hat zwanzig Millionen Aufrufe innerhalb von drei Wochen.
Gebannt sehe ich dabei zu, wie Ivy Cohen mit einer rauen, eingängigen Stimme davon singt, sich Stück für Stück aufzulösen. Sie singt davon, wie ihre Seele zerschmettert und mit dem Wind davongetragen wird. Es hat definitiv etwas Melancholisches, wie sie mit ihrer Reibeisenstimme und den blonden Haaren dasteht und von so viel Schmerz und Leid singt. Sicher finden sich viele Menschen darin wieder. Es ist der perfekte Song, um ihn nachts von irgendeinem Dach zu brüllen und sich mit ihren Worten verbunden zu fühlen. Es erinnert mich an den Zustand nach dem Tod meiner Mom … wenn die Trauer einem vorkommt, als würde man ins Leere fallen und nie wieder daraus ausbrechen können. Aber das ist eben die Macht von Musik. Sie erzeugt Bilder im Kopf und Sehnsucht im Herzen – dafür braucht es nicht unbedingt eine Ivy Cohen. Es gab schon viele Musiker und Bands, die mir den Zugang zu meinen Gefühlen erleichtert und mich berührt haben. Trotzdem beuge ich mich etwas tiefer über das Tablet, als Ivy zu tanzen beginnt. Während der Text und die Stimmfarbe Melancholie ausdrücken, sind ihre Bewegungen dazu federleicht. Sie würde mich fast an eine Elfe erinnern, wäre ihr Tanzstil nicht so verdammt sinnlich. Als wäre sie eine Sirene, die ihrem eigenen Ruf folgt.
Sie singt von innerer Leere und strahlt mit jeder Bewegung Lebendigkeit und Freiheit aus. Ob sie sich des Kontrasts, den sie da schafft, bewusst ist?
Steven stoppt das Video, und ich muss tatsächlich erst mal blinzeln, um mich mental wieder in seinem Büro einzufinden.
»Das war … einnehmend«, gebe ich zu. »Diese Mischung aus Dunkelheit und Licht.« Ich komme mir sofort seltsam vor bei diesen Worten, es klingt viel zu poetisch, um aus meinem Mund zu stammen. Und doch fällt mir keine bessere Beschreibung für das ein, was ich soeben gesehen habe.
Steven brummt zustimmend. »Das Internet ist voll mit Leuten, die versuchen, aus ihr und ihren Songs schlau zu werden und herauszufinden, was hinter diesen düsteren Lyrics steckt. Echte Erlebnisse? Nur PR? Es gibt wilde Spekulationen. Sowohl, was ihre Karriere angeht, als auch für die Zeit davor.« Steven nimmt einen Schluck aus seiner Kaffeetasse.
»Was weiß man aus der Zeit vor der Karriere?«
»Nichts.«
»Wie? Nichts?«, frage ich verdutzt. »Da werden einem doch Interviews mit ihr angezeigt«, sage ich mit einem Kopfnicken Richtung Tablet. »Irgendetwas muss sie darin doch erzählen.«
»Sie sagt offen, dass sie erst vor neun Monaten nach New York kam und dass das hier ihr neues Leben ist. Was sie bis dato gemacht hat, ist nicht bekannt. Bisher zumindest nicht. Es gibt Theorien darüber, dass sie vielleicht früher als Stripperin oder Pornodarstellerin gearbeitet hat, aber ich denke, diese Theorien wurde von Leuten gestreut, die etwas gegen ihre sinnlichen Shows haben. Es gibt einige Menschen, die glauben, Ivy würde mit ihrem Auftreten die jungen Fans verwirren.«
»Komisch. So einen Aufschrei gibt es immer nur bei Künstlerinnen. Was Boybands und männliche Sänger auf der Bühne anstellen, ist meistens egal.«
»Amen«, sagt Steven. »Aber Fakt ist, dass wir quasi nichts über Ivy wissen. Sie gibt so wenig von sich preis, dass die Gerüchte genauso gut wahr sein könnten. Man weiß es einfach nicht.« Frustriert blickt er auf das Standbild, auf dem Ivy mit dunklem Augen-Make-up zu sehen ist.
»Aber wieso dann der Hype?«, frage ich offen. »Ist es nur die erste Faszination? Die Leute mögen es doch eigentlich eher nahbar …«
»Sie ist nahbar. Zumindest für ihre Fans. Während sie in Interviews die Coole spielt und wenig von sich erzählt, ist sie bei den Fans total aufgeschlossen. Ivy gibt in den nächsten zehn Wochen exklusive Konzerte im Silverside, für die die Fans Tickets gewinnen können. Sie nimmt für diese Konzerte kein Geld, alle Tickets werden verschenkt. Und nach jedem Konzert macht sie Fotos mit den Fans und signiert Autogramme.«
Nachdenklich sehe ich zu dem Standbild. »Sie bedient also Gegensätze«, fasse ich zusammen. »Leichtigkeit in ihren Shows, Schwere in ihren Liedern. Offenheit ihren Fans gegenüber, Distanz in der Öffentlichkeit. Eine interessante Mischung.«
»Die für viel zusätzlichen Trubel sorgt, weil niemand so genau sagen kann, was davon nun die echte Ivy ist. Sie ist wie ein Rätsel, das gelöst werden will, und die Leute stürzen sich gerade darauf.«
Nach sechs Monaten bei Current Flash überrascht es mich nicht. Mir ist vorher nie klar gewesen, wie sehr die Leute Klatsch und Tratsch brauchen. Wie sehr die Menschen es lieben, Spekulationen aufzustellen und Geheimnissen auf den Grund zu gehen. Es lenkt sie von ihrem tristen, eintönigen Alltag ab und liefert ihnen ein Gesprächsthema. Ein gesellschaftliches Zusammengehörigkeitsgefühl.
Irgendwo habe ich sogar mal gelesen, dass dieses Phänomen zu unserer Entwicklungsgeschichte als Menschen dazugehört und in archaischen Zeiten überlebensnotwendig war – immerhin lebte man da in kleinen Verbunden und musste wissen, wenn es etwas Neues gab. Damals noch, um sich zu schützen, nicht aus Langeweile.
»Wieso genau erzählst du mir das alles? Was hat das mit deinem Auftrag für mich zu tun?«
»Der Besitzer vom Silverside, Daniel Chambers, sucht momentan einen neuen Barkeeper, und zufällig hat Mister Chambers einen anderen Barbesitzer um Rat gefragt.« Noch nie habe ich Steven so viel Zufriedenheit ausstrahlen sehen. »Nach allem, was im Silverside so los ist, hat er natürlich Sorge vor einer öffentlichen Stellenanzeige und hat auf Empfehlungen gehofft. Glück für mich, dass ich Manny kenne und dass er Mister Chambers von einem ehemaligen Barkeeper vorgeschwärmt hat. Ein gewisser Milo Harrison, der ihm letztes Jahr ausgeholfen hat. Und nun erwartet Mister Chambers von diesem jungen Mann einen Anruf zum Probearbeiten.«
Ich starre Steven an. »Du willst, dass ich im Silverside arbeite?«
»Ich will, dass du dich da einschleust und das Rätsel löst«, lässt er die Bombe platzen. »Enthülle, was Ivy vor dieser Karriere gemacht hat, woher sie kommt, ob sie diese Texte selbst schreibt und was ihre Inspiration dafür war. Letztendlich ist mir egal, was du herausfindest, solange nur eine große Story für uns dabei herausspringt.«
»Eine Story?«, frage ich begriffsstutzig. »Du willst, dass ich Ivy Cohen ausspioniere? Ich … ich weiß nicht, ob das so mein Ding ist.«
Steven verschränkt die Arme vor der Brust. »Du bist doch derjenige, der mir bei seinem Vorstellungsgespräch erzählt hat, dass er von großen Reportagen träumt.«
Genau das waren meine Worte. Nur habe ich dabei nicht an Klatschkolumnen und Lügenmärchen gedacht.
»Das hier ist deine Chance. Wenn du es gut machst, hast du am Ende deine große Reportage – auf der Titelseite, mit deinem Namen. Es gibt da draußen sicher einige Leute, die alles dafür geben würden, um diesen Auftrag auszuführen, aber nicht viele bekommen so eine Möglichkeit von mir.« Steven schmunzelt. »Du hast das, was ich brauche, nämlich echte Erfahrung als Barkeeper.«
Nachdenklich sehe ich zu Steven. Könnte ich wirklich für ein paar Wochen Milo, der Barkeeper sein? Ein verdeckter Journalist auf geheimer Mission? Für die Luftschlösser, die ich mir damals mit zehn Jahren im Büro meiner Mutter gebaut habe und die nun endlich Wirklichkeit werden wollen?
Damals habe ich mir immer vorgestellt, wie es wäre, eine eigene Reportage in einer Zeitung zu haben. An so eine Art von Artikel habe ich dabei aber nie gedacht.
»Wenn dich das noch nicht überzeugt hat, dann sieh dir das mal an«, unterbricht Steven meine Gedankengänge und schiebt mir einen gefalteten Zettel zu.
Einen Scheck.
Mir wird heiß und kalt zugleich, während ich darauf starre.
»D-dreißigtausend Dollar?« Eine Gänsehaut überzieht meine Arme und wandert rauf bis auf die Kopfhaut. »Du gibst mir dafür dreißigtausend Dollar?«
Allein diese Zahl auszusprechen, fühlt sich unwirklich an.
»Mir ist bewusst, dass dieser Auftrag Mehrarbeit und ein gewisses Risiko bedeutet. Er bedeutet, unentdeckt zu bleiben. Du wirst deine Spuren im Internet verwischen müssen – keine Social-Media-Profile unter echtem Namen, nichts, was dich irgendwie mit diesem Job hier in Verbindung bringt. Dein Glück, dass du noch so unbefleckt bist und es bisher keine Artikel unter deinem Namen gibt.« Er zwinkert mir zu, aber der Witz tut ein bisschen weh. »Der Auftrag bedeutet, am Abend hinter der Bar zu stehen, zu recherchieren und sich den Arsch aufzureißen, und das weiß ich zu schätzen. Genauso weiß ich es zu schätzen, wenn du mir das lieferst, was ich mir wünsche. Deswegen gibt es fünftausend Dollar gleich hier und heute, wenn du zusagst. Den Rest gibt es, wenn ich deinen Artikel gelesen und für gut befunden habe.«
Da ist wieder dieses zufriedene, etwas diabolische Grinsen von Steven.
»Wie klingt das für dich?«
Einige Sekunden lang kann ich nichts sagen. Mein Kopf ist dabei, alles durchzugehen und vor Zuversicht zu schreien.
Die roten Zahlen auf Dads Finanztabelle, die noch immer vor meinem inneren Auge tanzen, rufen mir zu, dass ich zusagen muss. Da ist Dad im Krankenhaus, während Maschinen sein Herz überwachen und die Ärztin mir sagt, dass mein Vater zu wenig getrunken und gegessen habe. Da ist Dad, wie er mir beichtet, dass er einen zweiten Job annehmen musste und nun Tag und Nacht arbeitet und sich zu wenig Pausen nimmt. Da ist Dad, der weint und mir gesteht, in welch tiefer Scheiße er steckt. Da sind Schuld und Verzweiflung, weil ich nichts davon habe kommen sehen. Da ist Angst, weil ich Dad nicht verlieren kann, wie ich Mom verloren habe. Weil ich nicht noch mal dabei zusehen kann, wie ein geliebter Mensch dahingerafft wird.
»Fünftausend bekomme ich sofort?« Meine Stimme ist nichts als ein Krächzen. Zu sehr will die Hoffnung durch die Dunkelheit der letzten Wochen kriechen.
Auch dann würde das Geld beim Treffen mit Jaxon nicht reichen, aber ich hätte immerhin eine bessere Verhandlungsgrundlage. Die ganze beschissene, eigentlich hoffnungslose Rechnung würde vielleicht doch noch aufgehen.
»Wenn das ein Ja ist?«, fragt Steven herausfordernd.
Mit fünftausend Dollar auf die Hand und der Aussicht auf weitere fünfundzwanzigtausend Dollar muss es ein Ja sein. Zweifel und Vorbehalte haben keinen Platz mehr, wenn es das Einzige ist, was meinen Dad vielleicht retten könnte.
»Es ist ein Ja«, höre ich mich sagen, obwohl es in meinem Kopf rauscht.
Die ganze Zeit über habe ich darauf gehofft, mich in der Redaktion endlich beweisen zu dürfen. Dabei habe ich nur nie gedacht, dass es direkt um Leben und Tod gehen würde.
Früher habe ich an Manifestation geglaubt. Ich wusste, dass ich Journalist werden wollte, bevor ich richtig schreiben konnte. Ich wusste es immer dann, wenn ich Mom bei ihrer Arbeit in der Havington Gazette beobachtet und mitbekommen habe, an welch wichtigen Reportagen sie arbeitet. Sie hat damit Themen und Missstände angesprochen, die sonst im Verborgenen geblieben wären. Ihre Worte hatten Macht. Und ich fühlte schon früh diesen tiefen Wunsch, in ihre Fußstapfen zu treten. Ich habe mir vorgestellt, wie ich ihren Platz in der Havington Gazette einnehmen würde, und habe gedanklich schon meine Artikel in denselben Ordner geheftet, in dem sie alle ihre Artikel aufbewahrt hat.
Die letzten Monate waren dadurch ein nur noch herberer Rückschlag. Erst habe ich den Job in der Havington Gazette nicht bekommen, dann wollte mich auch keine andere Zeitung einstellen. Letztendlich ist ein Bulldozer über sämtliche Manifestationen, Wünsche und Träume gefahren und hat alles zerstört. Current Flash war ein Kompromiss, der sich aber immer mehr als Frustrationsherd herausgestellt hat. Doch jetzt, als ich aus Stevens Büro komme, kann ich das erste Mal wieder das große Ziel vor Augen sehen.
»Milo? Alles gut?«
Priya steht vor mir und sieht mich besorgt an. Ihre Lippen sind noch schmaler als sonst, und ihr Blick huscht immer wieder zu mir und dann zu Howard, als würde sie ihn auffordern wollen, ihr eine Einschätzung meiner gegenwärtigen Verfassung zu geben. Dabei weiß ich selbst nicht mal, wie es mir geht. Alles fühlt sich noch ganz surreal an. Fast wie ein Fiebertraum.
»Was wollte Steven?«, fragt sie weiter.
»Hm?« Ich sehe verwirrt zu ihr.
»Er ist total hinüber.« Howard zieht hörbar die Luft ein. »Steven hat dich doch nicht gefeuert, oder?«
»Hat er natürlich nicht«, erwidert Priya sofort, aber ihre Stimme zittert leicht. »Richtig? Wieso sollte er so was auch tun?«
»Weil Steven manchmal echt ein Arsch ist«, antwortet Howard.
»Sprich leise, er hört dich noch.«
»Ich denke, er weiß, dass er ein Arsch sein kann. Sieh dir Milo doch mal an, der steht ja total neben sich.«
»Ich … bin okay«, bringe ich hervor und beende damit die Diskussion, auf die Priya gerade etwas erwidern wollte. »Ich bin nur etwas durch den Wind.«
»Weil du doch gefeuert wurdest?«, fragt Howard und fängt sich von Priya einen Klaps auf den Oberarm ein.
»Nein. Ich bin nicht gefeuert.« Ich kratze mich am Hinterkopf, dann sehe ich das erste Mal richtig zu den anderen. »Ich habe meinen ersten eigenen Auftrag.«
»Was?« Priyas braune Augen werden größer. »Ein echter Auftrag? Ein Interview?«
»Größer«, murmle ich. »Viel größer als das.«
Mechanisch gehe ich zu meinem Schreibtisch. Ich muss mich dringend setzen, denn ich fürchte, meine Beine könnten gleich nachgeben. Die anderen folgen mir aufgeregt.
Knapp erzähle ich ihnen von meinem Auftrag, während ich gedanklich meine nächsten Schritte durchgehe. Steven hat mir bereits eine Mail mit den Kontaktdaten von Daniel Chambers geschickt. Ich muss gleich heute dort anrufen, um alles in Gang zu bringen.
»Ivy Cohen«, murmelt Priya. Sie lächelt, aber ich sehe den kleinen Funken Enttäuschung in ihren Augen.
»Ich weiß, dass du vorab wegen dieser Sache recherchiert hast. Es fühlt sich bestimmt unfair an, dass du diesen Auftrag nicht bekommen hast.«
»Zugegeben, ich bin ein kleines bisschen neidisch. Aber das bedeutet nicht, dass ich mich nicht für dich freue. Wir warten schon so lange auf eine Chance.« Priyas Lächeln wird ein wenig echter. »Häng dich da bloß richtig rein, klar? Ich will, dass du das rockst und ihm zeigst, wie viel wir wert sind.«
»Genau, du kämpfst hier auch für uns anderen armen Schlucker, die nicht Paolo und Hillary heißen«, sagt nun Howard und zieht eine Grimasse.
»Weißt du was? Ich schicke dir alles, was ich bislang zum Silverside herausgefunden habe«, schlägt Priya vor. »Ich weiß nicht, wie viel es dir wirklich hilft, aber es schadet sicher auch nicht.«
Dankbar sehe ich zu ihr. Ich weiß, dass es nicht selbstverständlich ist, dass sie mich dabei unterstützt. Meine Mom hat immer gesagt, dass Redaktionen ein Haifischbecken sein können. So ist es wohl immer, wenn Leidenschaft und Kunst nebeneinanderstehen und es darum geht, immer den nächsten Auftrag an Land zu ziehen. Wenn man dabei scheitert, gerät man schnell in eine Spirale aus Selbstgeißelung und Eifersucht. Schafft man es, steht man unter dem Druck, sich immer wieder aufs Neue zu beweisen und ja nicht nachzulassen. Es ist ein Teufelskreis.
Priya eilt sofort zu ihrem Schreibtisch, um mir ihre Infos über das Silverside zu mailen.
Besitzer: Daniel Chambers, 51 Jahre alt. Verheiratet mit Lizz Chambers (49), Vater von Lennon Chambers (22). Früher Barchef im Barely Disfigured. Seit drei Jahren Besitzer vom Silverside, früher für Stage Comedy und Open-Mic-Nights bekannt. Erster Auftritt von Ivy Cohen im Januar 2024.
»Was wirst du als Erstes machen?«, fragt Howard, der über meine Schulter hinweg mitgelesen hat.
»Erst mal bei diesem Daniel Chambers anrufen«, erwidere ich und schnappe mir mein Smartphone.
Lieber telefoniere ich gleich mit ihm, bevor er sich nachher doch jemand anderen für die Bar sucht.
Ich entscheide mich dazu, auf den Flur zu gehen, um zu telefonieren, denn es ist besser, wenn er nicht aus Versehen etwas von unserer Reaktion mitbekommt. Zwischen Aufzug und Treppe hallt es ein wenig, aber ich wähle trotzdem seine Nummer.
Fünf Sekunden lang klingelt es, ehe ein Mann mit dunkler, freundlicher Stimme ans Telefon geht.
»Mister Chambers?« Mein Puls schießt in die Höhe, sodass ich befürchte, er könnte es durch das Telefon bemerken und sofort erkennen, dass ich ein Betrüger bin. »Hier spricht Milo Harrison. Manny Turner hat mir Ihre Nummer gegeben.«
»Ach.« Er lacht leise. »Ja, klar. Ich habe deinen Anruf schon erwartet.«
So weit, so gut.
»Manny hat dich wärmstens empfohlen. Er hat gesagt, dass du ein Jahr für ihn gearbeitet hast?«
»Neben meinem Studium«, versuche ich es mit der Halbwahrheit. »Ich stand jedes Wochenende hinter der Bar.«
»Das ist super.«
Im Hintergrund lacht eine Frau, er wirkt kurz abgelenkt. Ob das Ivy war? Könnte sie gerade im Silverside sein und proben?
»Manny ist schon lange ein Freund und Kollege von mir und meinte, dass ich niemand Besseren finden würde. Daher schlage ich vor, dass du einfach mal zum Probearbeiten kommst.«
Was hat Steven diesem Manny geboten, um seinen Freund zu hintergehen und ihm einen Barkeeper zu empfehlen, den er noch nie im Leben gesehen hat?
»Natürlich. Wann würde es denn am besten passen?«
»Wie wäre es übermorgen? Da haben wir volles Haus, und du kannst gleich mal zeigen, was du draufhast.«
Mister Chambers und ich besprechen die Zeit, zu der ich ins Silverside kommen soll, und ich gebe ihm noch meine Kontaktdaten. Es ist lockerer, als ich anfangs dachte. Irgendwie leicht, trotz der kleinen Lügen.
Als wir auflegen und ich zurück ins Büro gehe, bin ich erleichtert. Bleibt nur noch die Frage, wie ich es schaffen kann, Ivy Cohen bei diesem Barjob näherzukommen.
Kurzerhand gehe ich wieder an mein Laptop, öffne Google und suche die Sängerin, um deren Leben sich meine nächsten Wochen drehen werden.
Ich klicke mich durch Schlagzeilen wie »Neuer Star in New York gesichtet« und »Musikmanager Henry Bishop glaubt an eine große Karriere für Ivy Cohen«. Daneben finde ich auch einige Fanseiten. Videos, auf denen Auftritte der Sängerin zusammengeschnitten wurden, Fotocollagen, sogar Analyse- und Reactionvideos zu ihren Auftritten und den Songtexten.
Und dann finde ich die Artikel von Newsflash200, der wohl größten Konkurrenz von Current Flash. Steven verfällt regelmäßig in Hasstiraden auf das New Yorker Onlinemagazin, das mit seiner News-App und dem Liveticker so was wie Gossip Girl darstellt und eine viel größere Fanbase hat als wir.
Ivy Cohen: ein aufstrebender Stern oder doch nur ein PR-Konstrukt?
Kaum jemand kommt derzeit an der jungen Sängerin Ivy Cohen (21 Jahre) vorbei, die mit ihren nachdenklichen und doch aufreizenden Shows das Internet flutet. Die Fans sind begeistert von der Mischung aus ihren bodenständigen Interviews, tiefgründigen Songtexten und ihren selbstbewussten Auftritten. Doch alle fragen sich: Was hat die junge Frau erlebt, dass ihre Texte von so viel Leid und Schmerz handeln? Wieso erzählt Ivy gleichzeitig so wenig von sich privat? Und wie konnte sie trotzdem so schnell berühmt werden?
Newsflash200 hat mit dem Musikproduzenten Terence Lestright gesprochen, der selbst jahrelang bei SONY MUSIC gearbeitet hat – dem Label, bei dem Ivy Cohen nun exklusiv unter Vertrag genommen wurde. Wir wollten wissen, was er von der steilen Karriere der jungen Sängerin hält, und seine Antwort war vernichtend. »Ich produziere selbst seit rund zwanzig Jahren Musik und würde kritisch hinterfragen, wie schnell Ivy Cohen einen Exklusivvertrag bekommen hat und wie schnell die Albumproduktion gestartet ist; immerhin gibt es lange Vorlaufzeiten in den New Yorker Studios.«
War der Karrierestart über Nacht also im Vorhinein genauestens kalkuliert und alles geplant? Sehen wir hier wirklich eine authentische, aufstrebende Sängerin bei der Erfüllung ihrer Träume … oder doch eine geplante PR-Kampagne, bei der eine talentierte Sängerin eine Rolle spielt, um im Internet gehyped zu werden?
Wenn dem so ist, sollte Ivy wohl doch besser über eine Karriere als Schauspielerin nachdenken.
Die nächsten Artikel von Newsflash200 schlagen alle in dieselbe Kerbe und mutmaßen, dass Ivy nichts als eine Rolle spielt. »Eine Inszenierung durch und durch«, nennen sie es immer wieder, und ich frage mich, ob sie recht haben könnten.
Nachdenklich betrachte ich ein Foto, das Ivy Cohen im Central Park zeigt. Sie trägt eine dunkle Sonnenbrille, und ihre langen Haare sind zu zwei lockeren Zöpfen geflochten, dazu hat sie eine zerrissene Hotpants mit einem oversized Holzfällerhemd und einem Bandshirt von Nirvana kombiniert. Auf dem Bild sieht sie so normal aus, dass es nicht schwerfällt, darin die junge Frau zu erkennen, die erst vor ein paar Monaten bekannt geworden ist und vorher ein normales Leben geführt hat.
Aber sie wäre sicher nicht die erste Sängerin, die eine Rolle spielt, sei es nun freiwillig oder auf Druck durch das Label. Britney Spears wurde zu Beginn ihrer Karriere zu ihrer Babystimme verdammt. Lady Gaga hat in den ersten Monaten ihrer Karriere immerzu Kostüme getragen und sich nie so gezeigt, wie sie war. Miley Cyrus musste das brave Disney-Mäuschen spielen, obwohl sie sich so präsentieren wollte, wie Ivy es auf der Bühne tut: feminin, wild und frei.
»Ivy Cohen«, murmle ich, während ich mir einige Passagen aus dem Artikel abschreibe, um sie im Hinterkopf zu behalten. »Wer bist du? Und wie viel an dir ist echt?«
Kapitel 3
Herbal Tea in Bed
Meine langen Haare verfangen sich in flauschigen rosa Kissen, während ich in einem schwarzen Negligé einen Kräutertee trinke und mir dabei Tausende von Leuten zusehen. Ein seltsamer Gedanke. Es ist schwer, die vielen Kameras nicht bewusst wahrzunehmen und mich stattdessen auf Dolores James zu konzentrieren. In Good Morning, New York soll es gemütlich und intim zugehen, deswegen sitzt sie neben mir in einem Bett, das den Großteil ihres Fernsehstudios einnimmt. Während mein Negligé aus dünnem Seidenstoff ist, hat sich Dolores in einen rosa Flanellpyjama geschmissen und trägt ihre Häschen-Pantoffeln, die inzwischen so etwas wie ihr Markenzeichen geworden sind.
»Deine erste Single Riveting Humility ist erst vor knapp einer Woche direkt auf Platz drei der Charts eingestiegen«, sagt sie nach einem Schluck Kaffee. »Was, glaubst du, ist dein Erfolgsgeheimnis?«
»Ehrlich gesagt analysiere ich so was wie Erfolg nicht gerne. Ich ziehe einfach durch, was ich liebe, und versuche, meine Musik auszuleben.«
Ich widerstehe dem Drang, meine Marketingmanagerin Keyla Jones anzusehen, die nur ein paar Meter hinter der rechten Kamera steht und jedes meiner Worte sorgfältig verfolgt. Die Fragen wurden ihr vorab zugeschickt, sie sind also keine Überraschung für mich. Sie vor der Kamera zu beantworten ist trotzdem nach wie vor ungewohnt, und das, obwohl es mein zehnter Pressetermin diese Woche ist. Podcasts, Radiosendungen, Interviews, Talkshows. Releasewochen sind wild.
»Aber es ist wundervoll, dass meine Musik so gut ankommt. Ich glaube, meine Fans wissen gar nicht, wie viel mir ihre Unterstützung bedeutet.«
»Deswegen verschenkst du die Konzerttickets für deine aktuellen Shows, oder?«, will Dolores wissen. »Um ihnen etwas zurückzugeben?«
»Richtig. Ohne sie wäre ich jetzt nicht hier.«
»Deine Tanzeinlagen werden heiß diskutiert. Woher nimmst du das Selbstbewusstsein auf der Bühne?«
»Ich bin nicht mal sicher, ob es wirklich Selbstbewusstsein ist, was man sieht. Es ist eher das Gefühl, sich komplett im eigenen Körper und Geist fallen zu lassen.«
Dolores lächelt in die Kamera. »Das klingt ja fast spirituell.«
»Sich des eigenen Körpers bewusst zu sein, hat ja auch etwas sehr Spirituelles«, gebe ich zu bedenken.
»Trotzdem bin ich nicht die Einzige, die einen starken Kontrast zwischen deiner doch sehr aufreizenden Bühnenshow und deinen nachdenklichen Texten wahrnimmt. Woher kommt dieser Gegensatz?«
Ich spüre förmlich Keylas Blick auf mir. Er will mir so etwas wie Denk daran, was wir besprochen haben zurufen.
»Das Leben besteht doch aus Kontrasten«, antworte ich ausweichend. »Es gibt Höhen und Tiefen, Schatten und Licht. Und ich befasse mich gerne mit allen Facetten meines Seins.«
Dolores nickt vorsichtig. Ich sehe das kleine Zucken ihres Mundwinkels, als würde sie sich mehr als das erhoffen, aber ihr Lächeln bleibt freundlich.
»Trotzdem sind sich viele Leute da draußen einig, dass du diese Schattenseiten besonders intensiv erlebt haben musst. Deine Texte wirken so unfassbar schmerzvoll und intensiv, das kann doch nicht nur bloße Fiktion sein, oder?«
Ich weiß ehrlich nicht, ob ich es wunderbar oder beängstigend finden soll, dass Leute meinen Songtexten derart viel Beachtung schenken. Wenn man Dinge zu lange betrachtet, findet man ja doch nur etwas, was einem nicht gefällt. Die Wahrheit zum Beispiel.
»Musik ist kraftvoll«, gebe ich zurück.
»Ivy … du machst es einem echt nicht leicht, mehr aus dir herauszubekommen.«
Ich lache leise. »Wo wäre sonst der Spaß?«
Dolores schüttelt lächelnd den Kopf und schaut wieder direkt in die Kamera. »Es scheint, als würden heute nicht alle Rätsel um Ivy Cohen gelöst.« Dann sieht sie wieder zu mir. »Aber ein kleines Geheimnis über dich kannst du doch sicher noch verraten, oder? Irgendetwas, was noch niemand von dir weiß.«
»Mal überlegen.« Ich tue so, als würde ich nachdenken müssen, obwohl Keyla und ich bereits besprochen haben, was ich preisgeben kann. »Manchmal, wenn ich beim Songwriting nicht weiterkomme, höre ich mir Soundeffekte von zirpenden Grillen an.«
Dolores sieht mich verdutzt an. »Ivy Cohen ist also auch noch eine Naturfreundin?« Sie beugt sich etwas weiter vor zu mir. »Oder willst du uns damit einen Hinweis geben, dass du nicht in einer Großstadt aufgewachsen bist?«
Ich nippe lediglich an meinem Tee. Das ist besser als der Versuch eines Lächelns.
»Ich habe vorher auf jeden Fall noch nie in einer so großen Stadt wie New York gelebt. Es überwältigt mich jeden Tag aufs Neue, hier zu sein.«
Eine Stunde später verlasse ich an der Seite von Keyla die NBC Studios. New York City erstrahlt im Sonnenschein, der sich in den gläsernen Fassaden der Wolkenkratzer spiegelt und alles zum Funkeln bringt. Das Negligé habe ich wieder gegen eine enge Lederhose und einen spitzenbesetzten Body getauscht, über dem ich einen Mantel trage.
In den letzten Tagen ist der Frühling in Manhattan ausgebrochen. Die Kirschblüten zeigen sich in ihrer vollsten Pracht, im Central Park singen Vögel, und die Außenterrassen von Cafés und Restaurants sind gut gefüllt. Ungefähr so voll wie mein Terminkalender, der mich nun direkt weiter zum nächsten Interview schickt.
»In einer Stunde sollten wir bei NWYC