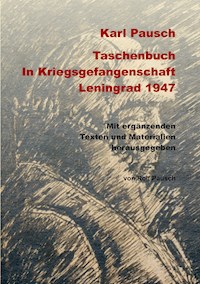
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Nach fast 10jähriger Abwesenheit in Krieg und Gefangenschaft kehrte Karl Pausch (1911-1996) kurz vor Weihnachten 1949 zu seiner Familie zurück. Als einziges Mitbringsel übergab er der Familie ein kleines, in schwarzes Kunstleder gebundenes Büchlein, das er unter Gefahren durch die Kontrollen gerettet hatte. Das 'Taschenbuch', wie er es selbst bezeichnete, ist eine Art Tagebuch des Jahres 1947 in russischer Kriegsgefangenschaft. Darstellt werden in Bild und Text Alltagssituationen des Lagerlebens und der Zwangsarbeit. Aber auch Reflexionen über die Hintergründe und Lebensumstände des Krieges sowie die stets präsenten Gedanken an die zurückgebliebene Familie und die Situation in der Heimat sind Gegenstand der Darstellung. Gedanken, die wohl auch die heutigen Flüchtlinge aus den Kriegs- und Krisenregionen bewegen. Anders als bei Briefen, Tagebüchern oder sonstigen Aufzeichnungen besteht die Besonderheit des Bändchens aber darin, dass der gesamte (Fließ-)Text in einer gezeichneten Schrift angelegt ist. In Einheit mit einer Vielzahl von Vignetten, kleineren und ganzseitigen Zeichnungen bildet das Ganze eine Art Buch-Kunstwerk. Der Herausgeber versucht, die Zeit, von der das 'Taschenbuch' handelt, in den Rahmen eines gelebten Lebens zu stellen: Neben Erinnerungsstücken aus dem Nachlass des Autors schien es sinnvoll, Erläuterungen und eigene Erinnerungen an die Person und die damaligen Lebensumstände beizutragen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 86
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Den Nachfolgenden
zur Erinnerung und Mahnung
Selbstportrait als Soldat (1943)
Für die Gestaltung des Einbands sind die Tusche-Zeichnung 'Ost-West' sowie das Aquarell 'Zementfabrik' aus dem Taschenbuch verwendet worden.
Vorwort
Im Zentrum der vorliegenden Schrift steht das liebevoll gestaltete 'Taschenbuch' meines Vaters aus der Kriegsgefangenschaft, das er meiner Mutter und mir zu Weihnachten 1949 als Geschenk und einziges Mitbringsel nach über 472 Jahren in russischer Gefangenschaft übergab.
Anders als viele Berichte dokumentiert es in ungewöhnlicher Weise in mehr als 100 vollkommen durchgestalteten Seiten mit Aquarellen, Signets und gezeichneten Texten die Lebenswirklichkeit in den Lagern, in denen die Gedanken der meisten Gefangenen bei schwerer Arbeit und unzureichender Ernährung unablässig um die Heimkehr und die Situation der zurück gelassenen Familie kreisten.
Ich selbst habe dieses Büchlein damals – gerade zehnjährig und in der komplexen Situation, dass da ein mir fremder Mann in unser familiäres Leben trat – nicht bewusst wahrgenommen. Auch später hat es mir meine Mutter nicht gezeigt und es wohl auch versteckt aufbewahrt. Mein Vater schrieb, er habe es nach Ihrem Tode im Juni1985 "im Geheimfach eines Nähtischchen" wiedergefunden. Vielleicht habe es sie belastet, sich an diese böse Zeit zu erinnern. Aus Anlass meines Geburtstages im September 1985 wolle er es aber in unserer Familie weitergeben.
Auch bei diesem Anlass habe ich das Büchlein – intensiv mit beruflichen Dingen beschäftigt – nur oberflächlich durchgesehen und für eine spätere Aufarbeitung zu anderen Erinnerungsstücken gelegt.
Erst im Zusammenhang mit einem Besuch in Köln im Mai 2020 erinnerte Tochter Sonja daran, dass es doch dieses Tagebuch des Großvaters gebe und dass dies vielleicht auch für Enkel Max von Interesse sein könne, da jene Zeit Schulstoff sei. Nachdem wir das Büchlein herausgekramt hatten, wurde mir klar, dass ich es noch nie vollständig gelesen und mit allen Details zur Kenntnis genommen hatte.
Die nunmehr eingehendere Beschäftigung mit dem wiedergefundenen Erinnerungsstück führte mir vor Augen, dass es sich dabei um ein zeitgeschichtliches Dokument handelt, das über die reine Textinformation hinaus durch seine grafische Gestaltung besticht. Es erscheint angemessen, das Büchlein über die reine Wiedergabe des Originals mit Erinnerungen an die Person des Autors und seiner Lebensumstände anzureichern, die mir noch zur Verfügung stehen. Manche Begriffe und Denkungsweisen der damaligen Zeit bedürfen auch der Erläuterung. –
In Gesprächen und Diskussionen hat meine Vater eher wenig über die Zeit in Kriegsgefangenschaft berichtet. Ich erinnere mich aber, dass er – fast 10 Jahre aus dem normalen Leben gerissen – in den 50er Jahren lange brauchte, sich aus den kulturellen und gesellschaftspolitischen Vorstellungen der 30er Jahre zu lösen. So etwa überwand er erst spät die typischen Vorurteile gegenüber der Kunst der klassischen Moderne, die noch recht nahe an der Verunglimpfung als 'entartet' lagen. Wenngleich kein Nazi, war ihm völkisches Gedankengut ("das deutsche Volk", "der Russe", Frankreich und England als feindliche Nationen) noch selbstverständlich. So manifestiert es sich sprachlich auch in dem 'Taschenbuch'. Diese Sichtweise veränderte sich erst in den 60er und 70er Jahren mit vielen Reisen durch ganz Europa.
Köln, im November 2020 Rolf Pausch
Inhalt
Vorwort
Rolf Pausch: Einführung
Vita
Militärdienst und Krieg
Im sowjetische Lagersystem
Spätheimkehr: Erinnerungen von Rolf Pausch
Anmerkungen zum 'Taschenbuch'
Das 'Taschenbuch': Texte und Bilder
Vorwort [Weihnachten 1949]
Heimat
Dir Hedi
Neujahr 1947
Briefe aus der Heimat
Erste Frühlingsblume
Muttertag
Zum 9. Mai 1947
[
Glossen:] Der Nachschlag | Das Kochrezept | Die verhängnisvolle Marke
Gemüsebau
190g Brot
Die letzte Kippe
Geburtstagsgrüße
Ziegel – Ziegel
Lieber Rolf!
Das Atelier
10 Jahre
Weihnachten 1947
Sylvester
Glossar
1943, während eines Heimaturlaubs in Wüsten
Rolf Pausch: Einführung
Die Einführung versucht, die Zeit, von der das 'Taschenbuch' handelt, in den Rahmen eines gelebten Lebens zu stellen. Neben einigen Erinnerungsstücken aus dem Nachlass meines Vaters schien es mir sinnvoll, eigene Erinnerungen an die Person und die damaligen Lebensumstände beizutragen. Die heutigen Möglichkeiten der Netzrecherche – an vorderer Stelle mit Hilfe von Wikipedia (zitiert als 'WP:' mit Lemma und Datum des Aufrufs) – erleichterten es, mit vertretbarem Aufwand Daten und Sachinformationen zu verifizieren und einzuordnen.
Selbstportrait nach einem Foto aus den 30er Jahren | Signet
Vita
Geboren 23.1.1911 in Freising bei München, gestorben 25.8.1996 in Herford/Westf. 1937 Heirat mit Hedwig Busold in Herford. Im September 1939, 14 Tage nach Kriegsbeginn, Geburt des Sohnes Rolf Pausch in Stettin. Ab Januar 1940 Kriegsdienst zunächst in Frankreich, anschließend an der Ostfront, wo er 1945 in russische Kriegsgefangenschaft geriet.
Karl Pausch war gelernter Schriftsetzer und bestand bereits als 23jähriger 1934 vor der Handwerkskammer Bielefeld die Meisterprüfung. Bis zum Beginn des Kriegsdienstes arbeitete er in diesem Beruf in verschiedenen Druckereien in Herford, Bitterfeld und Stettin. Über das Handwerk hinaus bildete er sich im grafischen Bereich weiter (u. a. an der Bielefelder Werkkunstschule, sowie an der Leipziger Akademie für Graphische Künste und das Buchgewerbe), entwarf Bucheinschläge, Prospekte, Lesezeichen etc., in denen stets das typografische Element eine zentrale Rolle spielte.
Im April 1939 hatte er eine Stellung als Betriebsleiter bei der Druckerei Reinke & Völz in Stettin angetreten – wie es im Einstellungsschreiben hieß, zur "Unterstützung der beiden Inhaber". Es bestand also wohl die Perspektive, als Geschäftsführer oder Mitinhaber in den Betrieb hineinzuwachsen. Die Familie fühlte sich in Stettin wohl und hätte dort festen Fuß fassen und sich weiterentwickeln können. Stattdessen wurde Karl Pausch Ende Januar zum Kriegsdienst eingezogen. Angesichts der sich abzeichnenden Kriegsentwicklung schien es für die junge, nun praktisch alleinstehenden Mutter mit Kleinkind jedoch angemessen, das soziale Umfeld der Geschwister in Herford zu suchen. So zog die Familie im September 1941 in das Dorf Wüsten bei Bad Salzuflen zu Hedwig Pauschs Schwester. Diese hatte unmittelbach zu Beginn des Krieges ihren Mann verloren und lebte allein in ihrem Haus. Glückliche Urlaubstage in diesem Haus beschreibt Karl Pausch auch im vorliegende 'Taschenbuch'. Kurz nach Kriegsende, als es noch keine Nachricht über der Verbleib ihres Mannes gab, zog Hedwig Pausch erneut um zu einer weiteren Schwester in Herford.
Dorthin kehrte Karl Pausch nach fast 10 Jahren Abwesenheit in Krieg und russischer Gefangenschaft als fast 40jähriger zu Weihnachten 1949 zurück. Hier begründete er ein eigenes Atelier und arbeitete als selbständiger Grafiker bis in die 80er Jahre vornehmlich für die Schokoladenindustrie. Auch dabei war Schrift stets ein sorgfältig und individuell gestaltetes Element. Berücksichtigt man, dass in dieser Generation von Grafikern bis zum Verbreitung leistungsfähiger Grafikrechner wichtige Schriftelemente stets von Hand und individuell gezeichnet wurden, so erklärt sich die handwerkliche Sicherheit bei der Schriftgestaltung.
Sowohl während des Kriegsdienstes in einer Felddruckerei wie auch phasenweise und in der Freizeit während der Gefangenschaft in Russland hatte er Gelegenheit, sich in diesem Bereich weiterzuentwickeln, wie das hier vorgelegte 'Taschenbuch' beweist.
Militärdienst und Krieg
Nach der Meisterprüfung, leistete K.P von Oktober 1935 bis September 1936 seine einjährige Wehrpflicht ab. Soweit ich weiß, war er auch zum 'Reichsarbeitsdienst' bei den Ausschachtungsarbeiten für die Autobahntrasse durch den Stuckenberg bei Herford verpflichtet worden.
1940 oder 1941
Schon Ende Januar 1 940 – also kurz nach seinem 29. Geburtstag – wurde er zum Kriegsdienst eingezogen. Die Familie bezog ab 27.1.1940 'Familienunterhalt' in Höhe von 178.– RM. Im ersten Kriegsjahr war er an der Westfront in Frankreich eingesetzt. Dort konnte er am 31. Januar 1941 noch seinen Geburtstag unter einigermaßen normalen Verhältnissen in Le Touquet am Ärmelkanal feiern, wie er im vorliegenen Text beschreibt. Über den 2. Geburtstag im Kriege schreibt er: "1942 habe ich bei Ic der 16. Armee von morgens 7 Uhr bis nachts um 12 Uhr stehend am Zeichentisch gearbeitet. Es war die Zeit des Russeneinbruchs bei Ostaschkow-Cholm und die Zeit der Kälte über 40°." Im Januar 1942 gab es also bereits Gegenoffensiven. Offensichtlich aufgrund seines Berufs wurde K.P. in einer sogenannten Propaganda-Kompanie eingesetzt. (Ic ist die Kurzbezeichnung für den 'Dritten Generalstabsoffizier', der für die 'Feindlage' und das 'militärische Nachrichtenwesen' zuständig war.) Über seine Aufgaben dort habe ich wenig erfahren. Der 'Zeichentisch' deutet darauf hin, dass Lagepläne für miltärische Operationen gezeichnet werden mussten. Es wurden aber auch Nachrichtenblätter, Propaganda-Schriften und Flugblätter gedruckt. Wir erhielten mit der Feldpost ein Bändchen mit Grimms Märchen, das mein Vater von Hand koloriert hatte. Es war wohl zur Erbauung der Soldaten und ihrer Angehörigen gedruckt worden.
Den Rest des Krieges scheint er bei der Produktion eines Nachrichtenblattes tätig gewesen zu sein, wie er wiederholt schreibt ("wir Nachrichtenblättler"). Dort wurde auch eine russisch-sprachige Zeitung von russischen Kollaboranten erstellt, wie er im Zusammenhang mit seinem Geburtstag 1943 erwähnt.
Sein militärischer Rang war Stabsgefreiter, also ein gehobener Mannschafts-Dienstgrad.
"Der Stabsgefreite war wie die anderen Gefreitendienstgrade für Angehörige der Mannschaften gedacht, denen die Unteroffizierslaufbahn verschlossen blieb. Sie wurden häufig mit Vertrauensstellungen wie Futter- und Quartiermeister bedacht. In den letzten Kriegsjahren wurden Stabsgefreite aufgrund des Mangels an Unteroffizieren oft als Gruppenführer verwandt." [WP: Stabsgefreiter, 26.06.2020]
Insgesamt hatte er das Glück, bis gegen Ende des Krieges nicht im Fronteinsatz gestanden zu haben.
Über den eigentlichen Vorgang der Gefangennahme hat er mit mir nie gesprochen. Seiner Rechnung nach, bei der er zu Beginn des Jahren 1947 von 20 Monaten Kriegsgefangenschaft spricht, muss dies unmittelbar vor oder im Zusammenhang mit der Kapitulation der Wehrmacht am 8./9. Mai 1945 erfolgt sein.
Im sowjetische Lagersystem
Die Zwangsarbeit der Kriegsgefangenen in den Lagern der Sowjetunion war zunächst darauf ausgerichtet, im Sinne einer 'Wiedergutmachung' die Schäden des Krieges auf dem Gebiet der Sowjetunion zu beseitigen. Ob dies in einer angemessenen Weise und nach den Regeln der Genfer Konvention geschah oder ob die Zwangsarbeit – wie auch in der Kriegswirtschaft des Dritten Reichs – zur kostengünstigen Erstellung von Gütern und Infrastruktur, also zur Bereicherung der eigenen Volkswirtschaft genutzt wurde, soll an dieser Stelle nicht erörtert werden. (Bei einer Schiffsreise 2010 von Moskau nach St. Petersburg fuhren wir über einen Kanal, der von deutschen Kriegsgefangenen ausgeschachtet worden war.)
Das System von Straf- und Arbeitslagern ('GULAG') hat in der Sowjetunion eine lange Traditon, die weit über die Internierung von Kriegsgefangenen hinausreicht. Schon immer wurden Straffällige aber auch politische Gegner, missliebige Ethnien und Nationalisten aus den Kolonialgebieten in Arbeitslager deportiert. Die Internierung der Kriegsgefangenen traf also bereits auf ein gut funktionierendes Verwaltungssystem, das in der
Lage war, die große Zahl der Gefangenen zu verteilen und den Arbeitseinsatz zu organisieren:
"Die über drei Millionen Kriegsgefangenen in der Sowjetunion wurden in Sammellager gebracht und von dort aus zu den einzelnen Kriegsgefangenenlagern transportiert. Ein Kriegsgefangenenlager hatte einen Hauptstandort mit dem Sitz der Lagerverwaltung und administrativ angeschlossene Nebenlager (bis zu 25 Nebenlager pro Hauptstandort).





























