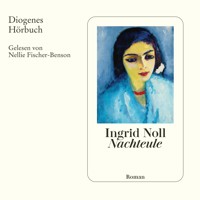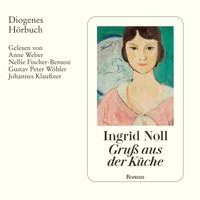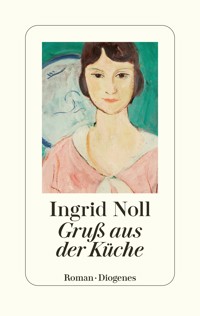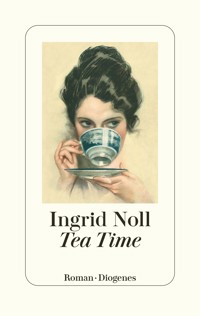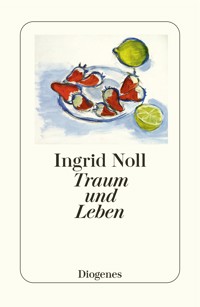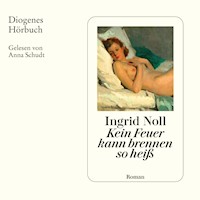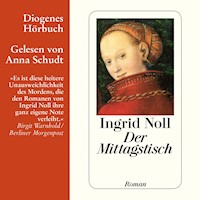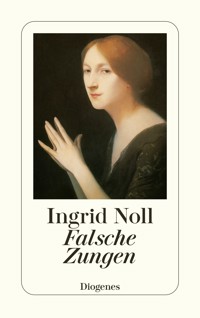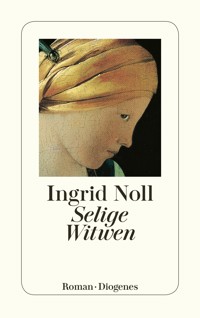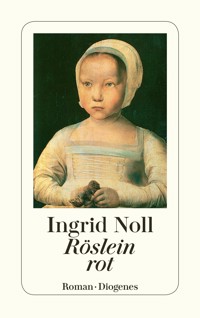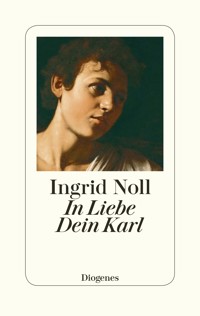
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die ganze Palette der Ingrid Noll in Kurzgeschichten: ihr krimineller Witz, ihre warmherzige Lebenserfahrung, ihre Beobachtungsgabe. In diesem Buch kommt ein Weiteres hinzu: Autobiographisches. Ein Brief an ihre verstorbene Mutter, die Rolle ihres Vaters. Ihre Kindheit in China. Wie sie sich ihre letzten 24 Stunden wünschen würde und was sie am Altwerden nervt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 265
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Ingrid Noll
In Liebe Dein Karl
Geschichten und mehr
Diogenes
Diebe und Triebe
Der Machandelbaum
Im Nachhinein war es ein Fehler, diesen Mann zu heiraten. Nicht dass er bösartig oder geizig wäre, aber eine Partnerschaft, die nur aus praktischen Gründen eingegangen wird, hat letztlich doch zu wenig mit Liebe zu tun. Außerdem brachte er einen kleinen Sohn mit in die Ehe, mit dem ich von Anfang an nicht zurechtkam.
Ich war alleinerziehende Mutter einer Tochter, er wiederum hatte seine Frau verloren und ein kleines Kind großzuziehen. Eine funktionierende Patchworkfamilie hat im Prinzip viel für sich. Mein Mann konnte nun unbesorgt zur Arbeit gehen, ich dagegen meinen verhassten Job als Souffleuse beim Stadttheater an den Nagel hängen, wo ich bei allen Proben und Aufführungen hatte präsent sein müssen. Mit den beiden Kindern, Haus und Garten hatte ich mehr als genug zu tun.
Seltsamerweise verstanden sich unsere Kinder auf Anhieb gut. Ja, mein Lenchen entwickelte mit seinen sieben Jahren geradezu mütterliche Gefühle für Timmi. Der Kleine bewunderte sie und nahm es sogar hin, dass sie ihn gelegentlich auslachte, weil er noch Windeln trug. Eigentlich hätte man erwarten müssen, dass Lene eifersüchtig würde, wenn der Kleine von seinem Vater in den Arm genommen und geherzt wurde, aber so war es nicht. Zwar kümmerte er sich aus purem Anstand gelegentlich auch um Lene, doch ganz ohne die bedingungslose Liebe, die er für seinen Sohn empfand. Ich konnte das kaum ertragen.
Jeden Abend saß dieser Mensch, der mir letztlich fremd geblieben ist, am Bettchen seines Sohnes und sang.
Abba Haidschi bumbaidschi schlaf lange,
Deine Mama ist ausgegange,
Sie ist ausgegange
Und kommt wieder heim,
Sie lässt ihren Timmi doch niemals allein …
Mit solchen gedankenlosen Versen nährte er die Hoffnung des Kindes, seine leibliche Mutter käme wie durch ein Wunder wieder zurück. Damit nahm er mir gänzlich die Chance, mit der Zeit an ihre Stelle zu treten.
Timm war ein verschlossener Junge. Er starrte mich mit seinen großen blauen Augen so ängstlich und vorwurfsvoll an, als sei ich die Hexe aus dem Märchen und für den Tod seiner Mutter verantwortlich. Meistens ignorierte er meine Fragen, zuckte nur weinerlich mit den Lippen und brachte keinen Ton heraus. Beim Essen brauchte er eine Ewigkeit, bis der Teller halbwegs leer war; mehr als einmal riss mir der Geduldsfaden. Dann schob ich ihm mit sanfter Gewalt das Fleisch in den Mund, das er stundenlang in den Backentaschen hamsterte. Manchmal konnte ich nur durch eine Ohrfeige erreichen, dass dieser Brocken endlich herunterrutschte. Obwohl ich also alles tat, um den Jungen vernünftig zu ernähren, blieb er klein und mickrig, bleich wie ein Albino, doch mit unnatürlich roten Lippen. Leider war er auch geistig zurückgeblieben und mit seinen vier Jahren auf dem Niveau eines Zweijährigen. Nur wenn er mit Lene spielte oder sein Vater heimkam, pflegte er ein wenig aufzutauen. Im Gegensatz zu meiner Tochter, die bei jeder Kleinigkeit in Tränen ausbrach, weinte Timmi fast nie. Selbst als er sich durch eine Ungeschicklichkeit meinerseits die Hand verbrühte, heulte nur Lenchen los. Ich hätte sie eher Heulsuse als Marlene taufen sollen.
Timm wurde von seinem Vater über die Maßen verwöhnt. Es leuchtet sicherlich ein, dass ich für einen Ausgleich sorgte und meine eigene Tochter bevorzugte. Die Kinder schienen dies als Selbstverständlichkeit hinzunehmen und beschwerten sich nie. Jeden Sonntag besuchte mein Mann das Grab seiner ersten Frau, wobei er Timm und Lene meistens mitnahm. Ein Zypressen-Wacholder war die einzige Zierde ihres Grabs. Timms Vater erzählte den Kindern, dass dieser Baum in einem Märchen vorkam und Machandelbaum genannt wurde. Lenchen behauptete, dass Timms verstorbene Mutter aus der Lüneburger Heide stammte und deswegen Wacholder liebte. Eine seltsame Vorstellung, statt an saftig frischem Grün an einem solch unscheinbaren, kratzigen Baum Gefallen zu finden.
Allein schon wegen ihrer abartigen Vorlieben musste diese Frau eine Spinnerin gewesen sein, wahrscheinlich kam der Junge ganz nach ihr. Um ehrlich zu sein, hasste ich sie ebenso wie ihr Kind, obwohl ich sie ja niemals kennengelernt hatte. In meiner Gegenwart sprachen mein Mann und sein Sohn nie über die Tote, aber man spürte, dass sie unentwegt an sie dachten. Der Geist dieser Spökenkiekerin waberte durch unser Haus und quälte mich. Hin und wieder zerbrach ich absichtlich einen Gegenstand aus ihrem Besitz, den sie wahrscheinlich schön gefunden hatte. Auf diese Weise entsorgte ich einige Gläser, Vasen und Tontöpfe, die auf ihren hausbackenen, altdeutschen Geschmack schließen ließen. Außerdem bohrte ich nach und nach immer mehr Mottenlöcher in die kitschig bestickten Kissen, bis mein Mann endlich auf die Idee kam, diese rieselnden Allergie- und Milbenschleudern höchstpersönlich in einen Rotkreuzcontainer zu werfen. Schwerer fiel es mir allerdings, die Katze loszuwerden. Fast schien es, als hätte sie mich durchschaut, denn sie ging mir aus dem Weg und ließ sich von mir nicht anfassen. Es war nicht ganz einfach, an Rattengift heranzukommen, doch es wirkte. Als Lene das tote Tier unter der Hecke fand, brach sie in ein theatralisches Lamento aus.
Timm blieb wie immer stumm, fixierte mich aber auf so penetrante Weise, dass ich es schließlich nicht mehr aushielt und ihn im Badezimmer einsperrte. Als mein Mann nach Hause kam, protestierte er scharf gegen diese Maßnahme. Ich hörte zu meinem Erstaunen, wie der sprachlose Timm anklagend sagte: »Papa! Mamas Katze ist tot.« Mich hatte das Kind nie mit Mutter, Mama oder Mutti angeredet.
Am nächsten Tag wurde Timm krank, mein Mann konnte ihn auf dem Weg zur Arbeit nicht wie gewohnt im Kindergarten absetzen. Der Junge habe erhöhte Temperatur und Halsschmerzen, behauptete er, vielleicht sei es ja die Schweinegrippe; ein fiebersenkendes Zäpfchen habe er ihm bereits verabreicht. Wahrscheinlich werde der Kleine nichts essen wollen, ich solle ihm aber Tee machen. Und ein Eis sei bei Halsweh auch nicht falsch, das rutsche immer hinunter. Das war wieder einmal typisch für die Ignoranz meines Mannes. Wo kämen wir hin, wenn man jedes verschnupfte Kind mit Eis füttern würde? Bauchweh und Durchfall wären die Folgen.
Gegen die eigene Überzeugung fragte ich Timm: »Möchtest du ein Eis?«, denn ich wollte meinem Mann keinen Anlass geben, mir wieder einmal Vorwürfe zu machen. Der Junge nickte matt, man hätte wirklich etwas mehr Dankbarkeit erwarten können. »Vanille oder Schokolade?«, fragte ich, doch er antwortete nicht. Dann solle sich das Herrchen gefälligst in den Keller bequemen und sein Eis selbst aussuchen, befand ich. In seinem ewig schmutzigen Schlafanzug und Lenes roten Pantoffeln schlurfte Timm hinter mir die Treppe hinunter.
Ich öffnete den schweren Deckel der Gefriertruhe, hob Timm ein Stückchen hoch und ließ ihn hineinschauen. Die Vorräte waren fast aufgebraucht, weshalb die Eispackungen tief unten lagerten. Zaghaft deutete er auf ein Cornetto-Hörnchen.
»Dann hol es dir«, sagte ich. Als der Junge während des Tauchgangs kopfüber in der Truhe hing, ließ ich seine Beinchen versehentlich los, und Timm purzelte hinein. Geistesgegenwärtig schlug ich den Deckel zu. Den Quälgeist bin ich für eine Weile los, dachte ich erleichtert, ging wieder nach oben und schaltete Bügeleisen und Fernseher ein. Die Zeit verging wie im Flug, weil ich ungestört meine spannende Daily Soap anschauen konnte. Draußen war ein heißer Tag, drinnen glühte das Bügeleisen, aber trotzdem fror ich.
Irgendwann war ich fertig mit der Arbeit und sah auf die Uhr. Sollte ich Timm jetzt wieder aus der Truhe befreien? Und wohin mit ihm, falls er erfroren war? Man durfte mir nicht auf die Schliche kommen, ich musste mir eine glaubwürdige Ausrede einfallen lassen. Doch in diesem Fall war es relativ einfach: Der Junge hatte sein Eis bereits aufgegessen und wollte sich unerlaubterweise ein zweites besorgen. Also war er in die Truhe geklettert, die zufällig noch nicht fest verschlossen war, und dabei war der Deckel zugefallen. Ein Unglücksfall, wie er im Buche steht. Sollte man mir erst einmal das Gegenteil beweisen.
Wo nur meine Lene blieb? Sie hätte längst von der Schule zurück sein müssen, es war inzwischen Mittag. Als ich zur Haustür lief und auf die Straße schaute, entdeckte ich neben der Gartenpforte ihr seidenes Tüchlein. Hatte sie es bereits auf dem Hinweg verloren? Nachdenklich nahm ich das Halstuch in die Hand, denn es passte nicht in die warme Jahreszeit. Innen war ein harter Gegenstand eingewickelt, ein abgenagtes Hühnerbein. Lenchen war im Gegensatz zu Timm eine gute Esserin, sie neigte leider dazu, sich mit dem täglichen Apfel nicht zufriedenzugeben und ihre Schulfreundinnen um deftigere Kost anzuschnorren. Angeekelt ließ ich den Fund wieder fallen.
Vielleicht hatte ich beim Fernsehen die Klingel überhört, und mein Kind hatte ratlos vor verschlossener Tür gestanden? Doch plötzlich bemerkte ich, dass das Garagentor offen stand, und mir fiel ein, dass Lene ja zum Glück das Versteck des Garagenschlüssels kannte. Wahrscheinlich saß sie schon längst im Kinderzimmer und machte Hausaufgaben.
Aber weder dort noch sonst wo im Haus war Lenchen zu finden. War es denkbar, dass sie von einem Pädophilen verfolgt und beim Betreten der Garage entführt worden war? Hatte sie heute vielleicht Wandertag, und ich wusste nichts davon, oder gab es noch ähnliche Strafen wie früher das Nachsitzen? In meiner Not rief ich bei der Schulsekretärin an und erfuhr, dass man die gesamte zweite Klasse am Morgen gleich wieder nach Hause geschickt hatte, da fünf Schüler an Schweinegrippe erkrankt waren. Wahrscheinlich war meine Tochter mit ihren Freundinnen mitgelaufen und spielte jetzt in deren Kinderzimmer mit Barbies.
Und wenn doch alles viel schlimmer war? Hatte Lene vielleicht auf dem Weg durch die Garage den Vorratskeller durchquert und Lust auf ein Eis bekommen? Und war sie am Ende zu ihrem Bruder in die Truhe geklettert und hatte den defekten Deckel nicht hochgehalten, so dass er zufiel und beide darin gefangen waren? Sekundenlang spürte ich einen fast übermächtigen Impuls, die Treppe hinunterzurennen, die Gefriertruhe aufzureißen und die Kinder zu retten.
Doch vielleicht war es längst zu spät, und es galt, zwei Tote zu bergen. Schon allein bei der Vorstellung wurde mir schlecht, ich musste mich übergeben und taumelte ins Schlafzimmer, wo ich mich halb ohnmächtig verschanzte. Trotz zweier Daunendecken bekam ich heftigen Schüttelfrost, muss aber kurze Zeit später eingeschlafen sein.
Wie ein durchsichtiges Gespenst stand Lene plötzlich vor meinem Bett und weinte. Als sie Stunden zuvor heimgekommen sei, habe sie den kleinen Timm tot in der Gefriertruhe entdeckt und in einer Art Schockzustand die Flucht ergriffen. Das dürfe der Papa nie erfahren, schluchzte sie, er würde uns bestimmt beide umbringen. Wir müssten den Kleinen verschwinden lassen, was auch nach meiner Meinung die beste Lösung war.
Meine kleine, aber kräftige Tochter half mir, den steifgefrorenen Jungen in den Hobbyraum zu tragen und mit der Motorsäge grob zu zerlegen. Die großen Teile schweißte ich ein und beschriftete sie mit rotem Folienstift: Rehkeule, Gänsebrust, Hasenfilet, Wildschweinrücken. In der Tiefkühltruhe würden die Pakete vorerst nicht weiter auffallen. Allerdings konnte ich mit den Händen und Füßen sowie dem abgetrennten Kopf, aus dem mich die riesigen blauen Augen immer noch anstarrten, nicht ebenso verfahren. Ich steckte alles in eine Kaufhaustüte, tauschte diese dann aber zwecks besserer Verrottung gegen ein Jutesäckchen aus und vergrub das Bündel im Komposthaufen. Entbeinte Stücke schnitt ich in mundgerechte Happen und gab sie mit Olivenöl, Zwiebeln, zwei Lorbeerblättern, Paprika, Salz und Pfeffer, Tomatenmark, Wacholderbeeren und Knoblauch in die heiße Pfanne. Dann löschte ich mit Rotwein ab. Schon bald duftete es köstlich, aber selbst die nimmersatte Lene mochte nicht einen Bissen probieren. Sie half zwar beim Umrühren, doch ihre Tränen tropften unablässig in den Bräter, so dass ich schon befürchtete, der Fond werde versalzen. Ein paar ausgelöste Knochen wickelte Lene umständlich in ihr Tüchlein.
»Sag dem Papa, dass ich mit Timmi auf dem Spielplatz bin«, sagte sie und verließ das Haus. Mir gab es jedes Mal einen Stich, wenn sie meinen Mann ganz selbstverständlich als Vater akzeptierte, während Timm mich immer wie eine Fremde behandelt hatte. Ich ließ Lene ziehen, denn ich musste dringend die Küche putzen, wenngleich ich bereits von der anstrengenden Arbeit ziemlich erschöpft war und eigentlich in Ruhe die Nachrichten sehen wollte.
Doch ich blieb nicht ungestört, denn schon bald kam mein Mann hungrig von der Arbeit.
»Wie geht es dem Kleinen, Marga?«, fragte er als Erstes. »Ist er wieder gesund?«
»Und ob«, sagte ich. »Er ist gerade mit Lenchen zum Spielplatz gelaufen; Kleinkinder scheinen ja manchmal dem Tode nah und sind zwei Stunden später wieder putzmunter.«
Das kannte mein Mann auch. »Umso besser«, sagte er, »aber mit dem Essen möchte ich nicht mehr lange warten.«
Das gutgewürzte Gulasch schmeckte ihm über alle Maßen, er schaufelte sich dreimal den Teller voll und wischte ihn schließlich mit Brot aus.
Als ich gerade das Geschirr abgeräumt und endlich den Fernseher eingeschaltet hatte, flatterte durch das offene Fenster ein Papagei, der wohl einem Nachbarn entflogen war. Vergeblich versuchte ich, ihn wieder nach draußen zu scheuchen. Der Vogel krallte sich an die Hängeleuchte, schlug mit den Flügeln und hackte nach mir, sobald ich mich mit dem Besen näherte. Zu allem Überfluss fing er an zu krächzen. Es war ein grässliches, ein schauriges Lied.
Das Lenchen hat mich ausgelacht.
Ihre Mutter hat mich kaltgemacht.
Zu Gulasch wurd’ ich weichgekocht.
Die Köchin wird nun eingelocht.
Der tückische Vogel plante wohl, mich zu verraten. Anfangs wollte ich ihn nur übertönen, konnte aber bald nicht mehr aufhören zu schreien.
»Hör auf mit dem Gekreische, Marga! Du bist sehr krank«, sagte mein Mann, beugte sich über mich und rüttelte mich an der Schulter. »Du phantasierst! Aber du musst mir trotzdem sagen, wo die Kinder sind.«
Hier in der geschlossenen Abteilung darf ich vorläufig keinen Besuch empfangen, auch nicht fernsehen, Radio hören oder Zeitung lesen. Doch die Putzfrau brachte mir gestern eine Illustrierte, die sie extra für mich hereingeschmuggelt hatte. Das sei doch ich, sagte sie stolz, weil sie das Bild sofort erkannt hatte. Ich betrachtete die Fotos unseres Hauses, der Küche, der veralteten Tiefkühltruhe und meiner Familie und fing schließlich an zu lesen.
Die psychisch kranke Margarete W. kam mit ihrem vierjährigen Stiefsohn nicht zurecht. Das Kind war durch den Tod seiner leiblichen Mama schwer traumatisiert, in seiner Entwicklung zurückgeblieben und lehnte die neue Mutter völlig ab. Frau W. scheint sich anfangs bemüht zu haben, mit dem schwierigen Jungen auszukommen, war jedoch aufgrund ihrer eigenen Psychose restlos überfordert. An jenem verhängnisvollen Tag erkrankte nicht nur der Kleine an einem fieberhaften Infekt, sondern auch sie selbst. Als sich das Kind ein Eis aus der Gefriertruhe holen wollte, stieß sie den Jungen hinein, schloss den Deckel und verließ den Raum. Ihren eigenen Angaben zufolge musste sie dringend bügeln; als das Fieber stieg, legte sie sich jedoch ins Bett und wurde von alptraumhaften Halluzinationen heimgesucht.
Die Tochter von Margarete W., die aus einer früheren Verbindung stammte, besuchte die 2. Klasse der Grundschule. Noch vor Beginn des Unterrichts wurden die Kinder wieder nach Hause geschickt, da mehrere Schüler an der Schweinegrippe erkrankt waren. Die meisten Eltern konnten telefonisch benachrichtigt werden, bei Familie W. meldete sich niemand. Die kleine L. konnte allerdings glaubhaft versichern, dass ihre Mutter zu Hause sei, da sie den kranken Bruder pflegen müsse.
Frau W. hatte weder das Telefon noch die Türglocke gehört, weil sie den Fernseher sehr laut gestellt hatte. Nach anhaltendem vergeblichen Klingeln erinnerte sich ihre Tochter an das Versteck des Garagenschlüssels und beschloss, durch den angrenzenden Keller ins Haus zu gelangen. Als sie an der Gefriertruhe vorbeikam, wollte sie die Gelegenheit nutzen und sich ein Eis herausnehmen. Zu ihrem Entsetzen stieß sie auf ihren kleinen Stiefbruder, der gerade erst in seinen eisigen Sarg eingeschlossen worden war. Wäre die Siebenjährige nur wenige Minuten später gekommen, hätte man das Kind wohl nicht mehr retten können.
Statt sich aber sofort einer Nachbarin anzuvertrauen, flohen die verstörten Kinder Hals über Kopf aus dem elterlichen Haus. Da der Kleine nach seiner Mama rief, brachte ihn das Mädchen auf den Friedhof. Die beiden Kinder saßen wohl schon lange unter einem Wacholderbaum, bohrten mit einem Hühnerknochen kleine Löcher in die Erde und steckten gepflückte Blumen hinein, als sie schließlich vom Vater des Jungen gefunden wurden. Dieser brachte sein Kind sofort in die Klinik. Der Kleine trug nur einen Schlafanzug und war trotz des warmen Wetters völlig unterkühlt.
Frau W. wurde in das psychiatrische Landeskrankenhaus eingewiesen. Laut Aussage ihres Mannes leidet sie unter wahnhaften Schüben und versetzt sich dann in die Rolle tragischer Heldinnen, deren Texte sie als Theatersouffleuse auswendig gelernt hat.
Ich war fassungslos: Die billig aufgemachte Illustrierte log wie gedruckt und verriet leider nicht, wer ihr niederträchtiger Informant war; ich tippe ja auf den Papagei. Für die siebenseitige Homestory mit den indiskreten Fotos hat mein Mann bestimmt nicht schlecht kassiert, er bezahlt wohl davon diese Schlampe, die kochen und sich in meiner Abwesenheit um die Kinder kümmern soll. Wenn ich demnächst heimkomme, werde ich alle beide vor die Tür setzen.
Aber zunächst muss ich das Fenster schließen. Der Papagei ist wieder hier, um mich auszuspionieren. Er betrachtet sich nämlich als Timmis Sprachrohr; wenn ich nicht aufpasse, wird er davonfliegen, sich auf den Machandelbaum setzen und mich bei meinem Mann anschwärzen.
»Schwester Monika, Sie müssen wissen, dass ich zwar Margarete heiße, aber Gretchen genannt werde. Ich habe heute mein Kind im Brunnen ertränkt, darauf steht die Todesstrafe.«
Meine Mutter, die Hur’,
Die mich umgebracht hat,
Mein Vater, der Schelm,
der mich gessen hat!
Mein Schwesterlein klein
Hub auf die Bein’,
An einem kühlen Ort.
Da war ich ein schönes Waldvögelein;
Fliege fort, fliege fort.
Draußen ist es stürmisch. In meinem engen Kerker ist nur eine winzige Luke, ich kann nichts als grauen Himmel sehen.
Eilende Wolken! Segler der Lüfte!
Wer mit euch wanderte, mit euch schiffte!
Grüßet mir freundlich mein Heimatland!
Ich bin gefangen, ich bin in Banden,
Ach, ich hab’ keinen andern Gesandten!
»Nein, Schwester Monika, ich bin doch nicht blond! Ich bin kein Gretchen, ich bin Maria Stuart und werde heute noch hingerichtet.«
Der Unhold von Unna
Wenn man mir vorwirft, ein Psychopath zu sein und an einem Mangel an Empathie zu leiden, dann lächle ich nur amüsiert und sage: »Sehr witzig!«
Denn einmal im Leben habe ich ja geliebt, und genau das führte zur Katastrophe.
Im Volksmund zitiert man ja gern Klischees – Verbrecher sollen zum Beispiel häufig an den Tatort zurückkehren. Mein Verhalten zeigt eher, dass sie besser beraten sind, wenn sie das Gegenteil tun. Dass ich Dortmund verließ, hatte seine Gründe, auf die ich hier nicht näher eingehen möchte. Sagen wir, dass es mir zu eng geworden war zwischen Phoenix-See und Reinoldiplatz. Die Abschaffung des Straßenstrichs tat ein Übriges dazu, dass ich mir einen neuen Lebens- und Wirkungsort suchte.
Unna erschien mir als eine gute Wahl – nicht zu nah an meinem letzten Tatort, aber auch entfernt genug, um nicht unmittelbar ins Visier polizeilichen Interesses zu geraten.
Mit meiner Ausbildung bekam ich leicht eine Stelle im Bereich Restmüllbehältervolumenminderung bei den Stadtbetrieben und fand eine schiefe, viel zu teure Wohnung in einem Fachwerkhaus des Nikolaiviertels. Dort lebte ich unauffällig und von meinen Nachbarn durchaus respektiert. Erst einige Jahre nach meinem Umzug habe ich zwei miteinander befreundete Flittchen liquidieren müssen, um die es nicht weiter schade war. Beide besserten sich ihr Taschengeld mit gelegentlicher Prostitution auf. Die Erste hatte sich mir gegenüber frech und aufsässig benommen, ja mich mehrfach lächerlich gemacht. Derartige Kränkungen kann ich nun einmal nicht ertragen. Die Zweite war mir kurz darauf auf die Schliche gekommen und wollte mich erpressen.
Aufgrund meiner Kenntnisse in der Restmüllbeseitigung kannte ich die Probleme bei der Entsorgung eines ausgewachsenen Menschen. Deswegen schritt ich in beiden Fällen im Freien zur Tat, im Stadtgarten am Ostring. Dem Kalender und dem Wetterbericht konnte ich entnehmen, wann Neumond war und es nasskalt sein würde. In solch ungemütlichen Nächten trieben sich nicht einmal mehr die Trinker im Stadtgarten herum, obwohl sie von der Polizei beim Fund der Leiche zuerst ins Visier genommen wurden. Ich hatte alles perfekt geplant, trug Einweghandschuhe und hinterließ zur Irreführung leere Schnapsflaschen mit fremder DNA, die ich aus einem Altglascontainer gefischt hatte. Es war nicht sonderlich schwer, die beiden Schnepfen in den finsteren Park zu locken, ich brauchte nur mit einer geheimnisvollen Offerte an ihre Geldgier zu appellieren, und sie wären mir in die Hölle gefolgt. Meine Wortwahl ist durchaus kein Zufall, denn der Hellweg ist ja bekanntlich ein Weg zur Hölle. Es klappte bei beiden Damen alles wie geschmiert, ich vergaß hinterher auch nie, mein blutiges Messer in Alufolie einzuschlagen. Falls es unfreiwillige Zeugen gegeben hätte, wäre es dann eben zu einem Kollateralschaden gekommen.
Nach dem Fund der zweiten Leiche las ich in der WAZ: Der Schlächter von Unna hat wieder zugeschlagen. In anderen Zeitungen war von einem Monster, einer Bestie, einem Teufel oder Unmenschen die Rede, Begriffe, die auf mich wahrhaftig nicht zutreffen. Die Ängste der Frauen, die sich nachts nicht mehr auf die Straße trauten, wurden von einer Boulevardzeitung kräftig geschürt. Da titelte doch einer der Schreiberlinge: Er schleicht durchs Gebüsch, er ist schon ganz nah – der Unhold von Unna ist wieder da!
Die allgemeine Aufmerksamkeit schmeichelte mir durchaus, denn man hatte es mir nicht an der Wiege gesungen, dass ich einmal so berühmt würde. Die Wortwahl hingegen irritierte mich. Ich und ein Unhold! War mein dickbäuchiger, raffsüchtiger Vermieter vielleicht ein Hold? Die Zeitungsfritzen schrieben hier doch über Dinge, von denen sie so viel verstanden wie ein Kalb von der Milchstraße.
Hin und wieder fragten mich Kollegen bei den Stadtbetrieben, warum ich mit fast vierzig Jahren noch nicht verheiratet war. Den Ratschlag meines Vaters, an den ich mich gehalten hatte, zitierte ich lieber nicht: »Junge, mach nicht den gleichen Fehler wie ich! Man sollte keine Kuh kaufen, wenn man bloß ein Glas Milch trinken will!« Ich habe seinen etwas altmodischen Spruch inzwischen für mich etwas modernisiert und sage: »Wenn man eine Steckdose sucht, muss man sich nicht gleich ein Haus bauen.«
Mein Vater ist mir immer ein Vorbild gewesen. Auch wenn er mich manchmal zur Gaudi meiner gehässigen Mutter versohlte, glaube ich nach wie vor, dass es zu meinem Besten geschah. Schließlich habe ich sowohl das Abitur bestanden als auch die Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten in der Entsorgungswirtschaft. Man schickte mich sogar für ein halbes Jahr in Unnas Partnerstadt Palaiseau, wo ich leidlich Französisch gelernt habe.
Auf die indiskreten Fragen meiner Kollegen habe ich stets ausweichend geantwortet: Die Richtige sei mir noch nicht über den Weg gelaufen. Was ja auch stimmte, denn alle bisherigen Versuche waren Missgriffe gewesen. Sie hatten es verdient, dass man sie aus dem Weg räumte.
Als ich Mona kennenlernte, war auf einmal alles anders. Sie war keine dumme Kuh wie meine Mutter, keine Nutte wie meine Bekanntschaften aus der Dortmunder Linienstraße, sondern eine selbstbewusste Abiturientin, die sich etwas Geld als Aushilfe im Café im Zib verdiente. Außer mir verbrachten dort noch einige andere aus unseren Büros ihre Mittagspause.
Natürlich interessierten sich auch meine Kollegen für die hübsche Neue, was sie umso begehrenswerter für mich machte. Mit ihr konnte ich mir zum ersten Mal eine Partnerschaft vorstellen. Ja, ich gebe es zu, ich wollte sie haben, und zwar mit Haut und Haar.
Mona sah so aus, wie ich mir ein modernes Schneewittchen vorstellte: schwarze Locken, heller Teint, unglaublich blaue Augen. Sie betonte ihren Typ durch weißes Make-up, schwarzlackierte Fingernägel, Piercings in Nase und Mundwinkel und durch ein paar tätowierte Rosen, die sich aus dem Ausschnitt rankten. Mit dem Körperschmuck konnte ich nicht viel anfangen, aber es gefiel mir ungemein, dass sie stets hohe Lackstiefel und enge schwarze Lederhosen trug. Ein bisschen erinnere ihr Auftritt an die Mode der Gothics, belehrte mich Frau Hartmann, eine klatschsüchtige, bestimmt auch neidische Kollegin.
Ignoranten sagen mir zwar einen Mangel an Humor nach, aber Mona fand es drollig, als ich sie mit Blanche-Neige ansprach.
»Wahnsinn! Du scheinst dich von meinen bisherigen Fans absetzen zu wollen«, sagte sie. »Denen fällt nichts anderes ein, als mich ›Mona Lisa‹ oder ›Desde-Mona‹ zu nennen!«
Endlich lernte ich eine Frau kennen, die eine Antenne für meinen hohen Bildungsgrad und meinen Charme hatte. Mehr als einmal stellte ich mir vor, wie ich Mona auf mein Sofa betten und ihr langsam die hohen Stiefel und dann alles andere ausziehen würde. Leider blieb es nur bei sexuellen Phantasien, denn es fiel mir seltsamerweise schwer, ihr meine Gefühle anzudeuten. Doch ich wusste durchaus, dass ich mich beeilen musste, denn die Konkurrenz schlief nicht.
Schnell hatte ich in Erfahrung gebracht, wann sich Mona mit Gleichgesinnten vorm Zib zum Rauchen traf. Obwohl ich den Qualm verabscheute, hatte ich Zigaretten gekauft und konnte so tun, als ob ich zufällig auch eine mittägliche Pause einlegen wollte. Beim zweiten Treffen zeigte sie sich erfreut, weil ich dieselbe Marke rauchte wie sie selbst. Es war allerdings kein Zufall, dass sie ihre eigenen Sargnägel nicht in ihrem Täschchen fand.
Fünf Raucher standen qualmend – und ich hüstelnd – im Kreis herum, als einer der Kollegen Mona anzüglich beäugte und bemerkte, er habe sie schon mehrmals auf dem Westfriedhof gesichtet. Ob sie vielleicht eine Liaison mit einem Vampir habe?
»Bist du endlich auch mal aus deiner Gruft gekrochen, Dracula?«, antwortete sie schlagfertig. »Eigentlich bist du doch in deiner miefigen Kammer am besten aufgehoben!«
Diesen Typen hatte sie bereits dreimal abblitzen lassen, ich witterte meine Chance. Schon mehrmals hatte Mona betont, dass sie sich am liebsten an der frischen Luft bewegte, also verabredeten wir uns zu einem Spaziergang. Natürlich achtete ich darauf, dass keiner meiner Rivalen von unserem Rendezvous etwas mitbekam.
Am Nachmittag stahl sich Frau Hartmann, die ebenfalls zur Rauchergruppe gehörte, in mein Zimmer. Nachdem sie ausführlich über andere gelästert hatte, meinte sie: »Ich mag es nicht, wenn man den Westfriedhof in Verbindung mit Vampiren erwähnt. Ich mag diesen Ort, nirgendwo sonst kann man mitten in Unna so beschauliche Spaziergänge machen. Das hat ja wohl selbst eure kesse Mona kapiert. Im Übrigen traue ich ihr nicht über den Weg. Haben Sie schon bemerkt, dass alle Männer hinter ihr her sind? Und dieses kleine Aas lässt sich den Hof machen, als ob sie eine Prinzessin sei!«
»Das ist sie bestimmt nicht«, behauptete ich, obwohl ich vom Gegenteil überzeugt war. Dann goss ich uns ein Gläschen Hertingpörter ein, und die Welt war für Frau Hartmann wieder in Ordnung.
Ich bin ein Stadtmensch und kein Naturbursche, trotzdem lief ich schon ein paar Tage vor unserem Treffen kreuz und quer über den Westfriedhof, um das Terrain zu erkunden. Leider wurde das Tor bei Anbruch der Dunkelheit abgeschlossen, so dass eine romantische Mondscheinbegegnung nicht in Frage kam. Die ungewohnte Umgebung irritierte mich ein wenig. Eichhörnchen huschten durch die Bäume, Vögel zwitscherten. Zwischen Farn und Gebüsch verbargen sich verwitterte Gräber und mit Moos, Flechten und Efeu überwucherte Stelen. Überall Verfall – gestürzte Kapitelle, verrostete Geländer, Grünspan an den Lanzenbekrönungen, umgefallene Kreuze. Beim Anblick eines trauernden Engels, der einen toten Jungen in den Armen hielt, dachte ich sofort an all jene, für die ich den Engel gespielt hatte. Sicherlich war es jedes Mal die richtige Entscheidung gewesen.
Seit 1980 wurden hier keine Toten mehr begraben, laut zahlreicher Inschriften ruhten sie in Gott. Auf den Grabsteinen entdeckte ich in Stein gehauene Anker, Schlangen und sogar inmitten eines Blätterkranzes einen kleinen Schmetterling, Symbol der Auferstehung. An was für Ammenmärchen die Leute wohl immer noch glaubten!
Auf meinem Streifzug war ich nicht der Einzige auf dem Friedhof, obwohl es ein trüber Tag war. Rentner drehten ihre Runden, Hunde und Kleinkinder wurden ausgeführt, und ein schrecklicher Laubbläser verursachte Lärm. Von Einsamkeit konnte nicht die Rede sein.
Als ich meinen Friedhofbummel beendete, war mir klar: Falls unsere Beziehung leider nicht so harmonisch verlaufen würde, wie ich es erhoffte, dann sollte Mona nicht wie ihre Vorgängerinnen im Stadtgarten gefunden werden, sondern hier; einer so schönen jungen Frau war man schließlich etwas schuldig. Ich würde sie vor dem steinernen Engel ablegen, vielleicht mit einem Ilexzweig auf der Brust. Je länger ich darüber nachdachte, desto anmutiger stellte ich mir dieses Stillleben vor, viel schöner noch als Schneewittchens gläsernen Sarg. Und ich ging sogar noch weiter in meinen Gedankenspielen, sah mich schließlich selbst als Toten, aufgefangen in den Armen eines Engels – ich, der überzeugte Atheist! Eine Vorstellung, für die Kitsch noch eine Beschönigung ist, die mich aber trotzdem zutiefst rührte. Schluss jetzt, befahl ich mir, was soll das! Ich werde sie kriegen, mit Haut und Haar.
Als wir uns dann am Samstagnachmittag beim Zib – dem Zentrum für Information und Bildung am Lindenplatz – trafen, traf mich allerdings eher der Schlag. Mona trug weder Lederhosen noch Stiefel, sondern einen spießigen Jogginganzug und giftgelbe Laufschuhe. Es hatte den ganzen Tag genieselt, die Straßen waren schmutzig, ich hätte meine teuren Budapester weder polieren noch anziehen sollen. Vom Zib war es nicht weit zum Friedhof, der bei diesem Schmuddelwetter allerdings ein tristes Ziel war.
»Ja was dachtest du denn?«, sagte sie, als sie meinen enttäuschten Blick registrierte. »Wir sind doch nicht zum Window-Shopping hier!« Und schon setzte sie sich in Bewegung, und ich musste ihr wohl oder übel nachhetzen. Schon öfters hatte ich erwogen, mich in einem Fitnessstudio anzumelden, doch es war leider bei diesen Überlegungen geblieben – jetzt rächte es sich. Mit bedrohlichem Herzrasen und hechelnd wie ein alter Jagdhund stolperte ich keine zehn Minuten später über eine Wurzel, glitt aus und rutschte der Länge nach in den Matsch. Mein edler dunkelgrauer Tuchmantel war ruiniert.
Mona hatte meinen Klagelaut gehört, machte kehrt und sah mich wie einen gestrandeten Käfer auf dem morastigen Untergrund herumzappeln. Statt mir aber die Hand zu reichen, brach sie in ein diabolisches Lachen aus, das wie das gemeine Keckern einer Hyäne klang. Ich geriet in grenzenlose Wut und brüllte: »Dein Glück, dass ich kein Messer dabeihabe!«
Eine alte Frau, die zufällig vorbeikam, half mir hoch und reichte mir mitfühlend eine Packung Papiertaschentücher. Anscheinend schämte sich Mona nun doch ein wenig. Sie begleitete mich zum Auto und schien zu überlegen, wie sich ihr schadenfrohes Gelächter wiedergutmachen ließe. »Ich fahr dich nach Hause, und wenn du dich umgezogen hast, könnten wir ja im Morgentor etwas essen, okay?«
Ich knurrte nur, aber es war mir recht. Bisher hatte mich noch nie eine Frau zum Essen eingeladen.
Um sieben hatte es schon wieder angefangen zu regnen, aber im gutgeheizten Morgentor saß man gemütlich. Das Lammkarree mit Rosmarinkartoffeln schmeckte vorzüglich, der Rotwein ebenso. Im Schein der Kerzen sah Mona verführerisch und wunderschön aus. Zu meiner Freude hatte sie sich auch umgezogen und trug jetzt eine enge schwarze Lodenjacke mit aufgestickten Flammen. Schade, dass der Friedhof inzwischen abgeschlossen und es keine laue Sommernacht sei, bemerkte ich und prostete ihr zu, sonst hätten wir später noch eine romantische Runde drehen können.
»Als Teenager war ich oft in Unna zu Besuch«, erzählte meine Blanche-Neige. »In den Sommerferien haben meine Cousine und ich manchmal gekifft, uns als Flattergeister verkleidet und die Patienten im Katharinen-Hospital mit unserem Eulenschrei erschreckt. Das liegt ja direkt am Westfriedhof, und die guckten dann aus dem Fenster auf die alten Gräber und machten sich wegen uns bestimmt ins Nachthemd. Beim Parkplatz kann man übrigens mühelos über den Zaun klettern. Aber seit dieser Unhold hier in Unna sein Unwesen treibt, sind uns solche Streiche zu gefährlich. Meine Kusine kannte übrigens eines der Mädchen, die der Schweinehund ermordet hat.«
»Welche denn?«, fragte ich. »Annika oder Tessi?«
»Die Tessi«, sagte sie, stutzte und hakte nach: »Woher kennst du überhaupt ihre Namen?«
»Das stand doch in allen Zeitungen«, log ich, und sie gab sich zufrieden.
Leider trank ich mehr, als mir guttat. Auch Mona ließ sich nicht lumpen, für ihre zierliche Erscheinung vertrug sie erstaunlich viel. Aufgekratzt erzählte sie, wie das alles mit ihrem Cousin angefangen habe, einem Schwarzfahrer. Das seien Leute, die am Wochenende gern mit einem ausrangierten Leichenwagen herumkurvten und dabei Gothic-Rock hörten.
Als wir schließlich aufbrachen, hatte der Regen aufgehört, und es schimmerte ein fahler Vollmond. Angeregt durch das magische Licht, wollte mir Mona unbedingt noch zeigen, wo man über den Zaun des Friedhofs steigen konnte. Darauf hätte ich mich natürlich nicht einlassen sollen, aber zu diesem Zeitpunkt wäre ich ihr auch bis in die Hölle gefolgt.