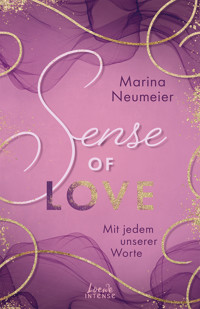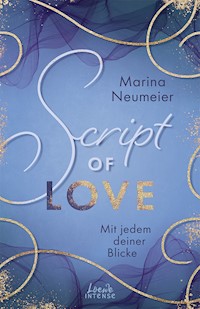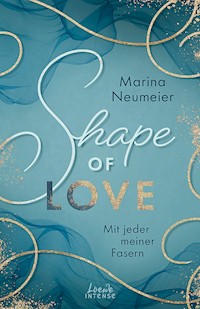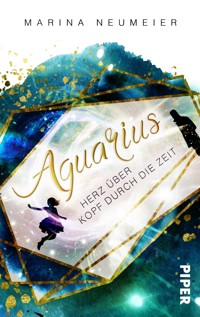6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper Wundervoll
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Eine Ewigkeit begraben – nun ist sie erwacht! Eine fesselnde Liebesgeschichte zwischen Vergangenheit und Gegenwart von Marina Neumeier »Ich habe so vieles vergessen über die Jahre. Aber an eines kann ich mich erinnern. Meinen Namen. Aliqua.« Als Aliqua nach jahrhundertelanger Gefangenschaft unter der Vulkanasche des Vesuv überraschend befreit wird, findet sie sich im Zentrum eines uralten Konflikts wieder: Seit der Antike lastet auf den Familien Omodeo und Pomponio ein Fluch, der Fluch der Unsterblichkeit. Aliqua gerät ins Visier einer Gruppe Unsterblicher, die nur ein Ziel kennen: die Grausamkeit der römischen Götter zurück auf die Erde zu holen. In Santo findet sie einen Verbündeten – doch er hütet ein düsteres Geheimnis … Nach der »Aquarius«-Trilogie folgt eine weitere spannende Fantasy-Liebesgeschichte von der Gewinnerin des Newpipertalent-Awards 2019! Band 2 der Dilogie erscheint im Sommer 2022. »Ein absolutes Lesehighlight für mich! Unglaublich spannend, erschütternd, romantisch... ich weiss gar nicht welche Beschreibung eigentlich die passende ist, weil es mich mehr als überwältigt hat.« ((Leserstimme auf Netgalley)) »Alle Charaktere sind mir so ans Herz gewachsen und am liebsten würde ich direkt weiterlesen. Von mir eine große Empfehlung! Lest es! Worauf wartet ihr noch?« ((Leserstimme auf Netgalley))
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 519
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Infinitas – Fluch aus Glut und Asche« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.
© Piper Verlag GmbH, München 2021
Sprachredaktion: Uwe Raum-Deinzer
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Covergestaltung: Giessel Design
Covermotiv: Bilder unter Lizenzierung von Shutterstock.com genutzt
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich der Piper Verlag die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Prolog
Kapitel Eins
Aliqua
Santo
Kapitel Zwei
Rom, 79 n. Chr.
Aliqua
Santo
Kapitel Drei
Aliqua
Santo
Kapitel Vier
Rom, 79 n. Chr.
Aliqua
Santo
Kapitel Fünf
Aliqua
Santo
Kapitel Sechs
Rom, 79 n. Chr.
Aliqua
Santo
Kapitel Sieben
Santo
Aliqua
Kapitel Acht
Rom, 79 n. Chr.
Aliqua
Kapitel Neun
Santo
Aliqua
Kapitel Zehn
Rom, 79 n. Chr.
Aliqua
Kapitel Elf
Aliqua
Kapitel Zwölf
Rom, 79 n. Chr.
Santo
Kapitel Dreizehn
Aliqua
Kapitel Vierzehn
Rom, 79 n. Chr.
Aliqua
Kapitel Fünfzehn
Santo
Kapitel Sechzehn
Rom, 79 n. Chr.
Aliqua
Kapitel Siebzehn
Aliqua
Kapitel Achtzehn
Rom, 79 n. Chr.
Santo
Kapitel Neunzehn
Aliqua
Kapitel Zwanzig
Rom, 79 n. Chr.
Aliqua
Kapitel Einundzwanzig
Aliqua
Kapitel Zweiundzwanzig
Rom, 79 n. Chr.
Aliqua
Danksagung
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Flüche sind für die Lebenden, nicht für die Toten.
Und ich lebe. Für immer. Für meinen Fluch.
Ich atme die Ewigkeit, in tiefen Zügen wie ein Ertrinkender. Tief in meine Lungen, wo sie den Rest meines Körpers befällt. Ich drohe daran zu ersticken, an der Unsterblichkeit, die meine Adern füllt. Die ein Herz durch mich pumpt, das schon lange zu Staub zerfallen sein sollte. Vermischt mit der Asche derer, die vor mir gingen und vor mir gehen werden. Erlöst, auch wenn sie den Tod fürchten.
Ich kenne eine Wahrheit, die grausamer ist als das Sterben.
Sie fließt durch mich mit jedem Atemzug.
Und hier bin ich. Ewig hier, ewig ich. Ewiglich.
Kapitel Eins
Aliqua
Unmittelbar über mir tapsen Schritte hinweg.
Ich versuche die Augen zu öffnen, doch die undurchdringliche Hülle aus erkalteter Lava, die mich wie eine zweite Haut einhüllt, verhindert es. Ein stummes Seufzen formt sich in meinen Gedanken.
Seit einer Ewigkeit ist mein Körper inzwischen hier gefangen, und noch immer kommt es vor, dass ich diese Tatsache vergesse. Total bescheuert, ich weiß, aber in so langer Zeit entfällt einem so einiges. Vor allem, wenn ich mal wieder für eine Weile (Jahrzehnte? Jahrhunderte? Wer weiß das schon!) im Dämmerschlaf versinke und nichts mehr wahrnehme.
Aber da … schon wieder Schritte! Ich spüre deutlich die Erschütterungen, die wie Schockwellen durch das Vulkangestein dringen, unter dem ich begraben bin.
Das ist wirklich seltsam.
Es ist schon sehr lange her, seit das letzte Mal jemand dort oben herumgelaufen ist, direkt über mir. An der Oberfläche.
Mein Herz zieht sich zusammen, wenn ich an die Welt außerhalb meines steinernen Gefängnisses denke. Auch wenn ich das Gefühl habe, inzwischen schon alles darüber vergessen zu haben, ist da immer noch diese Sehnsucht in mir. Nach Sonnenschein und Wind auf meiner Haut. Nein, niemals könnte ich die Sonne vergessen.
Angestrengt lausche ich auf weitere Vibrationen, doch eine Zeit lang herrscht Ruhe.
Bei Jupiter, ich wünschte wirklich, dass ich mehr hören könnte. Aber genauso hartnäckig, wie sie meine Augenlider daran hindert, sich zu öffnen, verschließt die erstarrte Lava meine Ohren. Mehr als Vibrationen kann ich nicht wahrnehmen.
Fast habe ich mich damit arrangiert, dass meine Besucher wieder verschwunden sind und ich für ein paar weitere Jahrzehnte im Dämmerschlaf versinken kann, als es plötzlich passiert.
Eine gewaltige Erschütterung lässt das Gestein um mich herum erbeben, und wenn ich könnte, würde ich schreien. Die Schockwelle ist so heftig, dass jeder Knochen in meinem Körper erzittert. Ich möchte die Hände in den Untergrund krallen oder irgendetwas tun, um mich dagegen zu wappnen, aber ich kann mich nicht bewegen.
Tatsächlich kenne ich solche Erdstöße – immerhin ist diese Gegend ein notorisches Erdbebengebiet, und auch wenn es früher heftiger war, kommt es immer wieder zu kleinen Schüben, die mich aufschrecken.
Aber so heftig wie jetzt war es noch nie.
Außerdem kommen die Stöße normalerweise aus dem Untergrund, tief aus der Erde selbst und dringen nicht von oben auf mich ein. Äußerst merkwürdig.
Was hier gerade passiert, ist definitiv anders und macht mich ziemlich nervös.
Die nächste Erschütterung schlägt ein, dann noch eine. Der Rhythmus steigert sich zu einem rasenden Stakkato, in dem die Einschläge zu einem einzigen markerschütternden Dröhnen verschmelzen.
Ich beiße die Zähne so fest zusammen, dass mein Kiefer knackt, während um mich herum die Erde bebt.
Alles in mir schreit danach, sich zu bewegen, die Arme schützend über den Kopf zu heben und mich zu einer Kugel zusammenzurollen, bis es vorbei ist. Aber noch immer umgibt mich die Lava-Zwangsjacke von Kopf bis Fuß und zwingt mich dazu, reglos liegen zu bleiben.
Wenn das so weitergeht, werde ich in meine Einzelteile zerspringen, und das war’s dann mit der Freiheit, nach der ich mich schon so lange sehne.
Ganz allmählich zwingt das unermüdliche Donnern von oben den Tuff dazu nachzugeben: Risse fahren wie Blitzeinschläge ins Gestein, das sich kreischend aufspaltet und zerbirst. Und je näher mir diese rohe, hämmernde Kraft kommt, desto deutlicher spüre ich, wie auch mein Panzer Risse bekommt. Schlag um Schlag lockert sich das Gestein um mich herum, bricht weiter auf und befreit mich das erste Mal seit einer Ewigkeit aus diesem starren Korsett.
Die erkaltete Lava, die mir Ohren, Nase, Mund und Augen versiegelt hat, platzt als Erstes von mir ab, und ich breche beinahe in Tränen aus angesichts des bestialischen Lärms, der um mich herum herrscht. Ich werde wahrscheinlich taub, noch bevor ich meine wiedergewonnene Sinneskraft auskosten kann. Einige unerträgliche Minuten hält das Donnern noch an, das meine winzig kleine Welt in Schutt und Asche legt, dann verstummt es endlich. Das Beben hat aufgehört, und ich spüre der neuen Umgebung nach, in der ich mich jetzt wiederfinde.
Der undurchdringliche Kokon aus Vulkangestein ist zerbröselt und gewährt mir ein ganz neues Gefühl von Freiheit. Da ist plötzlich Luft, die durch die Ritzen dringen kann, um mein freigelegtes Gesicht zu umschmeicheln. Ich möchte den Mund öffnen und tief Luft holen, aber ich habe zu viel Angst, dass ich nichts als Schutt einatmen könnte. Lieber noch ein wenig abwarten und dieses neue Gefühl erproben.
Probehalber wackle ich mit den Zehen, und ich kann spüren, wie der steinerne Mantel um meine Füße aufbricht.
Über mir sind schabende Geräusche zu hören, die ich nach einer Weile als Schaufeln einordnen kann, die in das Geröll gestoßen werden, um das lose Material über mir zu entfernen.
Ich bin ganz verblüfft über diese Erkenntnis. Ist da vielleicht jemand zu Gange, nur um mich zu befreien? Nach all der Zeit war ich eigentlich davon überzeugt, dass sich keine Menschenseele mehr an mich erinnern würde.
Stück um Stück wird das Erdreich über mir abgetragen. Das Gewicht von Jahrhunderten beginnt von mir zu weichen, und mein Herz dehnt sich vor Hoffnung aus, bis es meinen Brustkorb zu sprengen droht.
Es wird wirklich wahr: Ich werde befreit!
Doch als nur noch wenige Schippen fehlen, um mich vollkommen freizulegen, hört es mit einem Mal auf.
Nein, will ich brüllen, macht weiter!
Aber die Grabung kommt tatsächlich zum Erliegen, und stattdessen höre ich herumtänzelnde Schritte und wilde Laute, die an kämpfende Tiere erinnern. Was ist dort oben nur los? Warum haben sie aufgehört?
Wut macht sich in mir breit, und mit ihr kommt der Gedanke, dass ich selbst versuchen könnte, mich aus den letzten Zentimetern zu graben. Meine Arme zu heben, wie viel Zeit auch vergangen sein mag, und die letzten Brocken wegzuschieben.
Und dann tue ich es.
Als wäre es das Natürlichste der Welt, schiebe ich mich nach oben, wie ein Taucher, der aus großer Tiefe aufsteigt, um durch die Wasseroberfläche zu dringen. Und obwohl das Meer, aus dem ich mich emporkämpfe, aus fester erkalteter Magma besteht, schaffe ich es, bis nach oben zu gelangen.
Meine Muskeln brennen wie Feuer, jede steife Sehne in meinem Körper protestiert und meine Gelenke ächzen. Aber ich bewege mich, spüre sandigen Staub und Schutt über meine Haut rieseln, von der die harte Ascheschicht abplatzt.
Reine Willenskraft bringt mich dazu, die letzten Brocken aus dem Weg zu schieben, und dann bin ich frei. Zum ersten Mal seit Menschengedenken frei.
Keine erkaltete Lava mehr weder an noch unter oder über mir.
Diese Tatsache überwältigt mich so sehr, dass ich weinen möchte, doch für den Moment bin ich zu beschäftigt damit, zu atmen und meinen wiedererwachenden Körper zu bestaunen. Jeder Quadratmillimeter schmerzt, aber so fühlt sich die Freiheit an. Es kann bis in alle Ewigkeit wehtun, wenn es bedeutet, dass ich nicht mehr gefangen bin.
Santo
Ich bin unruhig diese Nacht.
Alleine und fast unsichtbar bahne ich mir meinen Weg durch die Straßen von Rom. Ganz in Schwarz gekleidet, verschmelze ich nahezu mit den Schatten und bewege mich so leise, dass kein Passant mich bemerkt, während ich wachsam meine Runden ziehe.
Eine Nacht wie jede andere, sollte man meinen, aber meine Sinne sind in Aufruhr. Ich spüre es, seit die Sonne untergegangen ist, noch bevor mein Verstand kapiert hat, was es ist.
Unsterblichkeit liegt in der Luft, und das kann nur eines bedeuten: Ärger.
Eigentlich bin ich es müde. Ich bin schon so viele Jahre müde, dass ich mich nicht daran erinnern kann, wann ich mich das letzte Mal wirklich wach und lebendig gefühlt habe.
Die Nächte auf Patrouille sind nur ein weiteres lähmendes Übel eines Daseins, in dem Tage längst an Bedeutung verloren haben. Das war nicht immer so, aber in letzter Zeit wird es immer schlimmer.
Vor fünfhundert Jahren konnte mich eine Verfolgungsjagd noch richtig begeistern, aber selbst dieser Nervenkitzel ist inzwischen verblasst. Auch die unheilvolle Vorahnung, die heute Nacht wie ein Mantel über der Stadt liegt, beunruhigt mich nicht annähernd so sehr, wie es sollte.
Im Endeffekt ist jede Unruhe, die diese Ewigkeitsjünger verursachen, nichts weiter als ein weiteres ermüdendes Ärgernis – nur dass sie im Gegensatz zu mir nie die Lust daran verlieren. Was mich zu der Erkenntnis bringt, dass Dummheit Bestand hat, egal wie lange man lebt.
San Lorenzo, das Viertel, das ich gerade durchstreife, kommt auch nachts nie ganz zur Ruhe. Hier wohnen viele Studierende, deren lärmende Partys aus angelehnten Fenstern hinunter auf die Straße geweht werden. Auch die Bars und Kneipen sind um diese Zeit noch gut besucht, und es wird noch belebter, je näher ich dem Hauptbahnhof komme.
Seit Jahren liege ich meinem Onkel Nerone in den Ohren, dass ich eine andere, weniger belebte Patrouillenroute haben möchte, doch mit dieser Bitte stoße ich bei ihm auf taube Ohren.
»Keiner ist so geschickt darin sich unsichtbar zu machen, wie du, Santo. Wenn ich einen von den anderen in die Gassen schicke, hört man sie schon aus einem Kilometer Entfernung herantrampeln, und diese Bastarde sind längst über alle Berge, bis einer auftaucht.«
Das Lob meines Onkels sollte mir schmeicheln, doch es befeuert eher meinen Trotz. Wenn sie wollten, könnten die anderen genauso leise sein wie ich. Aber sie bevorzugen die ruhigen, weitläufigen Außenbezirke der Stadt, wo man weniger auf der Hut sein muss. Die Innenstadt erfordert dagegen permanente Aufmerksamkeit, Konzentration und Intuition. Im Gewühl der Menschen sind Ewigliche so viel schwieriger aufzuspüren.
Doch obwohl die Luft vor Anspannung bebt, bemerke ich in der Stadt nichts Ungewöhnliches. Was uns Ewigliche angeht, ist alles ruhig. Aber trotzdem …
Das Handy in meiner Hosentasche vibriert und unterbricht meine Sondierungen. Ich ziehe es hervor, und das Gesicht meines Cousins Scuro erscheint auf dem Bildschirm.
Was will der denn?
Soweit ich weiß, hat er diese Nacht keinen Dienst, und eigentlich sollte er wissen, dass er mich in Ruhe lassen sollte. Trotzdem gehe ich ran.
»Was gibt’s?«, knurre ich. Während ich das Handy ans Ohr halte, wandert mein Blick weiter aufmerksam über die Piazza Indipendenza, die jetzt vor mir liegt. Doch außer einigen Autos, die den begrünten Mittelstreifen umrunden, gibt es nichts Spannendes zu sehen.
»Santo!«, dringt die Stimme meines Cousins aus dem Hörer. Ich verstehe ihn kaum, denn im Hintergrund wummert Musik und quillt Stimmengewirr dazwischen. Scuro ist auf einer Party? Kaum zu glauben. »Bist du noch unterwegs?«
Ich rolle mit den Augen. »Es ist kurz nach Mitternacht, meine Tour hat quasi erst begonnen.« Leider.
»Dann mach dich sofort auf den Weg hierher! Wir brauchen Unterstützung.«
Ich seufze. Adone muss ihn abgefüllt haben.
»Ich kann jetzt auf keine Party kommen, Scu. Wo steckst du überhaupt?«
Mein Cousin scheint sich von den Feiernden etwas wegzubewegen, denn im Hintergrund wird es deutlich ruhiger.
»Adone und ich sind in Positano, und hier liegt was in der Luft, ganz in der Nähe. Ernsthaft, es wundert mich, dass du es nicht bis nach Rom spüren kannst.«
Ich versteife mich und weiche unwillkürlich einen Schritt zurück in den Schatten der Gasse, an deren Ende ich stehe. Denn ich kann durchaus etwas spüren – auch wenn ich nicht gedacht hätte, dass es von außerhalb der Stadt kommt. Das ist ungewöhnlich und beunruhigend.
»Positano? Was zum Teufel macht ihr an der Amalfiküste?«
Scuro seufzt, und ich kann fast vor mir sehen, wie er mit den Augen rollt. »Adone musste mich unbedingt auf diese Party schleppen. Aber das ist doch jetzt völlig egal. Sieh zu, dass du so schnell wie möglich herkommst. Was auch immer da los ist, wir brauchen dich zur Unterstützung.«
Der eindringliche Ton in seiner Stimme ist es, der mich schließlich dazu bewegt, meinen Patrouilleposten zu verlassen. Ich kenne Scuro fast besser als mich selbst, und wenn er so alarmiert ist, dass er mich von Rom ins über zwei Stunden entfernte Positano ruft, dann ist die Sache wirklich ernst.
»Okay, ich komme. Ruf mich unterwegs an, wenn was ist.«
Ich lege auf und eile den Weg zurück, den ich gekommen bin. Leute weichen erschrocken vor mir zurück, als ich wie ein nachtschwarzer Blitz an ihnen vorbeizische. Doch ich bin schon weg, ehe sie sich zu mir umdrehen können. Mein Herzschlag hebt sich ein wenig, und ein Gefühl, das ich beinahe vergessen habe, macht sich in mir breit: eine leise Ahnung von Aufregung.
Mein Motorrad steht in einer Seitenstraße in der Nähe der Sapienza-Universität.
Fünfzehn Minuten später habe ich die Stadt hinter mir gelassen und fahre auf die Autostrada A1, die mich auf direktem Weg runter nach Neapel bringt.
Der Motor meiner schwarzen Moto Guzzi V12 grollt wie eine zufriedene Raubkatze, als ich über die kaum befahrene Autobahn rase und alle Tempolimits ignoriere.
Was auch immer mich an der Amalfiküste erwartet, diese Spritztour ist die Sache jetzt schon wert. Es ist schon viel zu lange her, dass ich mich dem Rausch der Geschwindigkeit hingegeben habe und einfach nur gefahren bin.
Keine Ahnung, was ich Nerone später sagen werde, um zu erklären, warum ich meinen Patrouilleposten verlassen habe, aber um Erklärungen können sich genauso gut Scuro und Adone kümmern. Immerhin bin ich nur wegen der beiden unterwegs in Richtung Süden.
Kurz vor Neapel halte ich an einem verlassenen Rastplatz und ziehe mein Handy aus der Innentasche meiner schwarzen Lederjacke. Ich habe es während der Fahrt mehrere Male an meiner Brust vibrieren gespürt, checke aber erst jetzt die eingegangenen Nachrichten, weil ich nicht alle paar Kilometer anhalten wollte. Andernfalls hätte ich es nie in der rekordverdächtigen Zeit von unter zwei Stunden hierher geschafft.
Ich habe mehrere Kurznachrichten von meinen beiden Cousins erhalten, die Positano inzwischen verlassen haben und sich im Küstenort Portici mit mir treffen wollen. Als ich den Namen dieses Ortes lese und mir klar wird, wo genau er liegt, senkt sich so was wie eine dunkle Vorahnung über mich. Das ist für meinen Geschmack entschieden zu nahe an jenem Flecken Erde, den ich am liebsten nie wieder betreten würde.
Bilder, die ich in den hintersten Winkel meines Gedächtnisses vergraben habe, drängen an die Oberfläche. Es sind Erinnerungen, älter als alles um mich herum, auf denen der Staub von Jahrhunderten liegt und die ich doch noch immer nicht anzutasten wage.
Es hat nichts mit damals zu tun, sage ich mir und klappe das Visier meines Helms wieder herunter.
Lauter als nötig lasse ich den Motor aufheulen und mache mich auf den Weg.
Keine zehn Minuten später stelle ich meine Maschine auf einem öffentlichen Parkplatz, direkt am kleinen Bahnhof von Portici, ab. Schon als ich den Helm vom Kopf nehme und mir durch die platt gedrückten Haare fahre, sehe ich zwei Schatten auf mich zukommen.
Trotz der Anspannung, die mich gefangen hält, seit ich weiß, wo wir uns treffen wollen, muss ich beim Anblick meiner beiden Cousins grinsen.
»Hey, Sackgesicht«, begrüßt mich Adone launig und verpasst mir einen Klaps, der einen schwächeren Mann in die Knie gezwungen hätte. Ich aber stemme die Beine in den Boden und erwidere seinen Gruß mit einem knappen Nicken.
Adone ist Nerones Sohn und ganz der Adonis, nach dem er benannt wurde. Er scheint aus nichts als Muskeln zu bestehen, und die Frauen schmelzen bei seinem Anblick reihenweise dahin. Neben ihn tritt Scuro, über einen Kopf kleiner und neben dem massigen Adone fast schmächtig. Aber der Eindruck täuscht. Scuro ist flink, clever und todbringend. Niemand, mit dem ich mich anlegen würde – aber das gilt für beide.
Wir drei sind Cousins, aber im Grunde stehen wir uns näher als Brüder. Schon immer, für immer.
Jetzt schaue ich die beiden mit fragend gehobenen Augenbrauen an. »Also, weswegen habt ihr mich nun den ganzen Weg hierher gejagt?«
»Als wäre das eine Zumutung für dich gewesen«, spottet Adone mit einem wissenden Blick auf meine Moto Guzzi.
Scuro geht dazwischen. »Spür mal.«
In dem Moment, in dem ich meine Aufmerksamkeit bewusst auf die Anwesenheit anderer Ewiglicher richte, bricht ein regelrechtes Feuerwerk an Aktivität über mich herein. Es explodiert in meinem Kopf, und ich brauche einen Moment, um mich zu sortieren.
Die Überreste der Göttergabe, die es mir möglich macht, meinesgleichen aufzuspüren, schlägt aus wie die Nadel eines Seismografen. So stelle ich mir meine Fähigkeit zumindest gerne vor – ein empfindliches Instrument, das die Schwingungen von Unsterblichkeit in der Luft wahrnehmen kann. Und hier pulsiert die Nacht geradezu.
Irgendetwas ist hier ganz in der Nähe. Und es riecht nach Ärger.
Wortlos setzen wir uns in Bewegung.
Portici ist ein dicht bebautes Örtchen, doch es zieht uns stetig nach Südosten, bis wir das überschaubare Stadtwäldchen erreichen und die eng gedrängten Häuser hinter uns lassen. Allumfassende Ruhe empfängt uns zwischen den Bäumen, unsere Schritte sind die einzigen Geräusche weit und breit. Die Härchen auf meinen Armen richten sich auf, aber nicht aus Angst – nein, Angst habe ich nicht mehr gespürt, seit Napoleon in Italien einmarschiert ist –, sondern aus einem Anflug von Vorfreude. Götter, heute Nacht bin ich regelrecht emotional.
Die gute Laune verpufft allerdings so schnell, wie sie gekommen ist, als wir den Wald durchquert haben und vor uns der Ort auftaucht, der direkt an Portici grenzt: Ercolano. Auf den ersten Blick ist es ein Städtchen wie alle anderen in Italien: enge, schlecht geteerte Straßen, Häuser, die schon bessere Zeiten gesehen haben, und Autos, die sich an jede Ecke quetschen. Aber Ercolano verbirgt noch mehr, den Grund, warum ich diesen Ort am liebsten für immer aus meinen Erinnerungen streichen würde: die antike Ruinenstadt Herculaneum. Sie wurde zusammen mit Pompeji, Stabiae und Oplontis beim Ausbruch des Vesuv im Jahr Neunundsiebzig zerstört und in der Neuzeit wieder ausgegraben. Es ärgert mich bis heute, dass wir nichts dagegen unternehmen konnten. Wenn es nach mir ginge, würde besonders Herculaneum für alle Ewigkeit unter dem Tuffstein begraben liegen. So aber wurden Teile der untergegangenen Stadt wieder freigelegt und befinden sich als lukrativer Touristenmagnet inmitten der modernen Nachfolgesiedlung Ercolano.
Adone scheint meinen Unwillen zu teilen. »Die treiben sich nicht wirklich in Herculaneum rum, oder? Ich hab noch nie gewusst, was damals alle an diesem Kaff gefunden haben.«
Meine Mundwinkel krümmen sich leicht. Ja, Adone fand diesen Ort schon immer zum Sterben langweilig. Das antike Herculaneum war ein klassisches Ziel für Sommerfrischler; reiche Säcke, die sich hier Villen gebaut haben, um den grandiosen Blick über den Golf von Neapel zu genießen und sich die frische Luft um die Nase wehen zu lassen. Nichts für jemanden wie meinen Cousin, der früher zum Vergnügen an Gladiatorenwettkämpfen teilgenommen hat.
Scuro enthält sich wie so oft, und sein Schweigen verrät nichts darüber, was er wirklich denkt. Aber ich weiß, dass es ihm genauso wenig wie uns behagt, hier zu sein. Dieser Ort weckt Erinnerungen in jedem von uns, die wir am liebsten für immer vergessen würden.
In Ercolano ist es ruhig, als wir durch die Straßen laufen, in Richtung der unsterblichen Aktivität, die uns magnetisch anzieht. In meinem Kopf sieht es aus wie auf einem Radarmonitor, der voller hell leuchtender Flecken ist, die sich auf einen Ort konzentrieren.
Das Ausgrabungsgelände von Herculaneum befindet sich inmitten der modernen Siedlung, aber nur ein Bruchteil der untergegangenen Stadt wurde überhaupt ausgegraben. Vieles, was der Vesuv damals verschluckt hat, liegt noch immer unter meterdicken Lavamassen begraben.
Je näher wir den Ruinen von Herculaneum kommen, desto klarer wird, dass sie dort zu Gange sein müssen. Mir steigt die Galle hoch, wenn ich daran denke, dass ich das Gelände wirklich betreten muss. Meine Finger zucken; diese fehlgeleiteten Bastarde können sich auf eine Abreibung gefasst machen.
Die Aggression wächst mit jedem Schritt in mir, aber nach den Jahren der Abgestumpftheit heiße ich diese Regung willkommen. Sie erfüllt mich mit einer Lebendigkeit, von der ich dachte, dass ich sie längst verloren habe. Ich bin weiß Gott nicht der Einzige von uns, dem es so geht, und das ist ja auch der Grund, warum die meisten so dringend nach einem Ausweg suchen.
Auf die archäologische Stätte zu kommen, ist nicht besonders schwer. Am Rand des Geländes klettern wir über eine bröckelige Außenmauer, die man kaum als Herausforderung betrachten kann. Zwar sind wir nicht mit übermenschlicher Stärke oder Ausdauer gesegnet (solche Vorteile hat der Fluch natürlich nicht für uns vorgesehen), aber wenn man so lange lebt wie wir, bleibt viel Zeit, den eigenen Körper zu trainieren.
Lautlos kommen meine Cousins und ich auf der anderen Seite auf und ducken uns in den Schatten der Mauer, um zunächst die Lage zu sondieren. Die wieder ausgegrabenen Straßen und Gebäude wirken auf den ersten Blick ruhig und verlassen. Aber aus einiger Entfernung dringen Geräusche zu mir, die meine Aufmerksamkeit fesseln. Ein dumpfes Hämmern und Kratzen, das ich zunächst nicht einordnen kann.
»Hört ihr das?«, raune ich, meine Stimme so leise, dass sie fast mit dem Wind verschmilzt.
Scuro und Adone nicken.
»Graben … die da etwas um?«
Als Scuro es ausspricht, sind wir augenblicklich alarmiert.
Ewigliche, die im Schutz der Nacht Grabungen in Herculaneum vornehmen … jede Faser meines Körpers spannt sich an, und das, was ich gerade für Aggression gehalten habe, verpufft angesichts einer dunkleren, tödlicheren Regung, die sich jetzt in mir breitmacht. Eiskalte Raserei, die mich bis in den hintersten Winkel meines Seins erfüllt und nur ein Ziel kennt: sie aufzuhalten.
Nur über meine verfluchte Seele werde ich zulassen, dass irgendjemand hier herumwühlt und Geheimnisse aus dem Boden holt, die für immer hier begraben bleiben sollten.
Ohne weiter darüber nachzudenken, setze ich mich in Bewegung. Hinter mir stößt Adone einen leisen Fluch aus, doch er und Scuro folgen mir auf dem Fuß.
Geschmeidig wie Panther, fast gänzlich mit der Dunkelheit verwoben, bewegen wir uns durch die Siedlung. Vorbei an ehemaligen Schenken, Ladengeschäften und Wohnhäusern, die wie Gerippe in den Nachthimmel ragen.
Trotz der unbezähmbaren Rage, die in mir tobt, bewege ich mich lautlos wie ein Schatten vorwärts.
Und da ist es schon. Ein Gebäude, nur zur Hälfte ausgegraben und der Öffentlichkeit nicht zugänglich. Ich muss nicht hinsehen, ich spüre mit unfehlbarer Sicherheit, dass die Grabungsarbeiten in diesem Haus vor sich gehen. Ohne eine Sekunde darauf zu verschwenden, mich mit Scuro und Adone abzusprechen, stürme ich durch das Atrium ins Innere. Ich überlasse meinen Instinkten die Führung, ergebe mich vollständig der Raserei, die mich auch blind an mein Ziel führt.
Vier vermummte Personen befinden sich in dem halb verfallenen Raum und sind gerade dabei, einen Teil des Bodens mit Hacken und Schaufeln zu bearbeiten. Neben ihnen liegt ein Presslufthammer, den sie wohl zunächst benutzt haben, um das Gestein aufzubrechen. Jetzt scharren sie durch den aufgeworfenen Schutt, als würden sie nach etwas suchen.
Sie sind so in ihre Tätigkeit vertieft, dass sie zu spät bemerken, dass meine Cousins und ich hereinkommen. Ich verschwende keine Zeit für Warnungen, sondern knöpfe sie mir gleich vor. Mit dem Fuß trete ich einem von ihnen das Werkzeug aus der Hand, was ihn überrascht aufschreien lässt. Seine Gefährten halten in ihrem Tun inne und wenden sich in dem Moment um, als Adone und Scuro auf sie losgehen.
Im ersten Moment sind sie von unserem Angriff überrumpelt, doch sie fangen sich schnell und setzen sich zur Wehr. Gut so. Ich will sie nicht von hinten k. o. schlagen, sie sollen kämpfen.
Der Kerl, dem ich die Hacke aus der Hand getreten habe, fährt zu mir herum. Er richtet sich in der Drehung auf und entgeht so einem Tritt gegen die Brust. Ein Knurren entweicht mir, als er auf mich losgeht, mit einer Geschicklichkeit und Schnelligkeit, die meiner in nichts nachsteht.
Unermüdlich weiche ich Schlägen und Tritten aus und versuche ihn aus der Reserve zu locken. Ich habe nicht vor, den Dreckskerl auszuschalten – er ist genauso unsterblich wie ich, es ist also eh ein Ding der Unmöglichkeit –, aber wenn ich ihn ärgere, wird er irgendwann sauer, und dann bekomme ich die Chance zuzuschlagen. Mein Gegner kriegt gar nicht mit, wie ich ihn immer weiter in die Ecke treibe. Ich erhöhe die Intensität meiner Schläge, weiche ihm nicht länger aus, sondern lasse den Zorn in mir angreifen. Die Kapuze verhüllt noch immer sein Gesicht, aber ich muss es nicht sehen, um zu spüren, dass er nervös wird. Er kapiert, dass er mit dem Rücken zur Wand steht, und ich besiegle es mit einem bösen Grinsen.
Hinter mir nehme ich ein Geräusch wahr, das mich für den Bruchteil einer Sekunde ablenkt. Ein Knacken, gefolgt von einem dumpfen Stöhnen. Was zum …?
Mein Gegner nutzt den Moment der Unachtsamkeit und tritt die Flucht an. Blitzschnell ist er unter meinem Arm hindurchgehuscht, und ich komme nicht mehr dazu, nach ihm zu greifen.
Auch Adone und Scuro haben sich ablenken lassen, und als ich mich umdrehe, sehe ich gerade noch, wie die vier Bastarde hinaushuschen.
Ich stoße einen Fluch aus.
»Was war denn das?«, grunzt Adone, noch immer geladen von dem so abrupt unterbrochenen Kampf. Sein wilder Blick wandert durch den halb verfallenen Raum.
Ich zucke mit den Schultern und nähere mich vorsichtig der Grube, die sie mit dem Presslufthammer in den Boden getrieben haben. Es ist ein einziger Schutthaufen, aber viel tiefer, als ich angenommen habe.
Was haben sie hier eigentlich gesucht?
Diese Frage habe ich mir noch gar nicht gestellt, mein ganzes Denken war davon beherrscht, sie aufzuhalten und ihnen dann eine Abreibung zu verpassen, weil sie an diesem Ort herumgewühlt haben. Aber jetzt interessiert es mich brennend, was sich in der Grube verbirgt. Denn etwas ist dort unten. Und es bewegt sich.
Adone und Scuro treten neben mich, und gemeinsam lugen wir hinunter in das finstere Loch.
Wieder ist dieses Knacken zu hören, als würde eine dicke Eierschale aufgebrochen werden. Gestein rieselt zu Boden, und Staub wird aufgewirbelt. Ich muss die Augen zusammenkneifen, um überhaupt noch etwas erkennen zu können.
Undeutlich nehme ich eine Bewegung wahr und beobachte mit angehaltenem Atem, wie sich ein Schemen aus der Dunkelheit schält.
Ist das … kann das ein Mensch sein? Da ist nichts außer Staub, Asche und Gestein.
Ich versuche noch zu begreifen, was ich da sehe, als inmitten des Schutts etwas aufblitzt.
Ein Paar Augen.
Sie finden meinen Blick, und im selben Atemzug stolpere ich zurück, als wäre eine Kugel auf mich abgefeuert worden.
Das kann nicht sein!
Das ist unmöglich!
Kapitel Zwei
Rom, 79 n. Chr.
Vor den Podesten herrschte hektisches Treiben.
Die Bürger Roms drängten sich auf dem Platz vor dem Dioskurentempel, riefen wild durcheinander, feilschten und zankten. Es war ein unheimliches Getöse, doch das Mädchen auf dem Podest nahm es kaum wahr.
Eingerahmt von einem kräftigen blonden Hünen und einer schwarzhaarigen Frau mittleren Alters stand sie dort oben und vermied es, direkt in die Menge zu blicken.
Wenn sie nicht hinsah, konnte sie sich weiterhin einreden, dass dies gerade nicht passierte. Dass es nicht sie selbst war, die mit einem Schild um den Hals auf dem Sklavenmarkt am Dioskurentempel zum Verkauf stand. Es schüttelte sie noch immer vor Abscheu, wenn sie daran dachte, was auf diesem Schild stand: Römerin, gebildet, makellose Schönheit, besitzt alle Zähne. Eine Zierde für jeden Haushalt oder das Bett.
Ja, sie war in der Tat gebildet und hatte deshalb die Worte lesen können, mit denen der arabische Händler sie den Käufern schmackhaft machen wollte. Und wenn sie gekonnt hätte, hätte sie ihm liebend gern die Augen dafür ausgekratzt.
Sie war schon ihr Leben lang eine Sklavin – als Tochter einer Unfreien war sie automatisch in diesen Stand hineingeboren worden –, doch sie hätte nie erwartet, je auf einem dieser Märkte zu enden. Zum Verkauf feilgeboten wie Vieh.
Ein Mann trat näher, dem Auftreten nach ein wohlhabender Bürger, und besah sich einen dunkelhäutigen Sklaven, der ein paar Schritte von ihr entfernt stand. Vorhin hatte sie einen kurzen Blick auf seine Tafel erhaschen können. Nubier, stand dort. Also stammte er aus dem fernen Afrika, und nur die Götter wussten, unter welchen Umständen es ihn hierher verschlagen hatte. Fortuna war ihnen allen nicht hold.
Wie sie hatte er den Blick stoisch auf einen Punkt jenseits des Publikums gerichtet, während der Interessent ihn genauestens musterte.
Der Händler umschwärmte ihn emsig, und man konnte bereits die goldenen Sesterzen in seinen Augen funkeln sehen. Dieser Kunde versprach ein gutes Geschäft.
»Ich hätte jemanden schicken können, aber ich sehe mir einen Sklaven lieber selbst an, ehe ich ihn erwerbe«, erklärte dieser dem Händler gerade blasiert. »Das letzte Mal, als ich es nicht persönlich erledigt habe, habe ich beschädigte Ware erhalten.«
Der drohende Blick ließ den Händler eilends betonen, dass man bei ihm nur beste Qualität zu erwarten hatte. Um es zu demonstrieren, packte er den dunkelhäutigen Mann am Arm und zwang ihn, sich nach allen Seiten zu drehen, um seinen kräftigen Körperbau vorzuführen. Dann drückte er ihm mit einer Hand den Mund auf, um das makellose weiße Gebiss zu demonstrieren.
»Er ist kräftig, aber auch äußerst geschickt. Beherrscht Latein!«
Der reiche Römer wiegte nachdenklich den Kopf. »Was verlangst du für ihn?«
»Siebentausend Sesterzen.«
Sie begannen zu handeln, ehe sie sich schließlich auf einen Preis von fünftausendachthundert Sesterzen für den nubischen Sklaven einigten.
Schließlich zerrte ihn sein neuer Besitzer mit selbstzufriedener Miene wie einen Schafbock von dem Podest. Der Sklave hatte seine Verschacherung mit stoischer Miene ertragen und stand jetzt reglos neben seinem neuen Meister.
Das alles verfolgte sie mit halbem Ohr, während sie weiter mit aller Kraft versuchte, diesen fürchterlichen Ort auszublenden. Aber es war schier unmöglich, wenn überall um sie herum Menschen wimmerten und Kinder greinten. Alle mit einem Schild um den Hals, welches das Ende ihres bisherigen Lebens symbolisierte. Diese Menschen waren aus allen Teilen des Imperiums hierher verschleppt worden. Männer, Frauen, Kinder waren ihrem alten Leben für immer entrissen worden, während sie selbst nie etwas anderes gekannt hatte.
Das Leben als Sklavin war nicht durchweg furchtbar. Das hätte sie manchen von ihnen gerne gesagt, um sie aufzumuntern. Im Haushalt ihres alten Herren Flavius Verus, in dem sie gelebt und gearbeitet hatte, seit sie denken konnte, war es ihr gut ergangen. Sie hatte mit den Töchtern des Hauses lernen dürfen, war ihnen Gefährtin und Dienerin gewesen, und man hatte nie die Hand gegen sie erhoben. Ihr waren so viele Privilegien zuteilgeworden, die für ein namenloses Sklavenmädchen nicht selbstverständlich waren.
Doch dann war Flavius gestorben, und sein Erbe hatte beschlossen, einige der Sklaven aus seinem Nachlass zu verkaufen, weil er selbst schon genug besaß. Und sie war eine der ersten gewesen, die dem Händler übergeben worden war. Schöne junge Frauen mit Bildung brachten am meisten ein.
Nein, sie ängstigte am heutigen Tag nicht die Aussicht, ihre Freiheit zu verlieren – die hatte sie nie besessen.
Dennoch lag hier, auf dem Markt, eine wichtige Wegscheide für ihr Leben. Hier entschied sich, ob sie weiterhin das angenehme Leben einer Haussklavin genießen durfte oder womöglich in einem Bordell endete. Beides war denkbar. Wenn der Verkäufer ihren Preis zu hoch angesetzt hatte, sie vielleicht doch nicht so schön war, wie er mit dröhnender Stimme verkündete und er sie nicht losbekam, dann würde sie verschachert werden. Und die Götter wussten, dass Dirnen in dieser Stadt ein elenderes Leben fristeten als mancher Ackergaul.
Also hielt sie sich gerade, das Gesicht reglos und ruhig, um niemandem den Schrecken in ihrem Inneren sehen zu lassen.
Einige Interessenten zogen an ihr vorbei, ließen sich ihren Körper vorführen und gingen doch wieder weiter. Die Sonne wanderte stetig ihrem Zenit entgegen, und die löchrigen Leinenplanen boten kaum Schutz vor der aufkommenden Hitze.
Lange würde das Markttreiben auf dem Forum nicht mehr andauern, und sie würden zurückgetrieben werden in den Verschlag, in dem sie zusammengepfercht wie Tiere bis zum nächsten Tag ausharren mussten. Wie oft würde der Händler sie noch hier oben auf dem Podium ausstellen, ehe er sie unter der Hand an einen Zuhälter verschacherte?
In diesem Moment des Zweifelns wagte sie es das erste Mal, den Blick über die Marktgänger schweifen zu lassen, um abschätzen zu können, wie viele Interessenten noch anwesend waren. Vielleicht konnte sie einen von ihnen mit einem Lächeln locken.
Ihr Blick huschte suchend umher.
Und dann sah sie ihn. Den jungen Mann in der feilschenden Menge. Er sah sie direkt an, und über das Gewühl der Menschen hinweg trafen sich ihre Blicke.
Was geschah, war ein Moment der vollkommenen Ruhe inmitten des hektischen Chaos. Das Gebrüll, das leise Weinen und Gezeter verstummte, während sie sich über die Distanz in die Augen schauten.
Sein Blick fesselte sie ganz und gar.
Augen, so blau wie das Tyrrhenische Meer, das war selbst über die Entfernung zu erkennen. Er hielt ihren Blick fest, und sie vergaß die Angst, die sie innerlich schüttelte, seit sie an einen Strick gefesselt auf die hölzerne Empore gezerrt worden war.
Er stand neben einem Mann, der sein Vater sein musste. Die massige, hochgewachsene Gestalt des Älteren war Ehrfurcht gebietend, und alles an seiner Haltung drückte aus, dass er ein Mann von Rang und Namen war.
Ohne den Blick von ihr zu lösen, sagte der junge Mann etwas zu seinem Vater, sodass auch dieser in ihre Richtung sah. Er musterte sie seinerseits, und eine Falte bildete sich zwischen den dichten Augenbrauen des Älteren.
Ihr Herz begann zu rasen – doch diesmal nicht vor Panik, sondern aus Aufregung. Beratschlagten die beiden gerade, sie zu kaufen?
Sie wusste nicht warum, aber die Aussicht, in den Besitz dieser beiden Männer überzugehen, ängstigte sie nicht im Geringsten. Es lag etwas im Blick dieses jungen Mannes, das sie alle Furcht vergessen ließ. Das ihr die Zuversicht gab, das Kinn zu recken und seinem Vater entgegenzublicken, als er sich einen Weg durch das Gewühl bis nach vorne zum Podium bahnte.
»Wie viel verlangst du für diese Sklavin?«, fragte er den Händler, und seine Stimme klang tief und angenehm.
»Hundertzwanzigtausend Sesterzen und kein As weniger.«
Ihr Herz raste wie verrückt. Hundertzwanzigtausend Sesterzen, das war ein horrender Preis!
Doch der Herr schien sich tatsächlich darauf einzulassen und begann zu feilschen. Sie verfolgte jedes Wort gespannt und musste sich immer wieder daran erinnern, Atem zu schöpfen.
Und dann, als sie dachte, sie wären sich einig, kam plötzlich der Mann dazu, der vorhin den nubischen Sklaven erworben hatte.
»Tiberius! Wie erfreulich, dich zu treffen. Hast du ein Auge auf dieses hübsche Täubchen geworfen?«
Der Mann, Tiberius, erwiderte den Gruß knapp. »Salve, Faustus.«
Faustus’ Augen wanderten zu ihr, und sie schauderte unter seinem abschätzenden Blick.
»Wie steht der Preis?«
»Hundertzehntausend Sesterzen«, warf der Händler eilfertig ein, der ganz offensichtlich einen lukrativen Bieterkrieg witterte. »Diese hellen Augen sind einzigartig, meinen die edlen Herren nicht auch? Wie der edelste Bernstein aus dem barbarischen Norden. Einmalig hier in Rom.«
Als Faustus und Tiberius zu feilschen begannen und der Händler ihren Preis immer weiter in die Höhe trieb, suchte sie nach den blauen Augen in der Menge. Er war nicht mit seinem Vater nach vorne an die Tribüne gekommen, sondern zurückgeblieben. Und nun hatten ihn die Menschen verschluckt!
Aufgeregt suchte sie von ihrem erhöhten Standpunkt aus die Gesichter ab, aber er war nirgends mehr zu entdecken. War er weitergezogen und hatte es seinem Vater überlassen, die neue Sklavin zu erwerben? Hatte sie sich diese besondere Verbindung, während sie sich angesehen hatten, womöglich nur eingebildet?
Schließlich hörte sie einen Satz von Tiberius, der ihr das Blut in den Adern gefrieren ließ.
»Verzeiht, aber mehr bin ich nicht gewillt zu zahlen. Faustus, ich gratuliere zu deiner entzückenden neuen Sklavin.«Mit einem respektvollen Nicken vor dem Händler und seinem Mitstreiter wandte sich Tiberius zum Gehen.
Nein, wollte sie rufen, geht nicht! Nehmt mich mit!Doch er warf keinen Blick zurück und war im nächsten Moment in der Menge verschwunden.
Der Händler zählte indes vor Stolz strahlend die Münzen, die er von Faustus überreicht bekommen hatte.
Sie hatte nicht mitbekommen, wie viel letztendlich für sie geboten worden war. Eigentlich war es ihr auch gleichgültig. Der junge Mann mit den blauen Augen war verschwunden, sie musste mit Faustus gehen und würde ihn nie mehr wiedersehen.
Die Hoffnungslosigkeit, die sie den ganzen Vormittag über so stoisch niedergerungen hatte, übermannte sie nun, und sie bekam es gar nicht mehr mit, wie sie von dem Podium hinuntergezerrt wurde.
Aliqua
Das Pochen und Stechen meines Körpers, mit dem ich mich gerade aus meinem aufgebrochenen Gefängnis befreit habe, tritt in den Hintergrund, als ich Bewegungen über mir wahrnehme und den Kopf hebe. Ich starre nach oben, wo die drei Gestalten am Rand der Grube stehen und zu mir hinunterschauen. Trotz der Dunkelheit spüre ich ihre Blicke auf mir. Meine Aufmerksamkeit dagegen liegt ausschließlich auf der Person in der Mitte, die mich auf unerklärliche Weise fesselt – und plötzlich einen Satz nach hinten macht, als hätte sie den Leibhaftigen gesehen.
Nun, wer weiß, ob ich das nicht vielleicht bin. Das wäre immerhin eine Erklärung dafür, warum ich so lange unter der Erde weggesperrt war. Im nächsten Moment flammt jäh ein grellweißes Licht auf, was mich erschrocken die Lider zusammenkneifen lässt. Autsch! Das erste Licht seit einer Ewigkeit, und es sticht mir in die Augen wie glühende Nadeln.
Von oben ertönt eine männliche Stimme. »Bei Jupiter, was haben wir denn da?«
Blinzelnd wage ich es, die Augen zu öffnen, doch das Licht ist noch immer so blendend hell, dass ich nichts sehen kann. Welche Ironie.
»Ein Mädchen«, sagt eine weitere Stimme, aus der dieselbe Verwunderung klingt.
»Sie müssen sie zurückgelassen haben … aber warum dann hier unten in der Grube?«
Ich kann euch hören, will ich sagen, aber mir kommt kein Wort über die Lippen.
Stattdessen versuche ich aufzustehen, um endlich aus diesem Loch herauszukommen. Aber so einfach ist das gar nicht. Meine Beine fühlen sich ganz steif und schwach an, nachdem ich sie so lange nicht benutzt habe. Ein Wunder, dass meine Muskeln nicht komplett verkümmert sind, aber eigentlich müsste nach all der Zeit mein ganzer Körper längst zerfallen sein. Ich stolpere und wanke, bis sich Hände zu mir nach unten strecken und mir Hilfe anbieten. Dankbar greife ich zu, und starke Arme ziehen mich aus dem Loch, das so lange mein Grab war. Zerklüftetes Gestein schabt über meine nackte Haut, und dann habe ich es geschafft.
Ich bin draußen. Frei.
Nur selten habe ich es mir erlaubt, darüber nachzudenken, wie dieser Moment sein würde. Wie würde es sich anfühlen? Würde ich tanzen vor Freude und den Göttern danken? Oder schlicht überwältigt sein vor Dankbarkeit und Glück?
Im Moment keines von alledem. Die Realität ist weder von Freudentränen noch von Glückstaumel erfüllt.
Meine Befreiung war schmerzhaft, und nicht nur meine Beine, die mich plötzlich wieder tragen müssen, fühlen sich wackelig an. Ich zittere am ganzen Körper und spüre dem überwältigenden Gefühl von Freiheit nach. Ich war so lange Zeit gebannt – es ist ein Wunder, dass ich überhaupt noch funktioniere. Dass ich nicht längst den Verstand verloren habe und jetzt hier stehen kann. Verwirrt, aber bei Sinnen.
Tief atme ich durch. Ich spüre es mit jedem Atemzug. Die Luft, die meine Lungen füllt und ausdehnt, das Blut, das durch meine Adern rauscht, und die Welt, die auf mich einströmt. Es fühlt sich fremd an und gleichzeitig so berauschend vertraut.
Endlich haben sich meine Augen an die grellen Lichtquellen gewöhnt, sodass ich die dunklen Gestalten – alles Männer, wie ich annehme – meinerseits mustern kann.
Mein Atem stockt.
Mir gegenüber stehen zwei junge Männer, die gegensätzlicher nicht sein könnten. Auf den ersten Blick sehen sie sich recht ähnlich mit dem dunklen, kurz geschnittenen Haar und der blassen Haut. Aber da enden die Gemeinsamkeiten auch schon. Der eine hat ein schmales, scharf geschnittenes Gesicht mit dunklen, melancholischen Augen. Seine Statur wirkt drahtig, aber in ihm lauert eine unverkennbare Erbarmungslosigkeit, die mich mahnt, ihn nicht zu unterschätzen. Der daneben dagegen ist groß und muskulös. Sein Bizeps wölbt sich beeindruckend, als er die Arme vor der Brust verschränkt, und ein Blick in sein Gesicht … mhhh. Etwas flattert in meinem Magen, während ich ihn betrachte. Ein anderes Wort als schön fällt mir nicht ein. Sie sehen beide nicht schlecht aus, aber sein Gesicht ist von einer universellen, unwiderstehlichen Attraktivität. Und als sich unsere Blicke treffen und er träge eine Augenbraue hebt, wird mir klar, dass er sich über diesen Umstand völlig bewusst ist. Er wirkt geradezu lächerlich selbstsicher.
Eine ganze Weile stehen wir uns schweigend gegenüber. Sie mustern mich ihrerseits, mit zusammengekniffenen Augen und anscheinend ratlos, wie sie mich einordnen sollen. Gut, so geht es mir nämlich auch. Ich habe keinen blassen Schimmer, wie ich mich verhalten soll. Auf dem Absatz kehrtmachen und zu fliehen versuchen? Auf die Knie gehen und ihnen die Füße küssen?
Als ich das Schweigen nicht mehr aushalte, beschließe ich den ersten Schritt zu tun.
»Danke!«
Das erste Wort seit Jahrhunderten. Das erste Mal nach so langer Zeit, dass ich meine eigene Stimme außerhalb meiner Gedanken höre.
Manchmal hatte ich Angst, das Sprechen verlernt zu haben, keinen Ton herauszubekommen, sollte es einmal so weit sein. Aber genau wie das Atmen funktioniert es wie von selbst, und ein kleiner Glücksschauer rieselt über meinen Rücken.
Beim Klang meiner Stimme zucken die beiden zusammen, und ihre Augen weiten sich.
»Sieh an, du kannst also sprechen.« Der Muskelprotz wechselt einen raschen Blick mit seinem Begleiter, der kaum merklich die Achseln hebt.
»Sie ist keine von ihnen.«
Keine von wem? Wovon sprechen sie? Meine Ratlosigkeit scheint man mir vom Gesicht ablesen zu können.
»Wer bist du?« Die Frage kommt von dem Kleineren mit dem ernsten Blick.
Und er erwischt mich eiskalt damit. In meinem Kopf herrscht dahingehend eine gähnende Leere, als hätte die Zeit selbst meine Identität ausradiert. Egal wie sehr ich mich anstrenge, es scheint nur einen Fetzen zu geben, der mir geblieben ist: meinen Namen.
»Ich heiße Aliqua.«
»Nur Aliqua? Kein Nachname?«
Bedauernd schüttle ich den Kopf. Nein, ich wüsste nicht, dass ich einen Nachnamen hätte.
Ihre Gesichter bleiben reglos, kein Hauch von Wiedererkennen auf ihren Mienen. Aber was habe ich auch erwartet? Dass nach all der Zeit noch jemand lebt, der sich an mich erinnert? Wohl eher nicht.
»Und ähm … wer seid ihr?« Es macht mich unerklärlicherweise nervös, ihre Namen nicht zu kennen. Und noch immer kann ich nicht einschätzen, wie sie mir gesinnt sind. Wahrscheinlich, weil sie es selbst noch nicht genau wissen. Ich stehe zwei Raubtieren gegenüber, die sich noch nicht entschieden haben, ob ich Feind, Beute oder Freund bin. Wobei ich Letzteres natürlich bevorzugen würde.
Der Muskelprotz gibt sich einen Ruck und tritt vor. Seine Augen bleiben wachsam, während er mich anlächelt. »Ich bin Adone«, stellt er sich vor. »Und das ist mein Cousin Scuro.« Er weist auf den kleineren Mann neben ihm. »Und Santo, ein weiterer Cousin. Wo steckt der Kerl eigentlich? Hey, Santo!« Suchend wendet er sich um.
Erst jetzt wird auch mir bewusst, dass sie anfangs zu dritt am Rand der Grube gestanden haben, ehe einer von ihnen zurückwich, als er mich sah. Diese Reaktion beunruhigt mich ziemlich. Adone und Scuro scheinen mich wirklich nicht zu kennen, aber was hat der Dritte in mir gesehen, das ihn so heftig reagieren ließ? Santo, Adone nannte ihn Santo. Im Gegensatz zu den anderen zupft beim Klang dieses Namens irgendetwas an den Tiefen meines Bewusstseins. Auf eine sehr abstrakte, schwer fassbare Weise fühlt es sich vertraut an.
Adone kommt zu uns zurück, und ihm folgt der dritte Mann.
Mein Atem stockt. Schon wieder.
Scuro und Adone verblassen, verschwinden geradezu aus meinem Sichtfeld, obwohl sie direkt neben ihm stehen. Aber nichts, absolut nichts in der Welt hat Bestand, angesichts des Gefühls, das mich übermannt, als ich ihm ins Gesicht schaue. Etwas reißt in diesem Moment an meinem Bewusstsein, ein kleiner Widerhaken, der sich wie eine längst vergessene Erinnerung anfühlt. Die Empfindung von Vertrautheit und Wiedererkennen ist so mächtig, dass alles in mir erbebt. Ich kann den Blick nicht von ihm nehmen, betrachte ihn in dem verzweifelten Wunsch, herauszufinden, woher meine Reaktion kommt.
Er ist so schön, dass ich wahrhaftig keine Luft mehr bekomme.
Dunkles Haar fällt ihm in widerspenstigen Wirbeln in die Stirn, während er reglos meinen Blick erwidert und mich seinerseits mustert. Jeder Gesichtszug scheint von der Hand eines antiken Meisterbildhauers geformt, und doch sind es seine Augen, die mich fesseln. Blau, so viele Nuancen von Blau. Das Meer verblasst gegen seine Augen. Gegen diesen Strudel aus Azurblau und Violett.
Eine ganze Weile blicke ich ihn an und krame verzweifelt in meinen verstaubten Erinnerungen nach dem Ursprung dieses Erkennens. Denn ich sehe diese Augen nicht zum ersten Mal. Es ist nicht das erste Mal, dass ich dieses Gefühl erlebe, den Boden unter den Füßen zu verlieren, wenn ich dieses Blau anschaue. Aber das kann nicht möglich sein, oder?
»Santo«, murmle ich gedankenverloren.
Eine Emotion huscht bei meinen Worten über sein Gesicht und legt sich wie ein Schatten über seine Züge. Eine uralte Düsternis, eine Traurigkeit, die an meinem Innersten zerrt. Es ist schneller verschwunden, als ich blinzeln kann, aber es ist mir nicht entgangen.
Noch immer hat er nichts zu mir gesagt, starrt mich nur reglos an, als könnte er selbst nicht ganz glauben, wen er da vor sich sieht.
»Santo«, sagt Scuro, der sich bisher im Hintergrund gehalten hat. »Weißt du, wer sie ist?«
Mehrere Augenblicke lang rührt sich Santo nicht. Würde sich seine Brust nicht unter schnellen Atemzügen heben und senken, könnte man meinen, er sei zu einer Statue erstarrt. Sein Gesicht gibt keine Regung preis, nur seine Augen flackern. Als er dann doch spricht, scheint seine Stimme aus weiter Ferne zu kommen.
»Ich kenne sie nicht.«
Seine nüchternen Worte schneiden durch mein Inneres wie eine geölte Klinge. Er behauptet, mich nicht zu kennen, und die Enttäuschung ist so schmerzhaft, dass ich mich zusammenkrümmen möchte. Irgendwie hat er die irrige Hoffnung in mir wachgerufen, dass uns etwas verbindet, an dem ich mich festhalten kann. Ein Anker, um mich zu orientieren.
Adone, Scuro und Santo starren mich noch immer forschend an.
Schließlich ist es Scuro, der als Erster wieder das Wort ergreift. »Wie bist du in diese Grube gekommen?«
Automatisch schaue ich zu der aufgeworfenen Spalte im Boden und weiche einen Schritt zurück. Ich bin weit genug davon entfernt, aber trotzdem habe ich Angst, wieder in dieses unerbittliche Grab hinabgesogen zu werden, wenn ich mich zu nah heranwage.
»Ich war dort unten gefangen«, sage ich, nachdem ich mich endlich davon losgerissen habe. Es laut auszusprechen, lässt mir ein Schaudern den Rücken hinunterlaufen.
Den dreien ist anzusehen, dass sie mit dieser Erklärung nicht viel anfangen können. Auch wenn es mir schwerfällt, versuche ich konkreter zu werden.
»Ich weiß nicht, wie oder warum, aber ich war für ziemlich lange Zeit hier, unter der Erde, gefangen. Irgendwann habe ich das Zeitgefühl verloren, und ich kann mich an kaum etwas erinnern. Da sind noch ein paar Fetzen … Hitze und Lärm und Chaos.«
Die Stille, die auf meine Worte folgt, ist ohrenbetäubend.
Scuros unergründlicher Blick liegt mit einer Intensität auf mir, als versuchte er durch meinen Schädel direkt in meinen Kopf zu schauen. Komischerweise fühlt es sich so an, als hätte er Erfolg damit.
»Du warst die ganze Zeit über am Leben? Dort unter der Erde?«
Ich nicke wieder und frage mich gleichzeitig, warum ich selbst nie genauer über diesen Umstand nachgedacht habe. Dort unten habe ich mich nie darüber gewundert, so lange am Leben zu sein.
Scuro lässt den Blick durch den Raum schweifen, in dem wir uns befinden. »Soweit ich weiß, wurde dieser Teil von Herculaneum während des Ausbruchs des Vesuv im Jahr 79 verschüttet. Du warst dort unten … das muss heißen, dass du von den Vulkanmassen begraben wurdest. Und überlebt hast.«
Ich spüre die Blicke von Santo und Adone auf mir, die beide vollkommen entgeistert wirken. Aber wenn es stimmt, was Scuro vermutet und ich von einem Vulkan verschüttet wurde und überlebt habe … das ist verrückt. Vollkommen verrückt, und trotzdem stehe ich hier. Schwach und wackelig, aber definitiv lebendig.
Santo ist der Einzige, der nicht weiter reagiert. Fest presst er die vollen Lippen zusammen und wirkt ansonsten so, als wäre er mit seinen Gedanken an einem völlig anderen Ort.
Ein Glucksen reißt mich jäh aus meiner Versunkenheit.
Adone lacht leise in sich hinein. »Immer, wenn ich denke, die Welt wird langweilig, schafft sie es doch wieder, mich zu überraschen.« Feixend schaut er in die Runde. »Sie muss wohl eine Art von Ewiglicher sein.«
Scuro schüttelt den Kopf, und das erste Mal treten erkennbare Emotionen hinter seiner kühlen Fassade hervor. »Wie kann es sein, dass sie lebt?«, will er wissen und mustert mich mit neuem Argwohn. Ich muss mir alle Mühe geben, aufrecht stehen zu bleiben und nicht unter dem Gewicht dieses Blickes einzuknicken.
Adone zuckt nur mit den Schultern. Fragend rempelt er Santo an, der heftig blinzelt, als wäre er aus einem Traum erwacht. »Ich habe keine Ahnung.« Santo klingt glatt und schneidend. Mir sackt ein schweres, bitteres Gefühl in die Magengrube. Anscheinend ist er ganz und gar nicht glücklich über meine Wiederauferstehung. Wünscht er sich, es wäre anders?
Ich weiß nicht, warum mir dieser Gedanke so viel ausmacht. In meinem Kopf ist keine konkrete Erinnerung an diesen Kerl, nichts weiter als ein vages Gefühl, das mir sagt, dass er mir einmal wichtig war. Und wenn es wirklich so gewesen ist, dann tut es weh, dass er nun so abweisend reagiert. Aber kann ich mir wirklich sicher sein, mir das nicht nur einzubilden?
Ich beginne zu zittern, was Staub und Gesteinsbröckchen an meinem Körper hinabrieseln lässt.
Scuro, dessen Blick offenbar nichts entgeht, bemerkt es. »Wir sollten sehen, dass wir hier wegkommen. Um alles andere können wir uns später kümmern.«
»Ja«, stimmt Santo ihm zu. »Wir sollten zurück in die Stadt, bevor hier jemand auftaucht. Die Bastarde waren bestimmt nicht gerade leise.« Er wirft einen bedeutungsschweren Blick auf den Presslufthammer am Boden. Seine Kiefermuskulatur tritt hervor und verrät, wie angespannt er noch immer ist.
Ich nicke stumm, weil auch ich diesen Ort so schnell wie möglich verlassen will. Weggehen und am besten nie mehr hierher zurückkehren. Noch immer habe ich keine Ahnung, wer diese drei überhaupt sind, geschweige denn, was sie mit mir vorhaben. Aber auf unerklärliche Weise vertraue ich ihnen, und sei es nur, damit sie mich von hier fortbringen.
Ohne einen Blick zurück verlasse ich das halb verfallene Gebäude und die gähnende Grube, die sich inmitten des Mosaikfußbodens auftut.
Santo
Verdammt! Verdammt, verdammt, verdammt!
Ich gehe vorneweg. Sorgsam achte ich darauf, meine Schritte möglichst lässig und meine Haltung entspannt wirken zu lassen, während in mir ein Höllensturm tobt. Ich will nicht weiter den Anschein erwecken, dass Aliquas Wiederkehr mich in irgendeiner Weise besonders berührt. Das, was bei ihrem Anblick aus mir herausgebrochen ist, konnte ich nicht kontrollieren, und ich kann nur hoffen, dass es zu einem späteren Zeitpunkt nicht auf mich zurückfallen wird.
Trotzdem fürchte ich, dass Adone und Scuro mich noch in die Mangel nehmen wollen. Meine Behauptung, Aliqua nicht zu kennen, war nicht gerade überzeugend, nachdem ich sie so unverwandt angestarrt habe.
Meine Hände, die ich in den Hosentaschen vergraben habe, ballen sich zu Fäusten.
Meine Fingernägel graben sich schmerzhaft in meine Handflächen, aber ich begrüße den Schmerz. Er fühlt sich realer an als das dumpfe Pochen in meiner Brust. Gibt mir das Gefühl, noch Herr über meine Sinne zu sein, nachdem mir der Boden unter den Füßen weggezogen wurde.
Wortwörtlich.
Aliqua in dieser Grube kauern zu sehen, von oben bis unten mit Staub und verkrusteter Asche bedeckt, sodass sie aussah wie eine fleischgewordene Statue, hat mich völlig unvorbereitet getroffen. Ihre Augen zu sehen, die als einziger Teil von ihr lebendig und erschreckend real wirkten. Der schlimmste Schock in meiner elendigen Existenz, und das muss was heißen.
Nicht in tausend Jahren hätte ich gedacht, dass sie noch am Leben ist. Das Entsetzen über diese Tatsache frisst ein Loch in meine Brust und bringt mich innerlich ins Taumeln. Sie, ausgerechnet sie.
Das macht mir eine Scheißangst. Zusammen mit der Frage, wie das möglich sein kann. Ich war mir so sicher, dass sie tot ist. So sicher, dass ich sie inzwischen erfolgreich aus meinen Erinnerungen getilgt hatte. Und doch genügte ein Blick auf sie, um alles zurückzuholen. All die Bilder, die ich nie wieder sehen wollte. Die Gefühle, die mich zu überwältigen drohen, jetzt, da sie zurück ist. Schuld, Hass, Gram.
Es war reiner Instinkt, so abweisend zu reagieren und sie zu verleugnen. Selbstschutz.
Was beim letzten Mal passiert ist, hat mich meine Lektion gelehrt.
Ein paar Minuten später nähern wir uns dem Parkplatz in Portici. Aufmerksam sondiere ich die Umgebung, aber noch ist alles ruhig. Es wird noch ein paar Stunden dauern, ehe jemandem die Verwüstung auf der archäologischen Grabungsstätte auffällt und das Chaos losbricht.
Mein Kopf brummt, wenn ich daran denke, welchen Rattenschwanz dieser Abend nach sich ziehen wird. Nicht nur hier in Herculaneum, sondern für mich und die Familien. Ich muss Nerone Bescheid geben, der das Tribunal informieren wird. Unmöglich, Aliqua vor ihnen geheim zu halten. Es wird eine Untersuchung geben, Befragungen, Nachforschungen.
Und alter Klatsch wird ausgegraben werden.
Aliqua stakst mit nackten Sohlen über den porösen Untergrund und verzieht jedes Mal das Gesicht, wenn sie auf spitze Steinchen oder Unrat tritt. »Wohin werdet ihr mich bringen?«
Ihre Stimme ist nicht mehr so rau wie vorhin, aber noch immer etwas belegt. So, als hätte sie sie schon lange Zeit nicht mehr benutzt. Noch immer kann ich nicht ganz begreifen, dass sie gerade ausgegraben wurde. Aus der Erde von Herculaneum, nachdem sie so lange Zeit dort unten lag – wenn es stimmt, was sie behauptet. Allein die Vorstellung führt dazu, dass sich mir der Magen umdreht.
Unwillkürlich lasse ich mich zurückfallen, um die Unterhaltung verfolgen zu können.
»Wir werden dich nach Rom mitnehmen.« Adone, der sich noch nie von einer Frau fernhalten konnte, selbst wenn nicht feststeht, wer oder was sie ist, wirft Aliqua sein berüchtigtes Grinsen zu. Ich merke genau, dass er bereits Sympathie für sie empfindet, und das bereitet mir Sorgen.
Sie blinzelt ein paarmal, ansonsten ist ihrem staubverkrusteten Gesicht keine Regung zu entnehmen. Trotzdem fällt mir auf, dass sie unmerklich näher an ihn herantritt. Sollten die beiden eine Allianz bilden, dann helfe mir Minerva.
Prompt wirft sich Adone in die Brust. »Die Frage ist nur, zu wem wir dich bringen. Ich hätte genug Platz …«
»Nein.« Das Wort entfährt mir mit ungeahnter Heftigkeit. »Sie kommt mit zu mir. Orela kann sich um sie kümmern.«
Dieser Ausbruch ist ein weiterer Fehler. Adone zieht auf seine nervtötende Art eine Augenbraue hoch und betrachtet mich mit neuem Interesse. Die meisten halten ihn für einen gedankenlosen Weiberhelden, aber damit unterschätzen sie meinen Cousin. Er kann verdammt scharfsichtig sein, und mir gefällt die Art, wie er mich gerade ansieht, überhaupt nicht. Hinter seiner Stirn arbeitet es, und mir graut vor den Schlüssen, die er ziehen könnte. Sobald ich mich halbwegs beruhigt habe, muss ich mit ihm reden und diesmal wirklich überzeugend sein. Was Scuro angeht … das steht auf einem ganz anderen Blatt.
Wir erreichen Adones schwarz glänzenden Land Rover, und er mustert Aliqua mit hochgezogenen Brauen. »Tut mir leid, aber bevor ich dich in mein Auto setzen kann, müssen wir dich wohl durch eine Waschanlage schleusen. Das Perfect Shine Programm.«
Aliqua wirft ihm einen gereizten Blick zu. »Ich fahre gerne im Kofferraum mit, wenn ich zu dreckig bin.« Sie wirft ihr langes, völlig verdrecktes Haar über die Schulter, und eine weitere Staubwolke steigt auf. Ich muss mich bemühen beim Aufblitzen ihres Temperaments nicht zu lächeln.
Adone grinst zerknirscht. »Das war ein Witz. Willst du vorne einsteigen?«
Als er an mir vorbeigeht, um ihr die Beifahrertür aufzumachen, höre ich ihn in sich hineinmurmeln: »Ich muss mir einen Industriestaubsauger besorgen.«
Nachdem er die Autotür hinter ihr zugeschlagen hat, nehme ich ihn zur Seite. »Ich fahre mit dem Motorrad in die Stadt. Wir treffen uns dann bei mir.«
Sein Blick wirkt nachdenklich. »Keine Ahnung, aber ich hab das Gefühl, dass du gerade einen Geist gesehen hast. Zweitausend Jahre sind eine lange Zeit, bist du sicher, dass du sie nicht kennst?«
Ich muss das letzte bisschen Konzentration zusammennehmen, um ruhig zu bleiben. Mich nicht weiter zu verraten. »Ich vergesse nie ein Gesicht«, ist alles, was ich dazu sage, bevor ich mich abwende.
Mit einem letzten langen Blick in meine Richtung steigt Adone hinters Steuer seines Wagens, und auch Scuro hüpft auf den Rücksitz.
Der Motor erwacht mit einem ohrenbetäubenden Grollen, und ich muss über Adones Vorliebe für gigantische, protzige Autos seufzen.
Aber gut, wer bin ich, mit meiner geliebten Moto Guzzi, um über ihn zu urteilen.
Ich bin verdammt froh, den Weg zurück nach Rom alleine auf meinem Motorrad zurücklegen zu können. Das gibt mir die Chance, meine Gedanken zu ordnen und meine Fassung vollends zurückzugewinnen.
In Gedanken gehe ich den Abend noch einmal durch und versuche Ordnung in das Chaos in meinem Kopf zu bringen.
Ich komme zu dem Schluss, dass ich mich nicht weiter wie ein abweisendes Arschloch verhalten kann. In Aliquas Augen habe ich nichts lesen können, was darauf schließen ließe, dass sie sich an viel erinnern kann. Was gut ist, wie ich mir sage. Die Vergangenheit ist geschehen, ich kann sie nicht rückgängig machen, egal wie sehr ich mich anstrenge. Und wenn sie sich nicht erinnert, werde ich den Teufel tun und sie auf die Idee bringen, auf Spurensuche zu gehen.
Ich werde ihr ein Freund sein. Sie dabei unterstützen, sich wieder an das Leben in Freiheit zu gewöhnen und nachzuholen, was sie verpasst hat. Das bin ich ihr schuldig.
Es wird nicht leicht für sie werden, sich in der neuen Zeit zurechtzufinden. Als sie verschwand, herrschten die Kaiser über das Imperium und die Götter hatten noch ihre Finger im Spiel. Es war eine archaische Welt, in die wir alle hineingeboren worden sind, voller Gewalt und Mysterien. Die Menschen sind noch immer gleich, aber alles darum herum hat sich gewaltig verändert. Damit muss sie lernen klarzukommen.
Obwohl … wenn ich darüber nachdenke, geht sie damit eigentlich ziemlich cool um. Sie war das letzte Mal vor knapp zweitausend Jahren draußen und ist, ohne mit der Wimper zu zucken, in ein Auto gestiegen. Sie wusste sogar, was ein Kofferraum ist.
Warum weiß sie so viel über die moderne Welt, wenn sie doch so lange gefangen war?
Diese Frage setze ich auf meine schier unendliche Liste an Punkten, die es zu klären gilt.