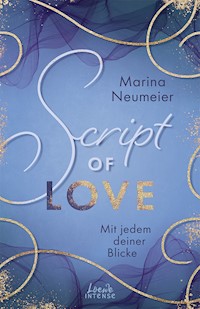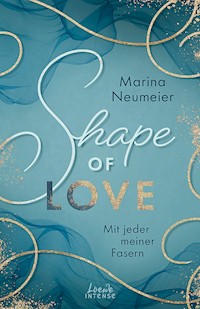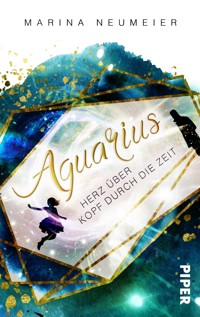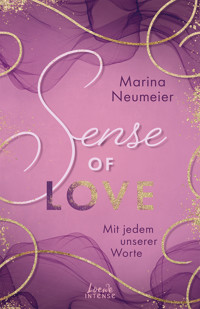
11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Loewe Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Love-Trilogie
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Ihre Vergangenheit ist voller Schatten. Doch gemeinsam können sie strahlen Model Livia Russo genießt ihr Jet-Set-Leben und würde am liebsten nie mehr in ihre Heimatstadt zurückkehren. Doch nach dem Tod ihres Vaters muss sie sich den Schatten ihrer Vergangenheit stellen. Einziger Lichtblick ist die Stimme von Gondoliere Luca, der insgeheim von einer Karriere als Opernsänger träumt. Kurzerhand stellt Livia ein Video von ihm online, das über Nacht viral geht und vor allem bei Lucas Vater auf Widerstand stößt. Ausgerechnet Livia bietet ihre Hilfe an und merkt nicht, was für Gefühle sie dadurch in ihnen beiden weckt. Bis ihr Erbe plötzlich bedroht wird und sie sich entscheiden muss: Kämpft sie für eine Sache, die sie nie wollte? Oder zieht sie weiter und lässt Venedig und somit auch Luca endgültig hinter sich. Erlebe, wie Venedig aus Freundschaft Liebe werden lässt! Marina Neumeiers abschließender Band ihrer New Adult-Reihe ist voller Mut und Hoffnung. "Sense of Love" ist nicht nur eine Liebeserklärung an die Musik, sondern vielmehr eine Erinnerung daran, dass Glück oft in unerwarteten Momenten zu finden ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 593
Ähnliche
Inhalt
Playlist
1LIVIA»Gib’s mir, Livia. …
2LUCA»Können Sie auch …
3LIVIAEs ist einfach, …
4LIVIANachdem diese Shitshow …
5LUCA»Ich kann einfach …
6LIVIAMein Marzipan-Kater verfolgt …
7LUCAOrnella Russos rechte …
8LIVIAJesus, Maria und …
9LUCAMein Handy verwandelt …
10LIVIAEine knappe Woche …
11LUCANach dem Boxtraining …
12LUCAAlles in mir …
13LIVIADas ist nicht …
14LUCAZu beobachten, wie …
15LIVIAAls ich es …
16LIVIAAm nächsten Tag …
17LUCALivias Blick bohrt …
18LIVIA»Ich fass es …
19LUCAIm Haus der …
20LIVIALuca [09:50]: …
21LIVIALuca und Valentina …
22LUCAIrgendwas verändert sich …
23LIVIA»Was willst du, …
24LIVIALivia [08:20]: …
25LUCAEs hat keinen …
26LIVIAFreunde sind ätzend. …
27LUCA»Sing es mir …
28LUCAOrlando, der offenbar …
29LIVIAIch verbringe den …
30LUCA»Das lief doch …
31LIVIADer Wein hat …
32LUCALivia ist fort …
EpilogLIVIAFünf Jahre später
Liebe Leser*innen,
dieses Buch enthält potenziell triggernde Inhalte.
Deshalb findet ihr auf der letzten Seite eine Triggerwarnung.
Achtung: Diese enthält Spoiler für die gesamte Geschichte!
Wir wünschen euch das bestmögliche Lesevergnügen.
Für Oma.
Livias Schmerz wurde zu meinem, als du gegangen bist, während ich dieses Buch geschrieben habe.
Ein Teil von dir steckt in dieser Reihe – in Nonna Margherita mit ihrem Sinn für die Familie, in Cleo und ihrer Leidenschaft fürs Nähen, in Luca und seiner Liebe für die Musik. Und sogar in Donatello, weil du Hunde immer lieber mochtest als Katzen.
PLAYLIST
Coldplay – Fix You
Dove Cameron – Breakfast
Fergie – Labels Or Love
Giuseppe Verdi, Andrea Bocelli, Israel Philharmonic Orchestra, Zubin Mehta – Rigoletto. La donna è mobile
Joe Juliano – Mary On A Cross
Måneskin – SUPERMODEL
Måneskin – ZITTI E BUONI
Paolo Conte – Via con me
Provinz – Zorn & Liebe (feat. Nina Chuba)
Rezz, Dove Cameron – Taste of You
Taylor Swift – Anti-Hero
Taylor Swift – Don’t Blame Me
Taylor Swift – Midnight Rain
Taylor Swift – Hits Different
Nessa Barrett – dying on the inside
Tessa Violet – YES MOM
Vance Joy – Mess Is Mine
1
LIVIA
»Gib’s mir, Livia. Mehr, mehr. Ja, genau! Bleib so, bleib so … verdammt, ja!«
Die Kamera klickt, unaufhörlich, wie in Schallgeschwindigkeit. Ich folge den Anweisungen des Fotografen, verbiege und recke meinen Körper, kontrolliere meinen Gesichtsausdruck und versuche gleichzeitig, dieses Ungetüm von Tüllkleid, das sich um mich herum aufbläht, in den Griff zu bekommen. Eisiger Wind pfeift über das Flachdach einer stillgelegten Fabrik in Berlin und mit jeder neuen Böe überkommt mich die irrationale Furcht, ich könnte davongeweht werden wie eine fluffige, pinke Pusteblume. Direkt hinter mir erhebt sich der Fernsehturm zwischen tristen Plattenbauten vor einem grauen Himmel – ein Blick auf dieses Panorama hat genügt, um meine ohnehin miese Stimmung in den Keller rauschen zu lassen. Ich hasse es hier oben.
Wäre es zu viel verlangt, Outdoor-Shootings per Verordnung nur an schönen, warmen Orten stattfinden zu lassen? Kulissen, die wirklich dafür gemacht sind, um in Kleidern herumzuturnen, die so wenig Wärme spenden wie Spitzendessous. Ernsthaft, dafür, dass diese Robe gefühlt aus einer Kubiktonne Tüll gefertigt wurde, schützt sie mich kein bisschen gegen die Kälte, sodass ich bis auf die Knochen durchgefroren bin. Der eisige Wind hier oben lässt meine Augen ununterbrochen tränen und meine Füße sind ganz taub. Was der einzige Vorteil der aktuellen Situation ist, da ich dadurch die unbequemsten Heels der Welt nicht mehr spüre. Womöglich habe ich heute schon kurz die Fassung verloren, als herauskam, dass die zuständige Stylistin in einer Demonstration absoluter Unfähigkeit meine Schuhe für das heutige Shooting eine Nummer zu klein geordert hat. Seitdem steht die Frau mit verkniffenem Gesichtsausdruck am Rand, drauf und dran, jeden Moment loszuheulen. So was von unprofessionell. Ich für meinen Teil reiße mir den Arsch auf, um perfekte Arbeit abzuliefern, da kann ich im Umkehrschluss doch wohl erwarten, dass alle anderen das ebenfalls tun, certo? Wir arbeiten zum ersten (und so wie das hier läuft, vermutlich auch letzten) Mal zusammen und es erfüllt mich mit grimmigem Stolz, meinem Ruf umgehend alle Ehre gemacht zu haben. Livia Russo: Topmodel. Kühl, unerbittlich und unvergleichlich vor der Kamera. Null Toleranz für Bullshit.
Am Set markiere ich sofort mein Revier und zeige keine Schwäche – ansonsten tanzt einem diese Branche auf der Nase herum. Mittlerweile bin ich allerdings erfahren genug, um mich dagegen zur Wehr zu setzen. Ich habe schon so viele angehende Models unter die Räder geraten sehen, konnte genau beobachten, wie sie nach und nach zerquetscht wurden, und habe daraus meine persönliche Überlebensstrategie gezogen: Sei ein eiskaltes Miststück, damit ja niemand auf die Idee kommt, dich fertigmachen zu können. Ich will nicht sagen, dass ich Angst verbreiten möchte … lediglich von Anfang an klarstellen, dass man sich sämtliche Psychotricks bei mir sparen kann. Was auch immer mir an den Kopf geworfen wird, ich lasse es abprallen, an einer eisigen Fassade, an der ich schon mein halbes Leben lang feile. Inzwischen ist die Frostschicht in meinem Inneren so dick, dass sie jedem Angriff mühelos standhalten kann.
Pommeroy, der Fotograf, der mit mir das heutige Editorial für ein namhaftes Modemagazin shootet, hüpft indes ununterbrochen wie ein Eichhörnchen auf Speed mit seiner Kamera um mich herum. Dabei wird er umschwirrt von Assistenten, die keuchend versuchen, mit seinem Tempo mitzuhalten. Er ist einer dieser Typen, die darauf bestehen, ausschließlich mit ihrem Nachnamen angesprochen zu werden, und sich dabei superedgy fühlen (eigentlich heißt er Malcolm, was zugegebenermaßen wirklich der ultimative Abturner-Name ist). Außerdem geben mir seine Anweisungen irgendwie immer das Gefühl, er würde über Sex reden.
Gib’s mir. Genauso. Ja, ja, ja!
Aber auch das gehört zur Branche – mein Job ist es, sexualisiert zu werden (zumindest, wenn ich nicht gerade für ein superkünstlerisches Projekt gebucht werde, um in Luftpolsterfolie gewickelt zu werden wie eine lebende Sushi-Rolle, nur um dann an Seilen von der Decke hängen zu müssen. Hatte ich schon, kein Witz. Wenigstens habe ich bei diesem Job mal nicht gefroren). Ansonsten gilt noch immer Sex sells, auch abseits der Kameras. Ich glaube, ich war fünfzehn und hatte mich gerade gegen meine Mutter durchgesetzt, Vollzeit mit dem Modeln beginnen zu können, als ich das erste Mal sexuell belästigt wurde. Er war ein Booker, vermittelte also zwischen mir und möglichen Auftraggebern. Damit bestimmte er indirekt, für welche Jobs ich als Model gebucht werden würde. Jedenfalls hielt er es für nötig, mir zu erzählen, wie ästhetisch meine vergleichsweise üppige Oberweite im Kontrast zu meinem sonst so überaus schlanken Körper aussehe. Ästhetisch bedeutete in diesem Fall nichts anderes als »Freifahrtschein, um eine Minderjährige zu begrapschen« – was ich am liebsten mit einem beherzten Tritt zwischen seine Beine quittiert hätte. Aber mir war schon damals klar, dass es so nicht läuft. Abschaum wie er hat die Macht, über die Karrieren von Models zu bestimmen, und das wissen sie auch ganz genau. Wir sind abhängig von ihrem Wohlwollen und kaum jemand wagt es, es sich mit einflussreichen Leuten zu verscherzen. Eine Zeit lang hatte ich die naive Hoffnung, dass alles anders werden würde, sobald ich mir erst einen Namen gemacht hätte. Aber wenn überhaupt, sind sie ab da nur diskreter, jedoch nicht weniger widerwärtig geworden. Ein Grund mehr, mich abzuschotten, um es nicht zu nah an mich heranzulassen, und mir einen Ruf als eiskaltes Miststück zuzulegen.
Wenn ich nichts fühle, kann mich nichts verletzen.
Es sind bloß Hände auf meinem Hintern, die sich lachend wegschieben lassen. Schlüpfrige Worte, die ich ignorieren kann. Angebote, die ich gelegentlich sogar freiwillig annehme, weil ich genau weiß, was dabei für mich rausspringt. Solange ich es ihnen nicht erlaube, bis zu meiner Seele vorzudringen, kann ich das alles als unvermeidliches Übel eines Jobs ansehen, der mir das gibt, wonach ich am allermeisten hungere: Freiheit. Unabhängigkeit. Flucht.
Das Shooting dauert an, bis die Sonne untergeht und es zu dunkel wird, um ohne künstliche Lichtquellen weiterzumachen (die es hier oben auf dem Dach nicht gibt, halleluja!). Auf dem Weg zurück in die Maske ziehe ich mir schnell einen warmen Bademantel an, um hoffentlich bald wieder Gefühl in meine steifen Gliedmaßen zu bekommen.
»Miss Russo?«
Ich blicke von meinem Platz am Schminkspiegel auf. Hinter mir steht eine junge Setassistentin – vielleicht eine Praktikantin –, die mir bereits während des Shoots aufgefallen ist, weil sie mit nervöser Miene ständig um mich rumgeschlichen ist. Als ich mich bewege, um sie ansehen zu können, sticht mir der Make-up-Artist, der gerade den Kranz künstlicher Wimpern in Feder-Optik von meinem Lid entfernt, beinahe ins Auge.
»Verzeihung«, murmelt er, als ich gereizt mit der Zunge schnalze. Dann wende ich mich wieder der jungen Frau zu, die mich sichtlich angespannt mustert.
»Ähm, Entschuldigung … aber zu meinen Aufgaben heute gehört es, Ihre persönlichen Besitztümer im Auge zu behalten, und mir ist aufgefallen … Entschuldigung, aber Ihr Handy klingelt seit über einer Stunde quasi ununterbrochen. Tut mir leid.«
Ich schiebe die Unterlippe vor, insgeheim amüsiert darüber, wie oft es ihr gelungen ist, sich in einem einzigen Satz zu entschuldigen.
»Wurde ein Name angezeigt oder war es eine fremde Nummer?«, frage ich, während ich meine Hände ausstrecke, damit als Nächstes die künstlichen, angeklebten Nägel entfernt werden können. Nur über meine Leiche laufe ich in meiner Freizeit mit denen rum.
Die Assistentin schluckt nervös und vermeidet meinen Blick.
Genervt verdrehe ich die Augen. »Sag schon.«
»Hmm … also, es war immer wieder jemand, den Sie als Speichelleckender Sklave eingespeichert haben.«
Dem Stylisten entweicht ein Prusten, während meine Laune endgültig den Nullpunkt erreicht. Hinter dem schmeichelhaften Pseudonym verbirgt sich Sergio, die rechte Hand im Modelabel meiner Mutter Ornella. Ich nenne ihn so, seit ich zufälligerweise rausgefunden habe, dass sein Vorname ausgerechnet Diener beziehungsweise Sklave bedeutet. Keine Ahnung, ob meine Mutter ihn bewusst deswegen eingestellt hat, aber Fakt ist: Er ist die Verkörperung dieser Bedeutung, durch und durch. Und ich verachte ihn, weil er Ornella dermaßen hörig ist.
»Danke, das ist unwichtig.« Ich hätte ihn längst blockieren sollen. Was ich sicherlich längst getan hätte, wüsste ich nicht, dass er dann umgehend bei Mamma petzen würde. Sie glaubt, eine gewisse Kontrolle über mich zu haben, wenn sie Sergio damit beauftragt, Kontakt mit mir zu halten.
Ich kann regelrecht sehen, wie die junge Frau aufatmet, ehe sie sich beeilt, von mir wegzukommen.
Zwanzig Minuten später bin ich in der Maske fertig und kann das Set endlich verlassen. Ich habe noch keine Pläne für heute Abend, kenne aber genügend Leute in Berlin, um in zehn Minuten Verabredungen für diverse Partys klarzumachen. Kurz habe ich beim Gedanken, feiern zu gehen, die Stimme des Wellness Coaches aus der Schweiz in meinem Kopf.
Halte dich von Situationen fern, die deinen Dämonen als Spielwiese dienen.
Unwillkürlich will ich die Augen verdrehen und mit einem genervten Jahaaa, schon kapiert antworten. Ich tue es nur nicht, weil ich genau weiß, wie bedenklich es ist, laut mit den eigenen inneren Stimmen zu quatschen. Keine Sorge, so weit bin ich noch nicht.
Ich war für mehrere Wochen in dieser Einrichtung, die sich bewusst nicht Klinik nennt und sämtliche Therapeuten sowie medizinisches Personal hinter schwammigen englischsprachigen Titeln wie Balance Assistant oder Mindfulness Guide versteckt. Alles nur, damit ja nicht der Eindruck erweckt werden könnte, irgendjemand der gut betuchten Gäste habe ein ernsthaftes Problem. Wie unkontrollierten Kokskonsum zum Beispiel. Was, ich? Nein, nein, ich bin nur hier, um Stress abzubauen und meine innere Mitte wiederzufinden.
Ein verlogener Haufen von vorne bis hinten, aber so was passt zu uns Russos. Ich bin die Tochter meiner Mutter, was bedeutet, dass ich mein Problem bis zum bitteren Ende verleugnet hätte, wenn meine Freundin Cleo nicht zufällig drauf gestoßen wäre und Ornella zum Handeln gezwungen hätte. Eine Weile hab ich Cleo wirklich gehasst für die Dreistigkeit, sich in mein Leben einzumischen. Aber auch wenn ich es niemals laut zugeben würde, bin ich ihr inzwischen dankbar. Und sei es nur, weil ihr Eingreifen dafür gesorgt hat, dass ich aus Venedig wegkonnte, nachdem ich mehr oder weniger gezwungen war, für eine Weile bei Mamma zu wohnen. Und das alles nur, weil die Presse ihr ein Foto zu viel zugesteckt hatte, auf dem ich über Lines gebeugt in irgendeinem Club zu sehen bin – und für das sie fürstlich bezahlen musste, um eine Veröffentlichung zu verhindern. Fotografen sind nicht dumm, oft bekommen sie deutlich höhere Summen gezahlt, wenn sie Material zurückhalten oder vernichten, statt es einfach an Magazine oder andere Medien zu verkaufen.
Die schwere Stahltür des Fabrikgebäudes fällt gerade mit einem dumpfen Knallen ins Schloss und ich trete nach draußen auf die Straße, als mein Handy erneut zu klingeln beginnt. Wenn Sergio jetzt nicht endlich Ruhe gibt! Drauf und dran, nun doch dranzugehen, um ihm den Einlauf seines Lebens zu verpassen, stutze ich, als ich sehe, welcher Name auf dem Display aufleuchtet: Ornella.
Wenn sie sich dazu herablässt, persönlich anzurufen, muss es etwas Ernstes sein. Für einen Moment halte ich das Gesicht in den einsetzenden Nieselregen, wappne mich mental für was auch immer sie mir mitzuteilen hat und gehe schließlich ran. »Was gibt’s?«
Einige Augenblicke lang herrscht vollkommene Stille in der Leitung. Irritiert, da Ornella sonst direkt Anweisungen entgegenbellt, will ich aufs Display schauen, ob etwas mit der Verbindung nicht stimmt, bis ich sie abgehackt atmen höre. Hätte ich nicht bereits geahnt, dass etwas nicht in Ordnung ist, wäre ich mir spätestens jetzt absolut sicher. Ornella Russos Atmung gerät nicht aus dem Takt, nicht mal während ihrer täglichen Laufband-Einheiten. Meine frisch gesäuberten Nägel bohren sich in meine Handfläche, während ich angespannt darauf warte, dass sie sich fängt.
Eine knappe Minute vergeht, ehe sie sich räuspert und endlich etwas sagt. Einen einzigen Satz, der die Macht hat, mir den Boden unter den Füßen wegzureißen. Ein Schmerz, heiß und stechend, durchfährt meine Brust, stark genug, um die Eisschicht, die mein Herz umgibt, zu durchdringen und ein Wimmern aus mir rauszupressen. Ich gerate ins Taumeln, pralle mit dem Rücken gegen die schmutzige, von Graffiti überzogene Hauswand hinter mir, während mich Emotionen mit sich reißen, von denen ich nicht gedacht hatte, sie überhaupt fühlen zu können. Ich hasse es. Ich hasse es, weil ich absolut nichts dagegen tun kann, dass mein Herz von diesem rasenden Aufwallen von unterschiedlichen Empfindungen mitten entzweigerissen wird. Wut und Verachtung und Trauer und Bedauern. So kalt und unberührbar der Klumpen in meiner Brust auch sein mag, in diesem Augenblick zerbirst er in hunderte Splitter, wie die Scherben von Bierflaschen auf dem Berliner Asphalt um mich herum.
Ganz langsam, wie in Zeitlupe, rutsche ich an der Mauer entlang zu Boden, das Handy wie einen Rettungsanker ans Ohr gepresst. »Wie konnte das …?« Keine Ahnung, wie ich es schaffe, Worte zu formen, aber irgendwie gelingt es mir zu sprechen.
Meine Mutter gibt ein Geräusch von sich, das ganz wie ein Schniefen klingt, woraufhin der Schmerz in meiner Brust, wenn überhaupt möglich, noch rasender wird. Sie … sie weint doch nicht etwa? Als sie schließlich spricht, klingt ihre Stimme jedoch schneidend wie immer:
»Du musst zurück nach Venedig kommen, jetzt sofort.«
2
LUCA
»Können Sie auch was von Harry Styles?«
Die gelangweilte Stimme eines etwa vierzehnjährigen Teenie-Mädchens reißt mich für einen Moment aus dem geschmeidigen Rhythmus meiner Ruderbewegungen, was dazu führt, dass meine Gondel beim Abbiegen an einem Häusereck entlangschrammt und ins Wanken gerät. Verärgert beiße ich die Zähne zusammen – wenn mir das noch häufiger passiert, muss ich sie bald in die Werkstatt bringen, um den Lack auffrischen zu lassen, und der Teufel weiß, wie viel sie dafür wieder verlangen werden. Ich stemme mich mit meinem gesamten Körpergewicht auf den linken Fuß und lasse den Ruderstab in schnellen Bewegungen durchs Wasser gleiten, um das Ruckeln des Gefährts auszugleichen.
Der Vater des Mädchens – ein glatzköpfiger Kerl mit einer Masse an Muskeln, die Dwayne The Rock Johnson neidisch gemacht hätte – klammert sich mit einem Grunzen an seinen Sitz. Er hat kommentarlos mit einem Geldbündel vor meiner Nase rumgewedelt, um eine Fahrt bei mir zu buchen, und beansprucht seitdem beinahe die gesamte Breite der Gondel für sich, was immerhin fast vier Meter an der weitesten Stelle sind. Es ist mir ehrlich ein Rätsel, wie seine Frau neben ihm Platz findet. Im Moment hält sie sich wegen der Turbulenzen, die wirklich kaum der Rede wert sind, am Bizeps ihres Ehemanns fest, der größer ist als ihr Kopf. Ich übertreibe nicht.
»Scusatemi«, entschuldige ich mich mit meinem charmantesten, reumütigsten Lächeln, doch meine derzeitigen Fahrgäste verziehen keine Miene.
»Haben Sie meine Tochter nicht gehört?«, grunzt der Mann mit schwer definierbarem Akzent. Vielleicht Holländer? Die Nationalitäten meiner Fahrgäste zu erraten, gehört zu meinen Lieblingsspielen, um nicht einzuschlafen, während ich innerhalb einer Woche das hundertste Mal Volare singe.
»Hm?« Ach verdammt, kurz hatte ich gehofft, die Frage wäre durch mein Missgeschick untergegangen.
Ich schaue wieder zu dem Mädchen, das auf einem der Extra-Schemel vor ihren Eltern sitzt und nonstop ihr Handy auf die Umgebung um sich herum richtet.
Sie erinnert mich an meine jüngere Schwester Valentina, zu der Zeit, als sie das erste Mal mit Make-up rumexperimentiert hat. Unsere Mutter ist ausgeflippt, weil Vale es sich zur Mission gemacht hatte, alle Produkte, die die kleine Drogerie an der Ecke in petto hatte, gleichzeitig auf ihrem Gesicht zu verteilen. Dass unser großer Bruder Orlando sie daraufhin einen Monat lang nur noch buffonella – einen weiblichen Clown – genannt hat, war vielleicht einer der Gründe, warum sie aufgehört hat, fünf verschiedene Lidschattenfarben auf einmal zu tragen.
Das Mädchen in meiner Gondel blinzelt mit von mehreren Schichten blauem Mascara verklebten Wimpern zu mir hoch.
»Harry Styles. Können Sie Songs von ihm? Dieser Klassik-Scheiß ist sterbenslangweilig.«
Ich verenge die Lider zu Schlitzen und starre auf diese Göre hinunter. Klassik-Scheiß ist sterbenslangweilig? Ärger regt sich in mir, wie immer, wenn jemand meint, sich über meine Art der Musik lustig machen zu müssen oder sie zu belächeln. Irgendwann habe ich aufgehört zu zählen, wie oft ich schon als Freak oder schwul beschimpft worden bin, nur weil ich Opern mag und Dutzende auswendig kann. Ernsthaft, Leute, die sexuelle Orientierungen als Beleidigungen benutzen, sind einfach nur armselig. Ich bin drauf und dran, diesem Mädchen einen Vortrag darüber zu halten, wie die Musik, auf die sie heute abfährt, durch scheißlangweilige Klassik überhaupt erst entstehen konnte. Immerhin waren Jahrtausende an Fortschritt nötig, einschließlich der letzten Jahrhunderte, um diverse Stilrichtungen und Muster hervorzubringen. Ganz abgesehen davon, wie viel ich jeden verdammten Tag damit verdiene, genau die Melodien zu singen, die seit Generationen geliebt werden, weil sie einfach schön sind. Basta.
Ich bin schon dabei, den Mund zu öffnen und mit alledem rauszuplatzen, rufe mich im letzten Moment aber zur Vernunft. Es bringt ja doch nichts. Niemand will Belehrungen von einem Gondoliere, den man dafür bezahlt, irgendwelche Ständchen zu singen.
»Harry Styles ist ziemlich schwierig a cappella zu singen«, antworte ich schließlich höflich, ehe ich den rechten Fuß gegen die nächste Hauswand stemme, um die Gondel um eine schmale Biegung zu bugsieren.
Das Mädchen zieht einen Schmollmund, woraufhin mich ihr Vater mit einem Mörderblick bedenkt, weil ich seine Prinzessin offenbar unglücklich gemacht habe. Da ich keinen Wert darauf lege, kopfüber von meinem eigenen Boot geworfen zu werden, füge ich hastig hinzu: »Aber Ed Sheeran wäre möglich.« Was Besseres fällt mir auf die Schnelle nicht ein.
»Wenn’s sein muss, duh.« Genervt verdreht sie die Augen. »Aber bloß nicht Perfect.«
Nur die Tatsache, dass sie mir schon bei Fahrtantritt ein extradickes Trinkgeld gezahlt haben, sorgt dafür, dass ich nicht ebenfalls die Augen verdrehe, bevor ich mich räuspere, um Afterglow anzustimmen. Der erste Titel von Ed, der mir in den Sinn kommt, abgesehen von Perfect. Ehe ich auch nur einen Ton von mir geben konnte, richtet das Mädchen ihr Handy auf mich. Ich halte inne.
»Keine Aufnahmen von mir, während ich singe, bitte.«
Tochter und Vater sehen mich entgeistert an. »Warum das denn nicht? Sie können uns doch so was nicht verbieten!«
Ich atme tief durch und zähle innerlich bis fünf, ehe ich sage: »Ich möchte mit meinem Gesang einfach nicht im Internet landen, das ist etwas Persönliches. Es würde mich sehr freuen, wenn Sie das respektieren könnten.«
Der Mann setzt bereits dazu an zu protestieren, als seine Frau ihm beschwichtigend eine Hand auf seine geballte Faust legt. »Wir werden das akzeptieren. Nadia, leg das Telefon weg. Es schadet dir nicht, die Welt um dich herum ein paar Minuten lang mal nicht durch einen Bildschirm wahrzunehmen.« Warnend funkelt sie ihre Tochter an, bis diese murrend das Smartphone zwischen die Oberschenkel klemmt und ihre Arme trotzig vor der Brust verschränkt.
Na, geht doch.
Ich summe, während ich mir den Song im Geiste vergegenwärtige und den richtigen Einsatzton suche. Sobald ich mir sicher bin, ihn zu haben (nichts ist peinlicher, als in der falschen Tonlage zu starten und nach einer halben Strophe beschämt noch mal von vorne anfangen zu müssen), lege ich los. Lyrics wurden schon immer wie magnetisch von meinem Gedächtnis angezogen und ich muss kaum darüber nachdenken, während ich nebenher die Gondel durch die malerischen Kanäle von Cannaregio steuere.
Mir ist klar, dass meine Bitte, beim Singen nicht gefilmt werden zu wollen, seltsam rüberkommen mag, aber ich habe bisher fast nur schlechte Erfahrungen damit gemacht. Wenn ich nur mein Standard-Repertoire, bestehend aus Volare und O sole mio, von mir gebe, kümmert es mich nicht so sehr – da gibt es Dutzende anderer Kollegen in der Stadt, die dasselbe tun. Aber wenn es um Extrawünsche und modernere Songs geht … einmal ist so eine Aufnahme von mir in diversen WhatsApp-Gruppen und über Facebook durch die halbe Stadt gegeistert und die Leute konnten gar nicht mehr aufhören, mich damit aufzuziehen – oder, noch schlimmer, mich immer wieder darauf anzusprechen, es doch als professioneller Sänger zu versuchen.
Klar, gern, wenn du in der Zwischenzeit meine Gondel fährst, um meine Familie abzusichern?
Musik war schon immer mein Traum. So oft habe ich davon geträumt, auf den Bühnen der großen Opernhäuser zu stehen und Arien zu singen, doch mein Leben hatte andere Pläne. Als mein Vater den Unfall hatte, bei dem er seinen rechten Unterschenkel verloren hat, musste ich von heute auf morgen die Gondellizenz übernehmen, um Geld zu verdienen. Es gibt kein Festgehalt – wer nicht auf dem Wasser ist, verdient auch nichts, dabei ist das Leben in Venedig auch so schon verdammt teuer. Dazu die Rechnungen für Papàs Behandlungen, die weiterhin nötig sind und nicht alle von der Krankenkasse übernommen werden … Ich hatte keine Wahl, ganz abgesehen davon, dass meine Familie zur ultrakonservativen Sorte gehört, deren ganzer Stolz auf der Tatsache fußt, dass die Lizenz bereits seit Generationen von Vater zu Sohn weitergegeben wird. Auch heute noch übernimmt der älteste Sohn den Job … In unserem Fall der Zweitgeborene, da mein älterer Bruder Orlando sich vor etwa fünf Jahren mit meinen Eltern überworfen hat. Sie haben ihn rausgeworfen, ihn regelrecht verbannt, was so weit geht, dass sein Name bei uns zu Hause nicht mehr erwähnt werden darf. Nachdem er so viele Jahre weg war und wir keinen Kontakt hatten, ist er im Sommer endlich zurückgekehrt und wir sind auf dem besten Weg, uns wieder anzunähern. Auch wenn seitens unserer Eltern nach wie vor Eiszeit herrscht. Mein Vater ist dermaßen verbohrt … Ich weiß wirklich nicht, was passieren müsste, damit die beiden sich überhaupt mal wieder gemeinsam in einem Raum aufhalten könnten, ohne einander an die Gurgel zu gehen. Mamma dagegen … sie ordnet sich ihrem Ehemann komplett unter, dabei weiß ich, wie sehr es sie schmerzt, dass sie eines ihrer Kinder aufgeben musste. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie heimlich jeden Film mit Orlando gesehen hat, der bisher erschienen ist. Außerdem ist es ihr zu verdanken, dass er das Studium unserer jüngeren Schwester finanziert. Wenn es nur Mamma betreffen würde, wäre es gar nicht erst zu einem Zerwürfnis gekommen. Jedenfalls belastet mich diese Situation ziemlich. Orlando ist und bleibt mein Bruder, egal, welche Fehler er in der Vergangenheit gemacht hat. Ich will ihn in meinem Leben haben und nicht jedes Mal mit einem cholerischen Wutanfall meines Vaters rechnen müssen, sobald ich ihn im Gespräch auch nur erwähne. Diese Gondel wird doch weiterhin von einem Grandin gefahren, alles andere kann ihm egal sein, oder?
Ich bekomme zurückhaltenden Applaus, als ich mit Afterglow fertig bin, und stelle mit einer gewissen Erleichterung fest, dass wir uns wieder dem Ausgangspunkt unserer einstündigen Tour nähern. Jeder Gondoliere in Venedig hat, genau wie Taxifahrer auf dem Festland, einen festen Punkt, an dem er tagsüber festmacht und den er eisern verteidigt. Am begehrtesten sind natürlich die Spots direkt am Markusplatz oder an der Rialtobrücke, wo einen Kundschaft wie Fruchtfliegen auf überreifem Obst umschwirrt. Ich für meinen Teil bin mit meinem Revier vollkommen zufrieden: direkt am Campo Santi Giovanni e Paolo (kurz San Zanipolo, denn wir stehen auf Abkürzungen und Wortverschmelzungen). Der für Venedig verhältnismäßig große Platz hat die Vorteile, dass es einige Cafés gibt, in denen ich mich während längerer Wartezeiten mit Getränken und Snacks versorgen kann und deren Toiletten ich benutzen darf. Außerdem kommen auch hier viele Touristen vorbei, um sich die gotische Basilika, das angeschlossene historische Hospital und das berühmte Reiterstandbild anzusehen. Trotzdem ist es nicht so überlaufen wie an anderen Hotspots. Es gibt jede Menge, worüber ich mich beschweren könnte, aber mit Zanipolo bin ich zufrieden.
Als wir nur noch ein paar hundert Meter von unserem Ziel entfernt sind, räuspere ich mich erneut. Mir steht der Sinn nach einer Zugabe, einfach so, um Nadia eine Freude zu bereiten. Aus voller Kehle beginne ich daher, Perfect von Ed Sheeran zu schmettern, und beobachte mit voller Zufriedenheit, wie sie missmutig ihr Gesicht verzieht.
Jep, die meisten Leute mögen Luca Grandin für einen netten Kerl halten. Dabei wissen sie nicht, dass auch ich eine ziemlich fiese Seite habe, die manchmal rauskommt, um zu spielen.
3
LIVIA
Es ist einfach, eine Bitch zu sein, wenn man eine einzige simple Regel befolgt: Lass nichts und niemanden an dich ran.
Das Leben ist so viel leichter, wenn man die Leute auf Abstand hält, statt sich in ihre unnötigen Probleme und emotionalen Dramen verwickeln zu lassen. Gefühle sind ätzend und laufen am Ende immer nur auf Kummer, Enttäuschungen und Bitterkeit hinaus. Und das alles macht bekanntlich Falten – noch eine Sache, auf die ich dankend verzichte.
Es zerrt an meinen Nerven, wie schwer es mir momentan fällt, mich wie sonst im Griff zu haben. Meine Finger krallen sich fester in den weichen Lederhenkel meiner schwarzen Lady-Dior-Bag, die ich zu einem schwarzen Kleid kombiniert habe.
Ich werde nicht weinen, sage ich mir in Gedanken immer wieder vor, auch nicht, insbesondere nicht anlässlich der Beerdigung meines Vaters, zu der ich gerade unterwegs bin. Trotzdem verkrampft sich mein Magen bei jedem Gedanken daran vor Unwohlsein. Ich gebe es nicht gerne zu, aber da ist diese innere Unruhe, die mich dazu bringen will, pausenlos an meinen Haaren rumzufummeln oder den Sitz des schwarzen Fascinators zu überprüfen und so sicherzugehen, dass das daran befestigte Stück Netzstoff weiterhin mein halbes Gesicht bedeckt. Ich kann zwar hindurchsehen, wohingegen meine Züge für alle anderen nur undeutlich zu erkennen sind. Am liebsten hätte ich mich von Kopf bis Fuß verhüllt oder wäre einfach zu Hause geblieben, aber das geht nicht. Auch wenn Guido derjenige war, der mich verlassen hat, als ich noch ein Kind war, gebietet es der Anstand, dass ich ihm die letzte Ehre erweise. Obwohl meine Mutter ihn genauso hasst wie ich, hat sie darauf bestanden, dass ich zur Beisetzung erscheine. Weil es sich so gehört. Ornella und ihr Zwang, den Schein zu wahren, sind genauso zum Kotzen wie diese gesellschaftlichen Erwartungen im Allgemeinen. Der Mann ist in all den Jahren zwar ein Fremder für mich geworden, aber Gott bewahre, wenn ich nicht ein paar Tränen an seinem Grab faken würde. Zum. Kotzen.
Hinzu kommt, dass ich mir selbst nicht über den Weg traue. Seit dem Anruf meiner Mutter und der Nachricht von Guidos unerwartetem Tod werde ich immer wieder von diesen unkontrollierbaren Wellen der Verzweiflung übermannt, für die ich mich jedes Mal ein klein wenig mehr hasse.
Ein geplatztes Hirnaneurysma. Tot ohne Vorwarnung, innerhalb von Sekunden. Ich sollte nicht das Geringste für diesen Mann empfinden und doch hat mich die Info so dermaßen aus der Bahn geworfen, dass ich für einen Moment tatsächlich befürchtet habe, in Tränen auszubrechen. Oder noch schlimmer: in Berlin loszuziehen und mich dem ultimativen Absturz hinzugeben – dieser Ort ist eins der gefährlichsten Pflaster für Menschen wie mich, mit all den zahlreichen Möglichkeiten, sich an jeder Ecke ohne den geringsten Aufwand einen Wochenvorrat Pillen und Pulver besorgen zu können. Spontan fielen mir fünf Leute ein, die mir mit Handkuss die beste Qualität liefern würden. Aber im Endeffekt war ich wie gelähmt vom Schock über die Todesnachricht, überwältigt von einem Wust an gegensätzlichen Emotionen, die in mir aufgestiegen sind wie betäubendes Lachgas. Es war so viel, zu viel, um auseinanderhalten zu können, was genau ich empfinde. Weder konnte noch wollte ich mich damit auseinandersetzen und habe es gerade so hinbekommen, mich irgendwie unter Kontrolle zu halten und zu verhindern, dass es mich vollkommen niederringt und zusammenbrechen lässt.
Auch wenn ich krampfhaft versuche, sämtliche Gedanken an ihn durch lodernde, wunderbar verzehrende Wut zu ersetzen, drängen sich immer wieder ungebetene Erinnerungen in meinen Kopf. Als er noch Babo war, der mich auf den Schultern trug, und wir ganze Nachmittage in seinem Theater verbracht haben. Wo er mir Geschichten erzählte, die das alte Gebäude vor meinen Augen in ein Wunderland verwandelten. Egal, wie sehr ich mich anstrenge, ich kann das wenige Gute, das ich für ihn empfinde, nicht ausblenden und das macht mich fucking unruhig.
Mehr denn je wünsche ich mir eine Line. Obwohl ich bereits monatelang clean bin, ist es ein Bedürfnis, das über das bloße Verlangen meines Körpers hinausgeht. Es ist mein Geist, der seit Ewigkeiten nach diesem Gefühl des Highs hungert, der puren Welle an Euphorie, die einige kostbare Stunden lang jeden negativen Gedanken beiseitewischen kann.
»Livia, wir sind da.«
Blinzelnd blicke ich auf, als die Stimme meiner Mutter mich zurück ins Hier und Jetzt katapultiert. Ich war so in Gedanken versunken, dass ich überhaupt nicht bemerkt habe, wie unser Boot angehalten hat, um an unserem Ziel festzumachen: der Friedhofsinsel San Michele. Ornella steht in einem zeitlos eleganten schwarzen Hosenanzug vor mir, die Haare zu einem strengen Knoten im Nacken zusammengebunden. Obwohl wir uns in der überdachten Kajüte befinden, trägt sie eine enorme Sonnenbrille aus ihrer eigenen Kollektion. Zwei vergoldete Schlangen bilden die Bügel und die kleinen Smaragdsteine, die die Augen darstellen sollen, blitzen je nach Einfall des Tageslichts. Trotz der dunklen Gläser spüre ich, wie der Blick meiner Mutter mich durchbohrt. Abschätzend, analytisch, nie zufrieden. Auffordernd nickt sie mir zu und ich stehe auf, darauf bedacht, mir nicht den Kopf an der niedrigen Decke zu stoßen.
Unser Chauffeur hilft uns an Land, worüber ich insgeheim dankbar bin – heute fühle ich mich alles andere als sicher auf meinen Heels. Für einen Moment kommt es mir vor, als würde der Steg unter meinen Füßen wanken, habe mich zwei staksende Schritte später jedoch im Griff. Ich muss. Haltung wahren, Emotionen zurückdrängen, um jeden Preis.
Ich drücke die Schultern durch und hebe das Kinn, während ich meiner Mutter vom Anleger aus zum Eingang des Friedhofs folge. Er nimmt die gesamte Fläche der kleinen, rechteckigen Insel ein und ist von einer hohen Backsteinmauer umgeben. Dahinter verbergen sich das alte Kloster, zwei Kirchen und natürlich die überfüllten Gräberfelder. San Michele ist für mich der Inbegriff dessen, was in Venedig falsch läuft: Die Stadt ist so heillos überfüllt und unpraktisch, dass nicht mal ihre Toten genug Platz finden. Nur wer es sich leisten kann, erhält eine dauerhafte Bestattung auf der Insel, alle anderen werden nach einer Ruhezeit von etwa zehn Jahren aus Platzgründen exhumiert und in ein Beinhaus auf dem Festland verfrachtet. Und die Leute halten mich für gottlos.
Der Trauergottesdienst bringt mich an meine Grenzen. Lediglich meine Mutter und ich sitzen in der ersten Reihe, allein auf einer langen Bank, die für eine große Verwandtschaft vorgesehen ist. Tja, technisch gesehen bin von der Dolfin-Seite nur noch ich übrig. Zumindest, wenn man einige Cousins ausklammert, die um so viele Ecken mit mir verwandt sind, dass ich sie vermutlich ohne Probleme heiraten könnte (nicht, dass ich das wollen würde. Alles, was auch nur ansatzweise mit dem Namen Dolfin in Verbindung steht, würde ich nicht einmal mit der Kneifzange anfassen). Auf einer Bank direkt gegenüber sitzt er, doch ich ignoriere seine Anwesenheit genauso gründlich, wie ich es mit den ersten Cellulitedellen handhabe, die sich an der Rückseite meiner Oberschenkel abzuzeichnen beginnen. Er ist eher die Personifikation von eingewachsenen Härchen, erweiterten Poren und Hämorriden. Alles zusammen.
Ich merke genau, dass er während des Gedenkgottesdienstes immer wieder in meine Richtung schaut, genauso, wie ich die Aufmerksamkeit sämtlicher Anwesenden permanent auf mir spüre. Guido Dolfin hat das Zeitliche gesegnet. Da will man sich natürlich nicht entgehen lassen, wie seine entfremdete Tochter reagiert. Als er schließlich nach vorne tritt, um eine ach so rührselige Trauerrede auf Guido zu halten, senke ich hastig den Blick, weil ich es nicht ertrage, ihn anzusehen, und spiele stattdessen mit dem schmalen Lederband der Cartier-Uhr, die ich von Ornella zum achtzehnten Geburtstag geschenkt bekommen habe. Darum bemüht, alles um mich herum auszublenden, richte ich meine ganze Aufmerksamkeit auf den Sekundenzeiger, beobachte, wie er seine Kreise zieht, und zähle jeden verstreichenden Moment in der Hoffnung, dass es schnell vorbeigeht. Am liebsten hätte ich mir auch noch demonstrativ die Ohren zugehalten wie ein trotziges Kind. Ich kann mir einfach nicht anhören, wie ein Loblied auf ausgerechnet den Mann gesungen wird, der mich im Stich gelassen hat. Der seine Energie lieber in wohltätige Zwecke und die Rettung Venedigs gesteckt hat, als sich darum zu scheren, dass seine eigene Tochter mit jedem Tag seiner Abwesenheit ein wenig mehr zerbröckelt ist. Es ist eine verdammt bittere Pille, mir einzugestehen, dass dieser Abschied immer noch wehtut – und das, obwohl er bereits vor vielen Jahren für mich gestorben ist. Manche Arten von Schmerz kann man einfach nicht von sich schieben oder mit der Person zusammen, die sie ausgelöst hat, begraben. Sie verlangen, gespürt zu werden, egal, wie entschlossen man gegen sie ankämpft. Egal, wie sehr ich jede Sekunde davon hasse, weil ich nichts mehr für ihn empfinden will. Er ist tot. Und dennoch habe ich den Verdacht, dass Guido es auch noch vom Jenseits aus schaffen wird, mich in die Knie zu zwingen. Er ist der einzige Mann, der das je konnte, und er wird der einzige bleiben. Guido war mein Vater, da hatte ich keine große Wahl. Aber ich werde niemals wieder einer anderen Person so viel Einfluss auf mein Inneres erlauben. Niemals.
Etwa eine Stunde später stehe ich umzingelt von etwas mehr als hundert Trauergästen am ehrwürdigen Familiengrab, in dem bereits Generationen von Dolfins die letzte Ruhe gefunden haben. Wie benommen starre ich das Blumenmeer an, das jeden freien Winkel des kleinen Mausoleums bedeckt. Ich nehme wahr, dass der süße Geruch von Lilien und Rosen sich mit dem Weihrauch zu einer erstickenden Duftwolke vermischt und mir mit jedem Atemzug mehr Übelkeit bereitet. Die letzten Takte von Via con me von Paolo Conte erklingen, während Guidos Urne in der dafür vorgesehenen Wandnische platziert wird. Wie überaus passend, dass ausgerechnet das sein Lieblingslied war: Es handelt davon, fortzugehen und alles zurückzulassen, um sich auf eine neue Liebe und das verlockende Leben in der Fremde einzulassen. Guidos Hymne.
It’s wonderful, ja, wirklich. Für dich vielleicht, Babo.
Pflichtschuldig lege ich eine weiße Rose, die mir irgendjemand beim Verlassen der Kirche in die Hand gedrückt hat, in die Grabnische, dann wende ich mich mit angespannten Schultern ab und gebe meiner Mutter mit einem Kopfnicken zu verstehen, dass ich gehen will. Doch statt mir zu folgen, verharrt Ornella weiter wie eine unnahbare Statue in erster Reihe und beobachtet hinter ihrer Sonnenbrille den Strom an Gästen, die an der Wandnische ein letztes Lebewohl wünschen. Meine Eltern sind zwar seit Ewigkeiten geschieden, doch ich habe das Gefühl, dass sie an diesem Tag das letzte Mal ihre Position als seine Ehefrau demonstrieren möchte. Im Gegensatz zu mir hätte es ihr niemand vorgeworfen, wenn sie nicht gekommen wäre. Aber sie tut es dennoch, um ein Zeichen zu setzen: dass ihre sowie meine Verbindung zu Guido den Tod überdauert und wir weiterhin ein Anrecht auf eine Stellung an der Spitze der Gesellschaft haben, die sein Name mit sich gebracht hat. Ich kenne jeden ihrer Psychotricks und weiß genau, was sie den Leuten damit ins Hirn pflanzen will. Sie wäre nicht dort, wo sie heute ist, wenn sie keine Meisterin in der Kunst der Manipulation wäre.
Die Blicke der Trauergäste folgen mir in einer Mischung aus Mitleid und unverhohlener Neugier, als ich aus dem Mausoleum trete und mich in den Schatten einer üppig grünen Zypresse verziehe. Meine Nerven liegen blank und mein Magen rebelliert, je länger diese Farce hier andauert.
Ornella kann von gesellschaftlichen Erwartungen reden, so viel sie will, meine Anwesenheit auf dieser Beerdigung lässt sich auf einen einzigen Grund runterbrechen: alle daran zu erinnern, dass ich die letzte verbleibende Dolfin und höchstwahrscheinliche Erbin bin. Nichts anderes will Mutter mit diesem Schaulaufen bezwecken.
Ich gehe bewusst rational an die Sache ran, denn a) bedeutet mir der Nachlass rein gar nichts – von mir aus könnte alles an den Staat gehen – und b) gibt es immer noch ihn.
Mamma mag davon überzeugt sein, dass ich erbe, aber ich bin mir da nicht so sicher. Wieso sollte mich ein Mann, der mich vor über zwölf Jahren aus seinem Leben gestrichen hat, nach seinem Tod mit irgendwas bedenken? Wahrscheinlich tanzen wir bald alle bei seinem Notar an, nur um zu erfahren, dass ich seine Sammlung alter Tennissocken bekommen soll.
»Livia.«
Ich schaue auf und erstarre schon im nächsten Moment zur Salzsäule.
Da steht er. Der Mann, dessen Namen ich heute nicht mal denken will, weil er mich so wütend macht, dass ich sonst drohe vor versammelter Mannschaft die Fassung zu verlieren. Derjenige, der der lebende, atmende Grund dafür ist, dass ich keinen Vater mehr habe. Mein ganz persönlicher Sündenbock, der eigentlich genau wissen sollte, dass das Letzte, was er tun sollte, mich anzusprechen ist.
Und trotzdem steht er jetzt vor mir, die Hände in den Taschen seines maßgeschneiderten Brioni-Anzugs vergraben und unverkennbar gezeichnet von Trauer.
Christos. Der Ehemann – huch, nun wohl eher Witwer – meines Vaters.
Ich denke, niemand kann sich den Skandal ausmalen, der aufbrandete, als bekannt wurde, dass Guido Dolfin seine Frau für einen Kerl verlassen hat. Auch heute noch wird sich hinter vorgehaltener Hand das Maul darüber zerrissen, wie schrecklich die Ehe mit Ornella gewesen sein muss, dass er sich letztendlich dem anderen Geschlecht zugewandt hat.
Nun, ich persönlich habe eine ellenlange Liste von Dingen, die ich meinem Vater vorwerfe, und ich kann ein verdammt fieses Miststück sein, aber seine Bisexualität gehört definitiv nicht dazu. Auch Christos ist mir im Grunde egal – ich weiß so gut wie nichts über ihn und so soll es auch bleiben. Er hat einfach nur das Pech, die Person zu sein, die mir vorgezogen wurde. Jemand, der in unser Leben trat und mir meinen wichtigsten Menschen weggenommen hat. Und dafür hasse ich ihn mit der Intensität einer implodierenden Supernova, die brennt und brennt und brennt.
»Livia, ich …« Nach Worten ringend streicht er sich über das wellige schwarze Haar, sein Gesicht ganz ausgemergelt vor Kummer. Nichtsdestotrotz ist unverkennbar, wie attraktiv er ist – ein griechischer Adonis, den man ohne Weiteres als Werbebotschafter für sein Heimatland auf Broschüren drucken könnte. Er hätte wunderbar Eric Bana als Hektor in Troja ersetzen können.
Stur richte ich den Blick auf einen Punkt hinter seiner Schulter, entschlossen, ihn einfach zu ignorieren, während er vor mir steht und herumstammelt.
»Ich hätte nicht erwartet, dass du heute kommst, aber ich bin froh, dass du hier bist. Guido hätte es …«
»Es hätte ihn einen Scheißdreck gejuckt«, unterbreche ich ihn entschieden. Wenn es nach mir ginge, könnte er es sich spätestens jetzt sparen, im Namen meines Vaters irgendwas zu heucheln.
Christos zuckt zusammen, als hätte ich ihm eine Ohrfeige verpasst. »Das ist nicht wahr. Er hat dich mehr geliebt als alles andere.« Er hat die Stimme gesenkt, doch die Eindringlichkeit, mit der er spricht, formt jede einzelne Silbe zu einer messerscharfen Klinge, die mich empfindlich trifft.
Wow, er ist echt gut darin, diesen Bullshit überzeugend klingen zu lassen.
Ich spüre, wie Gelächter in mir aufsteigt, höhnisch und humorlos, doch ich schlucke es entschlossen runter. Es stehen immer noch jede Menge Menschen um uns herum und ich will nicht wie der ultimative Psycho dastehen, indem ich am Grab meines Vaters lache. Ich passe mich nun ebenfalls seiner gedämpften Lautstärke an, sodass nur noch Christos mich versteht. »Dann hatte er eine wirklich seltsame Art, mir diese Liebe zu zeigen. Vergangenes Jahr hab ich ihm etwas gesagt, das ich jetzt auch gern für dich wiederhole: Leck mich.«
Den Ausdruck, den ich in seinen dunklen, rot geränderten Augen sehe, kann ich nicht deuten. Er schluckt mehrmals, ehe er antwortet. »Ich weiß, wie du zu mir stehst, Livia, und mir ist klar, dass es zu spät ist, um daran noch irgendetwas zu ändern. Glaub mir, ich hätte mir so sehr gewünscht, dass alles anders gelaufen wäre.« Angesichts des Bedauerns in seiner Stimme schürze ich nur abfällig die Lippen.
»Ich will nicht, dass du dich weiter aufregst. Dieser Tag ist anstrengend genug für uns alle, aber ich musste die Gelegenheit nutzen, um dir etwas zu geben.« Bevor ich auch nur reagieren kann, holt er ein Smartphone aus seiner Hosentasche und drückt es mir in die Hand. Das Gerät ist ausgeschaltet und ich starre es verwundert an, ehe ich den Blick wieder auf Christos richte.
»Das ist das Telefon deines Vaters, er hätte gewollt, dass du es bekommst. Schau es dir an, bevor du es im nächsten Kanal versenkst, bitte. Die PIN ist dein Geburtsdatum.«
Ohne meine Erwiderung abzuwarten, macht er auf dem Absatz kehrt und geht zurück zum Mausoleum. Seine breiten Schultern sind dabei gebeugt, als habe Guido ihn mit der Last der ganzen Welt zurückgelassen.
4
LIVIA
Nachdem diese Shitshow von Beerdigung endlich vorbei ist, kehre ich nicht mit meiner Mutter in ihr Loft über dem Atelier zurück, sondern beschließe, noch einen Spaziergang zu machen. Zum Glück vertraut mir Ornella wieder genug, um mich allein gehen zu lassen. Obwohl ich den Verdacht habe, dass sie bei meiner Rückkehr auf mich warten wird, um sicherzustellen, dass ich mir unterwegs kein Koks besorgt habe. Oder sie mir in der Nacht heimlich ein paar Haare ausreißt, um einen Drogentest durchzuführen. In der Hinsicht ist sie wirklich nachtragend.
Fürs Erste bin ich sie aber los und laufe ziellos durch Venedig. Der aufziehende Spätherbst und das bedeckte Wetter führen zum Glück dazu, dass die Straßen vergleichsweise leer sind, was mein einziger Trost ist. Denn ansonsten hasse ich jeden Meter, den ich in dieser jämmerlichen Stadt hinter mich bringe. Sie erdrückt mich mit ihrer pittoresken Schönheit, hinter der doch nur Moder und Verfall lauern. Es ist alles so … fucking malerisch, dabei ist das ein Ort, der tief im Kern kaputt ist, während er nach außen hin versucht, alles zu vertuschen. So wie ich. Vielleicht mag ich all das hier ja deshalb nicht, weil es mir den Spiegel vorhält. Mich gnadenlos daran erinnert, dass auch ich nur schöner Schein bin, während mein Inneres die Leute schreiend fliehen lassen würde. Guido scheint genau das bereits vor Jahren erkannt zu haben. Wieso sonst hätte er sich von mir abwenden sollen …? Beim Gedanken an meinen Vater durchzuckt mich wieder ein scharfer Schmerz, der mit jeder Minute zu wachsen scheint. Es ist … wie ein Fieber, das rasend schnell um sich greift und droht mich bei lebendigem Leibe zu verbrennen. Damit ich wie in Berlin, in diesem einen Moment der Schwäche, weinend in mich zusammensinke und mich all den Emotionen ergebe. Aber so bin ich nicht gepolt, weshalb ich beschließe, dass es jetzt genug ist. Ich bin es satt, mich wegen Guido mies zu fühlen, überhaupt etwas zu fühlen, weil er das so was von nicht verdient hat.
Indes schreit mein Körper nach einem High. Dem in Watte gepackten Hochgefühl, das mir das Kokain so oft gegeben hat. Jede Sorge war wie weggewischt, hat mich furchtlos und lebendig fühlen lassen. Und obwohl ich in diesem Moment genau das will, gebe ich dem Drang nicht nach. Ich werde meinem Vater nicht die Genugtuung verschaffen, mich in einen Rückfall gedrängt zu haben. Damit würde ich lediglich eingestehen, dass sein Tod genug in mir auslöst, um mich zu schwächen. Außerdem ist die Altstadt hier nicht wirklich geeignet, um sich Stoff zu besorgen – anders als in Großstädten wie Berlin, wo ich Dutzende Kontakte habe, die mir jederzeit ein Tütchen besorgen könnten, ist es hier schwieriger. Wenn überhaupt, müsste ich rüber nach Mestre fahren und … halt, stopp, Schluss damit, Gedankenspirale.
Entschlossen beschleunige ich mein Tempo – ein jämmerlicher Versuch, vor meinen eigenen Überlegungen davonzulaufen, aber ich brauche einen Ausweg. Eine Ersatzdroge, die ich überall bekommen kann und die mich ohne schlechtes Gewissen für den Moment ablenkt.
Eine Straßenkreuzung weiter entdecke ich, wonach ich suche: eine Pasticceria, in deren Schaufenster sich Berge von Konfekt und Gebäck stapeln. Wie eine Schlafwandlerin betrete ich das kleine, überheizte Geschäft; die Duftwolke, die mir prompt entgegenschlägt, ist so zuckrig süß, dass ich die Sünde schon förmlich auf der Zunge schmecken kann. Zucker ist das einzige Gift, das ich mir gelegentlich erlaube, und heute habe ich vor, mir die volle Dosis zu gönnen. Mein Blick gleitet über die Auswahl in der Theke, bis ich an einem kleinen Berg goldener Kugeln hängen bleibe: Pan di San Marco, das traditionelle venezianische Marzipan. Jackpot.
Wenige Minuten später mache ich mich, eine Tüte voll Marsapan, wie man hier sagt, an die Brust gedrückt, auf den Weg zum nächsten Kanal, wo ich mich auf die trockene Stelle einer von Algen verklebten Treppe setze. Ungeduldig fische ich eine der klebrigen Kugeln heraus und stopfe sie mir ohne jede Zurückhaltung in den Mund. Das Aroma von Mandeln und Orangenblütenwasser explodiert auf meiner Zunge und mit einem genießerischen Aufstöhnen schließe ich die Augen.
Zucker ist die Droge der Massen, heißt es bekanntlich und für mich ist das Mandelkonfekt in diesem Moment tröstliche Umarmung und Aufputschmittel in einem. Ich habe genug darüber gelesen, wie der Verzehr von Süßkram den Dopamin- und Serotoninspiegel erhöht, und bin fein damit, mich vollkommen diesem Rausch zu ergeben. Es dauert nicht lange, ehe ich spüre, wie sich eine betäubende Wärme in meinem Brustkorb ausbreitet und meine Emotionen in den Hintergrund drängt.
Ich weiß nicht, wie lange ich auf diesen Stufen am Wasser sitzen bleibe, aber irgendwann gelingt es mir tatsächlich, all die negativen Gefühle in mir zu begraben. Sie sind nicht verschwunden, doch mit genügend Willenskraft ist es mir gelungen, sie so weit von mir zu schieben, dass ich mir einreden kann, sie würden nicht existieren. Mein Magen schmerzt zwar inzwischen von all dem Pan di San Marco, aber die klebrige Marzipanmasse wirkt wie eine Schicht Beton, die ich über den emotionalen Abgrund in meinem Inneren gegossen habe, um ihn für eine Weile zu versiegeln.
In den letzten Stunden sind unzählige weitere Nachrichten auf meinem Handy eingegangen. Am liebsten würde ich es in den nächsten Kanal werfen. Ich brauche es nicht. Genauso wenig wie die Leute, die schreiben und schreiben, um sich nach mir zu erkundigen. Mir ging’s nie besser, danke der Nachfrage.
Als der Abend hereinbricht, rappele ich mich schließlich von meinem Platz am Wasser auf, weil die Steinstufe unter meinem Po allmählich unangenehm kalt wird und ich ohne Jacke zu frieren beginne. Außerdem bin ich fucking erschöpft von diesem Tag und habe kaum noch die Energie, einen Fuß vor den anderen zu setzen, weshalb ich ein wenig torkele, als wäre ich betrunken. Das wär’s, denke ich sehnsüchtig, während ich loslaufe. Mir mal wieder so richtig die Kante geben und auf alles scheißen. Aber natürlich ist das nicht drin, zu gefährlich für einen Ex-Junkie wie mich. Meine Willenskraft reicht gerade noch aus, um dem Drang nicht nachzugeben. Ich konzentriere mich einzig auf die Aufgabe, den Weg zurück zum Palazzo meiner Mutter am Canal Grande ohne größere Zwischenfälle hinter mich zu bringen – und mit Zwischenfall meine ich, versehentlich in eine Bar zu stolpern. Wobei … gehört der Palazzo überhaupt ihr? Mein müder Geist versucht, sich daran zu erinnern, ob er ihr bei der Scheidung komplett zugesprochen wurde oder ob Guido ihn ihr einfach nur zur freien Verfügung überlassen hat, um Scherereien zu vermeiden. Gehört er jetzt vielleicht mir? Oder Christos? Ein bitteres Kichern verlässt meine Lippen, wenn ich daran denke, möglicherweise doch noch etwas zu erben. Das kostbare, schützenswerte Dolfin-Eigentum, über das die Familie seit Generationen so selbstsüchtig wacht. Inzwischen ist niemand mehr übrig, der irgendwelche Besitzansprüche anmelden würde, und ich frage mich, was ich damit anstellen könnte, um Guido einen deutlichen Mittelfinger ins Jenseits zu schicken. Einen Fetischclub in einer der herrschaftlichen Immobilien eröffnen, vielleicht. Oder eine McDonald’s-Filiale. Nur daran zu denken, bringt mich so sehr zum Lachen, dass ich auf meinen Absätzen ins Taumeln gerate. Ich überquere gerade eine kleine Brücke, und an ihrem Scheitelpunkt angekommen, lehne ich mich einen Moment gegen die Brüstung, um mich zu sammeln.
Den Blick auf das träge schwappende, meergrüne Wasser unter mir gerichtet, verharre ich eine Weile und versuche, meinen rebellischen Geist zu leeren, bis plötzlich etwas an mein Ohr dringt, das mich aufhorchen lässt. Das ist … eine Stimme.
Gesang in Venedig zu hören, ist eigentlich nichts Ungewöhnliches – genug Gondolieri verdienen sich eine goldene Nase damit, selbst zu trällern oder sich Sänger aufs Boot zu setzen. Was dazu führt, dass man ständig Fetzen von Volare oder anderen ausgelutschten italienischen Klassikern über die Wasserwege schallen hört.
Aber das hier ist anders. Er ist anders, das merke ich trotz der bleiernen Müdigkeit, die meinen Geist bis gerade eben noch so herrlich betäubt und in Watte gepackt hat. Als wären diese Töne wie eine kalte Dusche durch mein Inneres gerauscht, die mich erfrischt und klar zurücklässt. Ich verrenke mir den Kopf, um zu sehen, woher die Musik kommt, doch bisher ist noch niemand in Sicht.
Stattdessen nehme ich die Melodie und die Lyrics wahr. Ich runzele die Stirn.
Es klingt nach Oper – voll und schwingend, erfüllt von einer Melancholie, die an vergangene Zeiten und große Bühnen erinnert. Die Töne finden ihren Weg zwischen engen Kanälen und sandfarbenen Bauten hindurch bis zu mir und der Text dieses Lieds … er kommt mir so dermaßen bekannt vor. Nur … ist er sonst anders, schneller, rau gesungen, untermalt mit Gitarren und dominantem Bass. Meine Lippen bewegen sich wie von selbst und endlich wird mir klar, was ich da höre: Zitti e Buoni von Måneskin. Ich glaube, jeder in Italien und darüber hinaus kennt den Song, mit dem die Band den ESC gewonnen hat, aber so habe ich ihn noch nie gehört. Es ist wie eine Unplugged-Version, langsam und vollmundig gesungen, so voller Gefühl, dass sie eine Gänsehaut überall auf meinem Körper hinterlässt. Im ersten Moment erschreckt es mich, mit welcher Heftigkeit ich auf den Klang reagiere, wie mühelos er meine inneren Wälle überwindet und mitten in mein vernarbtes, stillgelegtes Herz trifft.
Die Gänsehaut droht mittlerweile, sich zu einem leichten Zittern zu entwickeln, als endlich, endlich der versilberte Bug einer Gondel um die Ecke biegt. Inzwischen hänge ich halb über der Brüstung, begierig darauf zu sehen, wer da singt. Wie in Zeitlupe gleitet das Gefährt übers Wasser, angetrieben von den entspannten Ruderstößen eines Mannes, der vollkommen in seine eigene, wunderschöne Interpretation des Songs versunken ist. Er ist jung und vergleichsweise schlank gebaut, was mich angesichts des bombastischen Klangs seiner Stimme ziemlich überrascht. Wahrscheinlich sind das nichts als Vorurteile (eine meiner Spezialdisziplinen), aber ich habe an jemanden gedacht, der älter und ähm … imposanter ist.
Die Lyrics sind rebellisch, eine Hommage daran, anders zu sein und sich gegen den Status quo zu behaupten – in diesem kostbaren Moment fühle ich jede einzelne Zeile. Besonders diejenigen, in denen es darum geht, dass die Leute reden, ohne eine Ahnung zu haben, was verdammt erdrückend ist.
Und obwohl ich gerade komplett gefangen bin, fast schon geblendet von der Schönheit der Abendsonne, die auf dem Wasser glitzert, während der Mann in einiger Entfernung vorbeigleitet, kann ich diesen Augenblick nicht gehen lassen. Ich brauche eine Erinnerung an den herzzerreißenden Klang, der einen Punkt in meinem Inneren berührt, von dem ich nicht wusste, dass er in mir steckt. An diese Stimme, die es irgendwie schafft, das Chaos zu kurieren, das gegen meinen Willen in mir tobt. Selbst wenn es nur für einen Moment ist. Also hole ich, ohne länger darüber nachzudenken, mein Handy raus und starte eine Videoaufnahme. Ich bin durch und durch ein Kind meiner Generation. Mag sein, dass an dem Rumgeheule der alten Leute, man solle den Augenblick genießen, statt alles nur durch das Display des eigenen Handys zu erleben, etwas dran ist. Aber ich muss das hier einfach festhalten. Schon jetzt habe ich den Verdacht, dass es eine Erinnerung werden könnte, die das Potenzial hat, in der Zukunft einen ähnlich beschissenen Tag wie den heutigen ein wenig erträglicher zu machen. Ich will diese Interpretation immer wieder aufs Neue hören können, mich von der Weichheit dieser Stimme trösten lassen und mir ins Gedächtnis rufen, dass Emotionen auch etwas Gutes an sich haben können – selbst wenn sie negativ sind. Fuck, ich habe keine Ahnung, wer dieser Kerl ist, und doch empfinde ich in diesem Moment eine Verbundenheit mit ihm, die mich tief in meinem Inneren berührt – dort, wo ich vorhin noch sorgsam die Versiegelung angebracht habe, damit dieser Teil weggeschlossen bleibt. Ich erschaudere, doch was ich spüre, ist nicht Schmerz oder Verbitterung. Jede Nuance seiner Stimme sagt mir, dass er genau weiß, was er da singt, und ich fühle mich verstanden, gesehen, obwohl uns beide rein gar nichts verbindet und wir niemals mehr sein werden als zwei Fremde, die unbemerkt aneinander vorbeigleiten. Und damn it, ich brauche einfach ein Andenken an diesen Moment.
Also filme ich ihn, inmitten dieser malerischen Kulisse, die mir plötzlich so unverschämt schön vorkommt, dass ich einen Kloß im Hals habe. Der Gesang schwillt inzwischen zu einem gewaltigen Crescendo an.
Parla, la gente purtroppo parla.
Non sa di che cosa parla.
Die Leute reden, dabei wissen sie verdammt noch mal nicht, worüber. Das trifft in so vielerlei Hinsicht auf mich zu, dass es wehtut.
Mein Herz zuckt zusammen, als die Gondel schließlich aus meinem Sichtfeld verschwindet, die Melodie wie ein Band, das hinter dem Typen herflattert. Da war für wenige Minuten diese Connection zwischen uns, an die ich mich geklammert habe, obwohl das gar nicht meine Art ist. Ich habe niemanden und ich brauche niemanden und im Grunde sollte es perfekt für mich sein, dass ich zurückbleibe, während er um die nächste Wegbiegung verschwindet. Auf Nimmerwiedersehen. Seltsamerweise bleibt allerdings ein Funke Wehmut in mir zurück und der Wunsch, ihm hinterherlaufen zu können. Aber das kann ich mir nicht erlauben. Es ist besser so.
Nachdem ich versucht habe, auch die letzten Reste des Songs mit meiner Kamera einzufangen, beende ich die Aufnahme und öffne eine App. Meine Finger beben inzwischen, weil mir so kalt ist, aber ich nehme es gar nicht richtig wahr, während eine fixe Idee in mir Gestalt annimmt. Ein Gedanke, den ich einfach nicht niederringen kann: Die Welt muss das hören.
Womöglich gibt es Leute da draußen, die sich gerade genauso beschissen fühlen wie ich und etwas brauchen, woran sie sich festhalten können. Deren Herz auch mal zum Rasen gebracht werden muss, um sie daran zu erinnern, dass es dazu überhaupt noch in der Lage ist. Und sei es durch so etwas Banales wie ein Video von einem singenden Gondoliere.
Ich poste es, ohne lange darüber nachzudenken, ohne ausgeklügelte Hashtags zu verwenden oder irgendwen zu markieren. In diesem trunkenen Augenblick komme ich mir so verdammt edelmütig vor, weil ich die Aufnahme nicht nur für mich selbst konserviere, sondern sie mit anderen teile, um diesen winzigen Funken der Freude zu verbreiten. Nehmt das, Livia, die selbstlose Samariterin, is in the house!
Während ich nach Hause laufe, spule ich immer und immer wieder zurück, um den Moment jedes Mal aufs Neue zu erleben und um nicht in einer Stille zurückzubleiben, von der mir bis gerade eben überhaupt nicht klar war, wie allumfassend sie mich ausfüllt.
5
LUCA
»Ich kann einfach immer noch nicht glauben, dass Guido Dolfin gestorben sein soll.« Margherita umrundet mit einer dampfenden XXL-Espressokanne aus Edelstahl den Esstisch in ihrer Küche und verteilt den starken dunklen Kaffee zu gleichen Teilen in unsere Tassen. Das würzige Aroma steigt mir in die Nase und allein das genügt, um meine Lebensgeister ein Stück weit zum Leben zu erwecken. Verdammt, bin ich müde.
Eigentlich deutete gestern alles auf einen ruhigen, entspannten Feierabend hin, bis plötzlich die Tür zu Margheritas Küche aufging und Cleo und Alessandro ohne Vorankündigung reinkamen. Ich bin aus allen Wolken gefallen, als sie plötzlich vor mir standen, nachdem wir uns so viele Monate kaum gesehen hatten. Während ich ziemlich blöd aus der Wäsche geschaut haben muss, haben die beiden wie Honigkuchenpferde gegrinst, Überraschung gerufen und verkündet, diesmal für längere Zeit hierbleiben zu wollen. Alessandro hat die Therapie in Como beendet und Cleo arbeitet nicht länger für Graziano, sodass die beiden nun überlegen, ihren festen Wohnsitz nach Venedig zu verlegen. Dauerhaft, für längere Zeit … für mich sind das so ziemlich die besten News, die sie hätten mitbringen können, und auch Margherita ist vor Freude in Tränen ausgebrochen. Da ich den Großteil des Jahres durch meinen Job an die Stadt gefesselt bin, ist der Gedanke, zwei meiner engsten Freunde um mich zu haben, tröstlich – wenn auch etwas egoistisch, aber es war ja ihre Entscheidung.
Ihre Rückkehr musste dann natürlich umgehend mit einigen Flaschen Wein begossen werden, die ich spätestens heute Morgen bereue. Aber zumindest sind die beiden anderen auch schon auf und ich bin nicht der Einzige, der büßen muss. Margherita dagegen hat das Gelage erstaunlich gut weggesteckt und kann wie schon in den Tagen zuvor nicht aufhören, über Guido zu sprechen. Die Beisetzung war vorgestern und allmählich hängt mir das Thema zum Halse raus, weshalb ich froh bin, dass sie in Cleo und Alessandro ein neues, interessiertes Publikum gefunden hat.
»… viel zu jung, um zu sterben. Aber ein geplatztes Hirnaneurysma, was will man da machen? So was erwischt einen ohne Vorwarnung.« Mit einem raschen Blick zu dem geschnitzten Kruzifix neben der Tür schlägt sie ein Kreuzzeichen, ehe sie zum Herd wuselt, um warme Milch zu holen.
Cleo, die mir mit verquollenen Augen gegenübersitzt, gähnt ausgiebig und schüttelt anschließend bedauernd den Kopf. »Ich kann es auch nicht fassen. Vor allem, dass Livia nichts gesagt hat, sondern ich es erst von euch erfahren habe. Guido war immerhin ihr Vater.«
Fragend schaut sie in die Runde, aber Ale sieht angesichts des Koffeinmangels zu komatös aus, um antworten zu können, und ich … im Grunde weiß ich gar nichts über Livia oder ihre Familie. Nicht mehr als das, was in der Stadt über sie geredet – oder besser gesagt gemunkelt – wird. Und was Cleo uns erzählt. Sie ist neben Sofia vielleicht die Einzige, die hinter die strahlende, aber für gewöhnlich undurchdringliche Fassade des Russo-Dolfin-Sprösslings blicken kann. Wie es den beiden gelungen ist, Livia für sich zu gewinnen, die für ihre unterkühlte, abweisende Haltung allem und jedem gegenüber bekannt ist, stellt für mich ungelogen eines der großen Rätsel der Menschheit dar.
Aber zumindest eine Sache kann ich beisteuern. »Livia hatte seit der Scheidung ihrer Eltern quasi keinen Kontakt mehr zu ihrem Vater. Wahrscheinlich hat sie deswegen nichts dazugesagt.«
Cleo kaut nachdenklich auf ihrer Unterlippe herum. »Wann war das? Die Scheidung, meine ich.«