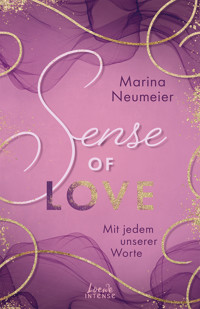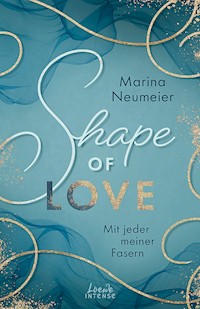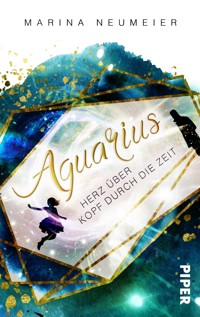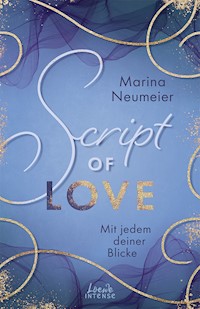
11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Loewe Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Love-Trilogie
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Eine Vergangenheit, die sie entzweit. Ein Skript, das sie vereint. Sofia Sartori ist gescheitert. Obwohl es schon immer ihr Traum war, Schauspielerin zu werden, zwingt sie ein folgenschwerer Zwischenfall in Hollywood dazu, die Traumfabrik zu verlassen. Jetzt, fünf Jahre später, hält sie sich in ihrer Heimatstadt Venedig mit einem Job in einem touristischen Theater über Wasser, fest entschlossen, nie mehr zum Kino zurückzukehren. Dieser Entschluss gerät ins Wanken, als Regisseur Roger Sheffield sie wie aus dem Nichts für die Hauptrolle in seinem neuen Projekt will. Kann Sofia vergessen, was in Los Angeles passiert ist, und sich noch einmal vor die Kamera stellen? Insbesondere dann, wenn ihr Co-Star kein anderer als ihr Ex Orlando Grandin ist? Lass dich entführen in eine Welt voller Fernweh, Hollywood-Charme und zweiter Chancen! Mit dem zweiten Band ihrer Love-Trilogie hat Marina Neumeier eine Second-Chance-Romance geschaffen, die auf einfühlsame Weise zeigt, dass MeToo und Slutshaming in allen Lebenslagen eine Rolle spielen und auf unterschiedlichste Arten Wunden hinterlassen können.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 571
Ähnliche
Inhalt
Playlist
1SOFIAWir alle tragen …
2ORLANDODer Vormittag zuvor, Samstag
3SOFIAHeterochromia iridis. …
4ORLANDODer Abend zuvor, Samstag
5SOFIANachdem ich mit …
6ORLANDOFuck, fuck, fuck, …
7SOFIA»Meinst du, Sofia …
8SOFIAAls ich nach …
9ORLANDO»Ich kann einfach …
10SOFIAAm nächsten Morgen …
11SOFIABegleitet vom leisen …
12ORLANDOSofia ist not …
13ORLANDO»Hast du schon …
14SOFIALautes Männerlachen und …
Los AngelesZwei Jahre zuvor
15SOFIAKalter Schweiß bedeckt …
16ORLANDOIch weiß nicht …
17SOFIAMein Finger schwebt …
18ORLANDOSofia ist … …
19SOFIADas Drehbuch zu …
20SOFIAHmmmm, schööön. …
21SOFIAZu behaupten ich …
22ORLANDOJeder Winkel meines …
23SOFIAWütend auf Orlando …
24SOFIAErst als wir …
25SOFIASchon am Morgen …
26ORLANDODas ist … …
27ORLANDODie restliche Woche …
28SOFIADas Drehbuch von …
29SOFIADie Wochen bis …
30SOFIADas Blut rauscht …
31SOFIAMeine Stimme ist …
EpilogSOFIAEin Jahr später, September
Liebe*r Leser*innen,
dieses Buch enthält potenziell triggernde Inhalte.
Deshalb findet ihr auf der letzten Seite eine Triggerwarnung.
Achtung: Diese enthält Spoiler für die gesamte Geschichte!
Wir wünschen euch das bestmögliche Lesevergnügen.
Die Welt ist dessen, der sie sich nimmt.
Venezianisches Sprichwort
PLAYLIST
Dove Cameron – Boyfriend
EMELINE, smle – flowers & sex
EMELINE – STRUT
Giant Rooks – All We Are
Giant Rooks – Morning Blue
Harry Styles – Cinema
Imagine Dragons – Shots
MOTHICA – buzzkill
Paloma Faith – Only Love Can Hurt Like This
Ray Goren – I Was Wrong
Rosa Linn – SNAP
The Contours – Do You Love Me
Thunder Jackson – Guilty Party
Toploader – Dancing in the Moonlight
1
SOFIA
Wir alle tragen Masken, um der Welt ein Gesicht zu zeigen, das nichts über unsere Abgründe verrät. Manche davon sitzen mit der Zeit so fest, dass man zu vergessen droht, wie es in Wahrheit dahinter aussieht. Bis man sich selbst nicht mehr wiedererkennt.
Meine aktuelle Maske besteht aus verschmiertem Mascara und den zweifelhaften Entscheidungen der letzten Nacht. Sie ist mittlerweile so sehr zu einem Teil von mir geworden, dass ich nicht einmal mehr zusammenzucke, wenn ich in den Spiegel schaue. Das ist nicht das Gesicht einer Fremden, sondern das Ich, das ich inzwischen bin.
Um bloß keine Geräusche zu verursachen, schleiche ich auf Zehenspitzen durch die dämmrige, mir völlig fremde Wohnung. Meine Sachen liegen quer über den gesamten Boden verteilt und bilden eine Spur, die von der Eingangstür ins Schlafzimmer führt. Die Unterwäsche und meinen Rock habe ich gestern Nacht offenbar achtlos direkt neben dem Bett fallen gelassen und einer meiner Schuhe ist unter das Sofa geschlittert. Meine Bluse finde ich schließlich als trauriges Knäuel in einer Ecke wieder. Als ich mich bücke, um sie aufzuheben, überkommt mich Schwindel, gefolgt von einem stechenden Schmerz direkt hinter meiner Stirn. Das Gefühl breitet sich über meine Schädeldecke aus wie tausend kleine Stiche und ich muss einen Moment innehalten, bis es einigermaßen abgeebbt ist.
So schlimm verkatert war ich echt schon lange nicht mehr.
Leise ächzend richte ich mich wieder auf und atme mehrere Male tief durch die Nase, bis mein Körper aufhört zu rebellieren und sich wieder beruhigt hat. Erst dann ziehe ich mir die zerknüllte Bluse über den Kopf. Sie verströmt den klassischen Geruch einer wilden Partynacht: Schweiß, Zigarettenrauch und Alkohol. Hmm, herzallerliebst.
Nachdem ich meine geschlossene Clutch direkt neben der Wohnungstür entdeckt habe, lasse ich einen letzten prüfenden Blick durch das winzige Apartment schweifen, um auch wirklich sicherzugehen, dass keine meiner Habseligkeiten zurückgeblieben ist.
Es ist äußerst beruhigend, das gleichmäßige Schnarchen des Kerls, den ich gestern abgeschleppt habe, aus dem offenen Durchgang zum Schlafzimmer zu hören. Er ist ein Tourist, mit dem ich gestern im Teatro Dolfin ins Gespräch gekommen und nach der Vorstellung in eine Bar weitergezogen bin. Reisende sind eigentlich immer eine relativ sichere Angelegenheit, aber man weiß ja nie, was im Licht eines neuen Tages so zum Vorschein kommt. Nächte haben diese magische Eigenschaft, Menschen von ihrer besten Seite zu zeigen, als wäre ein Filter über sie geworfen worden, der sämtliche Makel kaschiert. Doch von diesem Zauber ist nach Sonnenaufgang meist nichts mehr übrig. Und ich bin lieber schon weg, bevor ich das miterlebe.
Nichts, ich schwöre, absolut gar nichts ist so unangenehm wie der Morgen nach einem One-Night-Stand, wenn beide Akteure wach sind. Egal, worauf man sich am Abend zuvor geeinigt hat, die meisten Männer neigen dazu, beim Aufwachen die Definition eines ONS vergessen zu haben und versuchen, einen zum Bleiben zu überreden. Oder zu einer weiteren Runde, inklusive morgendlichem Mundgeruch (von dem ich mich selbst nicht ausnehme). Die bloße Vorstellung bereitet mir Übelkeit und ist der Grund dafür, dass ich es mir zur Gewohnheit gemacht habe zu verschwinden, bevor der andere aufwacht. Das ist vielleicht arschig von mir, erspart uns beiden aber unangenehme Gespräche und Peinlichkeiten.
So leise wie möglich verlasse ich schließlich die Wohnung und ziehe die Tür mit einem Klicken hinter mir zu. Ich atme auf, als mich das verschachtelte Treppenhaus samt typisch modrigem Geruch venezianischer Gemäuer erwartet. Die meisten Besucher rümpfen die Nase angesichts des charakteristischen Odeurs der Stadt, doch ich sehe es so pragmatisch wie meine Nonna: Man kann keine Stadt auf dem Wasser erbauen, ohne zu vermeiden, dass es gelegentlich nach Algen, Feuchtigkeit und Gulli riecht. Alles auf der Welt hat seine Kehrseite und zu Venedig gehören eben Mief und Überflutungen.
Draußen auf der Straße brauche ich einen Moment, um mich zu orientieren. Es ist bereits kurz vor Mittag und die Helligkeit der Sonne sticht mir schmerzhaft in den Augen, was das Pochen hinter meiner Stirn nur noch verstärkt. Als ich mich an die Lichtverhältnisse gewöhnt habe, stelle ich fest, dass ich mich mitten im Sestiere San Polo befinde, aber in meinem verkaterten Zustand fällt es mir schwer, mich zu konzentrieren. Wo muss ich lang, um am schnellsten nach Hause zu gelangen?
An unseren Weg hierher kann ich mich nur noch schemenhaft erinnern. Wie-auch-immer-er-heißt und ich sind vom Theater aus in die Bar Riva weitergezogen, eine meiner liebsten Kneipen in der Nähe des Rialto, aber als wir sie schließlich in Richtung seiner Ferienwohnung verlassen haben, habe ich überhaupt nicht mehr auf meine Umgebung geachtet. Etwas wackelig auf meinen Stilettos marschiere ich auf gut Glück los und weiß ein paar Weggabelungen später, welche Richtung ich einschlagen muss. Mein müdes Hirn nimmt endlich die Arbeit auf, indem es mich wie auf Autopilot durch die Gassen lotst.
Alles, was ich möchte, ist, in meine Wohnung im Haus meiner Großmutter zu huschen, heiß zu duschen und es mir mit einem extrastarken Kaffee auf dem Sofa bequem zu machen, um eine Wiederholung von Temptation Island zu gucken. Reality-Trash-Shows sind ein erstklassiges Mittel gegen Kater, vor allem italienische Formate, die so wunderbar theatralisch sind (ich schaue natürlich auch die internationalen Ableger online, aber an unsere Version kommt meiner Meinung nach nichts ran).
Ich bin so auf mein Ziel konzentriert, dass ich einen unverzeihlichen Fehler begehe. Als ich unser Viertel rund um die Kirche Santa Maria dei Miracoli erreiche, biege ich nicht in den schattigen Schleichweg ab, den ich normalerweise benutze, wenn ich nach Tagesanbruch nach Hause gehe. Stattdessen laufe ich unbewusst direkt an dem kleinen Platz neben der Kirche vorbei, an dem sich einige der beliebtesten Cafés des Viertels befinden.
Sobald mir auffällt, dass ich die falsche Route eingeschlagen habe, werden meine Schritte langsamer. Vorsichtig schaue ich mich um. Wenig überraschend sind die Aluminiumtische im Außenbereich an einem sonnigen Sonntagvormittag wie heute gut besucht. Überaus gut besucht. Bereits auf den ersten Blick entdecke ich mehrere Nachbarn und Bekannte meiner Großmutter, die zusammensitzen, um ihrem liebsten Hobby nachzugehen: Tratschen.
In Venedig, einer Stadt, die seit Jahren mit einem drastischen Einwohnerrückgang zu kämpfen hat (nicht zu verwechseln mit der nie endenden Flut an Besuchern, aber das ist ein anderes Thema), kennt man sich. Besonders, wenn man einer Familie angehört, die seit Generationen in der Stadt lebt und dementsprechend gut vernetzt ist. Meine Chancen, an den Cafés vorbeizuspazieren, ohne dabei von mindestens einer Person erkannt zu werden, gehen gegen null.
Dreh einfach um, sage ich mir, du bist noch weit genug entfernt.
Aber gerade, als ich mit klackenden Absätzen kehrtmachen möchte, höre ich jemanden meinen Namen rufen. Die Stimme hallt dermaßen laut über den Platz, dass sich sämtliche Cafébesucher in der Nähe suchend umschauen. Zähneknirschend halte ich inne. Keine Chance, so zu tun, als hätte ich das nicht gehört, solange ich mich nicht wie die unhöflichste Person überhaupt verhalten will. Und Höflichkeit war eine der Tugenden, die in meiner Erziehung besonders großgeschrieben wurden. Außerdem habe ich die Stimme der Rufenden sofort erkannt und weiß, dass es kein Entrinnen gibt. Sie hat mich gesehen, und wenn ich flüchte, würde sie nicht davor zurückschrecken, mich zu verfolgen. Angeschlagen von einer Nacht, die ich zum Großteil nicht mit Schlafen verbracht habe, und etwas wackelig in meinen High-Heels, traue ich mir keine Verfolgungsjagd durch die unebenen Gassen von Venedig zu. Nein, ich muss da jetzt durch und für meine Gedankenlosigkeit bezahlen.
Ich seufze stumm, pflastere mir mein überzeugendstes Bühnenlächeln aufs Gesicht und steuere direkt auf das Café zu.
Während ich näher komme, kann ich förmlich spüren, wie die Blicke der Leute jeder meiner Bewegungen folgen – ein Gefühl wie unzählige Finger, die alle gleichzeitig jeden Winkel meines Körpers abtasten und mir eine Gänsehaut bereiten. Das unangenehme Prickeln dringt durch meine Haut und sickert bis in mein Innerstes, wo es sich rasend schnell zu einem fiesen Jucken ausbreitet. Es ist die Art von Juckreiz, der auch dann nicht verschwindet oder besser wird, wenn man sich kratzt. In der Hoffnung, etwas von dem Druck loszuwerden, lasse ich unauffällig die Schultern kreisen. Doch es nützt nichts.
»Ciao, Esmeralda.« Ich bleibe vor einem der kleinen runden Tische in der ersten Reihe stehen, den sich Nonnas gute Freundin wie immer gesichert hat. Von dort aus hat sie den gesamten Platz bestens im Blick, wodurch ihr nichts entgeht – auch ich nicht. Die Frau sieht zwar ungefähr so frisch aus wie eine Dörrpflaume, doch ihre Augen sind nach wie vor erstaunlich gut. Von ihrem Sitz aus blinzelt sie durch die violett getönten Gläser ihrer Sofia-Loren-Sonnenbrille zu mir hoch und verzieht den farblich passend geschminkten Mund zu einem breiten Lächeln. Es ist ein Ausdruck äußerster Zufriedenheit darüber, mich erwischt zu haben, und ich weiß genau, dass sie plant, mich möglichst lange zappeln zu lassen.
»Sofia, dich habe ich ja schon ewig nicht mehr gesehen!«
Ja, weil ich alles Erdenkliche dafür tue, um dir aus dem Weg zu gehen.
Bevor ich antworten kann, ertönt ein Kläffen direkt neben meinen Fußknöcheln und erinnert mich an einen weiteren Grund, wieso ich normalerweise einen weiten Bogen um Esmeralda mache: ihr winziger Pinscher Cico kommt unter dem Stuhl seines Frauchens hervorgeschossen und knurrt mich mit gefletschten Zähnen an. Mit seinen kleinen Knopfaugen starrt er bösartig zu mir hoch und mich überkommt der alberne Impuls, ihm ebenfalls die Zähne zu zeigen. Dieser Hund leidet an der übelsten Ausprägung des Napoleon-Komplexes, die mir je untergekommen ist. Außerdem weiß ich gar nicht mehr, wie oft er mich schon in die Waden gekniffen hat. Esmeralda dagegen besteht darauf, dass er ein temperamentvoller kleiner Casanova ist, der nur spielen will.
Alles klar, Cico, solange du meine Beine nicht als Kauknochen benutzt.
Vorsichtshalber mache ich trotzdem einen Schritt zurück, froh darüber, dass seine Leine ihn an Ort und Stelle hält. Er quittiert es mit einem erzürnten Kläffen.
»Wir haben Margherita heute in der Messe vermisst«, fährt Esmeralda munter fort und stört sich kein bisschen daran, dass ich bisher kein Wort gesagt habe.
Mit Fingern, die über und über mit diversen funkelnden Ringen bestückt sind, streicht sie sich eine violettgräulich getönte Locke aus der Stirn und schaut zustimmungsheischend zu dem Mann, der am Tisch nebenan sitzt. Ich folge ihrem Blick und erstarre. Esmeralda und Cico haben meine Aufmerksamkeit dermaßen gefesselt, dass ich den anderen Gästen keine Beachtung geschenkt habe. Ich schaue direkt in das Gesicht von Padre Bruno, dem Pfarrer.
Das Kribbeln unter meiner Haut wird jäh intensiver und ich spüre, wie meine Wangen heiß werden. Es ist dämlich, aber jedes Mal, wenn ich ihn sehe, bekomme ich Gewissensbisse, weil ich genau weiß, dass er meinen Lebenswandel nicht gutheißt.
Während er seine leere Espressotasse mit einem leisen Klirren auf dem Unterteller abstellt, schenkt er mir ein höfliches Lächeln.
»Sofia, wie geht es dir? Ich habe dich schon lange nicht mehr im Gottesdienst gesehen.«
Unruhig verlagere ich das Gewicht von einem Fuß auf den anderen. Niemand, den ich in meinem Alter kenne, geht noch regelmäßig in die Kirche, aber natürlich wird der Padre nicht müde, uns ständig darauf anzusprechen. Und obwohl ich wirklich sehr gut ohne harte Sitzbänke und runtergeleierte Gebete leben kann, schafft er es jedes Mal zielsicher, dass ich mich schlecht fühle. Es sind diese freundlichen braunen Augen, die stets einen bekümmerten Ausdruck annehmen, sobald er darüber spricht. Als würde es ihn persönlich schmerzen, dass er nicht durch Beichtgespräche und Ave-Marias für mein Seelenheil sorgen kann.
Sorry, Vater, aber ich bin zu einer so schlimmen Sünderin geworden, dass mich beim Betreten Ihrer Kirche wahrscheinlich der Blitz treffen würde. Und wir wollen das hübsche Gebäude ja nicht beschädigen.
»Sie wissen doch, ich bin Schauspielerin und habe oft noch bis spätabends Vorstellungen.«
Noch ehe ich ausgesprochen habe, bemerke ich meinen Fehler … Dummes, verkatertes Gehirn.
Padre Brunos Miene verdüstert sich fast augenblicklich und Esmeralda schnappt hörbar nach Luft. Jetzt ist es nicht mehr nur die alte Dame vor mir, die mich von oben bis unten mustert, und ich weiß genau, welches Bild ich dem Pfarrer liefere: zerknitterte Klamotten, die unverkennbar vom Vortag stammen, verschmiertes Make-up und Haare, die einem Vogelnest gleichen. Alles an mir schreit nach einer durchzechten Nacht, die ich definitiv nicht in meinem eigenen Bett verbracht habe, und ich kann förmlich hören, welche Gedanken mein Anblick bei ihnen auslöst. Die missbilligend geschürzten Lippen und hochgezogenen Augenbrauen sprechen für sich.
Gerüchte verbreiten sich hier rasend schnell und ich weiß natürlich, dass mir mein Ruf als flatterhaftes Partygirl vorauseilt. Eigentlich ist mir das auch wirklich egal. Immerhin habe ich nie etwas dagegen unternommen, sondern eher versucht, die Meinung der Klatschtanten in meiner Umgebung zu ignorieren. Wäre da nicht meine Großmutter.
Da ich Esmeralda und Padre Bruno in die Arme gelaufen bin, nachdem ich offensichtlich von einer wilden Partynacht kam, wird Nonna bis spätestens heute Abend davon erfahren haben. Selbst wenn die beiden ausnahmsweise nichts sagen sollten – irgendjemand an den umliegenden Tischen wird es auf jeden Fall tun, in dieser Mischung aus Faszination und Missbilligung, mit der über alle gesprochen wird, deren Verhalten nicht der Norm entspricht.
Wie ein Flittchen, hallt es dumpf durch meinen Kopf, nichts mehr als ein billiges, verzweifeltes Flittchen.
Ich beiße die Zähne so fest zusammen, dass der Schwindel mit neuer Heftigkeit aufflammt, aber zumindest rückt dadurch die gehässige Stimme in meinem Inneren in den Hintergrund.
»Schauspielerin.« Der Pfarrer rollt das Wort auf der Zunge und verzieht sein Gesicht, als wäre die Bezeichnung ein direktes Synonym für Prostituierte. Was es für ihn und alle anderen, deren Moralvorstellungen irgendwo im achtzehnten Jahrhundert stecken geblieben sind, wahrscheinlich auch ist.
Inzwischen fühlt sich mein Lächeln mehr als verkrampft an und ich beschließe, dass ich nun wirklich höflich genug war.
»Nun, es war schön, Sie mal wieder getroffen zu haben.« Ich nicke dem Padre zum Abschied knapp zu. »Esmeralda, man sieht sich!« Ich habe es so eilig, den Rückzug anzutreten, dass ich beinahe über meine eigenen hohen Absätze stolpere. Zum Glück kann ich mich im letzten Moment an den zusammengefalteten Sonnenschirm neben dem Tisch klammern, ehe ich fliehe.
Über das Klackern meiner Schuhe hinweg höre ich, wie Esmeralda mir hinterherruft, ich solle meiner Großmutter Grüße ausrichten.
Beim Gedanken an Nonna sackt etwas Schweres und Drückendes in meine Magengrube. Dieses kleine Schaulaufen entlang der Cafés war ein Desaster und ich weiß nur zu gut, dass die Sorgenfalten im Gesicht meiner Nonna wieder etwas tiefer werden, sobald sie davon erfährt. Da wir im selben Haus wohnen, ist es ziemlich schwer, mein eigenes Ding zu machen, ohne dass sie etwas davon mitbekommt. Außerdem ist sie ohnehin bereits besorgt über meinen Lebenswandel (ihre Worte, nicht meine). Ich weiß, dass es ihr nicht darum geht, wann ich mit wie vielen Typen ins Bett gehe, sondern eher um meine Planlosigkeit im Allgemeinen. Seit ich vor zwei Jahren überstürzt nach Venedig zurückgekehrt bin, halte ich so gut wie möglich den Kopf über Wasser, doch meine Großmutter macht sich trotzdem Sorgen.
Meine Zukunft, wie ich sie mir früher immer ausgemalt habe, liegt nun in Scherben vor mir und ich habe bisher keinen Weg gefunden, wie ich die wieder zusammenkitten kann. Der Gedanke, dass mir das vielleicht nie gelingen könnte, ist so beängstigend, dass er mich vollkommen erstarren lässt. Es ist die Art von Mutlosigkeit, die einen überfällt, wenn man sich einem unüberschaubaren Berg aus Aufgaben gegenübersieht, ohne den Schimmer einer Ahnung, wo und wie man beginnen soll. Stattdessen verharre ich, eingeschüchtert und zu ängstlich, mich damit auseinanderzusetzen und zu enthüllen, was womöglich darunter zum Vorschein kommen könnte.
Lieber tänzele ich weiter um die Bruchstücke meiner Träume herum, als innezuhalten und feststellen zu müssen, dass ich daraus nie wieder etwas annähernd Funktionierendes und Heiles formen kann.
Unser Haus ist ein historischer Händler-Palazzo, mit abblätterndem terracottafarbenem Putz, dunkelgrünen Fensterläden und spitz zulaufenden, stuckverzierten Fenstern. Es ist das letzte Gebäude in einer Häuserreihe, die direkt an einem kleinen Kanal entlangführt. Der Gehweg am Wasser endet nur wenige Schritte hinter unserer Haustür und das ungesicherte Ende der Fondamenta ist vor allem nachts nicht ohne (was nicht nur ich selbst am eigenen Leib erfahren musste, sondern auch arglose Passanten, die regelmäßig beinahe im Nassen landen). Inzwischen hat Nonna dort einen großen Terracottatopf, in dem eine Pflanze mit buschigen Palmenblättern wächst, platziert, aber selbst das hält nicht jeden auf.
Der Palazzo ist seit Generationen in Besitz meiner Familie, auch wenn wir ihn nicht mehr alleine bewohnen. Stattdessen wurden die oberen Stockwerke in mehrere Wohneinheiten aufgeteilt, von denen manche nun vermietet werden. Wir Sartoris beklagen uns zwar sehr gerne darüber, wie aufwendig und kostspielig es ist, ein historisches Gebäude in Venedig in Schuss zu halten, aber ich weiß, dass alle, ohne zu zögern, ihren letzten Cent in dieses Haus stecken würden. Es ist Heimat. Ein sicherer Hafen. Ein Ort, der uns immer wieder willkommen heißt wie die wohlige Umarmung einer geliebten Person.
Als ich die knarzende Vordertür aufschließe, weht mir prompt eine Wolke verführerischer Essensdüfte aus Nonnas Küche im Erdgeschoss entgegen. Einen Moment verharre ich, die Hand noch am Türgriff, und atme mit geschlossenen Augen tief ein. Der Geruch nach frischem Gebäck umfängt mich, herrlich vertraut und heimelig. Das stechende Kribbeln lässt langsam nach und auch das Bedürfnis, mir meine Haut wie ein zu enges Kleidungsstück abzustreifen, rückt plötzlich in den Hintergrund. Mein Zuhause hatte schon immer diesen beruhigenden Effekt auf mich. Egal, was in der Welt da draußen passiert – sobald ich einen Fuß über diese Schwelle setze, komme ich mir vor wie in einem geborgenen Kokon.
Als Nächstes regt sich mein Magen, der sich Hoffnungen auf ein ausgiebiges Katerfrühstück macht. Ich überlege sogar kurz, direkt in die Küche zu gehen, um zu verschlingen, was auch immer da so absolut köstlich duftet, aber dafür muss ich zunächst die Spuren der letzten Nacht beseitigen. Es genügt schon, dass Nonna wieder einmal Klatsch über meinen losen Lebensstil zu hören bekommen wird, da muss sie mich nicht auch noch mit eigenen Augen in meinem zerknitterten Zustand sehen.
Ich bin schon auf dem Weg zur Treppe, als mir etwas auffällt, das mich innehalten lässt: Direkt unter den Briefkästen befindet sich fremdes Gepäck. Stirnrunzelnd bleibe ich stehen und zermartere mir mein übermüdetes Hirn, ob ich die Ankunft irgendwelcher neuer Mieter vergessen habe. Aber nein, ich wüsste es, wenn jemand bei uns einziehen würde, da ich es bin, die normalerweise im Vorfeld den meisten organisatorischen Kram für Nonna übernimmt. Dazu gehören das Einstellen der Inserate, der überwiegend schriftliche Kontakt mit den Interessenten sowie die Grundreinigung der Wohnung. Nonna besteht darauf, mich für meine Hilfe zu bezahlen, was zugegebenermaßen ein netter Zuverdienst zu meiner eher mageren Gage am Theater ist. Daher kann ich mir auch nicht erklären, was dieser unangekündigte Besuch zu bedeuten hat. Solange meine Großmutter den Eigentümer dieser Koffer nicht auf der Straße aufgelesen und ihm spontan ein Dach über dem Kopf angeboten hat, ist er oder sie kein offizieller Mieter, von dem ich etwas wissen sollte.
Ich trete einen Schritt vor und werfe einen genaueren Blick auf die vier Gepäckstücke, in der Hoffnung, irgendwelche Hinweise auf deren Besitzer zu entdecken. Bei genauerem Hinsehen erkenne ich ein kleines silbernes Markenlogo, das sich von dem schwarzen Hochglanzkunststoff abhebt. Alessandro hat mir vor einer Weile einen langatmigen Vortrag über genau diesen Reisegepäckhersteller gehalten, der quasi pleite und vollkommen out war, bis ein internationaler Luxus-Konzern ihn aufgekauft und durch ein Rebranding zu der Must-have-Reiseausstattung schlechthin gemacht hat. Inklusive einer saftigen Preissteigerung, versteht sich, sodass ich mit Sicherheit sagen kann, dass einer dieser Koffer teurer ist als alle meine persönlichen Besitztümer zusammen. Wer auch immer hier angekommen ist, sollte somit zumindest kein Schnorrer sein, der Nonnas Gutmütigkeit ausnutzen will, um kostenlos unterzukommen. Wir hatten schon die verrücktesten Vögel in diesem Haus und ich habe keine Lust, noch mal mit jemandem wie diesem Kerl aus Holland unter einem Dach zu leben – wenn einem die eigene Unterwäsche aus dem gemeinschaftlich genutzten Wäscheraum geklaut wird, fängt man an, das Nachbarschaftsverhältnis zu hinterfragen (Woher ich das weiß? Er ist aufgeflogen, weil mir irgendwann die Slips ausgegangen sind und er mich gefragt hat, ob ich mir nicht auch mal Spitzentangas zulegen könnte. Bah).
Immer noch über die Koffer gebeugt höre ich mit einem Mal Schritte auf der Treppe hinter mir.
Ich werfe einen Blick über die Schulter, in der Erwartung, Nonna aus dem Obergeschoss kommen zu sehen, oder vielleicht Luca, aber …
Mein Gehirn stellt die Arbeit ein. Für einen langen, langen Moment herrscht nichts als gähnende Leere in meinem Kopf, während ich dem Mann entgegenblicke, der mit federnden Schritten die Stufen runterkommt. Er schaut hoch und wird langsamer, sobald er mich entdeckt, wobei sein Fuß kurz in der Luft verharrt und er beinahe stolpert. Im letzten Moment kann er sich dann aber doch noch fangen und bleibt stocksteif stehen.
Ich kann ihn indes nur anstarren, erfüllt von diesem Vakuum, das mich für einen kurzen Augenblick davon abhält, etwas zu fühlen. Etwas zu denken.
Das muss der Restalkohol sein, geht es mir nach einigen langen Sekunden schließlich durch den Kopf, das hier ist eine Halluzination.
Denn unter keinen Umständen, so was von überhaupt keinen, ist es möglich, dass Orlando Grandin auf unserer Treppe steht. Mein Ex, auf allen möglichen Ebenen:
Ex-bester-Freund.
Ex-erste-große-Liebe.
Ex-verdammt-wichtigster-Mensch-auf-der-Welt-der-beschlossen-hat-mich-hängen-zu-lassen.
Darum bemüht, alle plötzlich umherwirbelnden Erinnerungen zu verdrängen, schließe ich kurz die Augen und schüttele mehrere Male heftig den Kopf. Ich klammere mich an die Hoffnung, dass er lediglich eine böse Wahnvorstellung ist, die einfach verschwindet, wenn ich nur lang genug an diesem nutzlosen Organ hinter meiner Stirn rüttele. Wie technische Geräte, die sich nach einem beherzten Klaps gegen das Gehäuse auch wieder fangen. Doch das alles hilft mir nicht weiter, denn als ich die Lider wieder öffne und meinen Blick hebe, ist da immer noch sein Gesicht. Und in diesem Moment, als ich bewusst aufschaue und auf ein Augenpaar treffe, das ich unter Tausenden wiedererkannt hätte, ist es fast so, als hätte jemand einen Schalter in mir umgelegt. Die Taubheit verschwindet und weicht einem Gefühl, das mich fast zu überwältigen droht. Es kommt mir vor, als würde ein Damm in mir brechen und eine Flutwelle an lodernden, hochgradig ätzenden Emotionen meine Brust fluten, die alles auf ihrem Weg niederbrennen. Schmerz und Angst und Verrat und Enttäuschung. Seine Präsenz prallt mit ungebremster Kraft auf mich ein und bringt mich ins Wanken. Ich schaffe es kaum, seinem Blick standzuhalten, und kann doch nicht wegsehen. Diese verdammten bunten Augen.
Blau und Grün und Braun.
Sie zerren Erinnerungen an die Oberfläche, gegen die ich nicht gewappnet bin und die einen Schmerz heraufbeschwören, unter dem ich mich zusammenkrümmen will. Für einen grauenvollen Moment kann ich nichts dagegen tun, dass mein Innerstes entblößt wird, indem es sich auf meinem Gesicht widerspiegelt. Als ich bemerke, wie viel ich preisgebe, rufe ich mich sofort zur Ordnung und versuche, mich zu sammeln. Reiß dich gefälligst zusammen. Endlich kehrt meine schützende Maske, die für einen Augenblick verrutscht ist, zurück an ihren Platz und ein Inferno der ganz anderen Art züngelt in mir hoch. Hatte ich eben noch das Gefühl, innerlich zu verbrennen, fühle ich mich jetzt eher, als würde die Hitze ein Teil von mir werden und mir Kraft spenden. Wenn ich will, kann ich wie ein Phönix sein, der in Flammen aufgeht, um mit neuer Stärke aus seiner Asche wiedergeboren zu werden. Meine Schultern gestrafft, hebe ich das Kinn an und recke ihm im Geiste beide Mittelfinger entgegen, als ich sage: »Es war ein Fehler, hier aufzutauchen, Orlando.«
2
ORLANDO
DER VORMITTAG ZUVOR, SAMSTAG
»A ride in the Gondola for you, signore? Only 150Euro!«
Erschrocken zucke ich zusammen, als mich plötzlich eine Stimme mit schwerem italienischem Dialekt aus meinen Gedanken reißt.
Ich war zu sehr damit beschäftigt, meine Umgebung in mich aufzusaugen, sodass ich, ohne es zu merken, stehen geblieben sein muss. Was offenbar einen geschäftstüchtigen Gondoliere auf den Plan gerufen hat, der in mir einen möglichen Kunden sieht – Gondelfahrer in Venedig haben einen untrüglichen Sinn dafür, Passanten, die zögern oder verharren, direkt mit einem Angebot locken zu wollen. Wie Raubkatzen, die das schwächste Tier in einer Herde ausmachen und sich anpirschen. Observation, Abwägung, Angriff.
Das Stichwort Gondola reicht aus, um meinen Körper mit einer Welle Adrenalin zu fluten und meinen Herzschlag zum Rasen zu bringen.
Er ist es nicht, versuche ich mich sofort zu beruhigen. Seine Stimme würde ich immer wiedererkennen, egal, wie viel Zeit vergangen ist. Trotzdem fühle ich mich in dieser Situation gerade mehr als unwohl. Auch wenn dieser Mann ein Fremder für mich ist, ruft sein Anblick jede Menge unangenehmer Erinnerungen in mir wach und macht mir deutlich, dass es hier in Venedig ziemlich schwer werden könnte, sie noch länger zu verdrängen.
Ich spüre nach wie vor den erwartungsvollen Blick des Fahrers auf mir und weiche instinktiv zurück, wobei ich gleichzeitig mein Cap tiefer in die Stirn ziehe. Nur weil ich ihn nicht kenne, heißt das nicht, dass es umgekehrt genauso sein muss. Es würde mich nicht wundern, wenn mein Vater während meiner Abwesenheit Plakate mit meinem Gesicht an alle Kollegen in Venedig verteilt hätte, auf denen mit krakeliger Aufschrift steht: Unwanted Nr.1. Bei Sichtung zu verjagen – tot oder lebendig.
Reg dich mal ab, versuche ich, mich selbst zur Ordnung zu rufen.
Der erste Schock weicht jetzt nervöser Anspannung, die meinen ganzen Körper in Alarmbereitschaft versetzt, bereit, jeden Moment die Flucht zu ergreifen.
Gleichzeitig versuche ich, den Mann durch die dunklen Gläser meiner Sonnenbrille so unauffällig wie möglich zu mustern.
Es gibt fast fünfhundert lizensierte Gondelfahrer in dieser Stadt. Die Chance, dass mich jeder Einzelne von ihnen sofort meiner Familie zuordnen kann, ist zwar verschwindend gering, aber dennoch nicht unmöglich. Vor allem, da es sich um eine eingeschworene, gut vernetzte Gemeinschaft handelt.
Es kommt mir vor, als könnte ich nicht vorsichtig genug sein, wenn ich vermeiden will, dass gewisse Leute von meiner Rückkehr erfahren, bevor ich die Möglichkeit hatte, es ihnen persönlich mitzuteilen. Das ist mir … einfach ein Bedürfnis.
Obwohl ich bisher von niemandem erkannt wurde, habe ich das Gefühl, mit Blicken verfolgt zu werden, während ich durch die Straßen streife. Blicke, die nicht den Schauspieler Orlando Grandin sehen, der es inzwischen bis nach Hollywood geschafft hat, sondern mein früheres Ich. Bei jeder Begegnung erwarte ich, im Vorbeigehen gegrüßt oder für einen kurzen Plausch angehalten zu werden. Oder – was noch schlimmer wäre – jemanden zu treffen, der mich bittet, Grüße an meine Eltern auszurichten.
Es sollte mich wirklich nicht dermaßen aus der Fassung bringen, einem Gondoliere über den Weg zu laufen. Schließlich bin ich in Venedig. Das erste Mal seit fünf Jahren.
Die Tatsache, wieder zurück zu sein, fühlt sich noch immer leicht surreal an, als würde ich wie in einem bekannten Traum durch eine Umgebung laufen, die mir fremd geworden, gleichzeitig aber immer noch schmerzlich vertraut ist.
Um den Kerl in dem Glauben zu lassen, ich sei ein x-beliebiger Tourist, antworte ich auf Englisch und versuche, den kalifornischen Dialekt meines Kumpels Ethan zu imitieren:
»Nein danke, kein Interesse, Dude.«
Der Mann runzelt irritiert die Stirn, als ich ihn Dude nenne, und ich nutze den Moment, um ihm zu entwischen.
Mit beschleunigtem Herzschlag setze ich meinen Weg fort. Dieses kleine Aufeinandertreffen hat die Gefasstheit, um die ich mich seit meinem Entschluss, in meine Heimat zurückzukehren, so bemüht habe, vollkommen ruiniert. Wie ein Mantra habe ich die Worte »Ich muss das tun« immer wieder aufs Neue wiederholt, während ich krampfhaft versuchte, mich nicht ständig nervös umzublicken. Ich muss mit meinen Eltern reden, bevor wir uns womöglich zufällig über den Weg laufen und alles nur noch schlimmer wird. Und auch wenn ich es eigentlich besser wissen sollte, trage ich einen kleinen Funken Hoffnung in mir, dass fünf Jahre im Exil genug waren, um ihre Meinung über mich und meine Entscheidungen zu ändern. Sie haben nie den Kontakt zu mir gesucht, was sicherlich vor allem an dem Stolz meines Vaters liegt. Wenn ich eine realistische Chance haben will, muss ich derjenige sein, der den ersten Schritt tut, auch wenn es mir so viel Angst macht, dass mir der kalte Schweiß ausbricht.
Mit zusammengebissenen Zähnen setze ich den Weg zum Haus meiner Eltern fort und versuche krampfhaft, an irgendetwas anderes zu denken. Ich richte all meine Aufmerksamkeit auf meine Umgebung, wobei mir auffällt, dass sich so gut wie nichts verändert hat – was gut und beschissen zugleich ist. Gut, weil ich dadurch das Gefühl habe, mich sofort wieder zurechtzufinden, fast so, als wäre ich nie wirklich weg gewesen. In letzter Zeit war da ständig diese Sorge in mir, ich könnte in meine Heimatstadt zurückkehren und einen Ort vorfinden, der mir fremd geworden ist.
Beschissen ist es, weil ich in den letzten Jahren zu einem anderen Menschen geworden bin, mich aber hier in meinem alten Zuhause wieder wie der Junge von damals fühle. Als wären mir die Entwicklung, die ich durchgemacht habe, die Erfahrungen und die Reife, irgendwo im Luftraum zwischen USA und Europa abhandengekommen, um mich als denselben verunsicherten Neunzehnjährigen zurückkommen zu lassen, der ich mal war. Was die brodelnde Angst beweist, die immer höher kocht, je weiter ich mich meinem Elternhaus nähere.
Dass das Bullshit ist, weiß ich selbst, doch solche Gefühle sind niemals rational.
Meine Unruhe erreicht ihren nervenzerreißenden Höhepunkt, als ich in unsere Straße einbiege. Alles. Sieht. Aus. Wie. Immer.
Ich weiß nicht, was ich erwartet habe, aber irgendwie kommt es mir seltsam vor, dass meine Abwesenheit keine sichtbaren Spuren hinterlassen hat (womit wir bei dem Ego-Problem wären, das mir meine Agentin so gerne scherzhaft unterstellt).
Dieselben abblätternden Wandfarben der Häuser in Nuancen von Terracotta bis Beige, aus den Angeln hängende Läden an Signora Mancinellis Fenster. Sogar die vertrockneten Topfpflanzen vor der Tür der D’Addarios scheinen noch immer dieselben zu sein. Ein seltsames Schaudern überläuft mich, als ich mein Ziel erblicke.
Unser Haus ist in einem hellen Pfirsichton gestrichen, der jedoch mit Spuren von Feuchtigkeit durchsetzt ist, und vor allem um das Fundament herum wird sehr deutlich sichtbar, in welchem Ausmaß das aufsteigende Wasser die Substanz schädigt. Leicht irritiert runzele ich die Stirn. Wenn meine Eltern auf etwas Wert legen, dann ist es der äußere Schein. Dafür, dass ständig Salz und Gezeiten an Venedigs Gebäuden nagen, war dieses Haus immer nahezu makellos. Und noch etwas fällt mir ins Auge: Stolze Gondoliere-Familie, die die Grandins seit Generationen nun mal sind, prangt seit jeher stets das steinerne Relief eines Gondelfahrers direkt über dem Eingang. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie mein Vater, der sonst aus Überzeugung keinen Finger im Haushalt gerührt hat, jedes Jahr höchstpersönlich auf eine Trittleiter gestiegen ist, um die Steinmetzarbeit liebevoll mit Schwamm und Spezialputzmitteln von Verschmutzungen und Moder zu befreien. Heute ist ein Teil des geschwungenen Bugs der Gondel abgebrochen und ein Riss zieht sich einmal quer durch das Boot.
Siehst du, hier ist das Zeichen deiner Abwesenheit, nach dem du gesucht hast, wispert mir meine innere Stimme zu, doch ich wische sie entschieden weg. Dass das Relief beschädigt ist, hat nichts damit zu tun, dass ich meinem Erbe den Rücken gekehrt habe. Es ist schließlich nicht so, als wäre hier der Blitz eingeschlagen, nur weil ich gegangen bin oder so. Glaube ich zumindest.
Eine gefühlte Ewigkeit lang starre ich auf den abblätternden Lack der Eingangstür und versuche, all meinen Mut zusammenzunehmen, um anzuklopfen. So lief das schon früher bei uns – die Klingel wurde so gut wie nie benutzt, weil alle wussten, dass immer irgendwer in der Nähe war, um das Pochen zu hören. Meine Knöchel verharren nur Millimeter vor dem spröden Holz, als ich dahinter plötzlich eine Unterhaltung zu hören glaube. Unsicher trete ich zurück und eine weibliche Stimme wird lauter.
»… habe dir immer wieder gesagt, dass du die Schuhe nicht auf der Straße stehen lassen sollst … oh.«
Die Tür schwingt auf und gibt den Blick auf die schmale Gestalt einer Frau mittleren Alters frei. Sie stockt mitten im Satz, als sie mich vor der Schwelle stehen sieht, und ihre Augen werden riesengroß – schmerzlich vertraute Augen, deren grünblaue Farbe an die Kanäle von Venedig erinnert. Im ersten Moment ist sie ganz starr vor Schock und mustert mich von oben bis unten, ehe ihr sämtliche Farbe aus dem hageren Gesicht weicht und sie sich eine Hand vor den Mund schlägt.
»Ciao, Mamma.« Meine Stimme klingt kehlig und erstickt. Alle möglichen Emotionen prallen zeitgleich auf mich ein und vereinen sich zu einer rohen, wilden Mischung, die mir als undefinierbarer Kloß in die Kehle steigt.
Ich betrachte sie meinerseits. Paola Grandin war schon immer eine zierliche Frau, doch heute kommt sie mir noch schmaler vor, als ich sie in Erinnerung hatte. Sie wirkt geradezu zerbrechlich in ihrem schicken blauen Kleid mit den kleinen weißen Pünktchen. Das Kleidungsstück sieht aus, als wäre es mehr als eine Nummer zu groß für sie – als hätte sie etliche Kilo verloren, seit sie es gekauft hat. Ihre Schlüsselbeine stehen überdeutlich hervor und Falten, die früher noch nicht da waren, zeichnen jetzt ihr Gesicht. Was mich jedoch am härtesten trifft, ist der Ausdruck, mit dem sie mich ansieht. Denn die Tränen in ihren Augen können nicht verhindern, dass ich dahinter einen Hauch von Furcht aufblitzen sehe.
Inzwischen presst sie sich die Hand auf die Brust und wirft hastig einen Blick hinter sich in den Flur, als fürchte sie, bei etwas Verbotenem erwischt zu werden. Dabei ist nicht sie diejenige, die ihr Verhalten überdenken müsste.
Ich bemühe mich um ein Lächeln, das allerdings sofort in sich zusammenfällt, als sie den Mund aufmacht und gehetzt flüstert: »Du hättest nicht herkommen sollen! Es war ein Fehler, wieder hier aufzutauchen, Orlando.«
Ihre Begrüßung hätte auch eine schallende Ohrfeige sein können, der Schmerz wär derselbe gewesen.
Das Blut schießt mir in die Wangen, als hätte ich tatsächlich einen Schlag abbekommen, und mühsam um Fassung ringend räuspere ich mich. »Mamma, es sind fünf Jahre vergangen und ich dachte … ich bin hier, weil ich einen neuen Film drehe, und ich hatte gehofft, dass wir in Ruhe über das sprechen können, was damals passiert ist. Ich bin … inzwischen bin ich erfolgreich in dem, was ich tue, und ich dachte … ihr solltet einfach wissen …«
Das Gesicht meiner Mutter nimmt jäh einen angespannten Ausdruck an, wodurch die Linien rund um ihren Mund und die Augen nur noch deutlicher werden. »Ich weiß, was du inzwischen erreicht hast, aber die Meinung deines Vaters hat sich nicht geändert. Bitte, Orlando, geh, bevor er merkt, dass du hier bist. Du weißt, wozu das führen kann.«
Sie tritt einen Schritt nach vorne, aber nicht, um auf mich zuzugehen, sondern, um mir den Blick ins Innere des Hauses zu versperren und eine Barriere mit ihrem Körper zu bilden. Diese Geste könnte nicht deutlicher sagen: Hier ist kein Zugang für dich, verschwinde! Und ich kann nicht leugnen, dass es wehtut. Mammas Zurückweisung ist so verdammt schmerzhaft, dass mich Verzweiflung und Bitterkeit schier niederdrücken. Das Gefühl von Einsamkeit, das in den letzten Jahren immer an meiner Seite war, erhebt sich mit neuer Macht und flüstert mir zu, dass ich allein bin. Mutterseelenallein.
Trotz alledem empfinde ich auch Sorge. Mamma wirkt nervös und ängstlich, was sofort meinen Beschützerinstinkt wachruft.
»Okay, okay, ich verschwinde.« Kraftlos, als hätte mich diese kurze Begegnung all meine Energie gekostet, mache ich einen Schritt rückwärts und hebe ergeben die Hände. »Aber bitte sag mir wenigstens: Geht’s dir gut? Und den Küken?« Die Küken, damit sind meine jüngeren Geschwister Luca und Valentina gemeint, die inzwischen beide erwachsen sind.
»Ja.« Mamma nickt energisch. »Ja, mach dir keine Sorgen. Aber bitte …«
»Paola, mit wem sprichst du da?«
Mein Magen sackt in die Tiefe, als seine Stimme aus dem Inneren des Hauses ertönt, so nah, dass er bestimmt schon den schummrigen Eingangsbereich betreten hat.
Mammas Augen werden, wenn möglich, noch größer, während sie mir hektisch gestikulierend bedeutet zu gehen. Ich zögere noch einen winzigen Moment, aber da ich sie nicht in Schwierigkeiten bringen will, wende ich mich ab und husche in die nächste Sackgasse zwei Häuser weiter. Von dort aus höre ich, wie meine Mutter Papà erklärt, sie habe eine streunende Katze verscheucht (wie überaus passend, danke vielmals, Madre), habe die Schuhe, nach denen sie ursprünglich gesucht hatte, aber nicht finden können. Eine Weile geht es noch zwischen den beiden hin und her und entweder ist sie eine noch bessere Schauspielerin als ich, oder ihren Sohn nach fünf Jahren wiederzusehen, hat sie wirklich vollkommen kaltgelassen. Dann, als wäre dies ein Tag wie jeder andere, schließt sich die Tür hinter ihnen und ihre Stimmen verstummen.
Keine Ahnung, wie lange ich in der schattigen Gasse stehen bleibe. Mit dem Rücken an die rohe Ziegelwand gelehnt versuche ich, mich zu sammeln, um nicht hier und jetzt die Fassung zu verlieren. Mein Kiefer schmerzt, so fest beiße ich die Zähne zusammen, um die Kombination aus Enttäuschung und Schmerz daran zu hindern, aus mir rauszubrechen – indem ich blindlings gegen die nächste Ziegelwand boxe, zum Beispiel, oder einen markerschütternden Schrei loslasse.
Im Vorfeld habe ich versucht, mit so niedrigen Erwartungen wie möglich hierherzukommen, aber anscheinend waren selbst die zu viel. Diese kurze Interaktion mit meiner Mutter hat mehr als deutlich gemacht, wo meine Eltern stehen. Ich bin nach wie vor nicht erwünscht und Mamma beugt sich weiterhin dem Willen meines Vaters, als wäre er das personifizierte Gesetz. Ein Wunder, dass sie überhaupt ein Wort mit mir gewechselt hat, statt mir postwendend die Tür vor der Nase zuzuknallen.
Nachdem ich mich etwas beruhigen konnte, raffe ich mich hoch, um mich wie auf Autopilot auf den Weg zurück zu meinem Hotel zu machen. Die Vorstellung, allein in die unpersönliche Suite zurückzukehren, die für die nächsten Wochen mein Zuhause sein wird, lässt meine Schultern weiter nach unten sinken. Bisher hatte ich diese verschwindend geringe Hoffnung, dass ich meinen Eltern in den vergangenen fünf Jahren so sehr gefehlt habe, dass der Verrat, den ich in ihren Augen begangen habe, inzwischen in den Hintergrund gerückt ist. Dass ich für die Dauer meines Aufenthalts bei ihnen wohnen könnte, so wie früher – oder zumindest gelegentlich vorbeischauen und sie besuchen. Tja, da war ich wohl naiv.
Völlig in Gedanken und blind für meine Umgebung überquere ich mit gesenktem Kopf gerade eine Brücke, als mein Name gerufen wird. Ich schrecke hoch, mit einem Mal zurück nach L.A. versetzt, wo immer wieder Paparazzi auf mich aufmerksam werden oder mir Filmfans begegnen. Mein Blick irrt über die Fondamenta, bis ich eine Frau sehe, die mir mit hastigen, trippelnden Schritten entgegeneilt, und ich erkenne sie sofort: Margherita Sartori. Je näher sie kommt, desto lauter ertönt das charakteristische Klappern ihrer halbhohen Absatzschuhe und ihr Anblick löst bei mir das erste echte Lächeln seit meiner Landung in Italien aus.
Margherita kennt mich, seit ich ein kleiner Junge war, und hat mich noch nie verurteilt, sondern stets mit offenen Armen empfangen. Sie tut es auch jetzt, als sie mit wippenden silberblonden Locken vor mir stehen bleibt und mich anstrahlt, als sei ich ihr lang verschollener dritter Enkel.
»Orlando, was für eine schöne Überraschung!«
Es ist erstaunlich, dass sie mich erkennt, obwohl ich mit der breitkrempigen LA-Lakers-Cap und der Sonnenbrille verhältnismäßig gut maskiert bin. Als ich Letztere abnehme, um ihr in die Augen schauen zu können, hebt sie die Hand, um meine Wange zu tätscheln, als wäre es das Natürlichste der Welt.
»Wie erwachsen du geworden bist.« Kurz kräuselt sie die Nase, was mir einen leichten Stich versetzt, weil mich diese Geste sehr an einen gewissen Jemand erinnert, an den zu denken ich mir in den letzten Minuten strikt verboten habe. »Aber über diesen Bart müssen wir noch mal reden.«
Gekonnt übergehe ich ihren Einwand bezüglich meiner Gesichtsbehaarung und greife kurz nach ihrer Hand, um sie zu drücken. »Wie schön, dich wiederzusehen, Margherita. Du siehst fabelhaft aus.«
»Danke, mein Lieber. Ich kann es wirklich nicht fassen, dich hier zu treffen. Ich war gerade auf dem Weg zum Postamt …« In einer beiläufigen Geste streicht sie über den Rock ihres geblümten Blusenkleids, ehe sie wieder zu mir hochschaut, leicht den Kopf zur Seite neigt und mich eingehender betrachtet. »Ist etwas passiert?«
Habe ich schon erwähnt, wie gruselig das Gespür dieser Frau für die Stimmungen anderer Leute ist? Dinge vor meinen Eltern zu verbergen, war schon immer leicht, aber Margherita? Ein Blick ins Gesicht und sie merkt, wenn etwas im Argen liegt. Und damn, ich sollte sie nicht mit meinen Problemen vollheulen. Vor allem nicht in dem Moment, in dem wir uns das erste Mal seit fünf Jahren wieder über den Weg laufen. Aber dann, ohne, dass ich etwas dagegen tun kann, bricht es einfach aus mir heraus: Das Zusammentreffen mit meiner Mutter, wie sie mich ohne Umschweife zu verscheuchen versuchte und nicht ein Wort darüber verloren hat, ob ich ihr in den letzten Jahren ebenso gefehlt habe wie sie mir. Ob sie sich wenigstens ein bisschen freut, mich zu sehen … Das hat mir endgültig vor Augen geführt, dass ich meine Familie verloren habe. Und ich mich noch mehr reinhängen muss, falls ich daran etwas ändern möchte.
Margherita hört mir geduldig zu und stellt keine Fragen, während sie mich weiter mit diesem leicht nachdenklichen Ausdruck ansieht. Als ich fertig bin, räuspert sie sich.
»Weißt du, Orlando, ich hätte da einen Vorschlag …«
3
SOFIA
Heterochromia iridis.
Das ist der Fachbegriff für das seltene Phänomen zweier unterschiedlicher Augenfarben beim Menschen. Es gibt diverse Abstufungen von Heterochromia, von kleinen Flecken in einer Iris, die kaum auffallen, bis hin zu Iriden, die zwei komplett unterschiedliche Farben haben. Letzteres ist unglaublich selten, es kommt bei nur circa vier Menschen auf eine Million vor. Und natürlich hat Orlando Grandin die absolut spektakulärste, außergewöhnlichste Kombination, die man im Hinblick auf Augenfarben haben kann: Das linke ist strahlend blau, das rechte grün mit einem braunen Rand rund um die Pupille.
Sobald ich den Blick hebe und hineinsehe, kann ich einfach nicht mehr wegschauen, sondern werde regelrecht eingesogen von diesen Augen, die nicht zusammenpassen und doch eine Einheit bilden. Umrahmt werden sie von diesen unverschämt dichten schwarzen Wimpern, um die ich ihn insgeheim schon immer beneidet habe. Ein Dreitagebart bedeckt seinen Kiefer und das markante Kinn mit dem Grübchen, was ihn reifer aussehen lässt und irgendwie … Na ja, sexy. Nicht, dass es mich ernsthaft interessieren würde, ich stelle es einfach fest. Rein objektiv. Ganz genauso, wie mir auffällt, dass seine leicht gebräunte Haut von einigen Sommersprossen überzogen ist. Oder sein dunkelbraunes Haar länger ist als früher, sodass es ihm in geschmeidigen Wirbeln in die Stirn fällt und sich im Nacken kräuselt.
Ich sondiere den Feind, nichts weiter.
Trotzdem kann ich nichts dagegen tun, dass mein Körper bei seinem Anblick reagiert, als würde ich gerade die steilste Achterbahn überhaupt runterrasen. Mein Magen zieht sich zusammen, und je länger ich ihn ansehe, desto lauter rauscht das Blut in meinen Ohren, bis es sämtliche Gedanken übertönt. Diese Begegnung reicht aus, um jede Menge Emotionen in mir hochkochen zu lassen, allem voran Wut. An die klammere ich mich. Wut ist machtvoll, sie ist reuelos und zielgerichtet und das Beste daran ist: Sie tut nicht weh. Zumindest nicht mir. Vielmehr umschließt sie mein Innerstes wie eine schützende Mauer, bereit, es bis aufs Äußerste zu verteidigen und sicherzugehen, dass niemand je dahinterblicken kann. Vor allem nicht er.
»Es war ein Fehler von dir, hier aufzutauchen, Orlando.« Meine Worte hängen noch immer zwischen uns in der Luft und für den Bruchteil einer Sekunde regt sich etwas in seinem Gesicht. Ich kann nicht genau deuten, was es ist, weil es zu schnell wieder verschwunden ist, aber es verrät ihn. Während ich mit aller Kraft versuche, ihm nicht an die Gurgel zu gehen, ist seine Miene zunächst ausdruckslos geblieben. So als wäre es ihm vollkommen egal, mich zu sehen. Vielmehr macht er den Eindruck, als sei er lediglich ein wenig überrascht, mich hier zu treffen. In meinem eigenen Zuhause, wohlgemerkt.
Als hätte mein Ausbruch ihn wachgerüttelt, verziehen sich seine Lippen zu einem lässigen Lächeln, mit dem er von seiner Position auf der Treppe auf mich hinuntersieht. Prompt fällt mir auf, dass er dabei nach wie vor den rechten Mundwinkel höher zieht als den linken. Noch etwas an ihm, das irgendwie unausgeglichen, aber auf seine ganz eigene Weise vollkommen ist.
Dieses Lächeln … es bringt mich so aus der Balance, dass ich schon wieder ins Wanken gerate.
Ma vaffanculo, ich verfluche diese verdammten Streichhölzer von Absätzen, die absolut keine Standfestigkeit bieten. Cleos angeblicher Confidence-Push hin oder her, gerade wären mir Boots entschieden lieber. Mit Stahlkappen. Oh ja, definitiv mit Stahlkappen, um sie in unaussprechliche Körperregionen gewisser Personen zu rammen, die unangekündigt aus dem Höllenkreis aufgetaucht sind, an den sie sich einst verpisst haben.
Lässig, als würde ihn die ganze Situation amüsieren, lehnt sich Orlando gegen das steinerne Treppengeländer. »Es ist auch schön, dich wiederzusehen, Sofia.«
Die Art und Weise, wie mein Name über seine Zunge rollt, sorgt dafür, dass sich für einen Moment die feinen Härchen an meinen Armen aufstellen. Obwohl sie vor Sarkasmus trieft, bringt seine Stimme die Erinnerungen mit noch mehr Heftigkeit zurück, als es sein Anblick ohnehin schon getan hat. Sie ist nach wie vor tief und rauchig, mit einer leicht kratzigen Note, als hätte er sich am Tag zuvor auf einem Rockkonzert die Seele aus dem Leib gebrüllt. Der Klang geht mir unter die Haut, schleicht sich in mich hinein und brennt, als hätte man mir eine ganze Flasche Desinfektionsmittel über eine offene Wunde gegossen. Eine Wunde, die sich verdächtig weit links in meinem Brustkorb befindet. Ich verziehe das Gesicht und weiche einen Schritt zurück, die Arme schützend um meinen Oberkörper geschlungen.
Dio, ich hasse es, ihn zu sehen. Ihn zu hören. Einfach alles an ihm.
Ich brauche einen Moment, um diese irrationale, heftige Abneigung abzuschütteln. »Was tust du hier?« Die Wut belegt meine Stimme, lässt sie dunkel und bedrohlich klingen, während ich ihn keinen Moment lang aus den Augen lasse.
Sein rechter Mundwinkel wandert daraufhin noch weiter nach oben, bis sein Lächeln zu einem boshaften Grinsen wird. »Ich dachte, ich statte dem Höllenloch, das sich meine Heimat nennt, mal wieder einen Besuch ab.«
»Nein«, zische ich gereizt. »Es geht darum, was du genau hier tust. In meinem Haus!«
Er macht einen Schritt vorwärts und kommt die letzte Treppenstufe runter. Wir befinden uns jetzt auf einer Ebene, doch obwohl ich meine schwindelerregend hohen Heels trage, bin ich nicht annähernd so groß wie er. Früher mochte ich es, wie er sein Kinn auf meinen Scheitel stützen konnte, wenn er mich umarmt hat, aber heute verabscheue ich, dass ich den Kopf in den Nacken legen muss, um zu ihm hochzuschauen.
»Hmm, vielleicht hatte ich ja Sehnsucht?« Er senkt den Kopf, taxiert mich aber weiterhin unter seinen Wimpern hervor, um auf eine Reaktion von mir zu lauern.
Genervt blase ich die Wangen auf. »Ach, und das wird dir nach fünf Jahren klar? Hat dich deine aktuelle Freundin verlassen und du dachtest: Hey, wenn ich schon mal in der Gegend bin, schaue ich mal, ob ich bei Sofia was abgreifen kann? Um der alten Zeiten willen?«
Er schweigt einen Moment, seine Miene ist nach wie vor undurchschaubar. »Wer sagt, dass ich deinetwegen hier bin?«
Autsch, der hat gesessen. Die kühle Gleichgültigkeit, die in seinem Tonfall mitschwingt, dringt in mich wie eine stählerne Klinge, die mir einen fiesen Stich zwischen die Rippen versetzt. Der Seitenhieb ist so gut platziert, dass mir im ersten Augenblick die Luft wegbleibt und ich darum kämpfen muss, mein Pokerface aufrechtzuerhalten. Warum gelingt ihm das so spielend leicht, während ich jeden Moment aus der Haut fahren könnte? Die Einsicht, dass es für ihn ein Leichtes war, mich aus seinem Leben zu streichen, nagt seit Jahren an mir wie ein hartnäckiger Parasit, den ich einfach nicht loswerde. Dass er aber auch heute bei meinem Anblick keine Regung zeigt, ist einfach nur niederschmetternd. Obwohl er mich verlassen hat, habe ich mich irgendwie stets an den Gedanken geklammert, dass es ihm damit mindestens genauso miserabel gegangen sein muss wie mir. Etwas anderes kam mir gar nicht in den Sinn, aber wenn ich ihn jetzt ansehe, wird mir bewusst, wie falsch ich lag. Da scheint kein Hauch von gar nichts mehr übrig zu sein.
Während ich schweige, fährt Orlando im Plauderton fort: »Ich bin gestern Margherita über den Weg gelaufen und sie hat mich eingeladen, heute herzukommen.«
Er macht sich an Nonna ran, ernsthaft?
»Du …« Der Zorn ist inzwischen so übermäßig, dass er mich am ganzen Körper zittern lässt. Ich schaffe es kaum noch, ein Wort zu formen, ohne loszubrüllen.
Er kann nicht … er kann nicht beschließen, ohne Ankündigung wieder hier aufzutauchen, in mein Leben, in meinen sicheren Hafen hineinwalzen und sich in meine Familie drängen, als hätte das keine Konsequenzen. Gäbe es ein Handbuch mit Verhaltensregeln à la »Wie benehme ich mich als respektvoller Expartner, ohne ein gefühlloses Arschloch zu sein«, würde der oberste Grundsatz heißen: Lass die Großmutter deiner Verflossenen in Ruhe. Verdammt, vielleicht sollte ich so ein Handbuch schreiben, offenbar existiert Bedarf.
Jeder weiß, dass Omas die weichsten Herzen von allen haben. Und wer meine im Speziellen kennt, dem wird bekannt sein, dass sie einem alles verzeihen würde. Selbst wenn sich herausstellen würde, dass ihre Enkel skrupellose Finanzbetrüger sind, die alte Leute um ihr gesamtes Erspartes gebracht haben, würde sie noch das Gute in ihnen sehen. Zwar würde sie es uns jeden Tag vorhalten, doch das würde sie nicht davon abhalten, uns trotzdem innig weiterzulieben und uns unser Lieblingsessen zu kochen. Diese Art Mensch ist meine Nonna, vor allem, wenn es um ihre Liebsten geht. Und ich weiß, dass sie Orlando schon immer zum erweiterten Kreis unserer Familie gezählt hat. Er ist praktisch in diesem Haus aufgewachsen, zusammen mit Alessandro, Luca und mir, ehe später noch Valentina – Lucas und Orlandos kleine Schwester – dazustieß. Früher bedeutete nach Hause gehen hierherzukommen, für alle von uns. Doch Orlando hat dieses Recht vor fünf Jahren verloren. Er hat es weggeworfen wie uns alle, als er beschloss, ohne eine Erklärung zu verschwinden und sich seitdem nicht mehr zu melden.
Meint er wirklich, es ist genauso leicht, jetzt zurückzukehren?
»Halt dich von Nonna fern!«, zische ich schließlich und untermale die Ansage mit meinem angsteinflößendsten Killerblick. Orlando wirkt davon vollkommen unbeeindruckt.
»Das könnte schwierig werden.«
Irre ich mich oder zucken seine Mundwinkel? Man könnte meinen, er hat gerade insgeheim den Spaß seines Lebens.
»Und wieso?« Mein Gott, hat er vor, länger in der Stadt zu bleiben? Werde ich ihm etwa öfter auf der Straße begegnen? Die Vorstellung allein genügt, um Hautausschlag zu bekommen.
»Ich werde für eine Weile hier wohnen.« Mit einem Kopfnicken deutet er auf die Koffer, die ich für kurze Zeit wieder vergessen hatte. Natürlich, das sollte mich wirklich nicht überraschen. Er ist ja inzwischen supererfolgreich und kann sich dieses Gepäck ohne Probleme leisten.
Seine Worte schaffen es erst mit einiger Verzögerung, zu mir durchzudringen, aber als sie es dann schließlich tun, detonieren sie mit der Wucht einer Atombombe in meinem Kopf. Mein Puls beginnt, in doppelter Geschwindigkeit zu rasen, und wummert so laut in meinen Ohren, dass er einen Tinnitus auslöst.
»Nein!« Meine Stimme schnalzt wie das Knallen einer Peitsche durch den Portego und ist so laut, dass der Schall sicherlich bis in die oberen Stockwerke des Hauses zu hören ist. Aber das ist mir egal. Ich muss das Chaos übertönen, das in meinem Inneren losgebrochen ist, oder besser noch: ein Ventil dafür finden, damit ich nicht platze.
Das ist kein ungläubiger Ausruf, sondern eine unmissverständliche Ansage. Unter gar keinen Umständen wird er hier einziehen. Selbst wenn wir seine letzte Möglichkeit sein sollten und er ansonsten unter einer Brücke schlafen müsste. Was sich in einer Stadt wie Venedig als schwierig herausstellen könnte, denn nun … all das Wasser. Meine Mundwinkel zucken bei der Vorstellung, dass er in einem Schlauchboot unter dem Ponte di Rialto campen muss.
Das Wissen, dass er wieder in der Stadt ist, ist schlimm genug, aber auch noch hier? Mit mir unter einem Dach? Nur über meine Leiche.
Orlando betrachtet mich weiterhin mit kühler Gelassenheit. »Deine Nonna hat mir bereits zusagt. Und bist du nicht …« Langsam gleitet sein Blick von meinem Gesicht über meinen Körper und jetzt ist er derjenige, der mich von oben bis unten mustert. »Ich hatte den Eindruck, dass du über die Sache von damals längst hinweg bist.« Fragend hebt er eine Braue. Eine Geste, die keiner Worte bedarf.
Sein Blick wird intensiver, je länger er mich anstarrt, als suche er auf meiner Haut nach möglichen Spuren der letzten Nacht. Beinahe fühlt es sich an wie eine Berührung, die meinen Hals hinunterstreicht, meine Schlüsselbeine streift und einen leichten Windhauch auf dem Ansatz meiner Brüste hinterlässt. Aber da gibt es nichts zu sehen für ihn! Ich bin mir ziemlich sicher, dass mein Bettpartner keine Knutschflecken oder Ähnliches hinterlassen hat (auf so was achte ich penibel). Meine schützende Maske ist vielleicht kurz verrutscht, aber sitzt jetzt so fest, als wäre sie mit meinem Gesicht verwachsen. Er kann versuchen, mich mit diesen Augen zu lesen, die wie das Yin-und-Yang-Zeichen eine gegensätzliche und doch perfekte Einheit ergeben, aber weiter als an der Oberfläche lasse ich ihn nicht kratzen. Als ihm das klar wird, verändert sich sein Ausdruck, wird kalt und abweisend, während er mich weiterhin abschätzig mustert. Orlando fällt ein Urteil über mich und das versetzt mir entgegen aller Vernunft einen weiteren schmerzhaften Stich. Er scheint genauso wie alle anderen zu sein, die glotzen und mich sofort in eine Schublade stecken.
Herausfordernd hebe ich das Kinn. »Hast du noch nie eine Frau gesehen, die von einem One-Night-Stand nach Hause kommt?«
Damit habe ich offenbar einen Treffer gelandet. Mit diebischer Freude beobachte ich, wie er die Augen verengt und ein Muskel an seinem Kiefer zuckt. »One-Night-Stands? Auf so was stehst du jetzt, Sofia?«
Er hat kein Recht dazu. Er kann nicht hier auftauchen und so tun, als wüsste er noch, wer ich bin und worauf ich stehe. Traurigkeit wallt in mir auf, weil er mal derjenige war, der mich am besten kannte, aber ich schiebe die Empfindung entschlossen von mir weg. Ich war viel zu lange am Boden zerstört wegen ihm und in diesem Moment wittere ich eine Chance, endlich mal zurückschlagen zu können. Ein Gegenangriff, nachdem ich all die Jahre nicht an ihn rangekommen bin, um ihn zur Rede zu stellen.
»Weißt du, du warst mein erster Freund überhaupt und das war schon alles ganz nett mit dir, aber inzwischen habe ich erkannt, was ich alles verpasst habe, während ich mit dir zusammen war. Jetzt habe ich die Möglichkeit, die freie Auswahl zu haben, und nichts davon ist … langweilig.«
Treffer … versenkt. Mit einiger Genugtuung beobachte ich, wie sein Kiefer förmlich zu Stein erstarrt und seine Lider leicht zucken. Ermutigt davon, einen empfindlichen Punkt erwischt zu haben, mache ich einen Schritt auf ihn zu.
Von außen betrachtet muss ich wie eine Salsa-Tänzerin aussehen, die ständig vor und zurück tänzelt.
Meine Stimme senkt sich zu einem Raunen, süß wie Honig. »Wage es nicht, über mich zu urteilen. Du meinst vielleicht, mich noch zu kennen, aber das Mädchen von damals gibt es nicht mehr. Du hast sie weggeworfen, ebenso, wie du es mit deiner Familie gemacht hast. Und jetzt hole ich mir von anderen Männern das, was du mir nie geben konntest.« Es ist fast unmöglich, ihm in die Augen zu schauen, ohne ständig zwischen dem linken und rechten hin und her zu springen. Aber gerade jetzt schaffe ich es, ihn direkt anzublicken; die Mischung aus schwelendem Zorn und reueloser Genugtuung angesichts meiner Retourkutsche machen mich blind für jede Ablenkung.
»Und um auf deine Andeutung von eben zurückzukommen: Über dich hinweg zu sein und dich trotzdem nicht ausstehen zu können, sind zwei unterschiedliche Dinge.« Allmählich rede ich mich richtig in Rage. »Ich weiß, Nonna kann zu niemandem Nein sagen, aber wie kommst du überhaupt auf die Idee, ernsthaft hier wohnen zu wollen? Hast du schon mal daran gedacht, dass auch dein Bruder hier lebt? Der dir die letzten Jahre genauso am Arsch vorbeigegangen ist wie der Rest von uns.« Erst, als ich es ausspreche, schwant mir, was Orlandos Anwesenheit mit meinem besten Freund machen wird. Er … keine Ahnung, wie er damit umgeht, aber ich fürchte, dass ihn Orlandos Auftauchen richtig fertigmachen und alle mühsam geflickten Wunden aufreißen wird.
Die Erwähnung von Luca scheint zum ersten Mal eine Reaktion bei Orlando hervorzurufen, die tiefer geht als diese herablassende Haltung, die er bisher gezeigt hat. Seine Miene verdüstert sich und zeigt Spuren von Schmerz und Bedauern, die sich zwischen seinen Augenbrauen eingraben.
Kurz presst er die Lippen zu einer schmalen Linie zusammen, ehe er sagt: »Vielleicht bin ich hier, um wieder in seiner Nähe sein zu können. Ich weiß, ich habe mich nicht richtig verhalten …«
»Nicht richtig verhalten?« Alles, was ich an Fassung noch zusammenhalten konnte, zerbirst und bricht in diesem Moment Feuer spuckend und schrill aus mir heraus. »Du bist gegangen, ohne ein Wort zu sagen. Du hast nicht zurückgeblickt. Was hier in der Zwischenzeit passiert ist, mit Luca und Valentina, war dir vollkommen egal. Hast du überhaupt gewusst, dass dein Vater nicht mehr arbeiten kann? Er hatte vor über einem Jahr einen Unfall und Luca musste seine Nachfolge antreten, während du dein Leben in Hollywood genossen hast. Nur, weil du dich jetzt gnädigerweise dazu herablässt, wieder hier aufzukreuzen, ändert das gar nichts. Sie hätten dich damals gebraucht, nicht heute.«
Orlando ist mit jedem meiner Worte blasser geworden und ich sehe seinen Kehlkopf hüpfen, als er schwer schluckt.
Ich bin machtlos gegen die wütenden Tränen, die inzwischen in meinen Augen brennen und meine Sicht verschwimmen lassen. Gerade ist es der Zorn, der mich beherrscht, aber direkt dahinter lauern Gefühle und Erinnerungen, die seit Jahren in mir rumoren und über die Zeit nichts von ihrer Potenz verloren haben. Vielmehr sind sie wie Gifte, die toxischer werden, je länger sie gelagert werden. Und verdammt, meine Erinnerungen an Orlando Grandin hatten mehr als genug Zeit, um in meinem Inneren zu schwelen. Das ist ganz sicher nicht die erwachsene, abgeklärte Version von mir, die ich mir für unser erstes mögliches Aufeinandertreffen nach all der Zeit ausgemalt hatte. Offenbar habe ich mir nur etwas vorgemacht. So wie ich vor allen anderen getan habe, als könnte mich nichts mehr verletzen. Tief in mir drin dagegen … dort sieht es anders aus, aber ich habe schon vor ziemlich langer Zeit aufgehört, einen genaueren Blick hineinzuwerfen.