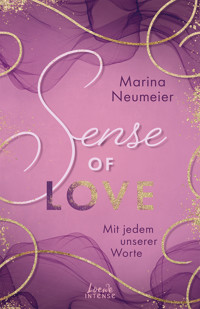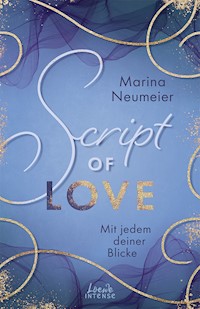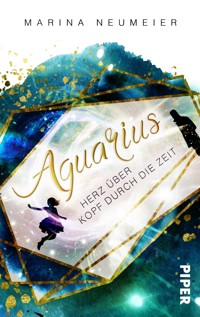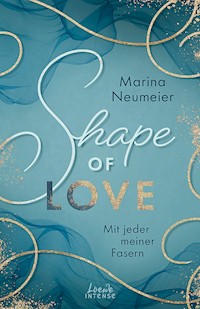
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Loewe Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Love-Trilogie
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Entdecke die neue New Adult-Reihe über Mode, Musik und Film im Herzen Venedigs Ihre Ängste halten ihn auf Distanz. Doch gemeinsam können sie heilen. Cleo kann ihr Glück kaum fassen: Sie hat ein Praktikum bei der gefeierten Designerin Ornella Russo in Venedig ergattert! Doch der Start verläuft holprig, denn ihre Chefin macht schnell klar, dass die kurvige Studentin in der Modewelt nichts zu suchen hat. Und dann ist da noch Alessandro: das Gesicht von Ornellas neuer Kollektion, ein berühmtes Männermodel – und der Enkel von Cleos Vermieterin. Von Beginn an spüren sie diese Anziehungskraft, die beide verunsichert. Denn während es Cleo aufgrund ihrer Figur schwerfällt, Nähe zuzulassen, hat Alessandro mit seinen eigenen Ängsten zu kämpfen … In ihrem ersten New Adult-Roman macht Marina Neumeier darauf aufmerksam, welche Auswirkungen stereotype Schönheitsbilder der Modebranche auf unsere Wahrnehmung haben können. Eine prickelnde Liebesgeschichte über Body Positivity und Essstörungen, die zeigt, dass Selbstliebe das wichtigste Schönheitsideal ist!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 565
Ähnliche
Inhalt
1CLEODas Leben ist …
2ALESSANDROSofia [11:14]: Sorry, …
3CLEOSo etwas wie …
4ALESSANDROObwohl ich Nonna …
5CLEOWiiip Wiiip …
6CLEOWenn man auf …
7ALESSANDROAm Montag werde …
8CLEOWährend ich angespannt …
9ALESSANDROZu beobachten, wie …
10CLEOAls ich mich …
11ALESSANDRODas Telefonat mit …
12CLEO»Einen Caffè Macchiato …
13ALESSANDROCleo beim Essen …
14CLEOAm Sonntagvormittag sitze …
15CLEOAm Abend vor …
16ALESSANDROIch werde Luca …
17CLEOMein Arm rutscht …
18CLEOWie in Trance …
19ALESSANDROAm nächsten Morgen …
20CLEOAm Montagmorgen betrete …
21CLEOMeine Mutter lässt …
22CLEOEs dauert über …
23ALESSANDROSasa [19:58]: Wer …
24CLEOAls ich völlig …
25CLEODas ist der …
26ALESSANDRO»Hallo, jemand zu …
27CLEODer Frühsommer in …
28ALESSANDRO»Danke Nonna, das …
29ALESSANDROIch kann mein …
30CLEOIch weine die …
31CLEO»Ich verstehe, warum …
32ALESSANDROIn den Wochen …
33CLEOEs fühlt sich …
34CLEOZwei Stunden später …
EpilogZWEI WOCHEN SPÄTER
Liebe*r Leser*innen,
dieses Buch enthält potenziell triggernde Inhalte.
Deshalb findet ihr auf der letzten Seite eine Triggerwarnung.
Achtung: Diese enthält Spoiler für die gesamte Geschichte!
Wir wünschen euch das bestmögliche Lesevergnügen.
Für alle, die manchmal denken, sie seien zu wenig. Oder zu viel.
1
CLEO
Das Leben ist ein Stück Stoff, der aus unendlich vielen Fäden gewoben wird.
Diesen Satz hat meine Nonna oft zu mir gesagt und bis heute bin ich mir nicht ganz sicher, ob sie ihn bloß aus einem Ratgeber geklaut hat oder ob er doch ihrer eigenen, universellen Weisheit entsprungen ist. Ich stelle mir gern vor, dass Letzteres der Fall ist.
Wenn ich mir mein Leben als ein unfertiges Stück Stoff vorstelle, dann bin ich gerade an dem Punkt angekommen, an dem die aktuelle Rolle unscheinbaren farblosen Garns aufgebraucht ist und nun ein neuer Faden darauf wartet, sich in das Gewebe zu schleichen. Momentan kann ich nur spekulieren, welche Beschaffenheit er haben wird: bunt schillernd und verheißungsvoll wie Seide oder doch wieder etwas eher Unspektakuläres wie Wolle. Ob er sich nahtlos in den Rest einfügen oder aber ein Fleck bleiben wird, der aus meinem Leben heraussticht.
Wie auch immer. Die ersten Maschen sind gesetzt und jetzt gibt es kein Zurück mehr.
Mein Blick wandert zum Fenster des Zugabteils, in dem ich alleine sitze, und ich betrachte die vorbeirasende Szenerie. Flaches grünes Land, das irgendwie trist wirkt, dazwischen immer wieder Häuser und Industrieanlagen. Dabei pule ich unruhig an meinen Fingernägeln herum, von denen ich in den letzten Stunden nach und nach den roséfarbenen Lack abgekratzt habe. Als mir klar geworden ist, was ich da tue, war es ohnehin zu spät und jetzt mache ich einfach weiter, um eine Beschäftigung für meine Hände zu haben. Die kläglichen Reste meiner einstigen Maniküre verteilen sich inzwischen als bröselige Krümel in meinem Schoß.
Der Himmel ist von tief hängenden Wolken bedeckt und ebenso undurchsichtig wie meine Zukunft, womit er ziemlich gut zu meiner nervösen Stimmung passt.
Ein knackendes Geräusch reißt mich aus meinen Gedanken. Ich höre das Rauschen eines Mikrofons, bevor eine Durchsage der Schaffnerin ertönt.
»Sehr geehrte Damen und Herren, nachdem wir soeben den Bahnhof von Padua passiert haben, werden wir in Kürze unseren Zielbahnhof Venedig Santa Lucia erreichen. Unsere Ankunftszeit …«
Das Panorama draußen verschwimmt vor meinen Augen, als mir klar wird, dass ich gleich da sein werde. Wirklich und wahrhaftig. Mein Puls legt einen Zahn zu, bis jeder Schlag meinen Brustkorb zum Vibrieren bringt. Das fühlt sich verdächtig nach aufsteigender Panik an, und bevor ich etwas wirklich Dummes tue – in Tränen ausbrechen wie ein trotziges Kind zum Beispiel –, beginne ich, meine Sachen zusammenzusuchen.
Mit zitternden Fingern greife ich nach dem Skizzenbuch, den Stiften und meiner Trinkflasche, die ich auf dem freien Sitz neben mir abgelegt habe. Sorgsamer als nötig verstaue ich sie in meiner Tasche, bevor ich die Nagellackbrösel auf meinem Schoß in eine Hand kehre und sie im Mülleimer entsorge (ich will keine Spur à la Krümelmonster hinterlassen). Als Letztes nehme ich mein Handy, das es während meiner Aufräummission eben irgendwie geschafft hat, in die Ritze zwischen den Sitzpolstern zu rutschen, und entsperre es.
Ein paar Meldungen auf Instagram, eine SMS meines Mobilfunkanbieters, der mich nun schon zum dritten Mal darüber informiert, dass ich mich in Italien befinde … keine Nachricht von meinen Eltern. War ja klar. Sie waren von Anfang an nicht begeistert davon, dass ich das hier mache. Ach, generell waren sie noch nie wirklich einverstanden mit mir. Eine Weile starre ich brütend auf unseren Familienchat, der hauptsächlich aus Mitteilungen von mir besteht, auf die einer der beiden einsilbig antwortet. Weil sie zu beschäftigt sind. Da frage ich mich, warum sie so überreagieren, wenn ich beschließe, für ein paar Monate ins Ausland zu gehen. Ab dem Moment, in dem ich während einem unserer seltenen gemeinsamen Abendessen verkündete, dass ich mein studentisches Pflichtpraktikum in Venedig absolvieren würde, waren sie Feuer und Flamme. Und zwar nicht auf die positive Art. Ich glaube, meine Mutter stand ganz kurz davor, wirklich Feuer zu spucken, und mein Vater nahm seine Krawatte ab. Das ist etwas, das ich bei ihm bisher nur einmal erlebt habe. Damals kam raus, dass einer seiner Senior Consultants bei den Spesen betrogen hatte. Ansonsten bleibt die Krawatte dran, bis er ins Bett geht.
Seufzend lasse ich mich tiefer in die durchgesessenen Polster sinken. Meine Eltern führen ihre eigene Unternehmensberatungsfirma in München und haben nie verstanden, warum ich mich ausgerechnet für ein Studium in Modedesign entschieden habe. Das Einzige, was sie in Sachen Mode interessiert, sind maßgeschneiderte Bürokleidung und die Frage, ob ein marineblauer Anzug die angemessene Wahl für ein Meeting mit diesem und jenem Großkunden ist. Ehrlich, ihre Kleiderschränke sind so dermaßen seelenlos, dass ich beim Anblick der ordentlichen Reihen weißer Hemden, schwarzer Röcke, Hosen und Jacketts jedes Mal ein Frösteln unterdrücken muss.
Keine Ahnung, ob sie jemals erwartet haben, dass ich ihnen in die Firma nachfolge, aber selbst wenn es eines Tages doch aus welchem Grund auch immer dazu kommen sollte, würde ich mich niemals auf diese Uniformität einlassen. Farben sind keine Todsünde, aber ich habe es aufgegeben, ihnen das erklären zu wollen.
Nach einem letzten Blick auf das Display wische ich den Familienchat weg, entschlossen, mir nicht länger selbst die Laune zu verderben, indem ich über meine Eltern nachgrübele. Denn ausnahmsweise geht es gerade nicht um sie. Sondern um mich. Und um die absolut irrsinnige, markerschütternde Tatsache, dass ich für ein halbes Jahr in Venedig leben werde. Vollkommen allein.
Woher die Courage für diesen Schritt kommt, ist mir noch immer nicht ganz klar. Denn streng genommen müsste ich mein Praktikum gar nicht im Ausland absolvieren. Gut, es wird gewissermaßen erwartet, dass wir unsere Komfortzone verlassen und uns einen Platz außerhalb von München suchen, um ein bisschen frische Luft zu schnuppern, aber ich hätte es wie einige meiner Kommilitonen und Kommilitoninnen machen und nach Berlin oder Köln gehen können. Es gibt fantastische Designer und Designerinnen in Deutschland und ich habe vor, eine von ihnen zu werden, aber die Sache ist die … niemand davon ist Ornella Russo. Die Grande Dame der italienischen Modewelt, seit dreißig Jahren unangefochten an der Spitze des Modeolymps. Und ich darf in ihrem venezianischen Atelier lernen. Nach wie vor kribbelt mein ganzer Körper vor Aufregung, wenn ich an den Moment denke, in dem ich die Zusage erhalten habe. So ganz fassen kann ich es auch jetzt nicht, da ich nur noch wenige Minuten vom Bahnhof Santa Lucia in Venedig entfernt bin. Die Aussicht darauf, gleich anzukommen, lässt meinen Herzschlag wieder unmittelbar in die Höhe schnellen. Weder das rasende Tempo, das mein Puls annimmt, noch die aufgestellten Härchen auf meinen Armen lassen sich ignorieren. Mein Körper benimmt sich, als würde ich einer Schlacht entgegenblicken, und auch mein Verstand ist mir keine Hilfe. Anstatt Ruhe zu bewahren, versorgt er mich mit einer Reihe von Horrorvisionen: angefangen bei der gemieteten Wohnung, die sich durchaus als Bruchbude herausstellen könnte, über deprimierende Bilder meiner selbst, wie ich sechs Monate komplett allein verbringe, weil ich es nicht schaffe, Anschluss zu finden, bis hin zu meinem Arbeitsplatz bei Ornella Russo, wo so ziemlich alles schiefgehen könnte. Um diese pessimistischen Szenarien zu vertreiben und wieder runterzukommen, kneife ich für einen Moment die Lider zu und atme tief durch. Als ich die Augen wieder öffne, wandert mein Blick wie von selbst zum Fenster. Und kurz ist mein Kopf tatsächlich wie leer gefegt. Denn da ist das Meer. Meine Lippen teilen sich verblüfft, während ich durch das fleckige Glas nach draußen starre und das Panorama in mich aufnehme.
Der Zug scheint direkt über die Meeresoberfläche zu rasen, über schaumig weiße Wellenkämme hinweg, auf denen sich die Sonne spiegelt. In einiger Entfernung kann ich einzelne Inseln erkennen, ansonsten erstreckt sich das tiefblaue Wasser der Lagune bis zum Horizont. Fast kommt es mir so vor, als könnte ich bereits das Salz auf der Zunge schmecken und die Schreie der Möwen hören.
Bin ich wirklich so in meine Gedanken vertieft gewesen, dass ich nicht mitbekommen habe, dass wir inzwischen die Brücke erreicht haben, die Venedig mit dem Festland verbindet?
Ich stehe auf und verrenke mir den Kopf in der Hoffnung, schon einen ersten Blick auf die Stadt zu erhaschen, aber dafür müsste ich das Fenster öffnen. Was natürlich nicht möglich ist. Ein bisschen enttäuscht rutsche ich zurück auf den Sitz und beginne unruhig, mit den Füßen auf den Boden zu trommeln. Die Aussicht vor mir hat mich für den Moment zwar abgelenkt, mir aber auch gezeigt, dass die Ankunft unmittelbar bevorsteht.
Kalter Schweiß breitet sich auf meiner Haut aus, gepaart mit einer Angst, die ich seit Tagen zu verdrängen versuche. Sie kehrt zurück, heftiger jetzt, und droht, mich unter sich zu begraben. Plötzlich habe ich das Gefühl, nicht mehr richtig atmen zu können, und merke, wie meine Sicht verschwimmt, was die Panik in mir nur noch weiter schürt.
Seit Wochen rede ich mir ein, dass dieses Praktikum eine unbezahlbare Gelegenheit ist. Etwas, das ich tun muss, um meinem großen Traum von einer internationalen Karriere als Designerin näher zu kommen. Dass es nur ein wenig Mut erfordert, den ersten Schritt zu wagen und alles andere von alleine kommt, wenn ich erst mal in Bewegung bin. Aber gerade fühle ich mich überhaupt nicht mutig. Am liebsten würde ich auf der Stelle umdrehen und … und was? Nach München zurückkehren? Zu meinen Eltern, die mich immer nur ausbremsen und meine Arbeit belächeln? Zu den Leuten, die nur auf Äußerlichkeiten fixiert sind?
Und mit einem Mal reicht die bloße Vorstellung, wie mein Umfeld reagieren würde, aus, um mir Zuversicht zu verleihen. Unwillkürlich nehme ich auf dem muffigen Sitz eine aufrechtere Haltung ein und richte den Blick auf das Gepäckfach an der Abteilwand gegenüber.
So beängstigend sich dieses neue Kapitel auch anfühlt, ich habe es bitter nötig. Mein Leben kommt mir schon seit einer ganzen Weile zu beengt und vorhersehbar vor. Verborgen hinter der Aufregung und der Angst vor dem Unbekannten existiert ein Teil von mir, der sich nach neuen Erfahrungen sehnt. Eine leise Stimme, die mich drängt, die Sicherheit des Alltäglichen zu verlassen und es zu genießen. Vielleicht hadere ich noch mit mir, weil ich keine Ahnung habe, was in diesem nächsten halben Jahr auf mich zukommen wird. Aber so ist das mit Abenteuern: Man kann vorab nie planen, wie sie sich entwickeln werden, sondern muss sich hineinstürzen. Und aufgeben ist für mich keine Option.
Mittlerweile hat sich der Zug auf annähernd Schritttempo verlangsamt und wir tauchen in die Ausläufer der Stadt ein, die den Charme eines Industriegebiets verströmen.
Obwohl mir vor Aufregung die Knie zittern, fasse ich einen Entschluss: Ich werde mich jetzt aus diesem durchgesessenen Sitz aufrappeln und Venedig eine Chance geben.
Während bei der Ankunft im Zielbahnhof hektische Betriebsamkeit im Gang vor meinem Abteil ausbricht, kämpfe ich damit, mein Gepäck aus der Ablage über den Sitzen zu wuchten. Fahrgäste mit Trolleys und leichten Reisetaschen eilen aus dem Zug und ich schaue ihnen neidisch hinterher. Beim Packen war ich der festen Überzeugung, dass ich das ganze Zeug für sechs Monate im Ausland brauchen werde, aber jetzt, da ich mich mit zwei riesigen Koffern abkämpfe, bereue ich meinen Überschwang. Außerdem habe ich mir selbst damit die Ausrede ruiniert, shoppen gehen zu müssen, weil ich mehr als genug Klamotten dabeihabe. Von Venedigs Boutiquen erwarte ich nicht besonders viel, aber an meinen freien Tagen hätte ich einen Ausflug ans Festland unternehmen und die verheißungsvollen Outlets im Umkreis von Mailand unsicher machen können. Das war wirklich kurzsichtig von mir.
Nachdem ich es endlich geschafft habe, mein ganzes Zeug aus dem Zug zu schleppen, fühlt sich mein Gesicht heiß an und ich keuche ein wenig, doch die Menge an Menschen um mich herum gibt mir keine Gelegenheit durchzuatmen. Also schultere ich meine Handtasche, greife nach den Henkeln der Koffer und ziehe sie hinter mir her über den Bahnsteig.
Das Gedränge ist atemberaubend. Blecherne Durchsagen auf Italienisch schallen über unsere Köpfe hinweg, doch wegen des Lärms kann ich kaum ein Wort verstehen. Mit zusammengebissenen Zähnen bahne ich mir meinen Weg zwischen schnatternden Touristengruppen, Schaffnern und diversen Infoständen hindurch. Dahinter beginnt ein Bereich mit Boutiquen, deren Schaufenster mich wie magisch anziehen, doch ich laufe stoisch daran vorbei und gelange in die Eingangshalle. Ich bin zum ersten Mal in Venedig, und obwohl ich im Vorfeld natürlich von den Besuchermassen gehört habe, überwältigt mich das Getümmel um mich herum. In der Halle brummt es wie in einem überfüllten Bienenstock und ich habe es eilig, nach draußen zu kommen. Und dort … Man wird wortwörtlich mitten in die Stadt hineingeworfen. Am Fuße einer breiten Außentreppe vor dem Bahnhofsgebäude fließt der Canal Grande entlang. Motorboote schneiden durch das grünliche Wasser, auf dem die Sonne glitzert, und am Ufer gegenüber befindet sich eine kleine weiße Kirche mit Kuppeldach, die mich an einen griechischen Tempel erinnert. Fasziniert lasse ich den Blick schweifen, und ohne darüber nachzudenken, schleicht sich ein Lächeln auf meine Lippen. Einige Augenblicke bin ich vollkommen gefangen von der Schönheit, die sich wie auf einer prächtigen, lebendigen Leinwand vor mir ausbreitet, bevor ich mich wieder in Bewegung setze. Mehr schlecht als recht wuchte ich meine Koffer die Treppe runter, wobei ich konsequent die Lastenträger ignoriere, die ein Geschäft wittern und mich von allen Seiten umschwärmen.
Unten angekommen puste ich mir eine lose hellbraune Haarsträhne aus der Stirn und ziehe mein Handy hervor. Für die Dauer meines Aufenthalts habe ich eine kleine Wohnung bei einer Frau namens Margherita gemietet, die freundlicherweise angeboten hat, mich abzuholen. Zur Sicherheit checke ich noch einmal ihre letzte Mail von heute Morgen:
Von: [email protected]: [email protected]: Re: Arrivo a Venezia
Cara Cleo,
grazie per averci comunicato l’orario di arrivo. Non è davvero un problema venirti a prendere in barca! Ci incontriamo proprio accanto alla fermata del vaporetto 1 – non lo puoi mancare.Tutto il meglio per il tuo arrivo e ci vediamo dopo
Margherita
Jep, da steht, dass es kein Problem für sie ist, mich abzuholen, und wir uns direkt neben der Vaporetto-Haltestelle 1 treffen werden. Ich schaue auf und erkenne die weiß-gelb gestrichenen Haltestellen, die wie schwimmende Häuschen am Kai dümpeln und über schmale Stege mit dem Land verbunden sind. Links von mir befinden sich die Stationen A und B, rechts weisen die Schilder auf C, D und E. Na, ganz toll. Verwirrt lese ich mir Margheritas Nachricht noch einmal durch, doch da steht definitiv eine 1. Hat sie sich nur vertan und meint A?
Ein wenig verzweifelt sehe ich mich noch einmal um, da fällt mein Blick auf einen hölzernen Steg zwischen den Vaporetto-Anlegestellen. Dort hat ein schnittiges Motorboot festgemacht und jemand winkt hektisch in meine Richtung.
Wegen des Standes der Sonne kann ich nur eine Silhouette ausmachen, aber es sollte definitiv eine weibliche Person sein. Hoffnungsvoll mache ich mich auf den Weg, wenn auch im Schneckentempo, weil mir von dem Gewicht allmählich die Arme abfallen und ich ins Schwitzen gerate. Für Anfang März ist es definitiv wärmer, als ich erwartet habe, und ich trage eine selbst geschneiderte Zigarrenhose aus marineblauer Schurwolle mit hohem Bund und einen kurzen hellgrauen Wollpullover. Ich meine, fast jeden einzelnen Schweißtropfen zu spüren, der mir den Rücken runterläuft, und am liebsten würde ich mir das Oberteil vom Leib reißen. Aber dann stünde ich nur noch im BH da, und so gern ich modische Wagnisse mag, das wäre mir doch etwas zu viel.
Auf dem Boot steht eine junge Frau, die jetzt mit einem eleganten Satz an Land springt, um mir entgegenzukommen.
»Ciao, bist du zufällig Cleo?«, ruft sie mir zu. Sie trägt eine gigantische Sonnenbrille und einen grauen Fedorahut, unter dem ein paar dunkelbraune Locken hervorschauen. Wie von selbst scanne ich ihr restliches Outfit und meine Mundwinkel zucken amüsiert: Während ich in meinem dünnen Pulli bereits schwitze, ist sie eingepackt, als würde tiefster Winter herrschen. Schwarze Jeans, ein gefüttertes Sweatshirt und dazu eine olivgrüne Daunenweste, die ihr beinahe bis zu den Knien reicht. Ich habe München bei wirklich kühlen acht Grad und Nieselregen verlassen und mir kommen die Temperaturen hier fast schon frühsommerlich vor. Aber die Italiener frieren sich offenbar noch den Hintern ab. Verrückt.
»Äh ja, und du bist Margherita?« Mein Italienisch ist ein bisschen eingerostet und ich höre mich hölzern an. Ehrlich gesagt bin ich überrascht, dass meine Vermieterin so jung ist. Schätzungsweise sind wir im selben Alter.
Sie grinst und schüttelt den Kopf. »Nein, ich bin ihre Enkelin, Sofia. Nonna traut sich nicht mehr zu fahren, zu viel Verkehr auf dem Canalazzo.« Mit einer lässigen Geste weist sie auf das Chaos aus Motorbooten, Wasserbussen und Kähnen vor uns. Hm, das kann ich nachvollziehen. »Eigentlich sollte ich heute meinen Cousin vom Flughafen abholen, aber meine Großmutter meinte, du bist wichtiger. Er wird richtig beleidigt sein, wenn er das hört.« Sie klingt amüsiert und wirft mir einen Blick zu, der zu sagen scheint: Männer sind doch solche Mimosen. »Komm, ich helfe dir mit deinem Gepäck.«
Ein bisschen überrumpelt von Sofias übersprudelndem Enthusiasmus lasse ich sie einen meiner Koffer nehmen. Sie ächzt überrascht, als ihr klar wird, wie schwer er ist, doch zusammen schaffen wir es, alles im hinteren Teil des Bootes zu verstauen. Anschließend trete ich neben sie ins Führerhaus, wo sie sich selbstbewusst hinters Steuer stellt.
»Es ist wirklich nett von dir, dass du mich abholst. Alleine hätte ich es wahrscheinlich nie durch die Stadt geschafft.«
Sofia steuert das Gefährt rückwärts vom Steg weg und macht währenddessen mit der freien Hand eine wegwerfende Geste. »Schon okay. Ich habe gerade sowieso viel Zeit. Außerdem steckt Nonna mir immer ein wenig Taschengeld zu, wenn ich ihr helfe.« Sie grinst verschwörerisch, und obwohl ich wegen des Hutes und der Sonnenbrille kaum etwas von ihrem Gesicht erkennen kann, ist sie mir direkt sympathisch. Sie hat so eine Art an sich … so offen und herzlich, die dazu führt, dass ich mich entspanne und ihr Lächeln erwidere.
»Erzähl mal, was führt dich nach Venedig?«
Mein Blick klebt an den vorbeiziehenden Palazzi, die lückenlos den Canal Grande säumen und Bilder von längst vergangenen Maskenbällen, prächtig gekleideten Menschen und dekadenten Festbanketten in mir heraufbeschwören. Es juckt mich in den Fingern, mein Skizzenbuch aus der Handtasche zu holen und die Ideen festzuhalten. Fließende meerblaue Seide, Goldstickereien und vielleicht ein wenig Brokat. Erst mit Verspätung dringt zu mir durch, dass Sofia mir eine Frage gestellt hat. Ich reiße mich von dem atemberaubenden Panorama los und versuche, mich daran zu erinnern, was sie wissen wollte.
»Ich studiere Modedesign und beginne am Montag ein sechsmonatiges Praktikum.«
Sofia zieht die Brauen hoch. »Mode? Bist du sicher, dass du hier richtig bist? Nach Mailand geht’s in die andere Richtung.«
Lächelnd schüttele ich den Kopf. »Ich fange bei Ornella Russo an.«
»Oho.« Beeindruckt stößt sie einen Pfiff aus. »Bei der Fürstin von Venedig, nicht schlecht.«
»Nennt man sie hier so?« Mir ist der leise Spott in Sofias Stimme nicht entgangen.
Sie zuckt lässig mit den Schultern.
»Na ja, Venedig ist ein Dorf, wenn man hier geboren und aufgewachsen ist. Es gibt nicht mehr viele eingesessene Venezianer und daher kennt wirklich jeder jeden. Du wirst verstehen, was ich meine, wenn du erst mal ein Weilchen hier bist.«
Mein Lächeln gerät ins Wanken. Das Prinzip Jeder kennt jeden ist mir von zu Hause nur allzu bekannt und eigentlich habe ich mich darauf gefreut, hier ein Niemand zu sein. Nicht die Tochter von Albert und Carmen Sternberg, die mit hochgezogenen Augenbrauen gemustert wird, weil sie so ganz anders ist als ihre Eltern. Unbewusst beginne ich, am Saum meines Oberteils rumzufriemeln.
Nein, sage ich mir streng, so wird es nicht sein. Auch wenn die Leute hier vielleicht gerne tratschen, wissen sie nichts über mich und ich werde mir Mühe geben, so lange wie möglich unter ihrem Radar zu bleiben. Darin bin ich gut. Und mit der Zeit werde ich es schon schaffen, mich anzupassen, bis ich mit dem Rest der Menge verschmelze.
Sofias Blick folgt meinen nervösen Fingern, mit denen ich noch immer an meiner Kleidung zupfe.
»Das ist ein richtig tolles Outfit«, sagt sie. Leider kann ich zu wenig von ihrem Gesicht sehen, um abzuschätzen, wie ernst sie ihr Kompliment meint.
»Danke, die Hose habe ich selbst geschneidert.« Automatisch streiche ich den dunkelblauen Stoff über meinem Oberschenkel glatt, während sich in meiner Brust ein warmer Funke Stolz entzündet. Es ist jedes Mal toll, Komplimente über die Teile zu hören, die ich entworfen und genäht habe, vor allem, wenn sie von Außenstehenden kommen.
Sofia zieht die Sonnenbrille ihre Nase hinunter, bis sie über den Rahmen hinweg meine Klamotten genauer begutachten kann. Dann schaut sie mich mit großen, strahlend blauen Augen an.
»Selbst geschneidert? Also, du hast die genäht?«
Bevor ich antworten kann, ertönt von draußen ein wütendes Hupen. Erschrocken schaue ich durch die Frontscheibe. Im ersten Moment sehe ich nur glänzendes mahagonibraunes Holz und schäumendes Wasser, bevor mein überfordertes Hirn kapiert, was los ist: Sofia war so abgelenkt dadurch, mich zu mustern, dass sie das Boot zu weit nach links gesteuert hat und wir nun beinahe mit einem Wassertaxi kollidieren.
Sofia bemerkt ihren Fehler und reißt im selben Moment mit einem Aufschrei das Steuer herum.
»Merda!«
Ihr heftiges Ausweichmanöver wirft mich fast von den Füßen, doch ich schaffe es gerade noch, mich seitlich am Armaturenbrett festzuhalten, bevor ich mich auf die Nase lege.
Der Fahrer rast so nah an uns vorbei, dass sich unsere Gefährte beinahe streifen, und brüllt uns wütend durch das offene Seitenfenster an. Sofia antwortet ihm mit einigen rüden Gesten und Beschimpfungen, die ich mir dringend merken muss. Italienisch habe ich von meiner Großmutter gelernt, die mich quasi großgezogen hat. Die Feinheiten des italienischen Fluchens hat sie mir allerdings wohlweislich vorenthalten.
»Ich hasse Taxifahrer. Solche Lackaffen«, schnauft Sofia. »Geht’s dir gut? Hast du dir wehgetan?« Sie hält den Blick nun sorgsam auf den Kanal gerichtet, während sie mit mir spricht, und klingt ziemlich besorgt.
»Danke, mir ist nichts passiert.« Mein Herzschlag hat sich zwar noch nicht ganz normalisiert und meine Knie haben die Konsistenz von Marshmallows angenommen, aber ich bin einfach nur froh, nicht unmittelbar nach meiner Ankunft gekentert zu sein.
Sofia schaut sich sorgfältig um, bevor sie das Motorboot nach links lenkt, um in einen Seitenkanal einzubiegen.
Ich muss schmunzeln, als ich an der Ecke ein Verkehrsschild entdecke, das den Wasserweg als Einbahnstraße kennzeichnet. Aber klar, in einer Stadt, in der sogar die Müllabfuhr durch die Kanäle schippert, muss es auch auf dem Wasser Regeln geben. In der engen Durchfahrt, die links und rechts von Häuserwänden eingerahmt ist, tauchen wir in deren Schatten ein. Sofia fährt konzentriert und im Schritttempo durch die Passage, danach biegen wir in einen breiteren, von Fußwegen gesäumten Kanal ein. Hier, abseits des Canal Grande, ist es deutlich ruhiger und so malerisch, dass bestimmt Herzchen in meinen Augen aufleuchten, während ich mich umschaue. Die Hausfassaden sind in warmen Orange- und Gelbtönen gestrichen, und dass an vielen Stellen der Putz abbröckelt und das Mauerwerk zum Vorschein kommt, trägt irgendwie nur noch mehr zum Zauber bei.
Ja, an Venedig nagen die Gezeiten und das Salz, aber das macht die morbide Schönheit dieses Ortes gerade aus. Wir gleiten unter einer steinernen Fußgängerbrücke hindurch, die ziemlich niedrig ist, sodass ich automatisch den Kopf einziehe.
»Also«, nimmt Sofia unser Gespräch von vorhin wieder auf. »Du schneiderst deine Kleider selbst?«
Ich nicke. »Es ist schwer, Kleidung zu finden, die mir gefällt und zu meiner Figur passt. Vieles von der Stange ist so ungünstig geschnitten, dass ich es lieber selbst entwerfe. Meine Nonna hat mir das Nähen als Kind beigebracht.«
Ich spüre den schnellen Blick, mit dem Sofia mich von oben bis unten mustert. Meine Figur ist nach den gängigen Standards alles andere als schlank und hat mir im Laufe der Zeit mehr dämliche oder beleidigende Kommentare eingebracht, als ich zählen kann. Oder stumme, abschätzige Seitenblicke, die manchmal mehr sagen als fiese Worte.
Im ersten Moment wird mein Inneres ganz starr, wie immer wenn ich auf diese Weise angesehen werde. Sofias Augen sind nach wie vor hinter der Sonnenbrille verborgen, weswegen ich ihren Ausdruck nicht wirklich einschätzen kann, aber sie gibt mir nicht das Gefühl, mich mit ihrer Musterung zu verurteilen. Schließlich nickt sie, als könne sie das Problem schlecht sitzender Kleidung trotz ihrer tollen Figur nachvollziehen.
Diese kleine, nonverbale Geste löst meine innere Anspannung, als wäre ein Faden durchtrennt worden, der mir die Brust abgeschnürt hat.
»Du sagtest Nonna, hast du italienische Familie? Du sprichst echt gut.«
Ganz froh darüber, dass sie das Thema Körperformen damit beendet, erwidere ich: »Meine Großmutter mütterlicherseits stammt aus der Nähe von Neapel, kam aber schon als junges Mädchen nach Deutschland. Ich war ständig bei ihr und habe, bis ich in den Kindergarten kam, fast nur italienisch gesprochen.« Die Erinnerung daran lässt mich lächeln, weil es meine Eltern damals zur Weißglut getrieben hat. Aber Nonna konnte sich mit Deutsch nie so richtig anfreunden, und da ich den Großteil meiner Zeit bei ihr verbracht habe, haben wir uns ausschließlich auf Italienisch unterhalten. Was sich spätestens jetzt auszahlt, wie ich finde.
»Neapel also? Was hat sie dir denn noch beigebracht außer Nähen?«
Als ich sie nur verdutzt ansehe, lacht Sofia.
»Du weißt doch, was man über Neapolitaner sagt: Sie werfen ihren Müll aus dem Fenster und manchmal auch die Körper ihrer Feinde.« Nonchalant zuckt sie mit den Schultern. »Wir wohnen jetzt im selben Haus, da sollte ich so was wissen.«
»Körper meiner Feinde?« Perplex starre ich sie an, was sie nur noch mehr zum Lachen bringt. Da hat wohl jemand zu viele Mafiafilme gesehen. Ich will nicht bestreiten, dass es in Neapel manchmal etwas rauer zugehen kann. Nonna hat mir genügend Geschichten über die organisierte Kriminalität im Süden Italiens erzählt, auch wenn ich inzwischen davon überzeugt bin, dass sie absichtlich übertrieben hat, um mir Angst einzujagen.
Nachdem Sofias Lachflash abgeebbt ist und ich ihr versichert habe, dass ich nicht vorhabe, Personen oder Müll aus dem Fenster zu werfen, fahren wir eine Weile in geselligem Schweigen weiter.
Irgendwann ertappe ich mich dabei, wie ich Sofia aus dem Augenwinkel mustere und mir überlege, welcher Stoff sie sein könnte.
Das ist so eine Macke von mir. Wahrscheinlich habe ich zu viel mit Nähmaschinen zu tun, aber ich ordne jedem Menschen einen Stoff zu. Für mich sind Textilien mehr als nur Gewebe. Jede Stoffart kann ihre eigene Geschichte erzählen und hat einen individuellen Charakter, so wie Menschen es auch tun. Manche sind flatterhaft wie Batist oder widerborstig wie Wolle.
Meine Mutter zum Beispiel ist Wildseide: hübsch glänzend, robust und ziemlich unflexibel. Ich glaube nicht, dass sie auch nur ein Kleidungsstück aus diesem Material besitzt, und über meinen Vergleich würde sie nur die Augen verdrehen – oder mich endgültig für verrückt erklären. Deswegen halte ich lieber den Mund, während ich über Sofia nachdenke. Spontan denke ich an luftigen Seidenchiffon, aber wahrscheinlich muss ich sie erst noch besser kennenlernen, um sie einzuordnen.
2
ALESSANDRO
Sofia [11:14]: Sorry, kann dich doch nicht holen, muss was für Nonna erledigen. XX
Mit gerunzelten Brauen betrachte ich die knappe Nachricht meiner Cousine. Ich lese sie zum dritten Mal, seit wir gelandet sind und ich den Flugmodus deaktivieren konnte, doch der Inhalt bleibt derselbe. Trotzdem bin ich fest davon überzeugt, dass sie mich nur verarscht. Ich meine, Sofia hat hoch und heilig versprochen, mich abzuholen, und jetzt lässt sie mich einfach hängen? Und weswegen überhaupt? Sie muss etwas für unsere Großmutter erledigen. Ominöser geht’s ja wohl nicht. Wahrscheinlich hat sie einen Maniküretermin und schiebt Nonna nur als Ausrede vor.
Schon seit dem Start am Flughafen Charles de Gaulle in Paris pocht es hinter meiner Stirn und der Schmerz fühlt sich inzwischen an, als wäre er kurz davor, mir den Schädel zu spalten. Stöhnend streiche ich mir ein paar Haarsträhnen aus der Stirn und stütze mich auf den Griff meines Trolleys. Mir ist klar, dass ich gerade überreagiere und es eigentlich kein Problem ist, ein Taxi zu nehmen, aber die Kopfschmerzen machen mich fertig. Und übellaunig. Wahrscheinlich ist es besser, dass sie nicht hier ist, denn gerade kann ich mich selbst nicht ausstehen und ich will meine Laune nicht an ihr auslassen.
Ein paar Sekunden hält der Plastikhenkel, auf dem ich mich abstütze, mein Gewicht. Dann knackt es und der Bügel schnalzt zurück in Parkposition. Ich verliere das Gleichgewicht, als mein Oberkörper nach vorne kippt und ich beinahe mit dem Kopf voran über den kleinen Hartschalenkoffer stürze. In letzter Sekunde kann ich mich fangen, aber einen Moment lang ist mir so schwindelig, dass ich Angst habe, doch noch auf die Nase zu fallen.
Nein, nicht jetzt. Mit zusammengebissenen Zähnen kämpfe ich darum, meinen Kreislauf in den Griff zu bekommen. Erst nach mehreren tiefen Atemzügen hört die Welt um mich herum auf zu rotieren und die Benommenheit legt sich.
Cazzo. Hastig richte ich mich auf und checke, ob mich jemand bei dieser verflucht peinlichen Aktion beobachtet hat oder, noch schlimmer, eine Kamera auf mich richtet. Ein Foto dieses Fauxpas im Internet kann ich wirklich nicht gebrauchen. Aber auf dem Platz vor dem venezianischen Flughafen Marco Polo wuselt nur eine Touristengruppe herum, die sich vor einem Reisebus sammelt. Niemand schenkt mir Beachtung und ich atme auf. Ich brauche noch einen Augenblick, dann ziehe ich den Griff des Trolleys wieder heraus und mache mich auf den Weg zur Anlegestelle. Der Kopfschmerz dröhnt bei jedem Schritt und es wäre eine Erleichterung, mich jetzt einfach neben Sofia ins Boot setzen und von ihr nach Hause schippern lassen zu können. Auch wenn ich glaube, dass sie irgendjemanden bestechen musste, um ihren Bootsführerschein zu bekommen. Selbst für venezianische Verhältnisse ist ihr Fahrstil ziemlich halsbrecherisch.
Der ausgeschilderte Fußweg zwischen Flughafen und Anleger ist nur einige Hundert Meter lang. Als vor mir das Wasser der Lagune auftaucht, zeigt sich, dass Sofia mich nicht verarscht. Ein letzter Funken Hoffnung lässt mich den Blick prüfend über die verankerten Taxiboote und die Vaporetto-Station schweifen, aber das Motorboot unserer Familie kann ich nirgends entdecken. Meine Cousine mag vielleicht eine Chaosqueen sein, aber pünktlich ist sie immer. Toll. Das bedeutet, sie holt mich wirklich nicht ab. Bei dieser Erkenntnis überrollt mich eine Welle der Erschöpfung, die mich regelrecht lähmt. Die Aussicht, den Wasserbus in die Stadt zu nehmen, ist heute unerträglich. Und als wäre die Müdigkeit allein nicht genug, sammeln sich bereits so viele Leute rund um die Haltestelle … Gott, nein. So ein Gedränge ist das Letzte, was mein fast explodierender Schädel gerade vertragen kann. Dann lieber eines der überteuerten Taxis. Ich steuere auf ein schnittiges Speedboot zu und der Fahrer schiebt sich die Sonnenbrille auf den kahlen Schädel, als er mich kommen sieht.
»Ciao. Ich möchte nach Cannaregio, Campiello dei Miracoli, bitte. Wie viel macht das?«
Der Mann mustert mich mit fachmännischem Blick. Vermutlich registriert er mein Outfit sowie das teure Reisegepäck und ich sehe förmlich die Eurozeichen in seinen Augen aufleuchten.
»Hundertachtzig.«
Verblüfft über so viel Dreistigkeit ziehe ich die Brauen hoch. »Alles klar. Und jetzt den Preis für Einheimische.« Ich bin in den typisch venezianischen Dialekt gewechselt, den ich im Alltag kaum benutze, und beobachte belustigt seine Reaktion: Sein Mund klappt auf und er hat tatsächlich den Anstand, rot zu werden. Stammelnd versucht er, sich zu rechtfertigen. »Nun … ähm … das sind Festpreise.«
Kommentarlos lasse ich den Blick über die anderen wartenden Taxen schweifen.
»Na gut, was sagen Sie zu hundertzwanzig?«
Ich lasse mir Zeit mit meiner Antwort. »Hundert. Plus Trinkgeld, wenn Sie schnell sind.«
Der Mann wischt sich über die glänzende Stirn, doch dann nickt er. Wortlos nimmt er mir den Trolley ab und ich gehe hinter ihm an Bord. Mein Gepäck landet in der niedrigen, überdachten Kajüte im hinteren Teil des Bootes und ich bleibe vorne am offenen Cockpit stehen.
Das Taxi verlässt die Parkposition und beschleunigt auf dem Weg hinaus in die Lagune. Fahrtwind peitscht mir durch die Haare und ruiniert, was ein Heer an Stylisten gestern noch fein säuberlich in Form gebracht hat. Aber – guess what – das ist mir herzlich egal. In den nächsten Wochen will ich nichts von hyperaktiven Friseuren, Set-Assistenten und Fotografen wissen. Gerade fühle ich mich sogar ein wenig wild und überlege, mich ein paar Tage lang nicht zu rasieren.
Stattdessen atme ich tief ein und merke, wie sehr ich die salzige Luft in den letzten Wochen vermisst habe. Sofort werde ich entspannter und habe den Eindruck, dass meine Kopfschmerzen zumindest ein bisschen nachlassen.
Das Schnellboot gleitet über grünliche Wellenkämme, zieht an Bojen und den ersten Inseln vorbei. Eine Weile schließe ich die Augen, genieße das Gefühl der Schnelligkeit, mit der wir über das Wasser rasen, und die Gischt, die mein Gesicht bestäubt.
Da wir vom Flughafen kommen, fahren wir nicht am Markusplatz vorbei, weswegen mir die beeindruckende Kulisse verwehrt bleibt. Unsere Route führt uns an Murano und der Friedhofsinsel San Michele vorbei und ich ziehe mein Handy aus der Hosentasche, als die beiden in Sicht kommen. Ich warte, bis wir etwa auf Höhe von San Michele sind, und beginne zu filmen. Vom chromglänzenden Cockpit schwenke ich hoch und drehe mich langsam, bis ich die ganze Szenerie aufgenommen habe. Als Nächstes öffne ich Instagram, um den Clip in meine Story zu posten. Soll ich einen längeren Text dazu schreiben? Nein, ein einfaches »Back home« reicht vollkommen. Nachdem der Clip hochgeladen ist, mache ich ein paar Selfies, die im Hintergrund das schnittige Boot und das aufgewirbelte Meer zeigen. Nachdem es mit dem Video beim ersten Versuch geklappt hat, brauche ich jetzt länger, um mich für ein Bild zu entscheiden, mit dem ich zufrieden bin. Wenn meine Familie mich dabei beobachtet, wie ich mein Instagram-Profil mit Fotos versorge, lachen sie sich immer halb schlapp und nennen mich einen selbstverliebten Gockel. Sie kapieren einfach nicht, dass das ein Teil meines Jobs ist und mir keine andere Wahl bleibt. Booker und Designer achten bei der Wahl ihrer Models inzwischen fast genauso sehr auf die Followerzahl auf Social Media wie auf die Sedcard.
Ich bemerke den Blick des Taxifahrers, während ich mit meinem Smartphone beschäftigt bin. Auch das kenne ich gut. Die meisten Leute reagieren noch immer irritiert, wenn sich jemand frei heraus selbst fotografiert und posiert, aber dieses Schamgefühl habe ich längst abgelegt. So was kann ich mir nicht leisten, wenn eine knappe Million Follower bespaßt werden muss. Prompt meldet die App die ersten Reaktionen auf die neuen Storys und die rote Zahl über dem Papierflieger-Symbol springt auf 99+ Nachrichten. Ich knirsche mit den Zähnen. Verdammt, später muss ich mir Zeit dafür nehmen.
Fürs Erste stecke ich das Handy weg und sauge den Anblick der näher kommenden Stadt in mich auf. Wir halten direkt auf das nördliche Ende von Cannaregio zu, das Stadtviertel, in dem ich geboren und aufgewachsen bin. Weiter östlich ist sogar der prominente Glockenturm, der am Markusplatz steht, zu erkennen.
»Sagen Sie mal«, überlegt der Fahrer laut, »ich habe das Gefühl, Sie zu kennen.«
Widerwillig reiße ich mich vom Anblick meiner Heimat los. »Ach ja?«
Zugegeben, inzwischen bin ich es gewohnt, gelegentlich erkannt zu werden, aber bei Männern mittleren Alters passiert das eher selten.
Mit konzentrierter Miene betrachtet er mich über den Rand seiner Sonnenbrille hinweg. Abwartend erwidere ich seinen Blick, denn ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass er mich kennt. Außerdem bin ich neugierig, für wen er mich hält.
»Ha! Jetzt weiß ich es!« Sein begeisterter Ausruf kommt so unerwartet, dass ich zusammenzucke.
»Sie sind der Aquaro-Parfüm-Typ. Meine Tochter hat ein Poster von Ihnen in ihrem Zimmer hängen.«
Leute hängen noch Poster an ihre Wände? Während ich mich darüber wundere, taucht vor meinem inneren Auge das Bild von besagter Kampagne auf. Dieses Bild. Der Grund für meinen kometenhaften Aufstieg in den Modelolymp vor knapp zwei Jahren. Als mich der Designer Emmanuele Aquaro engagierte, um seinen neuen Unisex-Duft zu bewerben, war ich noch ein absoluter Niemand. Eines von Hunderten Männermodels mit hübschem Gesicht und Sixpack, die um die wenigen lukrativen Jobs buhlten.
Der Hype kam über Nacht. Bis heute kann ich es mir nicht genau erklären, warum die Aktion dermaßen einschlug. Ich meine, ich bin nicht der einzige Kerl, der sich jemals oben ohne in einem Werbespot gezeigt hat. Das ist nicht sonderlich innovativ.
Aber den Leuten hat es gefallen.
Der Taxifahrer starrt mich weiterhin mit großen Augen an. »Meine Tochter wird durchdrehen, wenn sie erfährt, dass Sie bei mir mitgefahren sind.«
Plötzlich bin ich froh, dass ich ihm nicht meine genaue Adresse genannt habe, sondern den nächstgelegenen Platz. Wahrscheinlich klinge ich größenwahnsinnig, aber wenn ich zu Hause in Venedig bin, kommen immer wieder junge Mädchen vorbei und klingeln. Oder werfen Unterwäsche in den Briefkasten. Kein Witz. Das lässt sich leider nicht vermeiden, weil ich hier aufgewachsen bin und viele Leute mich noch von früher kennen. Leider haben sie scheinbar keine Hemmungen, meine Adresse an hysterische Teenager weiterzugeben. Zum Glück hat es meine Nonna bisher jedes Mal geschafft, sie mit ihrer resoluten Art zu vertreiben … einmal sogar mithilfe eines drohend erhobenen Kochlöffels. Trotzdem …
Der Fahrer steuert das Wassertaxi ins Gassengewirr von Cannaregio, doch das hält ihn nicht davon ab, mich weiter neugierig zu mustern.
»Könnten Sie mir vielleicht ein Autogramm für meine Tochter geben?«
»Ich habe eine bessere Idee. Geben Sie mir mal Ihr Handy?«
Der Mann wirkt verdattert, holt aber dennoch das Gerät hervor und legt es mir in die ausgestreckte Hand.
»Wie heißt Ihre Tochter?«
»Alessia.«
Ich muss das Smartphone nicht entsperren, um die Kamerafunktion zu öffnen und sie im Selfie-Modus auf mich zu richten. In bester Social-Media-Manier grinse ich mich selbst auf dem Display an und starte die Videoaufnahme.
»Ciao, Alessia, ich bin’s, Alessandro Sartori. Dein Vater fährt mich gerade nach Hause und hat mir von dir erzählt. Ich hoffe, du hast einen tollen Tag! Viele liebe Grüße von mir und hey«, ich senke die Stimme und schaue direkt in die Linse, als würde ich Alessia tief in die Augen blicken. »Nur du und Aquaro.« Das ist der superkomplexe Slogan der Parfümkampagne, den ich bereits so oft wiederholt habe, dass er mich bis in meine Träume verfolgt. Zum Abschluss garniere ich den Satz mit einem schiefen Lächeln und zwinkere, ehe ich die Aufnahme beende.
Der Taxifahrer starrt mich an, als wäre mir soeben ein zweiter Kopf gewachsen.
»Autogramme schreiben ist von vorgestern«, erkläre ich lächelnd und gebe ihm das Handy zurück.
Kopfschüttelnd steckt er es zurück in die Tasche seiner Weste. »Diese ganze Internet-Sache werde ich nie verstehen. Aber wenn Alessia sich freut.« Mit ratloser Miene hebt er die Schultern.
Insgeheim stimme ich ihm zu. Von außen betrachtet ist das einfach verrückt. Wann genau hat sich mein Leben so sehr verändert, dass es normal geworden ist, für fremde Mädchen Videobotschaften aufzunehmen, als wäre ich ein verdammter Popstar?
Gott, ich brauche diese Zeit bei meiner Familie wirklich dringender, als ich bisher dachte. Bei ihnen werde ich wieder auf dem Boden der Tatsachen landen und der Alessandro sein können, für den sich die Medien nicht interessieren. Auch wenn sie sich nonstop darüber lustig machen werden, dass ich mein Geld damit verdiene, halb nackt durch die Weltgeschichte zu stolzieren. Damit kann ich leben.
Fünfzehn Minuten später hat der Fahrer das Taxi durch den letzten engen Kanal manövriert und hält an einem Anleger, der eigentlich für Touristengondeln reserviert ist. Ich bezahle die vereinbarten hundert Euro für die Fahrt und lege noch einen Zwanziger obendrauf. Dann schnappe ich mir mein Gepäck aus der Kajüte und mache einen großen Schritt von Bord auf die steinernen Stufen, die vom Wasser hinauf an Land führen. Der Mann hupt zum Abschied, ehe er im Schneckentempo davonschippert. Wie besprochen hat er mich an dem kleinen Platz vor der Kirche Santa Maria dei Miracoli abgesetzt, und als ich zu dem kleinen Bau aufschaue, der wie ein perlmuttverziertes Schmuckkästchen aussieht, breitet sich ein überwältigendes Gefühl von Leichtigkeit in meiner Brust aus. Mein Puls, der immer ein wenig zu schnell ist, beruhigt sich und das Dröhnen hinter meiner Stirn rückt in den Hintergrund.
Zu Hause.
Mit meinem Koffer im Schlepptau begebe ich mich auf den kurzen Fußweg zum Haus meiner Großmutter. Die Rollen knattern wie wütende Gewehrsalven über das unebene Pflaster und ein paar alte Herrschaften vor der Kaffeebar an der Ecke neben der Kirche werfen mir missbilligende Blicke zu. Sicher halten sie mich für einen Touristen und ich muss die Augen verdrehen über die offenkundige Hassliebe der Venezianer zu den Besuchermassen. Die Stadt ist absolut abhängig vom Tourismus und alle wissen das, aber diejenigen Alteingesessenen, die noch übrig sind, sind davon meist wenig begeistert.
Eine Straße weiter laufe ich auf unseren Palazzo zu und krame meine Schlüssel hervor. Egal, wohin ich reise, ich habe sie immer dabei, wie eine Erinnerung daran, wo ich herkomme. Es ist ein unfassbar gutes Gefühl, die Haustür mit dem abblätternden Lack aufzuschließen und ins Atrium zu treten. Sofort umfängt mich die feuchte Luft, die vom Wassergeschoss eine Etage tiefer hochsteigt. Nirgends riecht Moder so gut wie hier. Ich höre Geklapper im Erdgeschoss und steuere wie ein Schlafwandler durch den kurzen Flur darauf zu. Aus dem Augenwinkel nehme ich wahr, dass der Briefkasten, der zu meiner Wohnung gehört, überquillt, doch auch diese Verpflichtung verschiebe ich auf später. Gerade ist was anderes wichtig.
Lautlos trete ich in die Küche und schaue mich um. Meine Großmutter steht mit dem Rücken zu mir an einer der Arbeitsplatten und ist damit beschäftigt, irgendwelche Zutaten klein zu schneiden. Ich muss grinsen. Irgendetwas würde in diesem Haus gehörig falschlaufen, wenn Nonna nicht zu jeder erdenklichen Tageszeit damit beschäftigt wäre, Essen zuzubereiten. Das Kochen ist der Leim, mit dem sie unseren seltsamen Haufen zusammenhält. Ein dumpfes Gefühl in meiner Magengrube signalisiert mir, dass mein Frühstück, bestehend aus einem doppelten Proteinshake und ein paar Beeren, schon viel zu lange her ist. Um nicht weiter drüber nachdenken zu müssen, schiebe ich das Bedürfnis beiseite und gehe einen großen Schritt auf meine Nonna zu.
»Kann es sein, dass dein Lieblingsenkel hier ist und du es gar nicht mitbekommst?«
Die schmale Gestalt meiner Großmutter spannt sich einen Moment lang an und sie hält in der Bewegung inne, doch im nächsten Moment fährt sie herum und stößt einen spitzen Schrei aus.
»Alessandro!« Mit einem beeindruckenden Fleischermesser in der Hand stürzt sie auf mich zu, so agil auf ihren Absatzschuhen, wie man es einer Frau ihres Alters gar nicht zutrauen würde. Man muss es mir wirklich zugutehalten, dass ich angesichts der auf mich gerichteten Klinge nicht zurückzucke. Stürmisch schließt Nonna mich in die Arme, wobei versehentlich der Messergriff gegen meinen Hinterkopf knallt. Mir entfährt ein Fluch, wofür ich wiederum einen strafenden Klaps gegen die Schulter ernte.
»So habe ich dich nicht erzogen!«
Mit einem zerknirschten Lächeln befreie ich mich von ihr, um mich außer Reichweite zu bringen. »Das mit der Erziehung hat deine Schwiegertochter verbockt. Du konntest nur noch Schadensbegrenzung betreiben.«
Bei der Erwähnung meiner Mutter verzieht Nonna belustigt den Mund. »Mirella hat getan, was sie konnte. Inzwischen fürchte ich, dass du von Anfang an ein unerziehbarer Satansbraten warst.«
Mit einem theatralischen Seufzen lege ich mir die Hand aufs Herz. »Das sagst du jetzt, nachdem du mich jahrelang den Stolz deiner Existenz genannt hast? Ich glaube, du hast die ganze Zeit geflunkert.«
Nonna bricht in Gelächter aus. »Du bist ein Schlimmer, Alessandro. Und Mirella sieht das übrigens ganz genauso. Wir haben gestern telefoniert, ich soll dir Grüße ausrichten.«
Bei der Erwähnung meiner Mutter macht sich ein wehmütiges Gefühl in mir breit. Es wäre schön, wenn sie und mein Vater auch hier sein könnten, aber es ist selten geworden, dass sich unsere Besuche in Venedig überschneiden. Das letzte Mal habe ich es vor einem halben Jahr geschafft, sie zu sehen. Als ich einen Zwischenstopp bei einer ihrer Ausstellungseröffnungen in London einlegen konnte, bevor ich weiter nach Singapur musste. Wahrscheinlich habe ich die Veranlagung zum Nomadenleben von meinen Eltern mitbekommen, die es selten lange an einem Ort aushalten. Mein Vater und sein Zwillingsbruder sind ein international erfolgreiches Künstler-Duo, meine Mutter ihre Managerin. Seit ich mich erinnern kann, tingeln die drei als eingeschworenes Trio von einer Kunstmesse zur nächsten oder verschanzen sich in ihrer Werkstatt, um an neuen Objekten zu arbeiten. Mein letzter Stand ist, dass sie sich gerade auf die Messe Art Basel im Juni vorbereiten.
Nonna und mein verstorbener Großvater waren es, die mich aufgezogen und mir die Stabilität gegeben haben, die meine Eltern mir nicht bieten konnten. Später nahmen sie dann auch meine Cousine Sofia auf, nachdem ihre Mutter sie und Onkel Vito verlassen hat, als sie noch ein Kleinkind war.
Ich liebe meine Eltern, aber Nonna bedeutet mir einfach alles auf der Welt.
Sie mustert mich mit einem zufriedenen Blick, wie ihn nur Großmütter beherrschen. Der unverkennbare Stolz in ihren Augen macht mich ein wenig verlegen. Aber ehrlich? Insgeheim aale ich mich darin. Obwohl ich in meinem Job so viel Applaus und Bewunderung ernte, ist das alles doch nichts als Speichelleckerei im Vergleich zu dem hier. Tut gut, mich mal wieder daran zu erinnern.
Schnell beuge ich mich vor und drücke ihr hörbar einen Schmatz auf die Wange. Lachend schiebt sie mich weg und fuchtelt erneut mit ihrem Hackebeil in der Luft herum.
»Es ist so schön, dass du da bist. Ich bin gerade dabei, Spaghetti zu kochen, mit Meeresfrüchten. Die magst du doch so gern.« Schwatzend wendet sie sich wieder der Arbeitsfläche zu und bemerkt zum Glück nicht, wie meine Miene gefriert. Ja, ich habe Hunger, aber eine Spaghetti-Völlerei à la Nonna? Gar keine gute Idee.
Vorsichtig bewege ich mich rückwärts in Richtung Tür.
»Du bist so schmal geworden«, fährt meine Großmutter munter fort, während sie einen Tintenfisch zerteilt. »Aber kein Wunder, diese Modeleute geben dir auch kein richtiges Essen. Ich sage ja immer … Moment, wo willst du hin?« Sie schaut über die Schulter und ihre Augen weiten sich alarmiert. Mir entgeht nicht, dass sie noch immer das Messer umklammert, und so wie ich sie kenne, würde sie nicht zögern, mich damit zu bedrohen, damit ich bleibe und »ordentlich« esse. Ich habe ihr schon so oft erklärt, worauf ich bei meinem Ernährungsplan achten muss, aber Ausführungen über Makronährstoffe und Low-Carb-Intervalle sind bei ihr bisher jedes Mal auf taube Ohren gestoßen. Wenn ein Gericht nicht zu drei Vierteln aus Kohlenhydraten besteht, vorzugsweise Pasta, gilt es in ihren Augen nicht als vollwertige Mahlzeit.
Inzwischen stehe ich wieder nah genug an der Tür und fasse nach dem Griff meines Koffers. »Weißt du, ich bin gerade erst angekommen und mein Briefkasten quillt über, darum muss ich mich echt mal kümmern. Außerdem muss ich noch bei ein paar Freunden vorbeischauen.« Ich bin schon halb zur Tür raus. Der Mund meiner Großmutter öffnet sich für einen letzten Protest, doch ich gebe ihr keine Gelegenheit dazu.
»Sorry, Nonna, wir sehen uns später. Versprochen!« Und so schnell, dass ich mich fast schäme, bin ich aus der Küche verschwunden.
3
CLEO
So etwas wie diesen Hauseingang habe ich noch nie gesehen. Wir schippern langsam ins Innere des Gebäudes, als würden wir eine Garage benutzen. Eine, deren Wände mit schmierig grünen Algen überzogen sind. In einer Ecke entdecke ich Steinstufen, die aus dem Wasser ragen. Insgesamt erinnert mich die Atmosphäre an eine Tropfsteinhöhle. Sofia springt direkt aus dem Führerhaus auf den Treppenabsatz, vertäut das Boot mit einigen geschickten Handgriffen und hilft mir dann raus. Meine Knie fühlen sich wackelig an, als ich endlich wieder festen Boden unter mir spüre.
Zum Glück kümmert sich meine neue Nachbarin darum, meine Koffer zu entladen.
»Das wird verdammt anstrengend, die Dinger hoch in dein Apartment zu bringen.«
»Du musst mir nicht helfen, das schaff ich schon«, wiegele ich sofort ab, doch Sofia schnalzt nur mit der Zunge.
»Wie arschig wäre das denn? Komm, jetzt lernst du erst mal meine Nonna kennen.«
Wir schleppen mein Gepäck aus dem muffig feuchten Wassergewölbe die Steintreppe hinauf, wo wir es in einer Art Eingangshalle abstellen.
»Hier kommt man rein, wenn man den Landeingang benutzt.« Sie deutet auf eine Tür am anderen Ende des saalartigen Raumes. Dort hängt eine Reihe von Briefkästen, wobei mir einer besonders ins Auge sticht, da er aus allen Nähten zu platzen scheint. Bevor ich fragen kann, was es damit auf sich hat, fährt Sofia munter fort, von dem Haus zu erzählen, während sie mich durch den Eingangsbereich führt.
»Früher war das hier das Anwesen eines schwerreichen Händlers – kein Patrizier-Palazzo wie die am Canalazzo, aber definitiv groß genug, um sich was darauf einzubilden. Irgendwann kam es in den Besitz meiner Familie und nach dem Krieg haben sie beschlossen, alles in Wohnungen aufzuteilen. Meine Nonna ist das unangefochtene Familienoberhaupt und sie hat … hmm … eine Schwäche dafür, verlorene Seelen aufzusammeln und hier wohnen zu lassen.« Sofia wackelt mit den Augenbrauen und stößt mit der Schulter eine angelehnte Tür auf.
Verlorene Seelen also. Ob sie sich auch dazuzählt?
Hinter ihr betrete ich einen Raum, der sich als großzügige Wohnküche herausstellt. Es ist etwas dunkler, weil wir uns im hinteren Teil des Hauses befinden, aber eine große gläserne Flügeltür führt hinaus in einen begrünten Innenhof und spendet etwas natürliches Licht. Mittig steht ein rustikaler Holztisch mit einem bunten Sammelsurium an Stühlen drum herum, der Rest der Küche wird von einem Herd aus Gusseisen und polierten Edelstahlarbeitsplatten eingenommen. Kräuterbündel und Kupfergeschirr hängen von der Decke und es duftet nach … mein Magen knurrt jäh, was mir sofort todpeinlich ist. Ich verschränke die Hände vor dem Bauch, aber ich kann mich dem verführerischen Geruch nach Knoblauch und gebratenem Fisch nicht entziehen. Prompt lässt mich mein rebellisches Verdauungsorgan schmählich im Stich und grollt noch einmal laut.
Eine Frau, die mit dem Rücken zu uns am Herd steht und gerade eine Pfanne schwenkt, dreht sich um. Ich schätze sie auf etwa Mitte sechzig und ein strahlendes Lächeln breitet sich auf ihrem Gesicht aus, als sie uns sieht. Ihre Lachfältchen sind die einzigen Altersanzeichen in ihrem Gesicht, ansonsten wirkt sie total jugendlich.
»Bellezza!«, ruft sie und breitet die Arme aus, um ihre Enkelin in Empfang zu nehmen. Man könnte meinen, dass sie sich monatelang nicht gesehen haben. Sofia verzieht ein wenig gequält das Gesicht.
»Nonna, das ist Cleo.« Mit der Hand wedelt sie in meine Richtung und tritt einen Schritt zurück, um sich der Begrüßung ihrer Großmutter zu entziehen, während ich etwas befangen am Eingang stehen geblieben bin.
Sofias Großmutter schaut in meine Richtung und das Strahlen in ihrem Gesicht nimmt sogar noch ein bisschen zu. Wenn sie nicht so nett aussähe, würde ich mich jetzt ein wenig fürchten. Doch sie kommt mit klackernden Absätzen auf mich zu und zieht mich in eine Umarmung, die auch von meiner eigenen Nonna sein könnte.
»Herzlich willkommen! Wie schön, dass du bist hier«, sagt sie in holprigem Deutsch. Ihre silberblonden Locken kitzeln mich an der Nase.
»Cleo spricht Italienisch«, erklärt Sofia belustigt.
»Tatsächlich?« Lächelnd löst sie ihre Umarmung und tritt einen Schritt zurück.
»Ja, ich habe eine italienische Großmutter.« Diesmal erwähne ich sicherheitshalber nicht, dass Nonna Liliana aus Neapel stammt. »Ich freue mich auch sehr, hier zu sein, Signora Sartori.«
Sie winkt ab. »Bitte, nenn mich Margherita. Willkommen in unserem Haus.« Liebevoll tätschelt sie meine Wange, dann wuselt sie zurück zum Herd.
»Ich war gerade dabei, eine Kleinigkeit für Alessandro zu kochen, aber er musste weg, ihr habt ihn ganz knapp verpasst.« Irre ich mich oder blinzelt sie mir bei diesen Worten verschwörerisch zu?
Sofia lässt sich mit einem theatralischen Seufzer auf einen Rattanstuhl am Küchentisch fallen. »Wahrscheinlich hat er Angst, sein Sixpack zu verlieren, wenn du ihn mit Kohlenhydraten vollstopfst, und hat die Flucht ergriffen.«
Margherita, die gerade einen Topf Spaghetti abgießt, zieht einen Flunsch. »Er ist hier, um sich zu erholen. Madonna, er wirkt so gestresst, vollkommen ausgelaugt! Da hilft nichts besser als Essen.«
Oh, da kann ich ihr nur zustimmen. Mit wässrigem Mund beobachte ich, wie sie die Nudeln in eine Pfanne voller Meeresfrüchte kippt und alles mit zwei großen Löffeln vermengt.
Wer auch immer dieser Alessandro ist, er verpasst hier definitiv etwas. Sixpack hin oder her.
Wie hypnotisiert lasse ich mich auf einen Stuhl gegenüber von Sofia sinken.
»Jetzt seid ihr Mädchen ja hier. Ihr esst mit mir, si?« Margherita, die bereits Teller in der Größe von Servierplatten mit Essen belädt, erwartet offensichtlich keinen Widerspruch von uns. Sofia zieht eine Karaffe mit Wasser zu sich heran und beginnt, drei Gläser zu befüllen.
»Daran wirst du dich gewöhnen«, raunt sie mir zu. »Deine Wohnung hat zwar eine kleine Küchenzeile, aber Nonna wird dir keine Gelegenheit dazu geben, sie häufig zu benutzen. Zum Glück kocht sie ganz passabel.«
Der letzte Satz bringt ihr einen kleinen strafenden Klaps auf den Hinterkopf von ihrer Großmutter ein.
Und dann stehen die Teller vor uns. Beim Anblick des Gerichts möchte ich am liebsten vor Entzückung in Ohnmacht fallen. Ich bin mitten in der Nacht aufgebrochen, um hierherzureisen, und habe nur ein labberiges Sandwich aus dem Bahnhofskiosk und ein paar Kekse im Magen. Dagegen kommen mir diese Spaghetti vor wie der Himmel auf Erden.
Ein paar Minuten essen wir drei schweigend, einzig unterbrochen von den wohligen Geräuschen, die ich nicht unterdrücken kann. Frische Meeresfrüchte, Knoblauch und Kirschtomaten. Das ist so verdammt lecker …
Sofia und Margherita tauschen einen belustigten Blick.
»Schmeckt’s?«, fragt Sofia mit vollem Mund.
Ich nicke begeistert, zwinge mich aber zu schlucken, ehe ich was sage. »Das ist so gut … Das zu essen fühlt sich an wie eine Ganzkörperumarmung.«
Margherita strahlt mich an, als hätte ich ihr das größte Kompliment überhaupt gemacht.
Ich liebe gutes Essen, das war schon immer so. Eine köstliche Mahlzeit macht mich einfach rundum glücklich und ich habe schon vor einer Weile akzeptiert, dass ich mit dieser innigen Beziehung zu Kohlenhydraten und Zucker wohl niemals Modelmaße haben werde. Ja, auch ich habe schon etliche Diäten hinter mir, aber schlussendlich sind mir Nudeln und Brot einfach zu wichtig, um sie langfristig von meinem Speiseplan zu verbannen. Niemand kann mir erzählen, dass man nur von Grünkohl und Eiweißshakes glücklich wird.
»Luca hat mir den Fisch heute Morgen frisch vom Markt am Rialto geholt, er ist ja so ein guter Junge.« Margherita schaut weiterhin breit lächelnd in die Runde.
Wer auch immer Luca ist. Allmählich beginnt mir von all den Namen der Kopf zu schwirren.
»Luca wohnt auch hier. Du wirst ihn noch kennenlernen«, verspricht Sofia, die meinen verwirrten Blick bemerkt. »Nonna versucht, uns zu verkuppeln.« Aus ihrem Tonfall ist herauszuhören, dass sie diese Versuche allerdings nicht besonders ernst nimmt.
Margherita schnappt nach Luft. »Das stimmt doch gar nicht!«
»Du denkst vielleicht, dass du subtil vorgehst, aber du bist so unauffällig wie ein Gorilla im Ballettröckchen.«
Ihre Großmutter runzelt bei diesem Vergleich die Stirn. Indes beugt sich Sofia über den Tisch zu mir vor. »Pass besser auf, sie will alles und jeden verkuppeln.«
»Nur weil ihr jungen Leute heutzutage schlicht unfähig seid, selbst für euer Glück zu sorgen. Immer so zögerlich und unentschlossen. In eurem Alter war ich bereits verheiratet und habe es vierzig Jahre lang keinen Tag bereut.«
Mit einem traurigen Lächeln, als würde sie in alten Erinnerungen schwelgen, wirft sie einen Blick auf ein gerahmtes Schwarz-Weiß-Foto neben der Tür. Es ist umringt von Täfelchen, die Engelsfiguren und Heilige zeigen, und an der Ecke des Rahmens klemmt ein kleines Blumensträußchen aus Plastik. Das Bild zeigt einen Mann, der zwar ernst in die Kamera schaut, doch um dessen Mundwinkel ein klammheimliches Lächeln zu erkennen ist.
Sofia legt eine Hand auf die ihrer Großmutter und drückt sie sanft. »Wir alle vermissen Nonno. Aber du musst zugeben, dass du einfach unverschämtes Glück mit ihm hattest und er ebenso mit dir. Männer wie ihn gibt es heute nicht mehr.« Mit einem wehmütigen Lächeln betrachtet sie das Foto ihres Großvaters.
Ein wenig befangen senke ich den Blick auf meinen Teller und drehe die letzten Nudeln auf meine Gabel.
»Das riecht ja fantastisch hier!«
Ich blicke auf, als hinter mir eine männliche Stimme ertönt.
Ein junger Mann mit wilden dunkelbraunen Locken kommt in die Küche geschlendert und lächelt unbekümmert in die Runde. Sein Blick bleibt an mir hängen.
»Ah, hallo, Luca, mein Lieber!« Margherita springt wie der Blitz von ihrem Platz auf und wuselt zur Anrichte, um unaufgefordert einen weiteren Teller mit Pasta zu beladen.
»Wenn man vom Teufel spricht! Signor Pavarotti persönlich«, ruft Sofia spöttisch, während sich der junge Mann Besteck aus einem Küchenschrank holt und zu uns an den Tisch kommt, um sich auf den Platz neben Sofia fallen zu lassen.
»Sind wir immer noch schlecht gelaunt?«
Sofia schnaubt. »Ich wäre dir einfach sehr verbunden, wenn du deine Arien nicht rund um die Uhr üben würdest. Manche Menschen arbeiten nachts und brauchen ihren Schlaf.«
Das Lächeln auf Lucas Gesicht wird boshaft und er senkt die Stimme. »Ach so, du nennst das arbeiten? Sah mir eher nach einer durchzechten Nacht aus, als du heimgekommen bist.«
Schockiert reißt Sofia die Augen auf und schielt zu ihrer Großmutter, doch die ist noch mit seinem Teller beschäftigt und hat Lucas Kommentar offenbar nicht gehört.
»Das ist kein Gesang, sondern Lärmbelästigung!«, zischt Sofia und lässt Lucas Kommentar bezüglich der durchzechten Nacht gekonnt unter den Tisch fallen.
»Wenn du Schlafenszeiten wie ein normaler Mensch hättest, gäbe es keine Probleme«, gibt Luca noch leiser zurück.
»Sofia!«, ruft Margherita bestürzt. Die Spitze ihrer Enkelin ist ihr offenbar nicht entgangen. »Lucas Stimme ist wunderschön. Wenn er wollte, könnte er in der Scala auftreten, das sage ich immer wieder!«
Luca legt sich die Hand auf die Brust und deutet eine Verbeugung an. »Danke, aber es ist wirklich nur ein Hobby.« Danach wendet er sich mir zu. »Hi, wir kennen uns noch nicht. Ich bin Luca.« Sein Lächeln ist so offen und fröhlich, dass ich es wie von selbst erwidere.
»Cleo. Schön, dich kennenzulernen.«
»Sie ist eben erst hier angekommen, hab sie vom Bahnhof abgeholt«, fügt Sofia hinzu und schenkt uns allen Wasser nach.
»Hab ich mir schon fast gedacht. Willkommen in der Casa Sartori.« Luca prostet mir freundschaftlich zu und wir stoßen an.
»Was bringt dich nach Venedig?«, erkundigt sich Luca und ich erzähle ihm von meinem Praktikum. Die Tatsache, dass es schon übermorgen losgeht, lässt mein Nervositätslevel schlagartig ansteigen.
»Ich wünschte wirklich, Alessandro wäre auch zum Essen geblieben.« Margherita ist zum Tisch zurückkehrt und schaut mit gerunzelter Stirn auf den freien Stuhl neben mir.
Luca schluckt schnell, ehe er fragt: »Er ist schon hier?«
»Ja, er ist kurz vor Sofia und Cleo angekommen. Aber so schnell, wie er gekommen ist, war er auch schon wieder weg.« Ihr Blick gleitet zu mir, und als sie meinen fragenden Gesichtsausdruck bemerkt, erklärt sie: »Alessandro ist ebenfalls mein Enkel und beruflich die meiste Zeit des Jahres unterwegs. Gerade ist er hier zu Besuch, um eine Pause einzulegen. Es wäre schön gewesen, wenn er uns beim Mittagessen Gesellschaft geleistet hätte.«
Interessiert nicke ich. Sofia hat diesen Alessandro vorhin bereits erwähnt und besonders der Teil über seinen Beruf weckt meine Neugier.
Ihre Enkelin streckt über den Tisch eine Hand nach Margherita aus. »Gib Ale ein paar Tage, um anzukommen, Nonna. Ich werde später mal bei ihm vorbeischauen und ihm etwas zu essen bringen, si?«
Margherita schnalzt mit der Zunge und schüttelt mit noch immer besorgter Miene den Kopf. »Ich mache mir Sorgen um den Jungen. Irgendwas stimmt da nicht …«