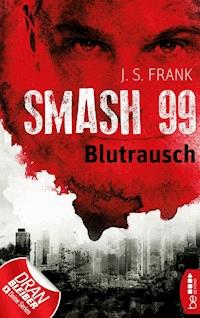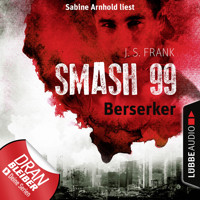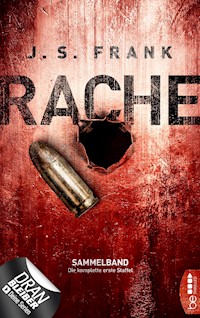4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Ein fremdartiges Toxin verbreitet sich rasend schnell. Wer damit infiziert wird, verwandelt sich innerhalb von Sekunden in einen vor Wut rasenden »Smasher«, der seine Mitmenschen anfällt und zerfetzt, bevor er selbst stirbt. Niemand weiß, wer hinter der Verbreitung des Gifts steckt. Klar aber ist: In einer Gesellschaft am Rande des Zusammenbruchs sind die Infizierten nicht dein größer Feind ...
Ein actionreicher und brutaler Endzeit-Thriller für alle Horror-Junkies, Fans von »The Walking Dead« und Leser von Guillermo del Toro.
Achtung: Nichts für schwache Nerven!
Dieses eBook beinhaltet die fünf zusammenhängenden Kurzromane, die ursprünglich unter dem Titel »Smash99« erschienen sind.
eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 747
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Inhalt
Cover
Weitere Titel des Autors
Über dieses eBook
Über den Autor
Titel
Impressum
BUCH 1
1. Kapitel: Verdammte Montage
2. Kapitel: Willkommen im Smash-Zeitalter
3. Kapitel: Das verlorene Paradies
4. Kapitel: Was Sie schon immer über Smash wissen wollten …
5. Kapitel: Zeit für ein Plädoyer
6. Kapitel: Verlass mich nicht …
7. Kapitel: Echte Freunde
8. Kapitel: Götterdämmerung
9. Kapitel: Gegen alle Widerstände
10. Kapitel: Die Rache des Erlkönigs
BUCH 2
1. Kapitel: Der Anschlag
2. Kapitel: Die Explosion
3. Kapitel: Der Bunker
4. Kapitel: Das Begräbnis
5. Kapitel: Die Ermittlungen
6. Kapitel: Das Verhör
7. Kapitel: Das Attentat
8. Kapitel: Die Ruhe vor dem Sturm
9. Kapitel: Das Blutbad
10. Kapitel: Der letzte Tanz
Epilog
BUCH 3
1. Kapitel: Cage-Fight
2. Kapitel: Bar-Fight
3. Kapitel: Street-Fight
4. Kapitel: Aufräumarbeiten
5. Kapitel: Peinliche Befragung
6. Kapitel: Patient X
7. Kapitel: Mephisto
8. Kapitel: Smasher-Fight
9. Kapitel: Erlösung
10. Kapitel: Abrechnung
Epilog
BUCH 4
1. Kapitel: Blutiger Asphalt
2. Kapitel: Töten und Übertöten
3. Kapitel: Die Schlangengrube
4. Kapitel: Die Kämpfer
5. Kapitel: Der Fremde
6. Kapitel: Die Rekrutierung
7. Kapitel: Das Himmelfahrtskommando
8. Kapitel: Startschuss
9. Kapitel: Showdown
10. Kapitel: Overkill
BUCH 5
1. Kapitel: Smasher-Jagd
2. Kapitel: Sniper und andere Menschen
3. Kapitel: Leben unter Geiern
4. Kapitel: Die Koma-Station
5. Kapitel: Die Securitate
6. Kapitel: Das Geständnis
7. Kapitel: Smash im Sonderangebot
8. Kapitel: Smash frei Haus
9. Kapitel: Die Smash-Station
10. Kapitel: Der Tod ist nicht das Ende
Leseprobe
Weitere Titel des Autors
RACHE – Der Informant
RACHE – Eine alte Rechnung
RACHE – Vertrauen ist tödlich
RACHE – Ein Tier in der Falle
RACHE – Auge um Auge
RACHE – Die letzte Zeugin
Über dieses eBook
Ein fremdartiges Toxin verbreitet sich rasend schnell. Wer damit infiziert wird, verwandelt sich innerhalb von Sekunden in einen vor Wut rasenden Berserker, der seine Mitmenschen anfällt und zerfetzt, bevor er selbst stirbt. Niemand weiß, wer hinter der Verbreitung des Gifts steckt. Klar aber ist: In einer Gesellschaft am Rande des Zusammenbruchs sind die Infizierten nicht dein größer Feind …
Dieses eBook besteht aus fünf zusammenhängenden Kurzromanen. Sie erschienen ursprünglich unter dem Titel »Smash99«.
Über den Autor
J.S. Frank hat nach seinem Germanistik-Studium mehr als zwanzig Jahre für ein internationales Medien-Unternehmen gearbeitet. Seit 2013 ist er freier Autor mit einem Faible für die anglo-amerikanische und französische Literatur. J.S. Frank ist ein Pseudonym des Autors Joachim Speidel, der mit seinen Kurzgeschichten bereits zweimal für den Agatha-Christie-Krimipreis nominiert war.
J.S. FRANK
INFIZIERT
ÜBERLEBEN IN ZONE 0
beTHRILLED
Sammelband
»be« – Das eBook-Imprint der Bastei Lübbe AG
Dieses eBook erschien ursprünglich in fünf Bänden unter dem Titel »Smash99«
Für die Originalausgabe: Copyright © 2016 by Bastei Lübbe AG, Köln
Für diese Ausgabe:Copyright © 2020 by Bastei Lübbe AG, Köln
Lektorat/Projektmanagement: Stephan Trinius / Lukas Weidenbach
Textredaktion: Uwe Voehl
Covergestaltung: © Massimo Peter
eBook-Erstellung: Jilzov Digital Publishing, Düsseldorf
ISBN 978-3-7517-0168-6
Dieses eBook enthält eine Leseprobe des in der Bastei Lübbe AG erscheinenden Werkes »RACHE – Der Informant« von J.S. Frank.
www.luebbe.de
www.lesejury.de
Buch 1BLUTRAUSCH
1. Kapitel: Verdammte Montage
Ich erinnere mich noch genau an den Tag, an dem ich zum ersten Mal mit ansah, wie sich innerhalb einer halben Minute ein ganz normaler Mensch in einen Smasher verwandelte und anschließend eine Frau im wahrsten Sinne des Wortes zerfetzte.
Es war Montag, der 16. März. Es war kurz vor sieben Uhr. Wie viele andere wartete ich an diesem Morgen in der U-Bahn-Station auf die Linie 9. Sie hatte Verspätung, und man warf ungeduldige Blicke auf die Anzeigetafeln und hoch zu den Lautsprechern, aber vom Verkehrsverbund sah sich noch niemand in der Lage, irgendwelche Informationen zu der Verspätung zu geben.
Für einen Märzmorgen war es verdammt kalt. Die Menschen hatten wieder ihre Wintersachen aus dem Schrank geholt und sich in ihre Mäntel und dicken Jacken eingehüllt.
Als schließlich eine scheppernde Stimme aus den Blechkästen an der Decke die knappe Mitteilung herauskrächzte, dass die Linie 9 etwa zehn Minuten später käme, war den Wartenden anzumerken, dass sie mit ihrer Geduld bald am Ende waren.
Verärgertes Gemurmel wurde laut, vereinzelt sogar spöttisches Gelächter. Köpfe wurden ungläubig geschüttelt und Smartphones hastig gezückt, um diese News übellaunig weiterzugeben.
Zehn Minuten konnten eine ätzend lange Zeit sein.
Eine große Frau stapfte schwer atmend die Treppe herunter und sah sich verwundert um, weil so viele Menschen am Bahnsteig warteten. Sie mochte etwa Mitte fünfzig sein und war stark übergewichtig. Trotz der Kälte trug sie ihren braunen Fell-Wintermantel offen. Sie stellte sich an eine Aushangvitrine und begann die Nahverkehrsverbindungen zu studieren.
Als sie sich wieder umdrehte, schien sie auch nicht schlauer geworden zu sein. Sie machte ein verdrießliches Gesicht. Nach einer Weile fing sie an zu husten. Und das Husten wurde mit der Zeit immer heftiger und ging schon bald in ein kurzatmiges Bellen über. Da half es auch nicht, dass sie die Hand vor den Mund hielt.
Man kehrte ihr den Rücken und ging deutlich auf Abstand, schließlich konnte man nicht wissen, ob sie sich nur verschluckt hatte oder ob sie schlimm erkältet war.
Auch ich trat ein paar Schritte zurück. Ihr Bellen tat mir in den Ohren weh.
Nur ein Mann schien davon gänzlich unbeeindruckt zu sein. Er blieb ganz in ihrer Nähe, den Kragen seines Trenchcoats hochgeschlagen, so als könne ihn nichts erschüttern. Er war schlank und irgendwo zwischen dreißig und vierzig Jahre alt. Er hatte trendige weiße Design-Kopfhörer auf und schien in sich zu ruhen.
Die U-Bahn auf dem Gegengleis fuhr ein, begleitet von den entsprechenden Durchsagen. Als sie nach einer Weile die Station wieder verließ, war von dem Bellen nichts mehr zu hören.
Die große Frau schien nun alles im Griff zu haben. Sie atmete befreit durch. Ihre geröteten Wangen leuchteten. Mit einem Ärmel ihres Mantels begann sie, vorsichtig den Schweiß von der Stirn zu tupfen.
Ihr Husten war Vergangenheit, aber wie aus dem Nichts baute sich auf einmal ein ganz anderes Geräusch auf.
Ein Keuchen, das langsam in ein Knurren überging.
Es war schwer zu lokalisieren, aber so weit weg konnte es nicht sein. Es wurde lauter und lauter. Schon bald war die ganze U-Bahn-Station erfüllt von einem tiefen, röchelnden Knurren.
Erst jetzt sah ich, dass etwas mit dem Mann im Trenchcoat nicht stimmte.
Er riss die Kopfhörer herunter, machte den Rücken rund, beugte die Knie, verkrampfte sich und schlug die Hände über dem Kopf zusammen. So als würde er von einem plötzlichen, gigantischen Migräne-Anfall heimgesucht. Er verfiel in ein wildes Zittern, das in ein wahnsinniges Zucken überging. Es sah so aus, als stünde er unter Strom. Schaum bildete sich vor seinem Mund. Das Zucken wurde schneller und schneller, und seine Augen schienen sich um das Vielfache zu vergrößern. Auf einmal erstarrte er, und sein ganzer Körper spannte sich derart an, als bestünde er nur noch aus einem einzigen, gewaltigen Muskel.
Als die Ersten fluchtartig die Treppen hochrasten, umso schnell wie möglich von hier wegzukommen, wusste ich, dass es jetzt auch für mich an der Zeit war abzuhauen. Und zwar sofort! Augenblicklich! Auf der Stelle! Aber meine Füße schienen in Beton zu stecken. Ich kam nicht los. Ich konnte mich keinen Zentimeter rühren.
Auch der großen Frau schien es so zu gehen wie mir. Sie wirkte wie versteinert. Ihre angstgeweiteten Augen waren auf den Mann im Trenchcoat geheftet, der keine zwei Meter entfernt von ihr stand.
Im nächsten Moment bäumte er sich auf und fiel sie an. Wie ein Löwe eine Antilope. Er packte sie. Verbiss sich in ihr. Zerfetzte mit seinen Zähnen ihre Halsschlagader. Seine Finger, zu Klauen geformt, gruben sich durch ihren dünnen Pullover in ihren Leib, zogen und rissen an ihr, bis Woll- und Fleischfetzen durch die Gegend flogen.
Als sie mit dem Rücken auf den Betonboden knallte, warf er sich auf sie und begann, in einem wahnsinnigen Stakkato und mit ungeheurer Wucht auf ihren Leib einzuhämmern. Seine Fäuste durchschlugen ihre Haut, ihr Fettgewebe und ihre Muskeln. Man hörte Knochen brechen und die schmatzenden Geräusche, als er Krater um Krater in ihren Leib schlug. Ihre Eingeweide verteilten sich auf dem Bahnsteig. Blut spritzte auf, als er, die Arme wie Dreschflegel schwingend, immer und immer wieder auf ihren Körper eindrosch.
Die Frau war tot. Ohne Zweifel. Wahrscheinlich war sie bereits in den ersten Sekunden tot gewesen, aber der Mann schlug immer noch auf sie ein, sogar noch, als seine eigenen Finger, Hände, Unterarme, Ellenbogen brachen. Er hörte auch nicht auf, als die zersplitterten Knochen seiner Armknochen wie spitze Dolche durch die Ärmel des Trenchcoats stachen, bleiche Zeugnisse der eigenen Selbstzerstörung.
Am Ende brach der Mann zusammen, das Knurren ließ nach, ging in ein Keuchen über und mündete schließlich in ein Japsen. In ein klägliches Japsen. Er bettete seinen Körper auf dem, was von der Frau übrig geblieben war.
Ich hatte mich die ganze Zeit keinen Zentimeter, keinen Millimeter gerührt. Ich hatte sogar meinen Atem angehalten. Das unwirklich anmutende, grausame Schauspiel hatte mich in seinen Bann geschlagen. Ich hatte keine Sekunde meine Augen davon lassen können.
Als ich wieder Luft in meine Lungen sog, kam mir dieses Atemholen wie der erste Atemzug nach langer Zeit vor. So wie wenn man aus einer großen Tiefe wieder an der Wasseroberfläche auftaucht.
Mein Blick streifte die Uhr auf der Anzeigetafel. Es war nicht mal eine Minute vergangen.
Ich sah, wie sich der Kopf des Mannes hob. Ganz langsam. Wie in Zeitlupe. Das Gesicht glänzte blutrot. Die Augäpfel schimmerten weiß. Der Blick war starr auf ein fernes Nichts gerichtet.
Als die Linie 9 einfuhr, versuchte er, stöhnend hochzukommen, wegzukommen von dem, was er angerichtet hatte. Es schien fast so, als wolle er sich mit letzter, allerletzter Kraft auf die Gleise werfen.
Aber er schaffte es nicht mehr.
Wenige Augenblicke später stürmten schwer bewaffnete und gepanzerte Polizisten die U-Bahn-Station und pflückten ihn auf wie faules Obst.
***
Die Polizei nahm den Fall so routiniert und förmlich auf wie ein Verkehrsdelikt. Die Spurensicherung erschien, die Leiche der Frau und ihre überall verstreuten Überreste wurden in einen Zinksarg gepackt und weggeschafft. Danach rückte ein Putzkommando an.
Während die U-Bahn-Station gründlich und schnell gesäubert wurde, führten die Polizisten die Zeugenbefragungen vollkommen leidenschaftslos durch. Neben mir hatten vier weitere Personen das Smasher-Spektakel mitbekommen. Zwei hatten sogar Videoaufnahmen mit ihren Handys gemacht, die sie den Polizisten stolz zeigten. Doch die interessierten sich nicht dafür. Sie wollten ihren Papierkram so schnell wie möglich erledigen, mehr nicht. Formulare ausfüllen, Unterschriften daruntersetzen, Kladde schließen. Fertig.
»Hier! Ihr Personalausweis!«
Ich musste den jungen Polizisten wohl etwas zu lange angeschaut haben, denn er fing an zu blinzeln.
»Wie bitte?«
Er reichte mir den Ausweis, und ich griff schnell zu, sonst hätte er ihn womöglich fallen lassen. Er war noch keine dreißig. Sein gelblich-fahles Gesicht erinnerte in Farbe und Konsistenz an einen Hefeteig.
Ich steckte den Ausweis ein und wollte schon gehen, als er sagte: »Sie haben uns sehr geholfen, Herr Stalmann!«
»Wobei?«
»Ja, also …«, fing er an, kam aber gleich ins Stocken. »Sie …« Er musterte mich. Seine Augenbrauen zogen sich zusammen. Er zeigte mit dem Zeigefinger recht zaghaft auf mein Gesicht. »Sie haben da etwas Blut abbekommen. Haben Sie ein Taschentuch? Oder vielleicht …?«
Ich wischte mir über die Wangen und das Kinn und betrachtete meine Handfläche. Ja, da war in der Tat etwas Blut zu sehen.
»Kein Problem«, sagte ich, fischte in meinem Mantel nach einem Papiertaschentuch, rieb mir das Gesicht damit ab und warf es in den Mülleimer.
Der Polizist inspizierte mich erneut. Es sah so aus, als wäre er immer noch nicht ganz zufrieden, aber schließlich nickte er. Er schien sich mit meinem Aussehen abgefunden zu haben.
»Darf ich Sie abschließend fragen – es ist nur rein informell –, wo Sie jetzt hingehen? Ich meine … haben Sie jemanden, den Sie benachrichtigen können? Der Sie abholt?«
Ich verdrehte die Augen. »Ich brauche niemanden, der mich abholt. Ich gehe jetzt zu meiner Arbeit.«
Er blickte mich fragend an.
»Ich gehe in die Schule«, sagte ich. »Ich bin Lehrer.«
Er machte zuerst ein verständnisvolles Gesicht, dann schüttelte er den Kopf. »Wollen Sie nicht …?«
»Was?«
»Freinehmen? Sich beurlauben lassen? Und wenn auch nur … für den heutigen Tag?«
»Warum?«
Der Polizist fühlte sich erkennbar unwohl. »Wissen Sie, ich meine es nur gut mit Ihnen. Das ist nur zu Ihrem Besten. Das, was Sie heute miterlebt, was Sie durchgemacht haben … Sie sollten das nicht auf die leichte Schulter nehmen!«
»Keine Sorge, das tue ich nicht. Es fällt schon viel zu viel Unterricht wegen nichts und wieder nichts aus. Da kann ich nicht auch noch fehlen.«
»Aber wenn Sie nun in die Schule gehen. Ich meine, Ihre Schüler …«
»Machen Sie sich um meine Schüler keine Sorgen. Die sind es gewohnt, wenn Ihr Deutsch-Lehrer mal ein bisschen komisch drauf ist.«
Er sah mich entgeistert an. »Komisch drauf?« Er musste schlucken. »Also ich meine, falls Sie psychologische Hilfe benötigen … es gibt Spezialisten … für … für Leute wie Sie.«
»Sie meinen: für Leute, die gesehen haben, was ich gerade gesehen habe!«
»Genau!«, sagte er und fing ganz langsam an zu strahlen. Man sah ihm an, wie er sich freute, dass ich ihn verstanden hatte.
***
Ich rief in der Schule an und sagte, dass ich heute etwas später käme. Es sei mir etwas Unvorhergesehenes dazwischengekommen.
Danach schaltete ich auf Autopilot. Ich stieg in die nächste U-Bahn. Warf mich auf einen freien Platz. Schaute nicht nach links, schaute nicht nach rechts. Scherte mich nicht um die anderen Fahrgäste. Nahm die einzelnen Haltestellen, die wir nach und nach passierten, mit nüchterner Gelassenheit wahr. Drückte mich schließlich rechtzeitig aus dem Sitz hoch und stieg anmeiner Haltestelle aus.
Als ich den Schulhof betrat, strömten gerade die Schüler in die große Pause.
Ich hatte letztendlich nur eine Unterrichtsstunde ausfallen lassen müssen.
Ich überquerte wie in Zeitlupe den Hof. Seit dem Vorfall heute Morgen war ich in ein somnambules Schlurfen verfallen, gegen das ich nichts tun konnte. Ich war mir nicht ganz sicher, ob das meine Beine waren, die sich Schritt für Schritt vorwärtskämpften, und ob das meine Füße, meine Stiefel waren, die über den Asphalt schabten.
Jedenfalls wurde ich misstrauisch beäugt, man konnte sich keinen Reim darauf machen, was mit mir los war.
Als ein Fußball gegen mein Schienbein prallte, kam ein Junge auf mich zugerannt, der mich linkisch und schuldbewusst angrinste.
»Tut mir leid, Herr Stalmann«, sagte er. »Hab den Ball nicht richtig getroffen.«
Ich hatte Mühe, mir seinen Namen ins Gedächtnis zu rufen. Nach einer halben Ewigkeit kam ich drauf.
»Macht nichts, Reuben«, sagte ich. »Schon in Ordnung.«
Er war ein Junge aus der Zehnten, ein guter Zweier-Schüler in fast allen Fächern. Seine Kumpels standen ein paar Meter entfernt und beobachteten uns aus sicherer Entfernung.
Reuben zuckte mit den Achseln. »Soll nicht wieder vorkommen«, sagte er schnell, schnappte sich den Ball und wollte sich schon umdrehen, aber dann sah er mich ganz komisch an. »Ist was mit Ihnen, Herr Stalmann?«
Ich schüttelte den Kopf. »Was soll mit mir sein?«
»Keine Ahnung … Sie sind so … weiß auch nicht … sind Sie krank?«
»Krank? Nein, das müsste ich wissen. Wie kommst du darauf?«
Er zuckte wieder mit den Achseln. »Weiß auch nicht. Sie ballern uns normalerweise immer den Ball um die Ohren, wenn einer von uns Sie aus Versehen mal anschießt.«
»Heute ist halt nicht mein Fußballtag«, sagte ich und setzte mein Schlurfen fort.
Als ich an dem ersten Sicherheitsmann vorbeikam, stutzte ich. Ich brauchte eine Weile, bis ich seine Erscheinung richtig einordnen konnte. Auch seine anderen Kollegen nahm ich nun erst wahr. Sie waren in allen Ecken und Winkeln der Schule postiert worden.
Gleich, als es zu den ersten Smasher-Vorfällen in Deutschland gekommen war, hatten die Innen- und Kultusministerien, die Lehrer- und Elternverbände darauf bestanden, dass die Schulen so schnell wie möglich gesichert werden mussten. Präventiv versteht sich. Da die Polizei ihr Personal von heute auf morgen nicht so rasch aufstocken konnte, hatte man private Dienste ins Spiel gebracht. Und die waren jetzt für den Schutz in den Schulen zuständig.
Anfangs hatte ich die privaten Sicherheitskräfte belächelt, aber das kam auch nicht ganz von ungefähr, denn in ihrer Aufmachung sahen sie aus wie die reinsten Witzfiguren: schwarze Uniformen, schwarze Sonnenbrillen, schwarze Gürtel mit schwarzen Holstern und schweren Revolvern. Richtige Schwarze Sheriffs eben, aber an diesem Morgen konnte ich überhaupt nichts Lächerliches an ihnen finden. Ich sah sie auf einmal mit anderen Augen.
Als ich gerade das Schulgebäude betreten wollte, kam mir Jimmy Osterwald entgegen. Er war ein großer, dünner Schlaks, neunzehn Jahre alt, wie ein Dandy gekleidet: dicker, schwarzer Ledermantel, der vorne offen stand, darunter ein weißer Anzug, schwarzes Hemd, weiße Krawatte. Ich konnte ihn nicht ausstehen.
Er stellte sich mir einfach in den Weg. »He, Teacher! Sie sind spät dran!«
Ich musste blinzeln, ich konnte es nicht fassen, dass ein Schüler aus der zwölften Klasse, der zweimal sitzen geblieben war und in dessen Schädel sich mehr abgestandene Luft als Hirn befand, mich am Weitergehen hinderte. Zu allem Überfluss grinste er auch noch unverschämt.
Ich blickte mich um und bemerkte, dass einige Schüler uns beobachteten. Ein paar von ihnen hielten Rauchzeugs zwischen ihren Fingern, das nur entfernt an Zigaretten erinnerte. Bei einigen klebte an den Nasenlöchern weißes Pulver. Andere standen nur dumm rum, kratzen sich an den Handrücken und stierten uns mit winzigen Pupillen an.
Mit winzigen Pupillen!
Was zum Teufel war hier los? Was für ein Spiel wurde hier gespielt? Ich spürte den hirnrissigen Impuls, mir mit der Hand über die Augen zu fahren, um dieses Bild, das sich mir hier bot, einfach wegzuwischen. Aber ich wusste, dass dies alles keine Sinnestäuschung war. Das, was ich hier zu sehen bekam, war die nackte Realität auf unserem Schulhof. Mir war bloß entfallen, seit wann!
Rein offiziell waren an allen Schulen Drogen tabu. Seit Jahren war sogar das Zigarettenrauchen auf dem Schulgelände verboten. Aber scherte das irgendjemanden? Ging das irgendjemanden auf den Senkel? Kratzte das irgendjemanden?
Edwin, der Schülersprecher, ein zugegebenermaßen begabter Redner mit allerdings mittelmäßigen Leistungen in allen nicht sprachlichen Fächern, grinste mich von Weitem verlegen an und winkte in meine Richtung. Dann ließ er sich einen Joint reichen.
Ich wandte mich wieder Jimmy zu. »Stimmt. Ich bin spät dran heute«, sagte ich nach einer Weile und sah zu ihm auf. »Hast du ein Problem damit?« Er war zwar gut einen halben Kopf größer als ich, aber mich überkam auf einmal die Lust, ihn zu vermöbeln.
Er nestelte am Knoten seiner Krawatte herum. »Ach was, nein! Wo denken Sie hin! Ich mach mir …«
»Was?«
»… Sorgen! Ja, Mann! Ich mach mir Sorgen um Sie. Sie sehen nicht gut aus. Ist Ihnen nicht wohl?«
»Stimmt, Jimmy! Mir ist leicht unwohl.«
»Das tut mir aber echt leid!«, sagte er grinsend.
Ich ließ noch mal meinen Blick über die Schüler in unserer Nähe schweifen, bevor ich antwortete: »Willst du wissen, warum mir gerade leicht unwohl ist? Hm? Willst du das wissen? Weißt du, ich kriege hier etwas zu sehen, was mir gar nicht gefällt. Und wenn ich sage, dass mir etwas gar nicht gefällt, heißt das auch, dass irgendetwas hier richtig übel aussieht und dass es hier stinkt. Verstehst du, was ich meine, Jimmy?«
Sein rechter Mundwinkel zuckte herablassend. Er beherrschte die Rolle eines Dandys schon ganz gut. »Keinen blassen Schimmer, Teacher. Ich habe keinen blassen Schimmer von dem, was Sie sagen.«
»Tu doch nicht so, als hättest du mit dem hier nichts zu schaffen.«
Er zeigte mir seine blitzenden Zähne. »Ich bin vollkommen unschuldig, Teacher.«
»Geh mir aus den Augen!«, blaffte ich ihn an.
»Kein Problem, Teacher«, sagte er und zwang sich zu einem herablassenden Grinsen. Was ihm aber misslang.
Er trat zur Seite, und ich setzte meinen Weg fort. Nicht ohne ihn noch mit der Schulter heftig anzurempeln.
»He, ich bin vollkommen unschuldig«, rief er mir noch mal hinterher.
Ich wusste es besser.
***
Im Lehrerzimmer schien niemandem aufzufallen, dass ich an diesem Tag zu spät kam.
Am Kaffeeautomaten wählte ich einen doppelten Espresso. Ich nippte ein wenig von der Crema, schloss für einen Moment die Augen und merkte, wie meine Geschmacksnerven anfingen, Kapriolen zu schlagen. Als ich mich mit der Tasse in der Hand umdrehte, stand Eileen vor mir – Eileen Bach, Geschichts- und Religionslehrerin.
»Kurze Nacht gehabt, Hardy?« Sie hatte eine zarte Stimme – vor allem wenn sie mit mir sprach. Sie hatte ihre Teetasse in der Hand und tauchte langsam und konzentriert einen Teebeutel immer wieder ins heiße Wasser, so als wolle sie mir zeigen, wie einfach das ginge.
»Kann ich nicht sagen«, murmelte ich und wich ihrem Blick aus. »Kann mich an die letzte Nacht nicht mehr erinnern.«
Sie war eine nette, junge Lehrerin, die, obwohl wir beide etwa gleich groß waren, es schaffte, mich immer von unten herauf anzuschauen. Wir waren ein paar Mal miteinander essen gegangen, und sie hatte mich dann auch einmal zu sich in ihre Wohnung, in ihr großräumiges, spartanisch eingerichtetes Loft, eingeladen.
Die Nacht mit ihr war ein totales Fiasko gewesen. Wobei es ganz alleine an mir gelegen hatte.
Ich hatte nicht ums Verrecken einen hochgekriegt.
Sie bezog das natürlich auf sich. Sie war etwas pummelig, aber auf ihre Art nicht unsexy. Sie versuchte auch allerhand, aber bei mir regte sich nichts. Ich gab mir die Schuld, bat sie um Verzeihung, tröstete sie, aber das half alles nichts. Sie war am Boden zerstört. Sie machte sich Vorwürfe. Sie hatte schon einige entwürdigende Erfahrungen mit Männern gemacht und war der Ansicht, dass es keine unattraktivere Frau auf der Welt gab als sie.
Wir verbrachten den Rest der Nacht zusammen vor dem Fernseher und futterten unzählige Packungen Chips. Eine Fortsetzung hatte es nicht gegeben, und wir verloren nie wieder ein Wort über dieses missglückte Tête-à-Tête.
»Ist was?«
Die Frage nach meinem Wohlbefinden begann zu nerven.
»Was soll sein?«
Sie zuckte zusammen. Sie war es nicht gewohnt, dass ich sie so anfuhr.
»Ich meine nur, weil …«
»Was weil?«
Sie musste schlucken. Vorsichtig betastete sie mein Kinn. »Hast du dich beim Rasieren geschnitten?«
»Warum?«
»Da ist noch bisschen … also nur ein wenig …«
»Ach, du meinst das Blut?« Ich rieb mir mit dem Handrücken übers Kinn. »Das ist nicht von mir!«
Eileen machte große Augen. »Von wem dann? Hast du dich geprügelt?«
»Es stammt von einer Frau.«
Sie musste schlucken. »Von einer Frau?«
»Ja!«, sagte ich. »Sie ist heute Morgen neben mir in der U-Bahn-Station von einem Smasher zerrissen worden.«
Augenblicklich war alles ruhig im Lehrerzimmer.
2. Kapitel: Willkommen im Smash-Zeitalter
Nein, es stimmte nicht ganz, dass augenblicklich alles ruhig war. In Lehrerzimmern ist es nie ganz ruhig. Dr. Seyfried, Geografie- und Englischlehrer, kritzelte weiterhin gedankenverloren mit seinem antiquierten Kuli in sein Notizbuch. Thea Sommer, Französisch- und Biologielehrerin, rührte mit einem Löffel in ihrer Kaffeetasse, als wolle sie das Porzellan wegkratzen, und Eileen fing an, hörbar ein- und auszuatmen.
Ich schloss für einen kurzen Moment die Augen. Schließlich begann ich, von meinem Smasher-Erlebnis heute Morgen zu erzählen.
Mir war es egal, ob ich gerade einen kleinen getrockneten Blutstropfen an meinem Kinn hatte oder ob ich mit knallig roter Kriegsbemalung hier vor meinen Kollegen stand. In knappen Worten schilderte ich ihnen, was vorgefallen war, auch wenn ich mir nicht ganz sicher war, ob sie es wirklich hören wollten.
Als schließlich die Schulglocke die große Pause schlagartig beendete, begann ein allgemeines Stühlerücken. Zwei Lehrer rasten fast gleichzeitig zum Ausgang, als ginge es darum, wer als Erster in sein Klassenzimmer käme. Von den anderen bekam ich aufmunternde Worte zu hören, und man beglückwünschte mich dazu, dass ich noch lebte. Aber das war auch alles. Nach und nach leerte sich das Zimmer und zurück blieben diejenigen, die sich intensiv ihren Unterrichtsvorbereitungen widmeten – und Eileen und ich.
»Mein Gott«, brachte sie, die sich die ganze Zeit nicht gerührt hatte, schließlich mühsam heraus. »Ich bin ja so froh, dass dir …« Ihre Augen glänzten feucht. Sie zitterte am ganzen Körper. Man sah ihr an, dass sie mich am liebsten umarmt hätte, aber meine Tasse Espresso und ihre Tasse Tee standen zwischen uns.
***
Dass die Mehrzahl meiner Kollegen auf meine Smasher-Geschichte nicht sonderlich einging, machte mich anfangs ein wenig stutzig. Im Nachhinein betrachtet war ihr Verhalten durchaus nachvollziehbar.
Mit der Smasher-Story konnte man keine gute Laune verbreiten oder bei einem Small-Talk-Wettbewerb gewinnen. Bei nicht wenigen wirkte das Thema wie ein Schlag vor den Kopf. Dabei sorgte es seit mehr als einem halben Jahr für die vorherrschenden Schlagzeilen in sämtlichen Medien. Rund um die Uhr wurde ausführlich über jeden Smasher-Vorfall in Deutschland berichtet, egal, ob im Fernsehen, im Internet, im Radio oder in den Zeitungen. Es war, als würden ununterbrochen Bomberstaffeln über den Himmel ziehen und »Bad News« abwerfen. Man wurde fast erschlagen von den Unmengen an Bildern und Videoaufnahmen, die die blutigen Anschläge in aller Ausführlichkeit zeigten. Egal, welchen Sender man auch einschaltete, jeder brachte ähnlich lautende Meldungen: »… wurden zwei Arbeiter auf einer Baustelle in Leipzig von einem Smasher getötet … griff ein Smasher fünf Spieler einer Rugby-Mannschaft in Niederbayern an … wurde ein Finanzbeamter in Kassel von einem Smasher umgebracht …« Angehörige, Nachbarn, Schaulustige, Politiker, Soziologen, Psychologen, Theologen, Kriminologen – auf allen Kanälen meldeten sie sich zu Wort.
Und jeder neue Tag brachte neue Horrormeldungen. Zeitweise führte das zu einem wahren Informations-Overkill!
Die ganze Geschichte hatte im Spätsommer letzten Jahres ihren Anfang genommen. An einem Mittwoch, dem 4. September, wurde in einer Kaufhauspassage in Berlin ein Smartphone-Händler von einer Sekunde zur anderen zu einem wahnsinnigen Mörder, der mit bloßen Händen nicht weniger als vier Passanten in Stücke riss. Er brach anschließend entkräftet zusammen und starb noch an Ort und Stelle.
Die Medien berichteten hoch und runter und in aller Ausführlichkeit über diese Mordtat, und natürlich zeigte man sich über die scheinbar sinnlose Grausamkeit und Brutalität entsetzt, erschüttert und aufgewühlt, aber auch – auf eine gewisse perverse Art und Weise – fasziniert.
Als es aber am nächsten Tag in der Bundeshauptstadt zu drei weiteren Attacken kam, wurde jedem langsam klar, dass es sich hierbei um eine verdammt ernste Sache handelte. In den darauffolgenden Tagen wurden etliche Großstädte – ob Hamburg, Hannover oder München – von Smashernheimgesucht. Die Grundstimmung änderte sich total. Wenn man nicht gerade in diesen Städten wohnte, hatte man aus der Ferne diese Vorfälle – so schrecklich und furchtbar sie auch waren – eine Zeit lang wie spektakuläre Unwetter wahrgenommen, wie plötzlich auftretender Hagel oder wie Blitzeinschläge. Solange sie einen nicht selbst betrafen, wähnte man sich noch einigermaßen in Sicherheit. Aber als der Hagel und die Blitzeinschläge näher rückten, als sie sich mit immer größer werdender Wucht und Häufigkeit ausbreiteten bis in die entlegensten Winkel des Landes, da hatten alle, die bis dahin noch nicht betroffen gewesen waren, auf einmal die Hosen voll. Als Smasher nicht nur in den Großstädten, sondern auch in den Kleinstädten, in Dörfern und selbst auf dem Ponyhof ganz in der Nähe wüteten, wusste bald auch der letzte Hinterwäldler, dass die Zeit, in der unser Land als eines der sichersten der Welt galt, der Vergangenheit angehörte. Man traute sich kaum mehr raus auf die Straße, so als steckten überall Landminen unter der Asphaltdecke.
Die Gesellschaft erstarrte in Paralyse. Nackte, bloße Angst hielt einen umklammert wie eine Faust.
Man war sich auf einmal bewusst, dass das Unheil nicht nur anderen passieren konnte, sondern einem selbst; dass man nirgends sicher war, dass es einen überall treffen konnte: nicht nur draußen auf der Straße und den öffentlichen Plätzen, sondern auch daheim in den eigenen vier Wänden.
Man hatte Angst davor, von einem Smasher zerfetzt zu werden, und man hatte Angst davor, selbst zu einem Smasher zu mutieren. Jederzeit bestand die Gefahr, dass man sich selbst in einen Smasher verwandelte. Schneller, als man dachte.
Und zwar durch Smash.
Smash war keine Naturkatastrophe, kein Virus und keine Genmutation. Smash war ein Gift, das aus einem Menschen eine reißende Bestie machte. Es bildete sich nicht von alleine oder durch Zufall, es war auch kein Insektizid oder Pestizid mit tödlichen Nebenwirkungen. Nein! Dieses bislang unbekannte Gift wurde gezielt produziert, damit Menschen Menschen töteten.
Und vergiftet konnte jeder werden.
Man stand an einer Ampel, und irgendein Arschloch jagte einem, ohne dass man es merkte, eine mikroskopisch feine Injektionsnadel mit einer winzigen Dosis dieses Giftes in die Hüfte. Oder man aß sein mit Smash verunreinigtes Lieblingsmüsli, und eine Stunde später wurde man zum lebenden Fleischwolf.
Die Frage war nur: Wer steckte dahinter? Wer produzierte dieses Teufelszeug? Wer war für diese Giftanschläge verantwortlich?
Nach mehr als sechs Monaten hielten sich die Ermittlungsbehörden immer noch ziemlich bedeckt. Es war klar, es konnte kein Einzeltäter sein, es musste sich um eine Gruppe oder eine Organisation handeln, die es sich zum Ziel gesetzt hatte, das ganze Land in Angst und Schrecken zu versetzen.
Und das war ihr mit Smash perfekt gelungen. Mit dem Gift hatte sie auch die Saat des Misstrauens in die Köpfe der Leute gesät.
Man misstraute den Mitmenschen, der eigenen Ehefrau, dem eigenen Ehemann, den eigenen Kindern. Man misstraute der Bäckersfrau von nebenan, denn sie konnte ja im nächsten Moment mit Schaum vor dem Mund auf dich zurasen, oder dem Banker, der am Service-Point auf einmal so komisch mit den Mundwinkeln zuckte. Und man begann, sich selbst zu misstrauen. Kam das Herzrasen davon, dass man gerade zu schnell die Treppe hochgegangen war, oder liefen da auf einmal sonderbare destruktive Veränderungen in einem ab?
Als Smasher hatte man ganz schlechte Karten. Entweder starb man innerhalb weniger Minuten, nachdem man Amok gelaufen war, an Herzversagen oder durch die Kugeln von Polizisten, Sicherheitskräften oder aufmerksamen Zeitgenossen.
Nur ganz wenige Smasher, so wie derjenige, den ich heute Morgen in der U-Bahn-Station erlebte hatte, kamen mit dem Leben davon.
Das Misstrauen und die Angst nahmen schon bald hysterische Züge an. Nicht ohne Grund. Auf dem Höhepunkt der Smasher-Gewaltwelle, Mitte Oktober, gerade mal fünf Wochen nach dem ersten Giftanschlag, gab es im Schnitt hundert Tote pro Tag. Die Bestatter hatten Hochkonjunktur. Beerdigungen wurden am laufenden Band abgehalten. Die Friedhöfe füllten sich rasend schnell.
Die Beziehungen zu den Nachbarländern wurden auf eine harte Probe gestellt. Als sie merkten, was in Deutschland vor sich ging, machten sie die Grenzen dicht. Das Schengener Abkommen wurdein den Zeiten von Smashaußer Kraft gesetzt. Jeder, der Deutschland verlassen wollte, kam zur Vorsicht erst einmal in Quarantäne. Und jeder, der nach Deutschland einreisen wollte, überlegte es sich sehr genau, ob es ihm dieses Risiko wert war.
Durch diese Vorsichtsmaßnahmen kam es im Ausland nur zu sehr wenigen Vorfällen mit Smashern – und wenn, dann meist in grenznahen Gebieten oder in Ländern, die es mit den Quarantäne-Bestimmungen nicht allzu ernst genommen hatten.
Die deutsche Politik handelte spät. Aber nach der anfänglichen Schockstarre handelte sie umso radikaler. Man nahm sich auf einmal keine Zeit mehr für meinungsbildende Grundsatzdiskussionen und Ursachenforschungen.
Die Sicherheitsvorkehrungen wurden massiv verschärft. Die Polizei wurde aufgerüstet und zeigte Präsenz. Unterstützt wurde sie dabei von privaten Sicherheitsdiensten. Diese Dienste erlebten einen noch nie da gewesenen Boom. Es wurden Rekrutierungsbüros aus dem Boden gestampft.
Als das alles nicht ausreichte, stufte die Bundesregierung die momentane Situation in Deutschland als eine sogenannte Ausnahmesituation katastrophischen Ausmaßes ein,die den Einsatz der Bundeswehr im Inneren nach einem höchstrichterlichen Beschluss aus den Zweitausendzehnerjahren zuließ.
Im Klartext hieß das, dass nun Soldaten der Bundeswehr flächendeckend in Deutschland eingesetzt werden konnten.
Die Republik befand sich im Ausnahmezustand. Sie machte mobil.
So kam es, wie es kommen musste: Straßen und öffentliche Plätze wurden mit Überwachungskameras vollgeklatscht und von bewaffneten Spezialeinheiten gesichert, die auch über die Lizenz zum finalen Todesschuss verfügten.
Klar, es gab auch einzelne Demonstrationen und Protestmärsche gegen diese martialische Zurschaustellung der inneren Sicherheit – aber sie hielten sich ziemlich in Grenzen. Vielleicht lag es ja daran, dass es hier nicht um ein abstraktes weltpolitisches Problem oder um eine politische Frage ging, über die man trefflich streiten konnte, sondern um ein tatsächliches, akutes Risiko, dem jeder tagtäglich ausgesetzt war.
Die Erfolge ließen nicht lange auf sich warten. Es sah fast so aus, als hätten die Soldaten, die Monate oder gar Jahre mit ihren Präzisionsgewehren geübt und trainiert hatten, nur auf so eine Gelegenheit gewartet. Sie durften sofort schießen, wenn Anzeichen auszumachen waren, dass sich ein Mensch in ein Monster verwandelte.
Gleich in den ersten Tagen wurden an die dreißig Smasher erschossen, ohne dass sie zuvor Gelegenheit gehabt hatten, großen Schaden anzurichten. Innerhalb eines Monats ging die Anzahl der Opfer durch Smasher-Angriffe auf etwa zehn pro Tag zurück.
Es blieb natürlich nicht aus, dass auch Unschuldige dran glauben mussten. Aber diese Kollateralschäden hielten sich – jedenfalls nach offiziellen Angaben – erstaunlicherweise in Grenzen. In Paderborn war ein Mann von einem Scharfschützen erschossen worden, als er auf offener Straße einen epileptischen Anfall erlitten hatte. Und in München wurde einem dreiundzwanzigjährigen Programmierer, der bei einer Junggesellenparty in der Fußgängerzone den Hulk gemacht hatte, eine Hochgeschwindigkeitskugel in den Kopf gejagt.
Mitte Dezember hatte sich dann das Leben wieder einigermaßen normalisiert. Sofern man von »normalisiert« sprechen konnte! Es war eher so, dass sich die Menschen mit ihrer Situation, mit ihrem »Schicksal« abgefunden hatten. Zehn Smasher-Tote pro Tag in ganz Deutschland – mit dieser Zahl konnte man auf einmal ganz gut leben. Das war überschaubar, das war kalkulierbar! Das entsprach in etwa der Anzahl der Verkehrstoten eines Jahres und kam damit fast schon dem Signal einer Entwarnung gleich! Und überhaupt – war nicht die ganze Welt ein Schlachtfeld? In Kriegen und Bürgerkriegen in Asien und Afrika gab es doch täglich Tausende von Toten. Warum sollte man da also hysterisch werden? Wer konnte schon eine hundertprozentige Sicherheit garantieren? Wer? Ein Ziegel fällt vom Dach, und das war’s dann!
Eine Gesellschaft atmete wieder auf.
Menschen, die anfangs ihre zehnfach gesicherten Wohnungen nur verlassen hatten, wenn es anders nicht ging, wenn es absolut notwendig war, wenn die tägliche Arbeit und Pflicht rief, bevölkerten nun wieder fast wie früher die Einkaufspassagen, Cafés, Kinos und Fußballstadien.
Es war wirklich erstaunlich, wie rasch sich die Bevölkerung an dieses Smasher-Risiko, aber auch an die permanente Überwachung und die rigorosen Sicherheitsmaßnahmen gewöhnt hatte. Doch ebenso erstaunlich war die hohe gesellschaftliche Akzeptanz für die Spezialeinheiten mit ihren Snipern, die zu jeder Tages- und Nachtzeit Smasher, aber auch verhaltensauffällige Zeitgenossen einfach so liquidieren konnten.
Wer auf die Straße trat, musste damit rechnen, dass vielleicht gerade jetzt irgendein Kaugummi kauender schießwütiger Soldat, den seine Freundin letzte Nacht abserviert hatte, einen ins Fadenkreuz nahm.
Man hatte begonnen, sich mit der Angst und dem Bewusstsein, dass man in der nächsten Sekunde tot sein konnte, zu arrangieren. Life goes on. Oder auch nicht.
Smash hatte die Gesellschaft verändert. Nichts war mehr, wie es vordem gewesen war. Es gab eine Zeit vor Smash, und es gab die Jetztzeit – die Zeit mit Smash.
Und jeder ging mit dieser Zeit anders um.
Zwar gab es welche, die sich weiterhin zurückzogen, die ihr Heil im Privaten und den eigenen vier Wänden suchten, die depressiv wurden, die der Welt den Rücken kehrten. Die meisten Menschen aber zog es in die Öffentlichkeit. Der Wunsch, jeden neuen Tag zu genießen, war überall spürbar. Jetzt erst recht. Weihnachten und Neujahr wurden gefeiert, als hätte die Regierung sie jahrzehntelang verboten und gerade eben wieder zugelassen. Die Kirchen waren so voll und die Feste so ausgelassen wie noch nie. Mit den ganzen Scharfschützen im Hintergrund hatte das natürlich auch etwas von einem Tanz auf dem Vulkan, aber bemerkenswerterweise war bisher nichts, aber auch gar nichts an diesen Tagen passiert.
Im Laufe der nächsten Monate übte man sich darin, Smashzu verdrängen, es aus dem Alltagsleben, so weit es ging, herauszuhalten. Jeder hatte so seine eigenen Strategien entwickelt, wie er sein Leben, sein Weiterleben mit dieser ständigen Bedrohung, bewältigen konnte. Adressen von Psychologen, Psychotherapeuten wurden ausgetauscht und Ratschläge gegeben, welche Medikamente wie halfen.
Die Arzneimittelbranche kam mit dem Produzieren von Psychopharmaka, von Antidepressiva, Neuroleptika, Tranquilizern und Hypnotika nicht nach. Jeder sehnte sich nach einem tiefen und vor allem traumlosen Schlaf und nach Ausgeglichenheit, guter Laune und Optimismus am Tag.
Es gab natürlich auch welche, denen das nicht weit genug ging. Die bereit waren, sich eine eigene kleine Welt in ihrem eigenen Innern zu erschaffen. Die sich mit Drogen zuknallten – egal, ob mit Alkohol, Marihuana oder mit noch härterem Zeugs –, und deren Zahl stetig anwuchs.
Aber nach gut einem halben Jahr musste man ganz nüchtern feststellen, dass die meisten Leute gerne bereit waren, das Thema Smash mit all seinen Begleiterscheinungen unter den Teppich zu kehren. Man nahm zwar zur Kenntnis, was sich tagtäglich so alles zutrug, aber man redete kaum darüber. Man tat in der Öffentlichkeit so, als wäre einem das Thema mehr oder weniger egal. Dieses Desinteresse zeichnete auch einen Großteil meiner Kollegen aus.
Und wenn ich ehrlich sein soll: mich auch. Bis zu diesem Montag jedenfalls.
***
Ich war nach der großen Pause auf die Toilette gegangen, hatte den Kopf ins Waschbecken unter einen kalten Wasserstrahl gesteckt und mir dann anschließend das Gesicht gewaschen. Als ich es im Spiegel betrachtete, gefiel es mir immer noch nicht. Ich musste mich mächtig zusammenreißen, als ich mich auf den Weg zu meiner nächsten Unterrichtsstunde machte.
Ich hatte eine Doppelstunde in der 8. im obersten Stock. Normalerweise nahm ich die Treppe, aber diesmal wartete ich auf den Aufzug.
Ich kam mit einer Viertelstunde Verspätung in die Klasse. Mit Verspätungen hatte ich es an diesem Tag.
Ich machte auf ernst wie selten, auf humorlos wie selten und verdonnerte die Klasse zu hirnlosen Gruppenarbeiten.
Ich brauchte meine Ruhe, um in Unterrichtsunterlagen zu starren, die mich nicht interessierten, und Aufsätze zu korrigieren, die ich schon längst hätte korrigieren müssen.
In der Pause zwischen den beiden Stunden tigerte ich verloren von einem Ende des Flurs zum anderen.
Ich fragte mich, wie ich diesen Scheißtag überleben sollte.
Am Ende der Doppelstunde ließ ich mir die Ergebnisse der Gruppenarbeiten vortragen, fand alles klasse und super, verabschiedete mich bis zum nächsten Mal und ging ins Lehrerzimmer, um mir dort einen doppelten Espresso zu genehmigen.
Ich hatte nichts im Magen, und der Espresso begann in mir zu explodieren. Ich schaffte es gerade noch rechtzeitig auf die Toilette und fiel vor der Kloschüssel auf die Knie. Aber nicht, um zu beten.
Danach ging es mir besser. Ich fühlte mich leichter. Befreit von einem Ballast, der mir jede Pore meines Körpers verstopft und das Atmen schwer gemacht hatte.
Ich hatte eine Hohlstunde und musste erst wieder nach zwölf Uhr ran. Also hatte ich Zeit und beschloss, mir die Füße im Hof zu vertreten.
Ich stieß einen Flügel der Schul-Eingangstür auf und trat hinaus ins Freie. Ein eisiger Wind war aufgekommen, wirbelte Papierfetzen auf, stach in meine Lungen und ließ für einen Moment meine Augen tränen. Ich hatte meinen Mantel nicht an und begann zu frieren. Es machte mir nichts aus. Die Kälte tat mir gut.
Ich wischte mir übers Gesicht, nahm ein paar tiefe Atemzüge. Als ich wieder klarer sah, bemerkte ich zwei Rettungssanitäter, die an der Hofausfahrt einen Jungen auf eine Trage schnallten und anhoben.
Was – zum – Teufel – war – hier – los?
So schnell es ging, marschierte ich über den Hof, um einen Blick in sein Gesicht werfen zu können, bevor sie ihn in den Rettungswagen schoben.
Es war ein Schüler aus der 12., Bennie oder Bernie, genau konnte ich mich nicht an seinen Namen erinnern. Er war schon einige Jahre her, dass ich ihn unterrichtet hatte. Er hatte ein graues und schweißnasses Gesicht.
Und ich hätte wetten können, dass er einer der Jungs war, die mich vor ein paar Stunden mit ihren stecknadelkopfgroßen Pupillen in der großen Pause im Schulhof angestarrt hatten.
»Was ist mit ihm?«, wollte ich von dem Sanitäter, der am Kopfende die Trage hielt, wissen.
»Kreislauf!«, sagte er maulfaul und teilnahmslos.
Ich packte ihn am Ellenbogen. »Verdammt! Ist es schlimm?«
Er schien auf einmal hellwach zu sein. Er zuckte richtiggehend zusammen. Er starrte auf meine Hand und anschließend in mein Gesicht. »Sind Sie noch ganz dicht? Hand weg, aber dalli!«
»Erst wenn ich weiß, wie es um ihn steht.«
»Scheiße! Keine Ahnung. Werden die im Krankenhaus sagen können. Los jetzt, Hand weg und aus dem Weg, Mann!«
»Danke, tausend Dank für die ausführliche Information«, ätzte ich und ließ ihn los, nicht ohne meine Finger anschließend demonstrativ an meiner Hose abzuputzen.
Ein paar Schüler standen ganz in der Nähe in einer Gruppe zusammen, so als wollten sie sich wärmen, warfen uns Blicke zu und tuschelten miteinander. Ich wollte bereits zu ihnen rübergehen, als ich aus den Augenwinkeln sah, wie Jimmy gemeinsam mit Edwin, dem Schulsprecher, kichernd und Zigaretten rauchend über den Schulhof geschlendert kam. So wie es aussah, war für die beiden die Schule zu Ende.
Jimmy kam mir wie gerufen. Er war der rechte Mann zur rechten Zeit. Unter dem schwarzen Ledermantel lugten die weißen Hosenbeine hervor. Seine Stiefeletten glänzten wie frisch poliert.
Als er mich sah, stutzte er im ersten Moment. Dann zeigte er mir wieder sein herablassendes Grinsen.
Was hinter mir abging, dass gerade ein Junge auf einer Trage in einen Rettungswagen geschoben wurde, schien ihn nicht die Bohne zu interessieren.
»Hallo Teacher, was machen Sie bei dieser Kälte hier draußen? Wollen Sie nicht lieber wieder reingehen? Sie werden sich noch erkälten.«
Während Edwin nach einem kurzen Abschiedsgruß rechts abbog, kam Jimmy mit lockeren Schritten auf mich zu, blieb schließlich vor mir stehen und genoss es, auf mich herabblicken zu können.
»Wissen Sie was, Teacher? Irgendwas stimmt nicht mit Ihnen. Heute Morgen haben Sie mir schon nicht gefallen und jetzt …«
»Halt – die – Schnauze!«, knurrte ich ihn an.
»… und jetzt gefallen Sie mir noch weniger«, fuhr er ungerührt fort.
»Verdammt!« Meine Hände schnellten hoch. Ich stellte mir schon bildlich vor, wie sie ihn zu würgen begannen. Aber ich bremste mich noch rechtzeitig. Für eine Sekunde schloss ich die Augen, atmete tief durch, lockerte die Schultern und stierte schließlich Jimmy von unten herauf an. »Pass mal gut auf, mein Freund. Hier läuft etwas aus dem Ruder. Hier in dieser Schule wird eindeutig zu viel geraucht und werden eindeutig zu viele Drogen eingeschmissen. Das ist nicht gut, das ist einfach nicht gut, verstehst du, was ich meine? Überall hier schmauchen, schnupfen und spritzen sich die Kids das Zeugs, das du verhökerst. Das ist nicht gerade die feine englische Art, Jimmy!«
Er sah mich lange an. Sein arrogantes Lächeln schmolz dahin, und er fuhr sich nervös mit der Zungenspitze über die Lippen.
Die Schüler, die auch bereits auf dem Heimweg waren und an uns vorübergingen, begannen, uns genauer in Augenschein zu nehmen. Manche blieben in gebührendem Abstand stehen und warteten, was noch kommen würde. Selbst die Schwarzen Sheriffs, die an allen vier Ecken des Schulhofes standen, beobachteten uns auf einmal aufmerksam, was schon recht seltsam war, denn dass hier den ganzen Tag über jede Menge illegaler Stoff kreiste und ab und an mal ein Schüler mit lebensbedrohlichen Kreislaufbeschwerden zusammenklappte, schien sie absolut nicht zu interessieren.
Nach einer Weile kehrte Jimmy zu seiner alten Selbstsicherheit zurück. Er fummelte an seinem Krawattenknoten herum und sagte: »Und was ist die feine englische Art, Teacher? Drogen kaufen, Drogen einstecken und sie zu Hause in den eigenen vier Wänden einpfeifen?«
Ich hätte ihm am liebsten sofort eine reingehauen. Aber ich hielt mich ein weiteres Mal zurück. Es machte sich nicht so gut, wenn ein Lehrer gegen einen Schüler, mochte er auch noch so ein großes Arschloch sein, tätlich wurde.
Im Übrigen durfte ich nicht zu weit mit ihm gehen.
Ich war in gewisser Weise auf ihn angewiesen.
Er war mein Dealer.
3. Kapitel: Das verlorene Paradies
Es hatte sich in der Schule herumgesprochen, dass irgendetwas mit mir heute nicht stimmte. Meine Kollegen hatten sich nach und nach auf den aktuellen Stand gebracht. Die Schüler konnten dagegen nur mutmaßen. Ich galt bei ihnen schon immer als ein etwas schräger Lehrer, aber heute war ich anscheinend noch schräger drauf als sonst. Man warf mir misstrauische Blicke zu. Beobachtete mich genau. Aus sicherer Entfernung. Vielleicht wartete der eine oder andere sogar darauf, dass ich ausrastete.
Die letzte Stunde, die Deutsch-Stunde in der 11. von viertel nach zwölf bis eins, gab mir den Rest. Abgesehen davon, dass ich nicht bei der Sache war, hatte ich noch eine nimmermüde, hyperaktive Schülerin in der Klasse.
»Ich finde«, sagte Lara Behrens irgendwann einmal mit Nachdruck, »es geht Michael Kohlhaas nur um Rache.«
»Ah ja«, sagte ich. »Rache? Wie kommst du auf diese Idee?«
Lara runzelte die Stirn. »Wie ich auf diese Idee komme? Na, hören Sie mal, Herr Stalmann! Man hat seine Pferde gequält, seinen treuen Knecht misshandelt und seine Frau getötet. Alles, was ihn danach antrieb, war Rache.«
Normalerweise war es ein Vergnügen, mit Lara zu diskutieren. Für ihre sechzehn Jahre hatte sie ein erstaunliches Selbstbewusstsein, das darin gründete, dass sie einfach intelligent und wortgewandt war. An diesem Tag war ich es aber, der zur Diskussion oder zum Redegefecht nicht sonderlich aufgelegt war. Und dabei war Michael Kohlhaas an und für sich ein dankbares Thema im Deutsch-Unterricht.
»Rache?«, sagte ich und versuchte, meine Gedanken zu ordnen. »Könnte es nicht auch sein Gerechtigkeitsempfinden sein, von dem er geleitet wird?«
Lara, ein schlankes Mädchen mit violett gefärbten Haaren, rollte mit den Augen. »Gerechtigkeitsempfinden? Gut, ihm wird übel mitgespielt, aber was macht er? Er legt eine ganze Landschaft in Schutt und Asche. Das hat doch nichts mit Gerechtigkeitsempfinden zu tun!«
Ich atmete einmal tief durch. »Aber vielleicht damit, dass es für ihn eine Bedeutung hat, dass man Unrecht wieder als Unrecht erkennt – und es auch so benennt. Und dass man nicht tatenlos zusieht, wie das Recht gebeugt wird, sondern dass man alles tut, diesem Recht wieder Geltung zu verschaffen.«
»Sie halten es also für legitim, dass er das Recht in die eigene Hand nimmt?«
Sie lehnte sich zurück und verschränkte die Hände hinter dem Kopf. Die Ärmel ihres Pullovers rutschten, und ich konnte ihre Unterarm-Tattoos sehen. Normalerweise durfte man sich in ihrem Alter nur mit Erlaubnis der Eltern tätowieren lassen, aber da sich ihre Eltern so gut wie nicht um sie kümmerten, setzte sie sich über diese Bestimmungen einfach hinweg. Sie hatte alle naselang eine neue Tätowierung und in der Zwischenzeit auch zwei schwarze Piercing-Ringe in der Unterlippe.
»Michael Kohlhaas hält es für legitim!«, sagte ich.
»Ohhh-kay! Aber was ist mit Ihnen? Sie müssen doch auch eine Meinung dazu haben!«
»Meine Meinung ist hier nicht von Belang. Noch einmal langsam zum Mitschreiben: Michael Kohlhaas hält es für legitim, das Recht in die eigene Hand zu nehmen, weil er schmerzlich erfahren muss, dass die sogenannte Obrigkeit das Recht mit Füßen tritt! Auf das kommt es an! In der Welt, in der er lebt, gibt es für ihn – so sieht er es jedenfalls – keine Alternative!«
Bei den letzten Worten war ich etwas lauter geworden, und die Klasse sah mich mit großen Augen an. Rasch fügte ich im normalen Tonfall hinzu: »Vielleicht hat er ja ein Problem mit der Verhältnismäßigkeit seiner Mittel.«
Lara, die von meinem hitzigen Auftreten wenig beeindruckt war, verzog leicht angewidert das Gesicht. »Verstehe ich nicht! Problem? Er hat kein Problem. Er ist voll überzeugt von dem, was er tut.«
»Aber das muss ja nicht unbedingt etwas mit Rache zu tun haben!«
»Jetzt hören Sie mal her«, sagte Lara und verschränkte die Arme vor der Brust. »Das hat was mit RACHE zu tun! Mit was sonst?«
»Jetzt hör du mal her …«, raunzte ich sie an, wurde aber von der Pausenglocke unterbrochen. Ende des Unterrichts. Zum Glück.
Ich war heilfroh, dass die Stunde endlich vorüber war.
Während die Schüler aus dem Klassenzimmer strömten und ich die Unterlagen in meiner Aktentasche verstaute, kam auf einmal Lara zu mir. »Sagen Sie, Herr Stalmann, heute ist aber nicht so Ihr Tag, oder?«
Als ich ihr in die dunkelgrünen Augen blickte, die mich grundehrlich und fast mitleidig musterten, schnürte sich mir für einen Moment die Kehle zusammen. »Nein, Lara, ist er nicht.« Ich war nahe daran, ihr zu erzählen, was ich heute schon erlebt hatte, ließ es aber bleiben. Sie war zwar meine Lieblingsschülerin, aber so vertraut wollte ich nun auch nicht mit ihr sein.
»Und warum nicht?« Lara war ein Mädchen, das es schaffte, früher oder später so ziemlich alle Lehrer zu nerven. Ich hatte mich immer als die einzige Ausnahme angesehen. Bis gerade eben.
Ich musste mich mächtig zusammennehmen. »Vielleicht bin ich heute Morgen mit dem falschen Fuß aufgestanden, irgend so was. Keine Ahnung, aber lass gut sein.«
»Mit dem falschen Fuß aufgestanden, verstehe! Aber ich finde, wir sollten das noch ausdiskutieren.« Sie schnappte sich ihre Tasche und warf sie sich über die Schulter.
»Ausdiskutieren?«, fragte ich. »Was?«
»Na, was wohl?«
Sie grinste. Bevor sie sich zum Gehen umwandte, zielte sie mit dem Zeigefinger auf mich und sagte: »Die Frage nach Rache oder Gerechtigkeit.«
***
Man hatte mich vor Lara gewarnt. Das heißt, meine Kollegen hatten mich vor ihr gewarnt. Sie sei frech, unverschämt, laut, schnippisch, aufrührerisch, destruktiv. Eine Plage für jeden Pädagogen.
Als ich sie letztes Jahr, in der Zehnten, zum ersten Mal im Deutsch-Unterricht erlebte, sagte sie die ganze Stunde über kein Wort. Beobachtete mich nur.
In den nächsten Wochen, wurde sie gesprächiger, machte im Unterricht mit, war immer vorbereitet. Ich konnte sie nicht aufs Glatteis führen. Und sie gab mir auch keinen Grund dazu.
Im Lehrerzimmer wollte man natürlich wissen, wie es so liefe mit Lara. Man war neugierig und vielleicht auch schadenfreudig. Bei manchen galt ich als verrückt. Ich kam mit meinen Schülern meistens gut aus. Das machte mich verdächtig.
Ich jedenfalls hatte keinen Grund zur Klage. Und ich hatte auch keine Probleme mit ihr. Sie brachte sich ein, schrieb gute Noten. Was wollte man mehr als Lehrer? Einige misstrauten mir. Als ich sie zu verteidigen begann, kriegte ich die eine oder andere Breitseite ab – auch von Kollegen, von denen ich es nicht erwartet hatte. Es dauerte eine Weile, bis es mir dämmerte. Es lag nicht an ihrem Charakter, ihrem Selbstbewusstsein, ihrem Nicht-Angepasst-Sein, warum manche sie nicht mochten und der Meinung waren, so eine wie sie gehöre nicht aufs Gymnasium.
So eine wie sie.
Sie stammte aus einer sogenannten Problemfamilie. Der Vater war die meiste Zeit weg, und die Mutter soff sich zu Tode. Sie hatte drei Geschwister, alle jünger als sie, für die sie sorgte. Sie schmiss den Laden, sie hielt die Familie zusammen. Sie schien alles mit links zu machen. War Sängerin in einer Hip-Hop-Band, ein Bücherwurm, und ihr Gedächtnis saugte das Wissen auf wie ein Schwamm. Sie war in den meisten Fächern so gut, dass sie Nachhilfestunden für Kinder gab, die von ihren Eltern mit SUVs zur Schule gebracht wurden, die halb so groß wie Eisenbahnwaggons waren.
Was ich am Anfang nicht richtig einordnen konnte, war, warum sie mich nicht wie andere Lehrer irgendwann mal aufs Korn nahm, ihre Kräfte mit mir maß, mich aus der Reserve lockte, mich provozierte. Sie hielt sich mir gegenüber zurück. Das war mir ganz angenehm, aber ich hatte nicht damit gerechnet. Vielleicht lag es ja an den Geschichten, die man über mich erzählte. Wobei ich selber nicht genau wusste, welche von ihnen stimmten und welche nicht.
Schließlich kam der Tag, als Lara mich auf die Probe stellte. Es ging um Goethes Erlkönig. Die Aufgabe: »Schreibt den Erlkönig um, in Prosa, in Gedichtform oder in ein szenisches Stück. Legt euch keine Zügel an. Lasst eure Fantasie spielen.«
So was hat mir als Lehrer schon immer Spaß gemacht: rauszubekommen, wer mit fünfzehn, sechzehn mit Sprache umgehen, wer wirklich schreiben konnte, wer was draufhatte.
Nicht selten kamen dabei ganz nette Texte raus. Manche waren sehr pathetisch, manche gingen in Richtung Comedy. Manchmal traf man aber auch auf kreative Ödnis.
Der Erlkönig hatte mich persönlich noch nie besonders angesprochen. Pathetischer Schmu. Ich hätte mich auch für Alternativen entscheiden können, aber ich hatte ihn bewusst ausgewählt. Ich wollte, dass die Klasse ihn niedermacht. Und ich wollte wissen, wie weit sie damit geht.
Ich ließ sie eine Stunde grübeln, sammelte danach die Hefte ein, und zu Hause machte ich mich an die Lektüre. Wie erwartet waren ein paar ganz ordentliche Sachen darunter. In der nächsten Stunde las ich die Besten vor.
Von Lara gab es nichts vorzulesen. Sie hatte ihr Heft ohne eine einzige Zeile zum Erlkönig abgegeben.
Ich machte auf »Arrogantes-Lehrer-Arschloch« und warf ihr das Heft hin. »Lara, hast du Lust, uns deine Version vorzulesen?«
Sie sah zu mir hoch, ein Mundwinkel zog sich zu einem spöttischen Grinsen in die Höhe. Dann tippte sie sich an den Kopf. Ganz langsam. Wie in Zeitlupe.
Es war, als ob die ganze Klasse die Luft anhielte. Es war so still, man hätte ein DIN-A4-Blatt durch die Luft segeln hören können.
»Ich hab alles hier oben drin«, sagte Lara und stand auf.
Wir taxierten uns eine Weile, schließlich sagte ich: »Okay, lass mal hören.«
Ich drehte mich um, setzte mich hinter mein Pult, schlug die Beine übereinander und verschränkte die Arme vor der Brust.
Und wartete.
Es kam nichts. Erstes Getuschel war zu hören. Lara wurde unruhig. Sie sah zu Boden, hob auf einmal wieder den Kopf, sah mir direkt in die Augen und legte los.
Sie entfernte sich inhaltlich schon ein Stück weit weg vom Original. Aber das war auch ganz okay so. Bei ihr war es jedoch die Form, die aufhorchen ließ. Ich konnte nicht gerade sagen, dass ich ein großer Rap-Fan war, aber was Lara aus dem Erlkönig machte, war was ganz Besonderes.
Anfangs rezitierte sie noch etwas stockend, aber dann hatte sie den Rhythmus gefunden, und es ging Schlag auf Schlag:
»…
Man sieht ihn weder im Abend- noch im Nachtprogramm.
Man fragt ihn auch nicht nach einem Autogramm.
Wenn er kommt, stehst du vor Angst gleich mal stramm.
Aber du weißt ja, wärst du ein Unschuldslamm,
würde dein Name nicht ausgewischt wie von einem Tafelschwamm,
und alle Daten gelöscht aus dem ewigen Computerprogramm.
Also beweg dich, hau ab, renn um dein Leben, kriech durch den Schlamm.
Warne die andern, rette sie! Bang your drum!
…«
Wenn man die Verse nur las, mochten sie vielleicht nicht viel hermachen, aber die Art und Weise, wie Lara sie deklamierte, wie sie die betonten Silben – die Beats – raushaute wie eine Nagelmaschine, jagte mir einen Schauer den Rücken hinunter.
Als sie fertig war, sah sie mich triumphierend an.
Ich sagte nichts.
Und auch die Klasse sagte nichts.
Lara ließ sich auf ihren Stuhl fallen, schlug die Beine übereinander, verschränkte die Arme vor der Brust – sie imitierte mich – und blickte mich trotzig an. Sie wartete darauf, dass ich sie fertigmachte. Aber den Gefallen tat ich ihr nicht. Aber nicht, weil ich ein fieser Drecksack war, sondern ganz einfach, weil sie mich geplättet hatte.
Ich hatte in meiner Zeit als Lehrer schon viele Aufsätze gelesen und jede Menge Vorträge und Referate über mich ergehen lassen, aber das, was sie hier präsentiert hatte, war verdammt noch mal das Beste, was ich je von einer Schülerin gehört hatte.
Mir fiel im ersten Moment nichts ein, was ich sagen sollte. Nach einer Weile nickte ich. »Nicht schlecht, Lara.«
Ich entflocht meine Beine und Arme und legte die Ellenbogen auf das Pult.
Das brachte sie ein wenig durcheinander. Ihr Grinsen verschwand.
Ich sagte: »Ich hatte ja eigentlich nicht vorgehabt, euch für eure Arbeiten Noten zu geben, daran will ich mich auch halten. Aber wenn ich euch Noten geben würde – also nur wenn –, würde ich sagen: Lara, das war eine glatte Eins. Eine fucking Eins.«
Die Klasse schaute mich fassungslos an. Lara klappte die Kinnlade herunter.
Dann entspannte sich ihr Gesicht. Ein Lächeln erschien. »Aber Herr Stalmann, das heißt doch: fuckingA.«
»Okay«, stöhnte ich. »Meinetwegen würdest du, wenn ich Noten vergeben würde, von mir halt eine fuckingA kriegen. Aber jetzt lass gut sein.«
Sie nickte mir fast unmerklich zu. Ihre Nase fing an zu laufen. Und als sie es merkte, wischte sie sich den Rotz einfach mit dem Handrücken ab.
Als die Nase nicht aufhören wollte zu laufen, warf ich ihr eine Packung Papiertaschentücher zu.
Und sie fing sie ganz lässig mit einer Hand auf.
Von da ab war die Zeit des Abwartens, des Belauerns vorbei. Von diesem Tag an hatte ich so was wie eine Tochter. Eine rebellische Tochter. Eine mehr oder weniger adoptierte Tochter. Manchmal diskutieren nur wir beide die ganze Unterrichtsstunde hindurch. Sie gab nie klein bei. Sie gab mir, wenn sie eine Chance sah, immer Kontra. Sie stellte prinzipiell alles infrage.
Und trotzdem machte es Spaß mit ihr. Oder vielleicht auch gerade deswegen.
***
Als ich an diesem Nachmittag den Heimweg antrat, fühlte ich mich so ausgepumpt, als hätte ich den ganzen Tag in einem Steinbruch geschuftet. Ich hatte immer noch nichts gegessen und träumte von einer Fertigpizza aus einem Backofen, an der man sich die Finger verbrennen konnte.
Von dem immer noch eiskalten Wind, der mir die Haare zerzauste, mein Gesicht schockfrostete und meinen Atem stocken ließ, wurde ich über den Schulhof, hinein in das Straßengewirr und in die labyrinthischen Gassen der Stadt geweht. Bei einem kleinen Supermarkt kaufte ich für den Abend ein.
Irgendwann stand ich wieder mit anderen Fahrgästen in einer kalten U-Bahn-Station, Atemwolken stiegen auf, ich wartete und fror, wartete und fror.
Die Bahn ließ sich nicht blicken. Wieder einmal. Ich merkte, wie ich unruhig wurde. Ich starrte hoch zu den Anzeigetafeln und spitzte die Ohren, ob bald irgendwelche erhellenden Lautsprecherdurchsagen kämen.
Ich begann, meine Umgebung zu sondieren. Die Wartenden. Die in der Gegend dumm Herumstehenden. Die in ihre Smartphones Glotzenden. Die Lachenden und Glucksenden und Tuschelnden. Die Musik Hörenden.
Und plötzlich hatte ich ein Déjà vu der besonderen Art.
Ich musste auf einmal bei mir feststellen, dass ich darauf gefasst war, im nächsten Moment ein verräterisches Keuchen zu hören. Ein Keuchen, das schon bald in ein Knurren überging. Ein Knurren, das sich langsam zu einer ohrenbetäubenden Lautstärke steigerte.
Ein Knurren, wie ich es heute Morgen schon einmal in einer U-Bahn-Station gehört hatte.
Ich stand da, vollkommen unfähig, mich zu bewegen.
Und wartete.
Auf einen Smasher.
4. Kapitel: Was Sie schon immer über Smash wissen wollten …
Als die U-Bahn einfuhr, endete mein Déjà vu. Ich löste mich aus meiner Erstarrung, stieg ein, und eine halbe Stunde später war ich zu Hause.
In den 18-Uhr-Nachrichten nahm ein Regionalpolitiker den Vorfall heute Morgen in der U-Bahn-Station zum Anlass, darauf hinzuweisen, dass es in vielen Städten immer noch öffentliche Plätze und Räume gab, die nicht oder nur notdürftig gesichert waren. Der junge Politiker, er mochte noch keine vierzig sein, strich sich die gegelten schwarzen Haare für die Kamera zurück, drückte ganz lässig mit dem Zeigefinger die Designerbrille aufs Nasenbein und plädierte dafür, dass der Einsatz von privaten Sicherheitskräften endlich »absolut flächendeckend« ausgeweitet werden müsse.
Ich musste grinsen. Ich konnte mir schon bildlich vorstellen, wie in jedem Bus, in jeder Buchhandlung, in jeder Eckkneipe, in jedem Schwimmbad ein Schwarzer Sheriff mit der Waffe im Anschlag die Anwesenden im Auge behielt.
Zwei Stunden später wurde in der Tagesschau über einen der schlimmsten Smasher-Vorfälle seit Langem berichtet. Er trug sich in einer Kaserne zu. Während des Exerzierens hatten sich zeitgleich zwei Soldaten – zu allem Überfluss auch noch die kräftigsten, stärksten, durchtrainiertesten Soldaten der ganzen Einheit – in Smasher verwandelt. Sie töteten acht ihrer Kameraden und verletzten weitere elf – zum Teil schwer –, bevor sie sich gegenseitig zerfleischten. Die Tagesschau zeigte ein Amateurvideo, alles verwackelt, vieles unscharf, etliches auch nachträglich unkenntlich gemacht. Der Amateurfilmer, wahrscheinlich ein Soldat, hatte sein Smartphone so lange auf das Geschehen gerichtet, bis einer der beiden Smasher wie ein Panzerfahrzeug in einem Höllentempo auf ihn zugewalzt kam. Dann wurden Bild und Ton ausgeblendet.
***
Nach der Tagesschau kam eine Sondersendung anlässlich des Smasher-Attentats in der Kaserne.
Während früher die Sondersendungen oftmals mit reißerischen Hintergrundbildern Aufmerksamkeit erregt hatten – Blutlachen auf dem Asphalt, mit Leichentüchern notdürftig bedeckte Tote, entsetzte blutverschmierte Gesichter von Augenzeugen in Großaufnahme –, so waren sie im Laufe der Zeit von der Optik her nüchterner geworden und verzichteten auf allzu plakative Effekte.