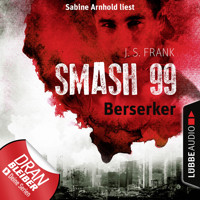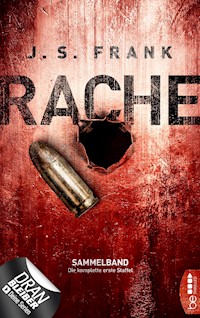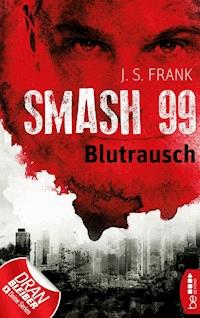
0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beBEYOND
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Smash99-Dystopie
- Sprache: Deutsch
DIE SERIE: Ein fremdartiges Toxin verbreitet sich rasend schnell - Smash. Wer damit infiziert wird, verwandelt sich innerhalb von Sekunden in einen vor Wut rasenden Smasher, der seine Mitmenschen anfällt und zerfetzt, bevor er selbst stirbt. Niemand weiß, wer hinter der Verbreitung des Gifts steckt. Klar aber ist: In einer Gesellschaft am Rande des Zusammenbruchs sind Smasher nicht dein größer Feind.
FOLGE 1 - BLUTRAUSCH: Hardy Stalmann hat sich wie die meisten Menschen an die täglichen Meldungen über tödliche Smasher-Angriffe gewöhnt. Doch dann erlebt er hautnah, wie ein Infizierter eine Frau in Stücke reißt. Das Erlebnis rüttelt Hardy wach. Ausgerechnet ihn, den drogensüchtigen Lehrer, der nichts mehr zu verlieren hat - und nun in einer hysterisch gewordenen Welt für ein wenig Ordnung sorgen will ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 150
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Inhalt
Cover
Die Serie
Folge 1: Blutrausch
Über den Autor
Titel
Impressum
1. Verdammte Montage
2. Kapitel: Willkommen im Smash-Zeitalter
3. Kapitel: Das verlorene Paradies
4. Kapitel: Was Sie schon immer über Smash wissen wollten …
5. Kapitel: Zeit für ein Plädoyer
6. Kapitel: Verlass mich nicht …
7. Kapitel: Echte Freunde
8. Kapitel: Götterdämmerung
9. Kapitel: Gegen alle Widerstände
10. Kapitel: Die Rache des Erlkönigs
In der nächsten Folge
Die Serie
Ein fremdartiges Toxin verbreitet sich rasend schnell – Smash. Wer damit infiziert wird, verwandelt sich innerhalb von Sekunden in einen vor Wut rasenden Smasher, der seine Mitmenschen anfällt und zerfetzt, bevor er selbst stirbt. Niemand weiß, wer hinter der Verbreitung des Gifts steckt. Klar aber ist: In einer Gesellschaft am Rande des Zusammenbruchs sind Smasher nicht dein größer Feind.
Folge 1: Blutrausch
Hardy Stalmann hat sich wie die meisten Menschen an die täglichen Meldungen über tödliche Smasher-Angriffe gewöhnt. Doch dann erlebt er hautnah, wie ein Infizierter eine Frau in Stücke reißt. Das Erlebnis rüttelt Hardy wach. Ausgerechnet ihn, den drogensüchtigen Lehrer, der nichts mehr zu verlieren hat – und nun in einer hysterisch gewordenen Welt für ein wenig Ordnung sorgen will …
Über den Autor
J.S. Frank hat nach seinem Germanistik-Studium mehr als zwanzig Jahre für ein internationales Medien-Unternehmen gearbeitet. Seit 2013 ist er freier Autor mit einem ungebrochenen Faible für die anglo-amerikanische und französische Literatur. J.S. Frank ist ein Pseudonym des Autors Joachim Speidel, der mit seinen Kurzgeschichten bereits zweimal für den Agatha-Christie-Krimipreis nominiert war.
J.S. Frank
Smash99
FOLGE 1
Blutrausch
beBEYOND
Digitale Originalausgabe
»be« – Das eBook-Imprint von Bastei Entertainment
Copyright © 2016 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Uwe Voehl
Projektmanagement: Stephan Trinius
Covergestaltung: Christin Wilhelm, www.grafic4u.de unter Verwendung von Motiven © shutterstock/501room; © shutterstock/Molodec; © shutterstock/Bildagentur Zoonar GmbH; © shutterstock/Subbotina Anna
eBook-Erstellung: Urban SatzKonzept, Düsseldorf
ISBN 978-3-7325-2555-3
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
1. Verdammte Montage
Ich erinnere mich noch genau an den Tag, an dem ich zum ersten Mal mit ansah, wie sich innerhalb einer halben Minute ein ganz normaler Mensch in einen Smasher verwandelte und anschließend eine Frau im wahrsten Sinne des Wortes zerfetzte.
Es war Montag, der 16. März. Es war kurz vor sieben Uhr. Wie viele andere wartete ich an diesem Morgen in der U-Bahn-Station auf die Linie 9. Sie hatte Verspätung, und man warf ungeduldige Blicke auf die Anzeigetafeln und hoch zu den Lautsprechern, aber vom Verkehrsverbund sah sich noch niemand in der Lage, irgendwelche Informationen zu der Verspätung zu geben.
Für einen Märzmorgen war es verdammt kalt. Die Menschen hatten wieder ihre Wintersachen aus dem Schrank geholt und sich in ihre Mäntel und dicken Jacken eingehüllt.
Als schließlich eine scheppernde Stimme aus den Blechkästen an der Decke die knappe Mitteilung herauskrächzte, dass die Linie 9 etwa zehn Minuten später käme, war den Wartenden anzumerken, dass sie mit ihrer Geduld bald am Ende waren.
Verärgertes Gemurmel wurde laut, vereinzelt sogar spöttisches Gelächter. Köpfe wurden ungläubig geschüttelt und Smartphones hastig gezückt, um diese News übellaunig weiterzugeben.
Zehn Minuten konnten eine ätzend lange Zeit sein.
Eine große Frau stapfte schwer atmend die Treppe herunter und sah sich verwundert um, weil so viele Menschen am Bahnsteig warteten. Sie mochte etwa Mitte fünfzig sein und war stark übergewichtig. Trotz der Kälte trug sie ihren braunen Fell-Wintermantel offen. Sie stellte sich an eine Aushangvitrine und begann die Nahverkehrsverbindungen zu studieren.
Als sie sich wieder umdrehte, schien sie auch nicht schlauer geworden zu sein. Sie machte ein verdrießliches Gesicht. Nach einer Weile fing sie an zu husten. Und das Husten wurde mit der Zeit immer heftiger und ging schon bald in ein kurzatmiges Bellen über. Da half es auch nicht, dass sie die Hand vor den Mund hielt.
Man kehrte ihr den Rücken und ging deutlich auf Abstand, schließlich konnte man nicht wissen, ob sie sich nur verschluckt hatte oder ob sie schlimm erkältet war.
Auch ich trat ein paar Schritte zurück. Ihr Bellen tat mir in den Ohren weh.
Nur ein Mann schien davon gänzlich unbeeindruckt zu sein. Er blieb ganz in ihrer Nähe, den Kragen seines Trenchcoats hochgeschlagen, so als könne ihn nichts erschüttern. Er war schlank und irgendwo zwischen dreißig und vierzig Jahre alt. Er hatte trendige weiße Design-Kopfhörer auf und schien in sich zu ruhen.
Die U-Bahn auf dem Gegengleis fuhr ein, begleitet von den entsprechenden Durchsagen. Als sie nach einer Weile die Station wieder verließ, war von dem Bellen nichts mehr zu hören.
Die große Frau schien nun alles im Griff zu haben. Sie atmete befreit durch. Ihre geröteten Wangen leuchteten. Mit einem Ärmel ihres Mantels begann sie, vorsichtig den Schweiß von der Stirn zu tupfen.
Ihr Husten war Vergangenheit, aber wie aus dem Nichts baute sich auf einmal ein ganz anderes Geräusch auf.
Ein Keuchen, das langsam in ein Knurren überging.
Es war schwer zu lokalisieren, aber so weit weg konnte es nicht sein. Es wurde lauter und lauter. Schon bald war die ganze U-Bahn-Station erfüllt von einem tiefen, röchelnden Knurren.
Erst jetzt sah ich, dass etwas mit dem Mann im Trenchcoat nicht stimmte.
Er riss die Kopfhörer herunter, machte den Rücken rund, beugte die Knie, verkrampfte sich und schlug die Hände über dem Kopf zusammen. So als würde er von einem plötzlichen, gigantischen Migräne-Anfall heimgesucht. Er verfiel in ein wildes Zittern, das in ein wahnsinniges Zucken überging. Es sah so aus, als stünde er unter Strom. Schaum bildete sich vor seinem Mund. Das Zucken wurde schneller und schneller, und seine Augen schienen sich um das Vielfache zu vergrößern. Auf einmal erstarrte er, und sein ganzer Körper spannte sich derart an, als bestünde er nur noch aus einem einzigen, gewaltigen Muskel.
Als die Ersten fluchtartig die Treppen hochrasten, umso schnell wie möglich von hier wegzukommen, wusste ich, dass es jetzt auch für mich an der Zeit war abzuhauen. Und zwar sofort! Augenblicklich! Auf der Stelle! Aber meine Füße schienen in Beton zu stecken. Ich kam nicht los. Ich konnte mich keinen Zentimeter rühren.
Auch der großen Frau schien es so zu gehen wie mir. Sie wirkte wie versteinert. Ihre angstgeweiteten Augen waren auf den Mann im Trenchcoat geheftet, der keine zwei Meter entfernt von ihr stand.
Im nächsten Moment bäumte er sich auf und fiel sie an. Wie ein Löwe eine Antilope. Er packte sie. Verbiss sich in ihr. Zerfetzte mit seinen Zähnen ihre Halsschlagader. Seine Finger, zu Klauen geformt, gruben sich durch ihren dünnen Pullover in ihren Leib, zogen und rissen an ihr, bis Woll- und Fleischfetzen durch die Gegend flogen.
Als sie mit dem Rücken auf den Betonboden knallte, warf er sich auf sie und begann, in einem wahnsinnigen Stakkato und mit ungeheurer Wucht auf ihren Leib einzuhämmern. Seine Fäuste durchschlugen ihre Haut, ihr Fettgewebe und ihre Muskeln. Man hörte Knochen brechen und die schmatzenden Geräusche, als er Krater um Krater in ihren Leib schlug. Ihre Eingeweide verteilten sich auf dem Bahnsteig. Blut spritzte auf, als er, die Arme wie Dreschflegel schwingend, immer und immer wieder auf ihren Körper eindrosch.
Die Frau war tot. Ohne Zweifel. Wahrscheinlich war sie bereits in den ersten Sekunden tot gewesen, aber der Mann schlug immer noch auf sie ein, sogar noch, als seine eigenen Finger, Hände, Unterarme, Ellenbogen brachen. Er hörte auch nicht auf, als die zersplitterten Knochen seiner Armknochen wie spitze Dolche durch die Ärmel des Trenchcoats stachen, bleiche Zeugnisse der eigenen Selbstzerstörung.
Am Ende brach der Mann zusammen, das Knurren ließ nach, ging in ein Keuchen über und mündete schließlich in ein Japsen. In ein klägliches Japsen. Er bettete seinen Körper auf dem, was von der Frau übrig geblieben war.
Ich hatte mich die ganze Zeit keinen Zentimeter, keinen Millimeter gerührt. Ich hatte sogar meinen Atem angehalten. Das unwirklich anmutende, grausame Schauspiel hatte mich in seinen Bann geschlagen. Ich hatte keine Sekunde meine Augen davon lassen können.
Als ich wieder Luft in meine Lungen sog, kam mir dieses Atemholen wie der erste Atemzug nach langer Zeit vor. So wie wenn man aus einer großen Tiefe wieder an der Wasseroberfläche auftaucht.
Mein Blick streifte die Uhr auf der Anzeigetafel. Es war nicht mal eine Minute vergangen.
Ich sah, wie sich der Kopf des Mannes hob. Ganz langsam. Wie in Zeitlupe. Das Gesicht glänzte blutrot. Die Augäpfel schimmerten weiß. Der Blick war starr auf ein fernes Nichts gerichtet.
Als die Linie 9 einfuhr, versuchte er, stöhnend hochzukommen, wegzukommen von dem, was er angerichtet hatte. Es schien fast so, als wolle er sich mit letzter, allerletzter Kraft auf die Gleise werfen.
Aber er schaffte es nicht mehr.
Wenige Augenblicke später stürmten schwer bewaffnete und gepanzerte Polizisten die U-Bahn-Station und pflückten ihn auf wie faules Obst.
***
Die Polizei nahm den Fall so routiniert und förmlich auf wie ein Verkehrsdelikt. Die Spurensicherung erschien, die Leiche der Frau und ihre überall verstreuten Überreste wurden in einen Zinksarg gepackt und weggeschafft. Danach rückte ein Putzkommando an.
Während die U-Bahn-Station gründlich und schnell gesäubert wurde, führten die Polizisten die Zeugenbefragungen vollkommen leidenschaftslos durch. Neben mir hatten vier weitere Personen das Smasher-Spektakel mitbekommen. Zwei hatten sogar Videoaufnahmen mit ihren Handys gemacht, die sie den Polizisten stolz zeigten. Doch die interessierten sich nicht dafür. Sie wollten ihren Papierkram so schnell wie möglich erledigen, mehr nicht. Formulare ausfüllen, Unterschriften daruntersetzen, Kladde schließen. Fertig.
»Hier! Ihr Personalausweis!«
Ich musste den jungen Polizisten wohl etwas zu lange angeschaut haben, denn er fing an zu blinzeln.
»Wie bitte?«
Er reichte mir den Ausweis, und ich griff schnell zu, sonst hätte er ihn womöglich fallen lassen. Er war noch keine dreißig. Sein gelblich-fahles Gesicht erinnerte in Farbe und Konsistenz an einen Hefeteig.
Ich steckte den Ausweis ein und wollte schon gehen, als er sagte: »Sie haben uns sehr geholfen, Herr Stalmann!«
»Wobei?«
»Ja, also …«, fing er an, kam aber gleich ins Stocken. »Sie …« Er musterte mich. Seine Augenbrauen zogen sich zusammen. Er zeigte mit dem Zeigefinger recht zaghaft auf mein Gesicht. »Sie haben da etwas Blut abbekommen. Haben Sie ein Taschentuch? Oder vielleicht …?«
Ich wischte mir über die Wangen und das Kinn und betrachtete meine Handfläche. Ja, da war in der Tat etwas Blut zu sehen.
»Kein Problem«, sagte ich, fischte in meinem Mantel nach einem Papiertaschentuch, rieb mir das Gesicht damit ab und warf es in den Mülleimer.
Der Polizist inspizierte mich erneut. Es sah so aus, als wäre er immer noch nicht ganz zufrieden, aber schließlich nickte er. Er schien sich mit meinem Aussehen abgefunden zu haben.
»Darf ich Sie abschließend fragen – es ist nur rein informell –, wo Sie jetzt hingehen? Ich meine … haben Sie jemanden, den Sie benachrichtigen können? Der Sie abholt?«
Ich verdrehte die Augen. »Ich brauche niemanden, der mich abholt. Ich gehe jetzt zu meiner Arbeit.«
Er blickte mich fragend an.
»Ich gehe in die Schule«, sagte ich. »Ich bin Lehrer.«
Er machte zuerst ein verständnisvolles Gesicht, dann schüttelte er den Kopf. »Wollen Sie nicht …?«
»Was?«
»Freinehmen? Sich beurlauben lassen? Und wenn auch nur … für den heutigen Tag?«
»Warum?«
Der Polizist fühlte sich erkennbar unwohl. »Wissen Sie, ich meine es nur gut mit Ihnen. Das ist nur zu Ihrem Besten. Das, was Sie heute miterlebt, was Sie durchgemacht haben … Sie sollten das nicht auf die leichte Schulter nehmen!«
»Keine Sorge, das tue ich nicht. Es fällt schon viel zu viel Unterricht wegen nichts und wieder nichts aus. Da kann ich nicht auch noch fehlen.«
»Aber wenn Sie nun in die Schule gehen. Ich meine, Ihre Schüler …«
»Machen Sie sich um meine Schüler keine Sorgen. Die sind es gewohnt, wenn Ihr Deutsch-Lehrer mal ein bisschen komisch drauf ist.«
Er sah mich entgeistert an. »Komisch drauf?« Er musste schlucken. »Also ich meine, falls Sie psychologische Hilfe benötigen … es gibt Spezialisten … für … für Leute wie Sie.«
»Sie meinen: für Leute, die gesehen haben, was ich gerade gesehen habe!«
»Genau!«, sagte er und fing ganz langsam an zu strahlen. Man sah ihm an, wie er sich freute, dass ich ihn verstanden hatte.
***
Ich rief in der Schule an und sagte, dass ich heute etwas später käme. Es sei mir etwas Unvorhergesehenes dazwischengekommen.
Danach schaltete ich auf Autopilot. Ich stieg in die nächste U-Bahn. Warf mich auf einen freien Platz. Schaute nicht nach links, schaute nicht nach rechts. Scherte mich nicht um die anderen Fahrgäste. Nahm die einzelnen Haltestellen, die wir nach und nach passierten, mit nüchterner Gelassenheit wahr. Drückte mich schließlich rechtzeitig aus dem Sitz hoch und stieg anmeiner Haltestelle aus.
Als ich den Schulhof betrat, strömten gerade die Schüler in die große Pause.
Ich hatte letztendlich nur eine Unterrichtsstunde ausfallen lassen müssen.
Ich überquerte wie in Zeitlupe den Hof. Seit dem Vorfall heute Morgen war ich in ein somnambules Schlurfen verfallen, gegen das ich nichts tun konnte. Ich war mir nicht ganz sicher, ob das meine Beine waren, die sich Schritt für Schritt vorwärtskämpften, und ob das meine Füße, meine Stiefel waren, die über den Asphalt schabten.
Jedenfalls wurde ich misstrauisch beäugt, man konnte sich keinen Reim darauf machen, was mit mir los war.
Als ein Fußball gegen mein Schienbein prallte, kam ein Junge auf mich zugerannt, der mich linkisch und schuldbewusst angrinste.
»Tut mir leid, Herr Stalmann«, sagte er. »Hab den Ball nicht richtig getroffen.«
Ich hatte Mühe, mir seinen Namen ins Gedächtnis zu rufen. Nach einer halben Ewigkeit kam ich drauf.
»Macht nichts, Reuben«, sagte ich. »Schon in Ordnung.«
Er war ein Junge aus der Zehnten, ein guter Zweier-Schüler in fast allen Fächern. Seine Kumpels standen ein paar Meter entfernt und beobachteten uns aus sicherer Entfernung.
Reuben zuckte mit den Achseln. »Soll nicht wieder vorkommen«, sagte er schnell, schnappte sich den Ball und wollte sich schon umdrehen, aber dann sah er mich ganz komisch an. »Ist was mit Ihnen, Herr Stalmann?«
Ich schüttelte den Kopf. »Was soll mit mir sein?«
»Keine Ahnung … Sie sind so … weiß auch nicht … sind Sie krank?«
»Krank? Nein, das müsste ich wissen. Wie kommst du darauf?«
Er zuckte wieder mit den Achseln. »Weiß auch nicht. Sie ballern uns normalerweise immer den Ball um die Ohren, wenn einer von uns Sie aus Versehen mal anschießt.«
»Heute ist halt nicht mein Fußballtag«, sagte ich und setzte mein Schlurfen fort.
Als ich an dem ersten Sicherheitsmann vorbeikam, stutzte ich. Ich brauchte eine Weile, bis ich seine Erscheinung richtig einordnen konnte. Auch seine anderen Kollegen nahm ich nun erst wahr. Sie waren in allen Ecken und Winkeln der Schule postiert worden.
Gleich, als es zu den ersten Smasher-Vorfällen in Deutschland gekommen war, hatten die Innen- und Kultusministerien, die Lehrer- und Elternverbände darauf bestanden, dass die Schulen so schnell wie möglich gesichert werden mussten. Präventiv versteht sich. Da die Polizei ihr Personal von heute auf morgen nicht so rasch aufstocken konnte, hatte man private Dienste ins Spiel gebracht. Und die waren jetzt für den Schutz in den Schulen zuständig.
Anfangs hatte ich die privaten Sicherheitskräfte belächelt, aber das kam auch nicht ganz von ungefähr, denn in ihrer Aufmachung sahen sie aus wie die reinsten Witzfiguren: schwarze Uniformen, schwarze Sonnenbrillen, schwarze Gürtel mit schwarzen Holstern und schweren Revolvern. Richtige Schwarze Sheriffs eben, aber an diesem Morgen konnte ich überhaupt nichts Lächerliches an ihnen finden. Ich sah sie auf einmal mit anderen Augen.
Als ich gerade das Schulgebäude betreten wollte, kam mir Jimmy Osterwald entgegen. Er war ein großer, dünner Schlaks, neunzehn Jahre alt, wie ein Dandy gekleidet: dicker, schwarzer Ledermantel, der vorne offen stand, darunter ein weißer Anzug, schwarzes Hemd, weiße Krawatte. Ich konnte ihn nicht ausstehen.
Er stellte sich mir einfach in den Weg. »He, Teacher! Sie sind spät dran!«
Ich musste blinzeln, ich konnte es nicht fassen, dass ein Schüler aus der zwölften Klasse, der zweimal sitzen geblieben war und in dessen Schädel sich mehr abgestandene Luft als Hirn befand, mich am Weitergehen hinderte. Zu allem Überfluss grinste er auch noch unverschämt.
Ich blickte mich um und bemerkte, dass einige Schüler uns beobachteten. Ein paar von ihnen hielten Rauchzeugs zwischen ihren Fingern, das nur entfernt an Zigaretten erinnerte. Bei einigen klebte an den Nasenlöchern weißes Pulver. Andere standen nur dumm rum, kratzen sich an den Handrücken und stierten uns mit winzigen Pupillen an.
Mit winzigen Pupillen!
Was zum Teufel war hier los? Was für ein Spiel wurde hier gespielt? Ich spürte den hirnrissigen Impuls, mir mit der Hand über die Augen zu fahren, um dieses Bild, das sich mir hier bot, einfach wegzuwischen. Aber ich wusste, dass dies alles keine Sinnestäuschung war. Das, was ich hier zu sehen bekam, war die nackte Realität auf unserem Schulhof. Mir war bloß entfallen, seit wann!
Rein offiziell waren an allen Schulen Drogen tabu. Seit Jahren war sogar das Zigarettenrauchen auf dem Schulgelände verboten. Aber scherte das irgendjemanden? Ging das irgendjemanden auf den Senkel? Kratzte das irgendjemanden?
Edwin, der Schülersprecher, ein zugegebenermaßen begabter Redner mit allerdings mittelmäßigen Leistungen in allen nicht sprachlichen Fächern, grinste mich von Weitem verlegen an und winkte in meine Richtung. Dann ließ er sich einen Joint reichen.
Ich wandte mich wieder Jimmy zu. »Stimmt. Ich bin spät dran heute«, sagte ich nach einer Weile und sah zu ihm auf. »Hast du ein Problem damit?« Er war zwar gut einen halben Kopf größer als ich, aber mich überkam auf einmal die Lust, ihn zu vermöbeln.
Er nestelte am Knoten seiner Krawatte herum. »Ach was, nein! Wo denken Sie hin! Ich mach mir …«
»Was?«
»… Sorgen! Ja, Mann! Ich mach mir Sorgen um Sie. Sie sehen nicht gut aus. Ist Ihnen nicht wohl?«
»Stimmt, Jimmy! Mir ist leicht unwohl.«
»Das tut mir aber echt leid!«, sagte er grinsend.
Ich ließ noch mal meinen Blick über die Schüler in unserer Nähe schweifen, bevor ich antwortete: »Willst du wissen, warum mir gerade leicht unwohl ist? Hm? Willst du das wissen? Weißt du, ich kriege hier etwas zu sehen, was mir gar nicht gefällt. Und wenn ich sage, dass mir etwas gar nicht gefällt, heißt das auch, dass irgendetwas hier richtig übel aussieht und dass es hier stinkt. Verstehst du, was ich meine, Jimmy?«