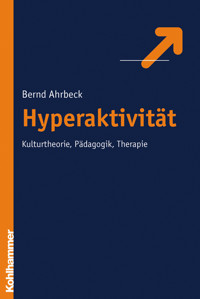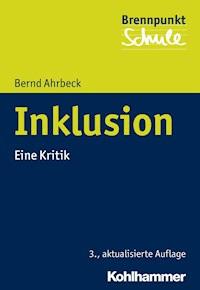
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer Verlag
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Deutsch
Die schulische Inklusion ist heute ein allseits akzeptiertes Ziel. Ein Mehr an Gemeinsamkeit von Kindern mit und ohne Behinderung kann nur begrüßt werden. Allerdings bleiben in der Inklusionsdebatte viele der anstehenden Fragen ungeklärt, darunter auch solche grundsätzlicher Art. Sie beziehen sich auf das Fernziel einer "inklusiven" Gesellschaft, das weitreichende Versprechen einer neuen Bildungsgerechtigkeit und gewagte pädagogische Konzepte, die dazu führen, dass die Bedürfnisse behinderter Kinder nur noch unzureichend beachtet werden. Vor unrealistischen Erwartungen, die mit einem radikalen Inklusionsverständnis einhergehen, wird gewarnt. Mit der Inklusion beginnt kein neues Zeitalter der Pädagogik: Die Grenzen des Möglichen und Sinnvollen müssen gesehen und anerkannt werden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 211
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Brennpunkt Schule
Herausgegeben von
Fred Berger
Herbert Scheithauer
Wilfried Schubarth
Bernd Ahrbeck
Inklusion
Eine Kritik
3, aktualisierte Auflage
Verlag W. Kohlhammer
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
3., aktualisierte Auflage 2016
Alle Rechte vorbehalten
© W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Gesamtherstellung: W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Print:
ISBN 978-3-17-031598-3
E-Book-Formate:
pdf: ISBN 978-3-17-031599-0
epub: ISBN 978-3-17-031600-3
mobi: ISBN 978-3-17-031601-0
Für den Inhalt abgedruckter oder verlinkter Websites ist ausschließlich der jeweilige Betreiber verantwortlich. Die W. Kohlhammer GmbH hat keinen Einfluss auf die verknüpften Seiten und übernimmt hierfür keinerlei Haftung.
Inhalt
Einleitung
1
Zum gegenwärtigen Stand schulischer Inklusion
2
Inklusion und Exklusion
3
Vielfalt, Normalisierung, Anerkennung
4
Auf dem Weg zu einer inklusiven Gesellschaft. Oder: Was ist eine inklusive Gesellschaft?
5
Bedrohliche Differenzen
6
Bildungsgerechtigkeit
7
»Gute« und »schlechte« Menschen
8
Abschließende Überlegungen
Literatur
Einleitung
Die Inklusion gilt zu Recht als ein allseits akzeptiertes Ziel, wer würde dem widersprechen. Sie soll dazu führen, dass die gesellschaftliche Zugehörigkeit und Teilhabe von Menschen mit Behinderung gestärkt wird, sich ihre individuellen Entfaltungsmöglichkeiten verbessern und persönlichen Lebensperspektiven erweitern. Eine erhöhte Akzeptanz und Anerkennung behinderter Kinder, Jugendlicher und Erwachsener ist dazu ein wichtiges Mittel. Es kann nur begrüßt werden, wenn zukünftig auch schulisch mehr Gemeinsamkeit von Kindern mit und ohne Behinderung gelingt. Doch das darf nicht bedingungslos geschehen und unter allen Umständen als der ausschließlich richtige Weg gelten.
Die Erwartungen und Ansprüche, die sich an die Inklusion richten, sind immens. Sie soll im Idealfall dafür sorgen, dass eine schulische Gemeinsamkeit entsteht, die sich auf unterschiedlichsten Ebenen als ertragreich erweist. Vom Gemeinschaftsleben wird erwartet, dass es für alle Beteiligten gewinnbringend, persönlich und sozial gleichermaßen bereichernd ist. Auf der Leistungsebene sollen alle Schüler profitieren aufgrund eines optimierten Lernalltages, der jedem Kind zugutekommt – von den Begabtesten bis zu den Leistungsschwächsten. Die chancengleiche Teilhabe für Menschen mit Behinderung und allgemeine Bildungsgerechtigkeit sind weitere Ziele, die inklusiv, so das Versprechen, besser als an anderen Orten erreicht werden können. Dem liegt die Erwartung zugrunde, dass die Förderung von Kindern mit Behinderung nunmehr auf einem höheren Niveau erfolgt als es spezielle Einrichtungen und Settings vermögen. In einem sozial-politischen Sinne wird die inklusive Schule nicht selten als ein Vorläufer einer inklusiven Gesellschaft angesehen. Das ist wahrlich ein großes Programm: Mit einer Fülle einzelner Anliegen, die gemeinsam erfüllt werden sollen, ohne dass sie in einen grundlegenden, schwer auflösbaren Widerspruch zueinander geraten.
Viele der im Hintergrund stehenden Fragen sind allerdings ungeklärt, darunter auch solche grundsätzlicher Art. Sie beziehen sich auf die anthropologischen Begründungen und Fernziele der Inklusion, ihre erziehungswissenschaftliche Fundierung, den Entwurf praxistauglicher Konzeptionen bis hin zu Problemen der konkreten Umsetzung vor Ort. Der Spannungsbogen, der sich hier auftut, ist beträchtlich. Auf der einen Seite steht die Vorstellung, die Pädagogik müsse nunmehr auf ein gänzlich neues Fundament gestellt werden; auch deshalb, weil es der Inklusionsgedanke erzwingt, die Gesellschaft in ihrer gesamten Architektur neu zu überdenken. Den anderen Pol bildet die nüchterne Feststellung, dass es um die Bekräftigung und Vertiefung der bisherigen Integrationsidee geht. Es sei kein fundamental neues Anliegen entstanden. Insofern verwundert es nicht, dass keine auch nur annähernd konsensfähige Definition dessen vorliegt, was denn nun unter Inklusion zu verstehen sei.
Tonangebend in der öffentlichen Wahrnehmung wie in breiten Teilen des Fachdiskurses sind nur wenige Stimmen, die sich laut vernehmbar in Szene setzen. Sie repräsentieren vornehmlich ein radikales Inklusionsverständnis, ein »totales« und »holistisches«, wie Mathias Brodkorb (2014) es nennt. Ihr Anliegen vertreten sie nicht selten mit einem starken Sendungsbewusstsein und hohen moralischen Ansprüchen, die mitunter den Anschein erwecken, als sei jede Art von Widerspruch illegitim. Diejenigen, die sich mehr als nur punktuell kritisch äußern, geraten leicht in den Verdacht, grundsätzlich gegen Inklusion zu sein; mitunter werden sie sogar als »Inklusionsfeinde« gebrandmarkt.
Doch es gibt auch ein anderes Verständnis von Inklusion, ein »gemäßigtes« und »approximatives«, das bescheidener auftritt, das Bisherige stärker wertschätzt und Schritt für Schritt die Lebens- und Lernsituation von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung verbessern möchte. Im Hinblick auf eine stärkere Partizipation und Teilhabe und vor allem auch dadurch, dass eine Förderung auf einem höheren Niveau als bisher ermöglicht wird. Es ist dabei von der nicht unberechtigten Sorge geleitet, dass eine unzureichend vorbereitete und fachlich unbedachte Auflösung spezieller pädagogischer Institutionen und Settings für die betroffenen Kinder zu mehr Nachteilen als Vorteilen führen kann. Gegenwärtig haben es die moderaten Stimmen vergleichsweise schwer, Gehör zu finden. Gleichwohl mehren sich die Anzeichen dafür, dass sich die Anfangseuphorie, die den Inklusionsgedanken zunächst begleitete, langsam ihrem Ende entgegen geht.
Grundlegend stehen sich also zwei unterschiedliche Arten des Inklusionsverständnisses gegenüber. Sie unterscheiden sich im angestrebten Reformtempo und – was noch wichtiger ist – darin, ob eine ungetrennte Gemeinsamkeit aller Schüler das ausschließlich gültige Ziel sein kann. Eine weitere zentrale Differenzlinie verläuft entlang der Frage, welcher Stellenwert der intraindividuellen und interindividuellen Leistungsbewertung eingeräumt wird. Die Akzeptanz oder (weitgehende) Ablehnung von Bildungsstandards ist dabei eine Kardinalfrage. Hinzu kommt eine unterschiedliche Bewertung der bisherigen sonderpädagogischen Förderkategorien. Während sie von gemäßigter Seite für unverzichtbar gehalten werden, möchten sie andere unter dem Stichwort der Dekategorisierung weitgehend, wenn nicht gar vollständig abschaffen.
All das sind keine akademischen Fragen. Faktisch erfolgen in allen Bundesländern schulstrukturelle Veränderungen, teils in einem rasanten Tempo. So werden in den Stadtstaaten Bremen und Hamburg Sonderschulen im Grundschulbereich in beträchtlichem Umfang oder gänzlich aufgelöst, so dass die Mehrzahl der Schüler mit Behinderung innerhalb kurzer Zeit gemeinsam beschult wird. Andere Bundesländer wie Sachsen gehen vorsichtiger vor, auch deshalb, weil sie ein (sonderpädagogisch) differenziertes System auf breiter Ebene beibehalten möchten.
Zunächst einmal scheint es eine weitgehende Übereinstimmung darin zu geben, dass die Inklusion ohne sonderpädagogisches Wissen, ohne sonderpädagogische Kompetenzen nicht gelingen kann. Ein solcher Konsens könnte sich jedoch als brüchiger erweisen, als der erste Blick verrät. Die Veränderungen, die für einige universitäre Ausbildungsinstitute angestrebt werden, setzen hierzu ein bedenkliches Zeichen. Bereits jetzt haben viele Studienstätten die sonderpädagogischen Schwerpunkte auf übergreifende Themen verlagert, die Fächervielfalt eingeschränkt und einzelne fachliche Schwerpunkte zusammengelegt. Andere werden dem folgen.
Nicht zu Unrecht stellt Andreas Hinz (2009) die Frage, ob die Inklusion einen veränderten Orientierungsrahmen für die sonderpädagogische Arbeit darstellt oder doch ihr Ende bedeutet. Diese Gegenüberstellung ist zugespitzt formuliert: Zu einer gänzlichen Aufgabe sonderpädagogischer Inhalte wird es sicherlich nicht kommen. Aber es ist sehr wohl möglich, dass sie zukünftig einen beträchtlichen Bedeutungsverlust erleiden werden. Für ein radikales Inklusionsverständnis dürfte das nur ein geringes Problem sein: Die Forderung nach einer weitreichenden Dekategorisierung sonderpädagogischer Begrifflichkeiten, die überzogene Relativierung verbindlicher Entwicklungsziele und eine latente oder offene Geringschätzung des Förderanliegens sprechen dafür. Die Gefahren, die daraus resultieren, sind offensichtlich: Der (sonder)pädagogischen Förderung droht ein Niveauverlust, für den ein hoher Preis zu entrichten ist, in aller erster Linie von den betroffenen Kindern selbst.
Die Inklusion kann im Spannungsfeld von Gleichheit und Besonderheit, allgemeiner und spezieller Förderung Schwerpunkte anders als bisher setzen. Die Paradoxien und Antinomien, die dem Erziehungs- und Bildungsgeschehen immanent sind, vermag sie jedoch ebenso wenig zu lösen wie alle vorangegangenen Reformen. Substantielle und beständige Fortschritte wird sie nur dann erzielen, wenn sie nicht mit Erwartungen, Ansprüchen und Hoffnungen überfrachtet wird, die sich bei realistischer Betrachtung als unerfüllbar erweisen. Insofern bedarf es Veränderungen, die mit Augenmaß erfolgen, und es ist wenig hilfreich, wenn die Inklusion als eine völlig neue Wirklichkeitsform gepriesen wird, als ein Olymp der Entwicklung (Wocken 2012, 72) oder gar als »Grenzstein […] zum Übergang in eine neue Welt« (Dreher 2012, 30). Eine abgeklärte Betrachtung führt deshalb auch zu einem anderen Ergebnis: Die »pädagogische Welt wird [auch jetzt] nicht neu erfunden und man fragt sich […], woher der frische Mut stammt, unter der Fahne der Inklusion jetzt alle Probleme bewältigen zu können, die sich nach historischer Erfahrung bei allen Reformen als resistent erwiesen haben« (Tenorth 2011, 19).
1
Zum gegenwärtigen Stand schulischer Inklusion
Die Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention hat dazu geführt, dass die einzelnen Bundesländer gravierende Veränderungen im Schulsystem anstreben und sie zum Teil bereits umgesetzt haben. Eine vermehrte gemeinsame Beschulung von Kindern mit und ohne Behinderung ist dabei das einvernehmliche Ziel. Eine spezielle Beschulung gilt nunmehr als im besonderen Maße begründungspflichtig, sie wird eher als Ausnahme denn als Regelfall angesehen. Sonderschulen wird es deshalb in Zukunft weniger als bisher geben, das ist sicher, und andere spezielle pädagogische Settings wohl auch.
Zwischen den einzelnen Bundesländern bestehen aber nicht unerhebliche Differenzen in der Frage, welche Rolle spezielle schulische Einrichtungen kurz-, mittel- oder langfristig spielen sollen. Einige Bundesländer setzen darauf, Schulen für Kinder mit einem Förderbedarf im Bereich des Lernens, der emotional-sozialen und sprachlichen Entwicklung schnellstmöglich aufzulösen, andere Sonderschulen sollen dem in absehbarer Zeit folgen – bis auf sehr wenige Ausnahmen. Andere Länder gehen moderater vor, indem sie eine schrittweise Reduzierung spezieller Schulen anstreben, ohne dass grundsätzlich auf sie verzichtet werden soll. Insofern unterscheiden sich die Bundesländer nicht nur im eingeschlagenen Reformtempo, sondern auch in den Vorstellungen darüber, wie die Inklusion pädagogisch verantwortlich, fachlich begründet und mit optimalen Erfolgsaussichten umgesetzt werden kann.
Bereits 1994 hatte die Kultusministerkonferenz empfohlen, dass ein spezieller Förderbedarf nicht mehr zwangsläufig zu einer Sonderbeschulung führen soll. Die Integration von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung wurde zum vornehmlichen Ziel erklärt. Die sich daran anschließende Entwicklung ist von einer ganzen Reihe von Parametern abhängig, unter anderem davon, wie häufig ein Förderbedarf vergeben wird. Betrachtet man die letzten zehn Jahre, dann zeigt sich, dass die Förderquoten kontinuierlich angestiegen sind. Verantwortlich dafür sind vor allem Veränderungen in den Bereichen geistige, emotional-soziale und sprachliche Entwicklung. Im Schulbesuchsjahr 2010/2011 wurde mit einem Förderbedarf bei 6,3 Prozent aller Schüler der bisherige Höchststand erreicht (Dietze 2012, 26 f.) – das ist ein Wert, der international im Mittelbereich liegt (EADSNE 2012).
Damit einher geht eine leichte Steigerung der Sonderschulbesuchsquoten und eine stärkere bei einer gemeinsamen Unterrichtung. Da die Integrationsquoten im genannten Zeitraum aber nicht beträchtlich angestiegen sind, wird die Mehrzahl der Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf nach wie vor an speziellen Schulen unterrichtet. Die Integrations- bzw. Inklusionsquote liegt im Schuljahr 2010/2011 bei 22,2 Prozent (Dietze 2012, 28), mit erheblichen Variationen zwischen den einzelnen Behinderungsarten und starken regionalen Unterschieden.
Der höchste Anteil integriert/inkludiert beschulter Kinder und Jugendlicher findet sich in den Bundesländern Schleswig-Holstein, Berlin und Bremen mit Werten zwischen 49,3 und 41,0 Prozent. Die geringsten Quoten weisen Niedersachsen, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt auf, sie liegen zwischen 8,5 und 16,9 Prozent. Das ist der gegenwärtige Stand: Er geht auf unterschiedliche Integrationstraditionen in den einzelnen Bundesländern zurück und mischt sich mit den Folgen von Umsteuerungsprozessen, die bisher in Richtung Inklusion erfolgt sind.
Beachtet werden muss dabei, dass die genannten Quoten auf ungleichen Ausgangslagen beruhen. Die einzelnen Bundesländer differieren in ihren Förderquoten erheblich. Über den höchsten Wert mit 11,3 Prozent verfügt Mecklenburg-Vorpommern, gefolgt von Sachsen-Anhalt (9,7 %), Brandenburg (8,5 %), und Sachsen (8,4 %), die niedrigsten Quoten verzeichnen Rheinland-Pfalz (4,5 %) und Niedersachsen (4,8 %) (Dietze 2012, 26 ff.).
Die Gründe dafür sind vielfältig. Sie liegen zum einen in der soziographischen Zusammensetzung der Bevölkerung, die mit unterschiedlichen sozialen Belastungen einhergeht. Für die Genese von Lern-, Sprach- oder Verhaltensstörungen ist das ein bedeutendes Faktum, und auch bei körperlichen und Sinnesbeeinträchtigungen erweisen sich soziale Faktoren als nicht einflusslos. Insofern ist bereits aus diesem Grund mit Ungleichverteilungen zwischen den Bundesländern zu rechnen. Zum anderen spielen neben der Zusammensetzung der Schülerschaft auch allgemeine schulische Rahmenbedingungen eine wichtige Rolle: Unter anderem die Struktur des Schulsystems, die Verfügbarkeit von innerschulischen Beratungs- und Unterstützungsangeboten sowie von vor- und außerschulischen Hilfen. Die Gestaltung und Qualität der unterrichtlichen Praxis ist eine weitere wichtige Einflussgröße, die darüber (mit)entscheidet, ob sich bestimmte (schulische) Entwicklungsprobleme abmildern, verfestigen oder gar verschärfen. Unterschiedliche Bewertungsmaßstäbe und Diagnosepraktiken kommen als ein gewichtiger Faktor hinzu.
Um in diesem hochkomplexen Feld Zuordnungs- und Entscheidungsprozesse transparenter zu gestalten, wird vielfach gefordert, die Erhebung des Förderbedarfs solle objektiviert werden. Mit Hilfe stärker standardisierter Erhebungsverfahren und zum Teil auch dadurch, dass eine zentralisierte Diagnostik angestrebt wird, die schulunabhängig erfolgt. Länderspezifische und regionale Disparitäten könnten auf diesem Weg reduziert oder gar ausgeglichen werden, so lautet die dahinter stehende Erwartung und Hoffnung. Sie richtet ihren Blick zugleich auf die kontinuierlich steigenden Kosten, die mit den anwachsenden Förderbedarfen einhergehen.
Ganz sicher ist es ein lobenswertes Ziel, dafür einzutreten, dass diagnostische Entscheidungen transparenter werden. Einige regionale Disparitäten stechen ins Auge und es bedarf der Aufklärung darüber, warum sie so ausgeprägt existieren (Dietze 2011; Lehmann & Hoffmann 2009). Zweifel sind aber angebracht, ob der vorgeschlagene Weg zu einem gehaltvollen Ergebnis führt, einem solchen, das sich pädagogisch als tragfähig erweist. Ob ein Förderbedarf sinnvollerweise, das heißt zum Wohle des Kindes ausgesprochen wird, hängt in den allermeisten Fällen von einem komplexen schulischen und außerschulischen Bedingungsgefüge ab, in das unter anderem die soeben genannten Faktoren eingehen. Seit langem und zu Recht wird im Fachdiskurs davon ausgegangen, dass sich die Existenz einer Behinderung nicht mehr nur an der Person festmachen lässt. Äußere Rahmenbedingungen bedürfen gleichermaßen einer gezielten Aufmerksamkeit, damit eine behindernde Umwelt als eine solche erkannt und verändert werden kann. Die International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) bietet dazu ein bedeutendes, weithin anerkanntes Referenzsystem (Hillenbrand 2013).
Der sonderpädagogische Förderbedarf bedarf deshalb einer engen Anbindung an die schulische (und außerschulische) Lebens- und Lernsituation des Kindes, ohne ihre Berücksichtigung lässt er sich kaum adäquat formulieren. Die Herausnahme dieser diagnostischen Aufgabe aus dem Schulalltag muss deshalb kritisch gesehen werden. Ebenso wie der aus Schulverwaltungssicht verständliche, pädagogisch aber wenig fruchtbringende Versuch, über objektivierende Erhebungen zu vergleichbaren Kennzahlen zu gelangen. Sofern sie vornehmlich personenbezogen ermittelt werden, was naheliegt, verdunkeln sie den Blick auf ein hochkomplexes Feld, das eine solche Komplexitätsreduktion nicht erlaubt.
Bei der Betrachtung des Einzelfalles in seiner sozialen Einbindung sind dem Streben nach Objektivität Grenzen gesetzt. Diagnostische Bewertungen und Entscheidungen müssen plausibel und nachvollziehbar dargestellt werden, das ist eine Selbstverständlichkeit. Subjektive Sichtweisen und Bewertungen lassen sich dabei aber nicht gänzlich ausschließen und situativen Gegebenheiten kommt einiges Gewicht zu; jedes Kind ist in seiner individuellen Lebenssituation zu erfassen. Das oberste Ziel muss es sein, dass einem Kind die besten Entwicklungsmöglichkeiten eingeräumt werden – und diese sind nun einmal in ein persönliches Bedingungsgefüge eingebunden und von den Gegebenheiten vor Ort abhängig. Insofern kann es sehr wohl verantwortlich sein, wenn ein bestimmtes Kind einen sonderpädagogischen Förderbedarf erhält und ein anderes nicht, obgleich sich ihre objektiv beschreibbaren Daten ähneln oder fast identisch sind.
Aus diesen und den anderen bereits genannten Gründen ist es schwierig, die unterschiedlichen Förderquoten der einzelnen Bundesländer wertend zu vergleichen. Dazu gibt es zu viele ungeklärte Fragen: Soll ein häufig vergebener Förderbedarf als ein Indikator dafür gelten, dass bestimmte Schüler die ihnen gebührende Aufmerksamkeit erhalten? Werden sie deshalb besser gefördert? Oder wird eine entsprechende Diagnose zu schnell und leichtfertig erstellt? Zum Schaden der unnötig etikettierten Kinder oder gar, weil in erster Linie die schulische Ausstattung verbessert werden soll? Wird ein Förderbedarf deshalb vergleichsweise selten gestellt, damit Kinder vor einem Sonderstatus geschützt werden? Oder unterbleibt dadurch eine gezielte Hilfestellung, auf die manche Kinder dringend angewiesen sind? Die Reihe der Fragen ließe sich weiter ergänzen. Eine aussagekräftige Antwort darauf steht im Ländervergleich bisher aus.
Auch bedürfen die unterschiedlichen Integrations-/Inklusionsquoten der einzelnen Bundesländer einer sorgsamen Interpretation. Zunächst einmal scheinen die Bundesländer im Vorteil, die das grundlegend wünschenswerte Prinzip einer gemeinsamen Beschulung am stärksten umgesetzt haben. Sie sind am weitetesten auf dem Weg zur Inklusion fortgeschritten, so heißt es. Aber stimmt das wirklich? Allein der Umstand, dass gemeinsam beschult wird, erlaubt noch kein Urteil darüber, ob die damit verbundenen Ziele auch erreicht werden. Es sei denn, es gilt nur ein einziges Kriterium, das der Gemeinsamkeit aller, unabhängig von allen sonstigen Folgen. Stein warnt deshalb vor voreiligen Schlussfolgerungen: »Die in der Diskussion dominante, sehr schlichte Betrachtung von Integrationsquoten wird der Komplexität der Tatbestände nicht gerecht. Eine hohe Integrationsquote sagt noch nichts über die tatsächliche Integration bzw. die Qualität inklusiver Beschulung von Kindern und Jugendlichen aus« (Stein 2012, 191).
Von einem selbstverständlichen Gelingen darf hier ebenso wenig ausgegangen werden wie in anderen schulischen Organisationsformen – die Sonderschulen eingeschlossen. Wichtige Kriterien erfolgreicher schulischer Arbeit sind die soziale Einbindung eines Kindes in die Klasse, seine emotionale Befindlichkeit, die behinderungsspezifische Förderung und nicht zuletzt seine schulische Leistungsentwicklung. Kein System wird auf allen Ebenen zugleich eine optimale Lösung anbieten können. Es kommt deshalb darauf an, dass die genannten Ziele in einem ausbalancierten Verhältnis zueinander stehen. So, dass der größtmögliche Gewinn erzielt wird und die Nachteile gering ausfallen. Eine ideale Lösung wird es nicht geben: Die Anforderungen, die an die inklusive Schule gestellt werden, sollten sich daher im realistischen Rahmen dessen halten, was Schule vermag.
Ein Wettstreit zwischen den Bundesländern um die höchsten Inklusionsquoten ist aus den genannten Gründen nicht unproblematisch. So wünschenswert hohe Inklusionsquoten im Prinzip auch sind: Allein auf sich gestellt, führen sie nur zu begrenzt belastbaren Daten. Zumal dann, wenn politisch motiviert Umdefinitionen erfolgen, die es ermöglichen, dass spezielle pädagogische Settings in die Landesstatistiken nicht mehr als solche eingehen (vgl. Rauh, Laubenstein & Auer 2012, 24).
Für den innereuropäischen oder gar weltweiten Vergleich besteht die gleiche Problematik. Sie verschärft sich aber insofern, als die politischen, kulturellen, pädagogischen und institutionellen Rahmenbedingungen noch sehr viel stärker differieren. Hinzu kommt, dass der Behinderungsbegriff uneinheitlich definiert wird und sich die Erhebungsmerkmale erheblich voneinander unterscheiden (WHO 2011). So werden Kinder mit dem hiesigen Förderbedarf Lernen und emotional-soziale Entwicklung in einigen Staaten gar nicht gesondert als förderbedürftig ausgewiesen. Auch wirft die vergleichende Betrachtung von Schulsystemen einige Fragen auf.1
Dennoch ist unverkennbar, dass Deutschland im europäischen Raum eine besonders hohe Sonderschulbesuchsquote (4,3 %) aufweist, die nur noch von Belgien in beiden Landesteilen (5,5 %; 4,8 %) übertroffen wird. Ebenfalls hohe Werte finden sich in der Slowakei (3,8 %), in Lettland (3,7 %) und in den Niederlanden (2,7 %). Einer der Gründe dafür dürfte darin liegen, dass in vielen Ländern Kinder mit Behinderung schulisch deutlich weniger erfasst werden, wie etwa in Schweden, Luxemburg, Spanien, Italien oder England (EADSNE 2012, 37 ff.). In Bulgarien oder Rumänien sind die Beschulungsquoten behinderter Kinder extrem gering. In ihrer Mehrzahl gehen sie dort überhaupt nicht zur Schule (WHO 2011, 204).
Aber auch unterschiedliche Integrationserfahrungen spielen eine Rolle. Viele andere Länder verfügen über eine sehr viel längere Tradition der gemeinsamen Unterrichtung: Mit einem dementsprechend reichen Erfahrungsschatz, persönlichen Haltungen und pädagogischen Qualifikationen, die dieser Aufgabe zugute kommen. Insofern verfügen sie über einige Vorteile. Ob dies durchgängig für alle Länder mit hohen Integrations-/Inklusionsquoten gilt, sei dahin gestellt. Die gegenwärtige Forschungslage jedenfalls ermöglicht dazu keine klare Aussage. Die »Analyse vorliegender Forschungsliteratur« führt nämlich zu dem »eher nüchterne[n] Fazit, dass sowohl in der Historischen Pädagogik ›international vergleichende Untersuchungen in der Regel fehlen‹ (Lüth 2000, 100) als auch in der Vergleichenden Pädagogik ›die Erforschung der transnationalen Zivilgesellschaft im Bildungsbereich noch in den Anfängen‹ steht (Fuchs & Schriewer 2007, 146)« (Ellger-Rüttgardt 2013, 241).
Man sollte sich aber nicht täuschen: Auch die traditionell sehr integrationsbereiten und -erfahrenen, oftmals als Vorbilder angesehenen skandinavischen Länder verzichten nicht auf klassische Sonderschulen oder spezielle pädagogische Settings. Dazu Herz (2011, 33): »Eine inklusive Schulpädagogik und Kommunalpolitik scheint in den skandinavischen Ländern professionell umgesetzt zu werden; als Glanzlicht wird vor allem Finnland gepriesen. [Dabei] wird unterschlagen, dass Finnland 6 unseren Schulen für Erziehungshilfe entsprechende Sonderschulen […] vorhält – eine Art Kleinstheimsonderschule –, 6 Kleinstschulen in der Kinder- und Jugendpsychiatrie […] bestehen sowie 3 geschlossene Unterbringungen für etwa 30 – 40 Heranwachsende.« Das ist für ein so bevölkerungsschwaches Land keine geringe Zahl, zumal Finnland kaum über soziale Brennpunkte und nur geringe Migrantenquoten verfügt. In Finnland werden insgesamt 1,1 Prozent aller Schüler in klassischen Sonderschulen unterrichtet, darüber hinaus 2,7 Prozent in getrennten Spezialklassen in allgemeinen Schulen (EADSNE 2012, 21). Aufaddiert sind also 3,8 Prozent aller finnischen Schüler betroffen; von den deutschen Sonderschulquoten ist dies nicht weit entfernt.
An diesen Zahlen ist die besondere geographische Lage nicht unbeteiligt: »40 % aller finnischen Schulen haben weniger als 50 Schüler, 60 % haben weniger als sieben Lehrkräfte. Über 500 Schüler haben ganze 3 % aller Schulen« (von Freymann 2002, 1). Den Möglichkeiten, ein gegliedertes Schulsystem einzurichten, sind bereits dadurch kaum überwindbare Grenzen gesetzt. Gleiches gilt für den Aufbau eines differenzierten Sonderschulsystems. Die Zahl der Schüler, die in speziellen Klassen unterrichtet wird, ist aber seit 1998 stetig angestiegen. »In 2008 upwards of 6,1 % of the students in comprehensive schools were placed in special classes at least part-time. The legitimization of the separate special class system is strong. In opposition to inclusion, the official policy promotes early intervention as a main area of development. The high legitimacy and constant growth of segregates special education can be understood as a consequence of the individual funding model, teacher professionalism and the Finnish value system originating from the late modernisation of overall society« (Saloviita 2009, 1).
Schweden kennt nur wenige Sonderschulen, dafür aber Sonderklassen, wenngleich nur in recht geringem Umfang (1,4 %; EADSNE 2012, 65). Allerdings hat sich die Zahl der Sonderklassen für Kinder mit geistiger Behinderung seit Mitte der 1990er Jahre fast verdoppelt (gegenwärtig: 1,5 %; Barow 2011, 4). Ihre Existenz wird auch zukünftig nicht in Frage gestellt (Barow & Persson 2011, 22). Weiterhin bedeutet eine sogenannte integrative oder inklusive Beschulung nicht, dass alle Kinder tatsächlich gemeinsam unterrichtet werden; 2,3 % bis 3,1 % der schwedischen Grundschüler verbringen »mindestens die Hälfte ihres Unterrichts in gesonderten Lerngruppen« (Barow 2011, 4).
All das spricht nicht gegen die Integrations- und Inklusionsbemühungen der genannten skandinavischen Länder, wohl aber gegen eine Idealisierung oder gar Idolisierung der dortigen Verhältnisse. Institutionelle Differenzierungen werden auch in diesen Ländern vorgenommen, in einem nicht unbedeutenden Ausmaß, zwischen den Schulformen oder innerhalb der Gesamtschulsysteme. Von Freymann (2002) weist zudem darauf hin, dass sich die finnischen Schulen in ihrer fachlichen Ausrichtung und dem Unterrichtsniveau erheblich voneinander unterscheiden, sehr viel stärker als dies in Deutschland innerhalb einer Schulform der Fall ist.
Von der innerschulischen Struktur her mag das dortige Gesamtschulsystem vorteilhaft sein: Spezielle Settings können schneller eingerichtet, aber auch wieder aufgegeben werden. Diese größere Flexibilität kann dazu beitragen, dass pädagogisch gezielter und letztlich effektiver gearbeitet werden kann.
Allerdings sind dort die Grundlagen der pädagogischen Arbeit andere: Generell weisen die skandinavischen Länder im Allgemeinen auffallend hohe Quoten speziellen Förderbedarfs auf. In Finnland liegt er nach neuesten Angaben bei 8,3 % aller Schüler; zusätzlich erhalten 23 % der Kinder mit weniger gravierenden Lernproblemen eine zeitweilige spezielle Unterstützung (EADSNE 2012, 21) – mit entsprechenden Folgen für die Personalausstattung.
Diese kurzen Ausführungen müssen an dieser Stelle genügen: Sie belegen, wie komplex sich die bildungspolitische Situation in unterschiedlichen europäischen Ländern bereits auf den ersten Blick darstellt. Und sie signalisieren, dass Vorsicht geboten ist, wenn es um vergleichende Bewertungen geht (Bürli 2009). Im öffentlichen Diskurs über Schulsysteme und die schulische Inklusion finden sich voreilige Stellungnahmen jedoch immer wieder, auch in den als seriös geltenden Medien und oftmals auf einer weithin ungesicherten Datenbasis. Bedauerlicherweise ist auch die wissenschaftliche Fachdiskussion nicht gänzlich frei davon.
Ein Überblick über die weltweite Situation findet sich im WHO-Weltbericht Behinderung (2011). Für viele Entwicklungsländer besteht die primäre Verpflichtung darin, überhaupt für eine Beschulung zu sorgen, die alle Kinder umfasst, damit ein elementares Bildungsrecht garantiert werden kann. Das gilt sowohl für Kinder mit als auch ohne Behinderung. Insofern müssen schulische Strukturen häufig erst noch aufgebaut werden. Für diejenigen Staaten, die über gut ausgestattete Systeme verfügen, stellt sich eine andere Aufgabe, nämlich die, eine stärkere gemeinsame Beschulung herbeizuführen. Insgesamt wird von der Weltgesundheitsorganisation für kein einheitliches Modell plädiert: »Die Anzahl der Kinder mit Behinderungen, die entweder in Regelschulkontexten oder in segregierten Kontexten unterrichtet werden, unterscheidet sich stark von Land zu Land, und ein vollständig inklusives System gibt es in keinem der Länder. Es ist wichtig, dass die Unterbringung flexibel gehandhabt wird. […] Pädagogische Bedürfnisse müssen im Hinblick darauf beurteilt werden, was für den Einzelnen das Beste ist« (WHO 2011, 205).
1 Dazu ein Beispiel: Japan verfügt über ein ausgeprägtes Gesamtschulsystem. Eine gemeinsame Beschulung gilt im offiziellen Selbstverständnis als Selbstverständlichkeit, sie geht entsprechend in die Statistiken ein. Faktisch sind die Verhältnisse komplizierter: Für viele Schüler ist inzwischen ein »System doppelter Beschulung« (Bude 2011, 28) entstanden. Die eigentlich relevanten Lernfortschritte werden in privat organisierten Abend-, Wochenend- und Ferienkursen angestrebt mit dem Ziel, die Starken weiter zu fördern. Eltern, die an einer guten Schulbildung interessiert sind, setzen erheblich Kräfte darin, ihren Kindern diese Möglichkeit zu eröffnen. »67 % der Achtklässler [besuchen] in Japan nach der Schule eine Ergänzungsschule« (Bude 2011, 28). »Die Mehrzahl der Schülerinnen und Schüler gehen mit dieser Paradoxie so um, dass sie sich auf dem privaten Bildungsmarkt höchster Anstrengung unterwerfen und auf der öffentlichen Schule Ruhe gönnen« (Bude 2011, 34).
2
Inklusion und Exklusion
»Will sich die Idee der Inklusion gemessen an ihren eigenen grundlegenden Überzeugungen nicht selbst ad absurdum führen, so muss die Zielvorstellung für die inklusive Schule der Zukunft die Schule für alle sein!« (Jennessen & Wagner 2012, 340). Eine »Schule für alle« nimmt jeden Schüler auf, unabhängig von Art und Schwere seiner Behinderung oder sonstigen Besonderheit. Sie verzichtet auf jede Art von »Aussonderung« und »Ausschluss«, ist also eine Schule, in der Exklusion nicht mehr vorkommt. Diese Idee setzt voraus, dass die gemeinsame Beschulung nicht nur aus einem örtlichen Zusammentreffen unterschiedlicher Menschen besteht; sie hat nur dann Gehalt, wenn die Gemeinsamkeit für jeden Einzelnen einen Ort der inneren und äußeren Heimat darstellt.