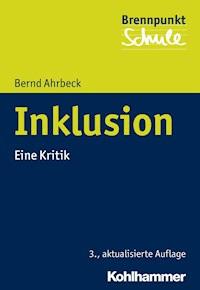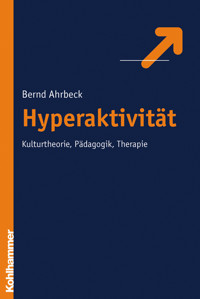Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: zu Klampen Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: zu Klampen Essays
- Sprache: Deutsch
Einen höheren Grad an Gleichberechtigung als in unserer Gesellschaft hat es kaum je in der Geschichte gegeben. In den gegenwärtigen Debatten jedoch scheint es häufig so, als seien noch nie so viele Menschen diskriminiert worden wie heute. Beständig drängen neue Interessengruppen mit Forderungen nach Entschädigung an die Öffentlichkeit, ein regelrechter Wettkampf, wem die größte Opferrolle gebührt, ist entbrannt. Befindlichkeit ist Trumpf. Mit den gesteigerten Empfindlichkeiten wächst das Bedürfnis nach Deutungshoheit und Sozialkontrolle. Gegen die Interessen und Lebensvorstellungen einer überwältigenden Mehrheit streben kleine Gruppierungen, getrieben von politischem Sendungsbewusstsein, den fundamentalen gesellschaftlichen Wandel und ein neues kulturelles Selbstverständnis an. Bernd Ahrbeck zieht eine ernüchternde Bilanz dieser Entwicklung und verweist auf ihre beachtliche Sprengkraft.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 127
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Reihe zu Klampen Essay
Herausgegeben von
Anne Hamilton
Bernd Ahrbeck,
geboren 1949, ist Erziehungswissenschaftler, Diplom-Psychologe und Psychoanalytiker. Er lehrt als Professor für Psychoanalytische Pädagogik an der Internationalen Psychoanalytischen Universität (IPU-Berlin). Von 1994 bis 2016 hatte er einen Lehrstuhl am Institut für Rehabilitationswissenschaften der Humboldt-Universität zu Berlin inne. Seine Arbeitsschwerpunkte sind Psychoanalytische Pädagogik, kultureller Wandel und Erziehungsphilosophien, schulische Inklusion und empirische Bildungsforschung.
BERND AHRBECK
Jahrmarkt derBefindlichkeiten
Von der Zivilgesellschaftzur Opfergemeinschaft
Inhalt
Einleitung
Gerechtigkeit
Inklusion
Sexualpädagogik
Transgender
Identitätspolitik
Vergangenheit
Grenzen
Literatur
Einleitung
DIE Gesellschaft ändert sich gravierend, in einer Geschwindigkeit und Richtung, die noch vor einem Jahrzehnt kaum vorstellbar war. Grundfeste der bürgerlichen Ordnung werden infrage gestellt: Nicht nur punktuell, wie es im Laufe der Zeit immer wieder und teils mit erfrischender Wirkung geschah. Nunmehr kumulieren einzelne, ursprünglich separierte Anliegen zu einer Bewegung, die sich machtvoll in Szene setzt und zunehmend an Einfluss gewinnt. Sie strebt einen fundamentalen gesellschaftlichen Wandel an, ein neues kulturelles Selbstverständnis, das mit dem bisherigen an entscheidenden Stellen bricht.
In den Vereinigten Staaten ist diese Entwicklung am weitesten vorangeschritten. Dort ist inzwischen ein regelrechter Kulturkampf entbrannt zwischen den sich als fortschrittlich verstehenden, vor allem der Identitätspolitik verpflichteten Kräften und jenen, die ihnen widersprechen, weil sie Ordnungsverluste fürchten und ihre persönliche Freiheit bedroht sehen. Die politische Korrektheit ist dabei eine wesentliche Größe. Zunächst hatte sie ein überaus berechtigtes Anliegen: Unerkannte oder nicht ausreichend beachtete Herabsetzungen von Personengruppen oder einzelnen sollten aufgedeckt und es sollte ihnen entgegenwirkt werden, unter anderem durch einen sensibilisierten Sprachgebrauch. Dabei stieß sie, historisch betrachtet, auf ein lohnendes Arbeitsfeld. Inzwischen ist die politische Korrektheit weit über ihr ursprüngliches Ziel hinausgeschossen. »Den Zustand der gebotenen Antidiskriminierung hat PC längst verlassen. Sie ist zum politischen Entwurf geworden, der die Gesellschaft und den Staat umkrempeln soll.«1
Immer mehr Gruppierungen stellen an sich in immer feineren Verästelungen Diskriminierungen und Benachteiligungen fest. Immer lauter wird ihr Ruf nach Entschädigung und Wiedergutmachung, geradezu in einem Wettkampf darum, wem die größte Opferrolle gebührt. Oft unter Verweis auf eine Intersektionalität, die Konkurrenzvorteile erbringen soll. Mit den gesteigerten Sensibilitäten wächst auch das Bedürfnis nach Sprachkontrolle, darüber, was gesagt werden darf und was nicht. Und nach Sanktionen für diejenigen, die sich nicht daran halten. Häufig reicht allein der Umstand aus, dass sich jemand gekränkt fühlen könnte, um Verbote zu begründen.
Dieses Anliegen stößt auf große gesellschaftliche Resonanz: in den Medien, in Parteien, Gewerkschaften und Nichtregierungsorganisationen, diversen sozialen Verbänden und Unternehmen. Das Machtbegehren, das damit einhergeht, wird verständnisvoll aufgenommen, der Anspruch auf moralische Hegemonie oft sogar offen unterstützt. Irgendwie, diese diffuse Formel ist berechtigt, scheint es, dass etwas angesprochen wird, das Aufgeklärtheit verspricht und gute Gefühle vermittelt, vor allem Schuldfreiheit und die narzisstische Gratifikation, weltoffen auf der Seite des Fortschritts zu stehen.
Gender-, Anticolonial-, Critical Whiteness- und Antirassismusstudien, im Gesamtkonzert der Wissenschaften allenfalls kleine Nebenstimmen, werden stark wahrgenommen. Hier zahlt sich aus, dass sich ihre wissenschaftliche Erkenntnissuche wie in kaum einer anderen Disziplin mit politischem Sendungsbewusstsein vermischt. Der moralische Druck, den sie ausüben, ist ausgesprochen hoch und er fällt auf einen aufnahmebereiten Boden. An amerikanischen Universitäten haben sie eine Machtposition errungen, die sich kaum noch begrenzen lässt. Einschränkungen des freien Diskurses sind an der Tagesordnung. Faktisch handelt es sich um Rede- und Denkverbote, die von Studenten und Hochschullehrern unterschiedlicher Fächer eingeklagt werden. Dazu gehört die Forderung, dass bestimmte Literatur aus dem Lehrkanon gestrichen wird und unliebsame Bücher aus Bibliotheken verschwinden. Diese Entwicklung ist so weit vorangeschritten, dass Condoleezza Rice, die ehemalige Außenministerin der USA, die jetzt wieder in Stanford lehrt, besorgt feststellt: »PC ist eine ernstzunehmende Bedrohung für die Existenz von Universitäten«2 geworden.
Die hiesigen Verhältnisse sind davon (noch) deutlich entfernt. Doch Anlass zur Sorge gibt es auch hier, und es ist keine Petitesse, wenn sich der Deutsche Hochschullehrerverband erklärt: »Problematisch ist aber, dass ›Political Correctness‹ zunehmend ausgrenzend und latent aggressiv instrumentalisiert wird, verbunden mit der Attitüde, aus einer moralisch unangreifbaren Position heraus zu argumentieren. Wenn jedoch abweichende wissenschaftliche Meinungen Gefahr laufen, als unmoralisch stigmatisiert zu werden, verkehrt sich der Anspruch von Toleranz und Offenheit in das Gegenteil: Jede konstruktive Auseinandersetzung wird im Keim erstickt. Statt Aufbruch und Neugier führt das zu Feigheit und Anbiederung.«3 Und eine Pressemitteilung vom 11. April 2019 (»Freie Debattenkultur muss verteidigt werden«) warnt erneut vor Einschränkungen der Meinungsfreiheit: »Differenzen zu Andersdenkenden sind im argumentativen Streit auszutragen – nicht mit Boykott, Bashing, Mobbing oder gar Gewalt.«4 »Die Freiheit der Wissenschaft ist in Gefahr«, das hat Bernhard Kempen, Präsident des Hochschullehrerverbandes, kürzlich noch einmal bekräftigt.5
Eine eigentümliche Beklommenheit hat um sich gegriffen, insbesondere in den Kultur- und Sozialwissenschaften. Es scheint, als sei ein riesiges Gewitter aufgezogen, das überall bemerkt wird, über das aber nicht gesprochen werden darf. Aus Angst, es könne ausbrechen. Eine offene Auseinandersetzung unterbleibt deshalb. Heikle Themen werden vermieden, Literaturlisten vor ihrer Publikation überprüft, damit sie bloß keine Titel enthalten, die Verlagen oder der (Fach-)Öffentlichkeit anstößig erscheinen könnten – unabhängig von ihrem wissenschaftlichen Gehalt. Bei Vorträgen und in Seminaren werden bestimmte Autorinnen und Autoren nicht mehr genannt. Ob die dahinter stehenden Befürchtungen tatsächlich in jedem Fall eintreten, ist eine andere Frage, bereits die intellektuelle Selbstbeschneidung stellt ein gravierendes Problem dar. Die Folge einer übersensitiven Ängstlichkeit ist sie zumeist nicht. Die Gefahren, die lauern, sind durchaus reale.
Fest steht auch: Diese bedrückende Entwicklung ist durchaus so gewollt. Medial und aus den Universitäten heraus wird sie aktiv und wirkungsmächtig befeuert. »Mittlerweile bestimmt sie ganz selbstverständlich den öffentlichen Diskurs.«6 Die »falschen« Stimmen sollen nicht mehr zu Wort kommen, das Böse müsse bekämpft werden: Rassismus und bis heute fortwährende koloniale Haltungen, Islamophobie, Frauenbenachteiligung und Transphobie, Behindertenfeindlichkeit und Exklusion. Eine Rücksichtnahme auf Andersdenkende sei fehl am Platz, das erlauben die hohen Ziele nicht mehr. Demokratische Grundrechte müssten, wenn die Umstände es erfordern, Einschränkungen erfahren. Zum Beispiel, indem Vorträge gewaltsam verhindert werden. Konservative und (Neo-)Liberale, Rechte und Reaktionäre hätten sich schließlich lange genug austoben können.
Ein ursprüngliches Aufklärungsbemühen und Antidiskriminierungsbestreben ist damit auf ein falsches Gleis geraten. Frauen haben lange und erfolgreich für ihre Rechte gekämpft, mit viel Geduld und großer Entschiedenheit. Die Akzeptanz, die Homosexuelle heute erfahren, ist ebenfalls nicht vom Himmel gefallen. Auch sie wurde hart erstritten. Die verbesserte Lebenssituation Transsexueller, die auf veränderten juristischen Grundlagen beruht, ist ein weiteres Beispiel, die schulische Integration und später die Inklusion behinderter Kinder ein anderes. Jeweils ging es darum, dass sehr konkrete, klar benennbare, teils auch juristisch fixierte Benachteiligungen und Diskriminierungen überwunden werden sollten.
Inzwischen hat sich die Situation gewandelt. Vorwürfe von Benachteiligung und Unmenschlichkeit stehen allgegenwärtig im Raum, pauschale Anklagen, die sich dem Abgleich mit der Realität nur selten stellen. Das würde eine strenge Empirie erfordern, den Willen, zwischen gravierenden Verletzungen und Bagatellphänomenen zu unterscheiden. Statt dessen beherrschen gesteigerte Empfindlichkeiten das Feld, die jede Gegenwehr im Keim ersticken sollen. Die Entdifferenzierungen, die damit einhergehen, sind beträchtlich und an Grobheit mitunter kaum zu überbieten. Alle Weißen sind Rassisten, ausnahmslos, verkündigt die Soziologin und Bestsellerautorin DiAngelo (2020). »Jeder Weiße ist Rassist durch die Sozialisation in einer rassistischen Kultur.«7 Auf der institutionellen Ebene wird das gegliederte deutsche Schulsystem mit der Apartheid in Verbindung gebracht, der politisch verfügten Rassentrennung. Das »deutsche Bildungssystem [sei] eines der weltweit segregierendsten, [ein] an Apartheid grenzendes Aussonderungssystem«, so lautet die Klage von Theresia Degener8, der ehemaligen Vorsitzenden des Ausschusses der Vereinten Nationen für die Rechte von Menschen mit Behinderungen. Und Schumann9 brandmarkt die Existenz von Sonderschulen als skandalöse Menschenrechtsverletzung.
Doch nicht nur institutionelle Differenzierungen sollen aufgehoben werden, etwa im Sinne einer »Schule für alle«, die konsequenterweise keine Privatschulen mehr erlauben dürfte. Auch elementare Unterschiede zwischen Personen werden infrage gestellt. Differenzen zwischen Behinderung und Nichtbehinderung, zwischen den Geschlechtern, sexuellen Orientierungen und Sexualpraktiken, zwischen Kindern und Erwachsenen, öffentlichem und privatem Leben oder zwischen unterschiedlichen Leistungsfähigkeiten, die unter Gerechtigkeitsaspekten verdächtig erscheinen. Wer Grenzen benennt, von ihrer Sinnhaftigkeit überzeugt ist und sich Nivellierungsbestrebungen widersetzt, begibt sich in Gefahr. Er wird schnell als unaufgeklärt und hoffnungslos rückständig klassifiziert oder schlimmer noch: als jemand, der ausschließlich an der eigenen Macht interessiert ist und seine Privilegien retten will.
Das Lob der Vielfalt trägt hier offensichtlich nicht mehr. Unterschiedlichkeit hat ihren ansonsten beschworenen positiven Wert verloren. Schnell und unnachgiebig werden neue Grenzen gezogen. In zwei Richtungen: Zunächst gegenüber denjenigen, die nicht der eigenen Weltanschauung entsprechen. Im Sinne einer neuen moralischen Ständeordnung ist ihre Sicht zweitrangig geworden, das, was sie beizutragen haben, von minderem Wert. Mitunter wird sogar gefordert, sie sollten sich gänzlich der Stimme enthalten, sofern sie nicht unmittelbar betroffen sind. Am Ende der Kette, ganz unten in der Hierarchie, steht der weiße alte europäische Mann, der als so schuldbeladen gilt, dass er kaum noch ein Recht hat, sich zu äußern.
Betroffen ist aber auch, wer sich innerhalb der eigenen Gruppierung nicht genau an den Gruppenkodex hält. Ein Beispiel: Die Loveparade ist eine bunte, exaltierte, teils auch provozierende Form der Selbstdarstellung unterschiedlicher Personengruppen, die sich früher verstecken mussten. Aber warum darf sich dort heute nicht jeder Homosexuelle zeigen, der Lust hat, daran teilzunehmen? Douglas Murray wurde dies verwehrt, mit der Begründung, er sei ein erklärter Konservativer. Peter Thiel, Gründer des Online-Bezahldienstes Paypal, musste sich im Schwulenmagazin »Advocate« vorwerfen lassen, er sei kein wirklicher Schwuler. Seine politische Haltung lasse das nicht zu. Nicht mehr Fakten sind hier gefragt, denn an der sexuellen Ausrichtung gibt es keinen Zweifel. Entscheidend ist das Bekenntnis zu einer bestimmten Lebensform, die keine Abweichung toleriert.
Die Frauenrechtlerin Alice Schwarzer ist inzwischen zum Feindbild wichtiger Teile der Genderforschung und Genderbewegung geworden. Sie repräsentiere, so lautet der Vorwurf, die Sicht alter privilegierter weißer Frauen. Besonders übel wird ihr genommen, dass sie den kulturrelativistischen Positionen, die Judith Butler10 einnimmt, widerspricht und sich weigert, in der Zwangsverschleierung von Frauen einen emanzipatorischen Akt zu sehen. An der Wiener Universität für Kunst wurde sie deshalb am Reden gehindert, mit der Begründung, sie vertrete einseitige, rassistische und islamophobe Positionen.
Einen ebenso schweren Stand haben konservative Schwarze in den Vereinigten Staaten. Sie gelten leicht als Verräter, wenn sie sich vom Meinungsstrom ihrer tonangebenden ethnischen Gruppe entfernen und ihm widersprechen, insbesondere an Universitäten. »Uncle Tom«11, so lautet der bezeichnende Titel eines Films, der diese Situation nachzeichnet.
Nirgendwo wird die Gemeinsamkeit aller stärker beschworen als dort, wo eine totale Inklusion angestrebt wird. Vielfalt gilt als überaus bereichernd, jeder soll dazugehören und in seiner Besonderheit anerkannt werden. Ausnahmslos und unterschiedslos. Nur: Was ist mit denjenigen, die sich nicht einschließen lassen wollen, die separierte Wege gehen möchten? Was ist mit den Kritikern, denen eine solche Inklusion zu weit geht? Sie stoßen auf heftige Ablehnung, werden moralisch attackiert bis hin zur Ausstoßung. Im Wissenschaftsdiskurs gibt es genügend Beispiele dafür. Wer als Inklusionsgegner etikettiert ist, wird nicht mehr eingeladen, seine Publikationen werden entwertet, nicht selten unterstützt von persönlichen Angriffen. Damit ist eine widersprüchliche Lage benannt. Auf der einen Seite sollen alle gleich, in Freiheit und gegenseitigem Respekt verbunden sein oder sich zumindest so fühlen. Anderseits erfolgen neue Grenzziehungen, mit großer Entschiedenheit und teils unerbittlicher Härte, so dass dadurch tiefe Gräben entstehen.
Hinter dieser Entwicklung steht eine Befreiungsidee, die sich in zwei unterschiedliche, miteinander unvereinbare Richtungen erstreckt. Es geht jeweils um eine wahre Bestimmtheit des Menschen, die entweder seiner Innenwelt entspringen oder aus Herkunftsbedingungen resultieren soll – etwa dem Geschlecht, der Hautfarbe oder der sozialen Lage. Gemeinsam ist ihnen, dass sie einer starken Abgrenzung nach außen bedürfen, aus der existentiellen Notwendigkeit heraus, sich über eine ablehnende, wenn nicht gar feindliche Umwelt zu definieren.
Im ersten Fall wird die Auflösung bestehender Grenzen angestrebt. Differenzen erscheinen in einer Welt, in der jedem alles möglich sein soll, per se als anrüchig, benachteiligend und ungerecht. Sie sollen möglichst nicht mehr in Erscheinung treten. So kann es bereits als freiheitsberaubend und persönlichkeitsschädigend gelten, wenn Kinder ihrem biologischen Geschlecht gemäß ungleich behandelt werden, auf welche Weise auch immer. Allein das Benennen von Unterschieden, discriminare im ursprünglichen Wortsinn, wird als ein diskriminierender Akt angesehen, der zwangsläufig zu Kränkungen und Herabsetzungen führt. Eine durch und durch rücksichtslose Gesellschaft zeige darin ihr wahres Gesicht.
Diese Herrschaftsverhältnisse sollen jetzt gebrochen, soziale Fesseln abgelegt werden, die Zeit sei reif dafür. Dann könne sich die Menschheit endlich frei entfalten und zu sich selbst finden. Die Selbstkonstruktion ist dabei zum entscheidenden Begriff aufgestiegen. Jeder könne sich seine eigene Welt erschaffen, durch sprachliche Destruktion, die eine neue Wirklichkeit erzeugt, oder auf andere Weise. Leitend ist die Vorstellung, dass innere Kräfte existieren, die zur Entfaltung drängen, umso erfolgreicher, je weniger sie von außen gestört werden. Diese Hoffnung, die Sehnsucht nach einer kränkungsfreien, den Menschen natürlich umhüllenden Welt, ist uralt. Sie findet sich bereits bei Rousseau, tritt seitdem in immer neuen Formen und diversen Verkleidungen auf und genießt heute ein besonderes Ansehen.
Wie eine solche Selbstschöpfung erfolgen soll, worauf sie genau zurückgreift, bleibt allerdings unklar. Der Verweis auf eine freischwebende Vorstellungskraft, die sich mit diffusen Ursprungsmythen verbindet, gibt darauf keine auch nur annähernd befriedigende Antwort. Nach Cohen12, dem israelischen Psychoanalytiker, wird hier eine »goldene Fantasie« bedient. Die Illusion, es könne eine von historischen Belastungen, gesellschaftlichen Verpflichtungen und inneren Widersprüchen bereinigte
Entwicklung geben. Das Kind entwickelt sich dann nicht mehr dialogisch, in Abhängigkeit von und Auseinandersetzung mit signifikanten Anderen, sondern es verbleibt in seiner narzisstischen Blase, die auf die Außenwelt ausgedehnt wird. Getrieben von der Erwartung, die Umwelt müsse sich seinen Bedürfnissen anpassen, mehr noch: sich ihnen vorausahnend unterwerfen, um jede Störung zu vermeiden – fast wie in einem safe space. Die Gesetzmäßigkeiten der äußeren Realität müssen dazu in wesentlichen Bereichen außer Kraft gesetzt und fremde Interessen zum Schweigen gebracht werden. Wie eine Gesellschaft aussehen könnte, die aus so strukturierten Personen besteht, ist schwerlich vorstellbar, zumal dann, wenn sie sich eine hohe Funktionsfähigkeit erhalten möchte. Das allerdings teilt sie mit anderen Utopien. »Es ist die unendliche Schwäche einer jeden kritischen Position«, dass »wir von einer solchen Welt nichts Zuverlässiges wissen«.13
Die andere Seite, den Gegenpol dazu, bilden erneute Grenzziehungen. Im Namen der Identitätspolitik haben Differenzen eine Renaissance erlebt. Abgrenzung ist wieder zu einem hohen Wert geworden. Entscheidend soll nun wieder die Zugehörigkeit zu einer Gruppe sein, die sich anhand besonderer Kennzeichen ausweist, die als unverrückbare Größen im Raum stehen. Sie bestimmen, wohin jemand gehört. »So wie nach Marx’scher Lesart die Produktionsverhältnisse die Stellung eines Menschen in der Gesellschaft gänzlich determinieren, sind es heute die Merkmale Geschlecht, sexuelle Orientierung, Ethnie.«14 – Höherwertigkeit oder Geringerwertigkeit inbegriffen. Frauen zählen mehr als Männer, Homosexuelle sind wichtiger als Heterosexuelle, Schwarz ist besser als Weiß.
Diese Gruppenzugehörigkeit, über die streng gewacht wird, soll auch darüber entscheiden, ob sich jemand als Person entfalten kann. Wie in einer Art Urheimat, die vor fremden Einflüssen zu schützen ist, damit sie nicht überflutet wird. Erst auf diesem sicheren Boden, einem rein gehaltenen Acker, könne es ein persönlich stimmiges und freies Leben geben, in einer ursprünglichen Verbundenheit, die den Kern der persönlichen Identität prägt. Von einer offenen Selbstkonstruktion, die bisherige Grenzen überschreitet, ist dieses Verständnis weit entfernt. Identitätspolitisch müssen Differenzen und Grenzen bewahrt, gefestigt oder neu errichtet, nicht aber abgebaut werden. Martin Luther Kings Traum, Menschen sollten »nicht wegen der Farbe ihrer Haut, sondern nach dem Wesen ihres Charakters beurteilt werden«15, hat sich in sein Gegenteil verkehrt. Was jetzt wieder zählt, ist die Hautfarbe