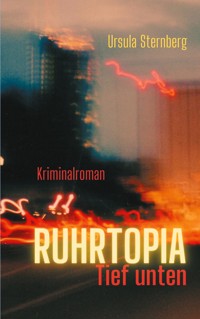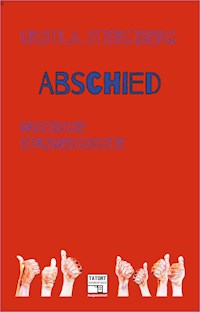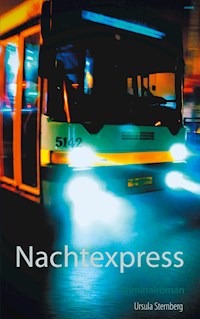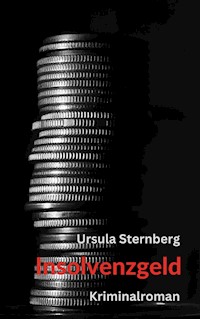
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Krimi
- Serie: Toni Blauvogel
- Sprache: Deutsch
Eigentlich hat Toni Blauvogel in diesem drückend heißen Sommer gar keine Lust auf Detektivarbeit. Matt und gereizt taumelt sie durch den Tag, sie ist immer noch arbeitslos, und dass ihre neue Liebe ein paar Tage verreist ist, hebt ihre Stimmung auch nicht gerade. Da wird ein toter Mann aus dem Baldeneysee gefischt. "Er sah aus wie Heinz Erhardt. Rundes Gesicht unter nach hinten gekämmten schütteren Haaren. Große Brille aus dunklem Horn. Ich betrachtete das Foto, registrierte den üppigen Mund in diesem fast mongoloid wirkenden Mondgesicht, die leicht verschmitzt aussehenden Augen dieses Mannes" Schnell wird klar, dass der Tote in Radlerkleidung Insolvenzverwalter war und alles andere als eine reine Weste hatte. Toni folgt seiner Spur bis nach Oberhausen und steckt bald mitten im tiefsten Wirtschaftskrimi. Nach "Ruhrschnellweg" (WAZ: Ein packender Krimi 'von hier', dessen Tempo und Spannung sich der Leser kaum entziehen kann) schockt Ursula Sternberg ihre unkonventionelle Ermittlerin Toni Blauvogel erneut in die Niederungen der schmutzigen Geschäfte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 292
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ursula Sternberg
Insolvenzgeld
Kriminalroman
Für die kleinen Essener Buchhandlungen,
die mich so großartig unterstützt haben!
Die Personen
Gerhard Schöffler verwaltet Insolvenzen und wird tot aufgefunden.
Karin Schöffler ist ihren Mann endgültig los und damit auch einige Sorgen.
Hedda Kaldenbach ist Schöfflers Partnerin und genauso gewieft im Abwickeln von Insolvenzen wie er.
Martin Borg ist insolvent und fühlt sich betrogen. Dabei läuft er zu Höchstform auf.
Horst Krullkowski interessiert sich nicht für Insolvenzen und steckt tiefer drin, als man glaubt.
Ruby Hauser bekommt Insolvenzgeld und kann demnächst Privatinsolvenz anmelden.
Augustus Monk versteht viel von Insolvenzen und hilft Toni auf die Sprünge.
Mike aus Kupferdreh verfügt über ein fundiertes Geschichtswissen, vor allem, wenn es um Motorräder geht.
Reinhold Schütte ermittelt nicht zum Tod des Insolvenzverwalters und ist immer weniger verkehrt.
Max Schulze hat Zukunftspläne und hackt nur noch legal.
Toni Blauvogel weiß bald mehr über Insolvenzen, als ihr lieb ist.
Eins
Das Gebäude wirkte düster und abweisend. Mit einem mulmigen Gefühl in der Magengrube sondierte ich den nur schlecht beleuchteten, aus quadratischen Granitplatten bestehenden Weg vor mir. Dort musste ich lang. Leider.
Bisher war es doch gar nicht so schwer gewesen, versuchte ich mich aufzumuntern. Das flaue Gefühl im Magen ließ sich aber nicht davon beeindrucken. Kneifen gilt nicht, Blauvogel, knurrte ich also. Bist schließlich nicht mitten in der Nacht den ganzen Weg nach Oberhausen gefahren, um jetzt einfach wieder abzudrehen. Los jetzt!
Zögernd setzte ich mich in Bewegung.
Ein Geräusch ließ mich abrupt innehalten. Für einen kurzen Augenblick setzte mein Herzschlag aus. Es ist nichts, beruhigte ich mich. Dennoch verharrte ich reglos und lauschte angestrengt.
Da war es wieder. Leise erst, ein dumpfes Brummen nur. Dann lauter. Bösartig. Und verdammt nah, direkt vor mir im tiefen Schlagschatten des Gebäudes. Kalter Angstschweiß lief mir in feinen Rinnsalen den Rücken hinunter.
Nicht, dass ich mich grundsätzlich vor Hunden fürchte. Eigentlich komme ich gut mit ihnen klar. Natürlich gibt es Ausnahmen, doch daran sind eher die zugehörigen Hundebesitzer schuld. Man muss ein paar Dinge beachten, dann ist der Umgang mit Hunden kein Problem. Ein paar Regeln nur: Nicht wild mit den Armen rudern. Keine hektischen Bewegungen. Freundlich und leise mit ihnen sprechen. Keine Angst zeigen. Nicht in ihr Revier eindringen. Wirklich einfach. Kein Problem.
Aber eine dieser Spielregeln hatte ich verletzt. Leider war es die wichtigste. Ich war über ein abgeschlossenes Tor geklettert und in ein eingezäuntes Grundstück eingedrungen.
Er ist bestimmt angekettet, versuchte ich mich zu beruhigen. Vorsichtig machte ich einen Schritt rückwärts.
Da war es wieder. Ein langgezogenes Grollen, nicht weniger furchteinflößend als das erste Mal. Ich erstarrte.
Denk nach, befahl ich mir. Denk dir was aus! Mir fiel nichts Gescheites ein. Zurück bis zu dem hohen Tor, über das ich vor ein paar Minuten geklettert war, kam ich nie und nimmer. Es sei denn, der Hund war angekettet. Was ich nicht wusste. Und worauf ich mich auf keinen Fall ernsthaft verlassen wollte.
Vorsichtig wandte ich den Kopf nach links, dann nach rechts.
Der Weg, auf dem ich stand und der direkt auf den gläsernen Eingang des Gebäudes zuführte, war in regelmäßigen Abständen flankiert von einer Art Gerüst, das sich in leichten Bögen parallel zum Weg schwang und damit eine Art Kreuzgang bildete. Nur dass die tragenden Säulen nicht rund und aus Stein waren, sondern sich wie die eisernen Streben des Eifelturmes in einer Art Gitterwerk verschlungen in die Höhe hoben. Knapp zwei Meter links hinter mir befand sich eine dieser Säulen. Dort musste ich hin.
Behutsam machte ich einen weiteren Schritt rückwärts.
Augenblicklich knurrte es. Schwoll an und ging in ein wütendes Bellen über. Etwas Massiges setzte sich in Bewegung.
Ich spurtete los. Das Bellen wurde lauter, aggressiver... erreichte die Säule, griff nach einer Strebe, zog mich hoch... spürte, wie das Tier hinter mir ebenfalls in die Höhe sprang... nach mir schnappte – oh Gott, ich spürte schon die Zähne in meinem Fleisch, schwer zog es an mir. Dann hörte ich Stoff reißen und ein lautes Platschen, mit dem das Viech zurück auf den Boden schlug.
Hastig kletterte ich weiter, hangelte mich höher und zog mich schließlich auf den zur nächsten Säule hinüber gespannten Bogen hinauf.
Der Hund sprang knurrend an dem Pfeiler hoch, rutschte an dem Metall ab und landete erneut mit einem uneleganten Plumpsen auf dem Boden. Er versuchte es noch ein paar Mal, dann gab er auf. Umkreiste die Säule und setzte sich schließlich mit aufmerksam nach oben gerecktem Kopf und lautem Grollen vor den metallenen Pfeiler.
Ich kniete immer noch auf allen Vieren. Tastete vorsichtig mit der Hand mein Hinterteil ab. Es schien unversehrt. Aber in die Jacke hatte das Biest ein großes Loch gerissen. Meine gute Wanderjacke! Ich hatte sie angezogen, weil sie dunkel und leicht war und über eine Reihe von Taschen verfügte, in die ich die wichtigsten Utensilien packen konnte.
„Scheißköter“, fluchte ich.
Der Köter war ein Rottweiler. Groß. Schwarzbraun. Mit massigem Kopf und einem mächtigen Gebiss. Und er knurrte erneut sehr bedrohlich.
Vorsichtig drehte ich mich aus der Vierfüßlerposition in die Sitzhaltung. Etwas rutschte aus meiner Jackentasche und schlug mit einem hässlich metallenen Geräusch auf dem Boden auf. Mein Handy.
„Clever, Blauvogel!“, kommentierte ich böse. Und während ich meine Lage sondierte, feststellte, dass ich keine Chance hatte, zurück zum Tor zu gelangen und versuchte, eine halbwegs bequeme Position auf meiner Querstrebe zu finden, machte es sich der Hund gemütlich, legte den massigen Kopf auf seine ausgestreckten Vorderbeine und signalisierte mir ab und zu mit einem tiefen Grollen aus seinem mächtigen Brustkorb, dass er seine Aufgabe nach wie vor sehr ernst nahm.
Ich beobachtete, wie der Mond langsam über dem Wipfel eines Baumes auftauchte, wartete darauf, dass irgendein Wachdienst vorbeikommen und mich aus meiner misslichen Lage befreien würde und verfluchte den Tag, an dem das alles begonnen hatte.
Zwei
Zwanzig Uhr. Ich wagte einen Versuch, raffte meine dunkelblauen, mit eingewobenen Sternen versehenen Vorhänge beiseite und öffnete die großen Fensterflügel meines Spitzgiebels. Eine Welle von heißer Luft schlug mir entgegen. Ich tappte über den einen knappen Meter breiten Sims zu meinem Balkon hinüber. Das Gitter der Brüstung war so von der Hitze aufgeladen, dass man es kaum berühren konnte.
Resigniert inspizierte ich meine Balkonpflanzen. Die Blätter des Hibiskus hingen herunter, der Oleander wirkte eher grau als grün und wies bräunliche Flecken auf, Feigenbaum und Yucca-Palme hatten bis auf einen feinen Kranz noch junger Triebe sämtliche Blätter abgeworfen, und die sonst so üppige Pracht meiner Stauden, Ranker und Sommerblumen in den Kästen war zu einer Art verdorrtem Gestrüpp verkommen.
„Ihr solltet doch südländisches Klima gewohnt sein“, sagte ich kopfschüttelnd, drehte die Düse an der Spitze des Schlauches auf und ließ einen sanften Regen sonnenerhitzten Wassers über die Pflanzen rieseln. „Mehr als zweimal am Tag gießen kann ich euch nicht, ihr Schätzeken. Ihr verbrennt, wenn ich euch tagsüber in der prallen Sonne Wasser gebe!“
Sie antworteten nicht. Sacht strich ich dem Oleander über die Blätter. Ich bildete mir ein, dass zumindest er jetzt etwas besser aussah. Er ließ ein paar Blätter fallen. Vermutlich, um mich des Gegenteils zu belehren.
Als ich die Wohnung wieder betrat, schlug mir warmer, abgestandener Mief entgegen. Nicht, dass ich etwas dafür konnte. Angesichts der bereits über fünf Wochen andauernden Hitze war es einfach unmöglich, tagsüber die Fenster zu öffnen.
Verdrossen kletterte ich die fragile Treppe aus Drahtseilen und Buchenholz von der oberen Ebene meiner Wohnung hinunter und öffnete die Fenster auf der gegenüberliegenden Seite des Wohnraumes. Einen Moment blieb ich stehen und wartete auf einen Luftzug. Vergebens.
Der Kaltwasserhahn spendete warmes Wasser. Ich öffnete den Kühlschrank und stellte fest, dass ich mal wieder vergessen hatte, eine Flasche mit sodagestreamtem Wasser kalt zu stellen. Ein paar schrumpelige Radieschen. Ein kleines Stück Comté mit einer unappetitlichen Färbung. Ansonsten war der Kühlschrank leer. Notgedrungen beschloss ich, hinunter ins Viertel zu gehen.
Auf dem Isenbergplatz herrschte reges Treiben. Der Spielplatz war voll mit Kindern und Hunden. Mütter und Väter hockten oder standen in kleinen Grüppchen zusammen und palaverten, als würden sie sich auf einer italienischen Piazza befinden. Die Tische unter den hohen Platanen des Café Click waren ebenso besetzt wie die des De Prins, und die Seitenstraßen, die sternförmig auf dem Platz mündeten, spuckten weitere Grüppchen mit leicht bekleideten, biergartensüchtigen Menschen aus. Es würde mal wieder eine lange, schlaflose Nacht werden.
Suchend sah ich mich um. Schließlich entdeckte ich Bertholds Glatze an einem der eng zusammenstehenden Tische. Er winkte mir zu. Wundersamerweise befanden sich zwei freie Stühle an seinem Tisch, die er energisch gegen den Andrang verteidigte. Ich ließ mich erleichtert auf einen der beiden Sitze plumpsen.
„Hi Toni“, grüßte er mich mit warmem Lächeln.
„Bertold!“, lächelte ich zurück. „Was für ein Glück, dass du hier bist. Sonst hätte ich wohl kaum eine Chance gehabt.“
„Hast du deinen Anrufbeantworter nicht abgehört?“, fragte Bertold erstaunt. „Ich hatte doch vorgeschlagen, dass wir uns hier treffen.“
„Echt? Das habe ich nicht mitbekommen.“ Ich schüttelte meinen Kopf. „Ich war heute nicht lange im Büro. Ein bisschen Tauschbörse, ein bisschen Jobbörse im Internet, so ein Kram halt. Ist einfach nichts los zurzeit. Also habe mich auf mein Sofa gehauen und still vor mich hin geölt. Wolltest du was Bestimmtes?“
Bertold nickte. Auf seiner polierten Pläte glänzte es feucht. „Besetzt“, verteidigte er den freien Stuhl gegen den Zugriff durch eine aufreizend leicht bekleidete Blondine. Er schien noch jemanden zu erwarten. Dann schob er mir auffordernd den Lokalteil der NRZ über den Tisch.
Er sah aus wie Heinz Erhardt. Rundes Gesicht unter nach hinten gekämmten schütteren Haaren. Große Brille aus dunklem Horn. Ich betrachtete das Foto, registrierte den üppigen Mund in diesem fast mongoloid wirkenden Mondgesicht, die leicht verschmitzt aussehenden Augen dieses Mannes.
„Lies“, drängte Bertold.
Gehorsam folgte ich den Zeilen, die das Foto einrahmten. Tod eines Insolvenzverwalters, las ich. Gestern wurde die Leiche von G.Schöffler aufgefunden. Ruderer des Clubs FC-Fischlaken fanden den Mann in den frühen Morgenstunden in einem Kahn auf dem Baldeneysee treibend. Der Tote trug Radlerkleidung. Von seinem Rad fehlt bis jetzt jedoch jede Spur. G.Schöffler war Insolvenzverwalter und den Heisinger Bürgern wegen seines Engagements für den Erhalt der St.Georg-Kirche sehr gut bekannt. ‚Wir haben eine wertvolle Stütze unserer Gemeinde verloren’, klagte Pfarrer Hermann W. Furtweiler.“
Unschlüssig drehte ich die NRZ zu einer Rolle zusammen. „Und? Was soll ich damit?“, fragte ich und schlug mir die Zeitung in die geöffnete Hand.
„Der Mann ist tot“, sagte Bertold. Dabei sah er mich an, als sei das bereits Erklärung genug.
„Dann muss er wenigstens nicht mehr schwitzen.“ Ich grinste über meinen Witz, während ich mit dem Handrücken den Schweißtropfen wegwischte, der sich in meiner Augenbraue verfangen hatte. „Der Glückliche!“
„Damit macht man keine Scherze!“, tadelte Bertold pikiert.
Überrascht sah ich ihn an. Er war doch sonst nicht so – wie auch immer ich das nennen sollte.
„Wirklich, Toni. Das ist überhaupt nicht komisch.“ Bertold zog ein kariertes, zerknittertes Taschentuch aus seiner Jeans und wischte sich über die Glatze.
Ich begriff. „Tut mir leid, daran habe ich wirklich nicht gedacht“, entschuldigte ich mich schnell. Es war erst gute dreieinhalb Jahre her, dass Bertold seinen Krebs überstanden hatte. Den Krebs und die Chemotherapie. Da er ein Hüne von Mann war, vergaß man schnell, dass er nach wie vor auf einer Bombe saß, bei der man nicht sicher sein konnte, ob sie auch wirklich entschärft worden war. Die Glatze, die seltsam spärlich hellen Augenbrauen und die fast wimpernlosen Augen waren das Einzige, was einen an die Krankheit erinnerte. Und daran hatte ich mich nun mal gewöhnt.
„War ein blöder Scherz“, sagte ich zerknirscht und legte ihm begütigend die Hand auf den Arm.
„Schon gut.“ Er lächelte zurück.
„Also, was soll ich damit?“ Erleichtert nahm ich das helle Weizen entgegen, das die Kellnerin mir reichte. Ich stürzte einen großen Schluck in mich hinein. Kalt. Köstlich.
„Ich will, dass du ein bisschen recherchierst in diesem Fall“, sagte Bertold.
„Machst du Witze?“
„Wieso! Der Eintrag in der Tauschbörse ‚Biete detektivische Fähigkeiten’ ist doch bestimmt von dir, habe ich recht?“
Siedendheiß fiel es mir wieder ein, wie ich, frisch aus dem Krankenhaus entlassen, mit zerschundenem Körper, aber eindeutig lebend, aus der Euphorie der Stunde heraus am Nachmittag von Silvester diesen Eintrag in die Tauschbörse gemacht hatte, vielmehr besser dem VNH Essen-Süd, dem Verein für Nachbarschaftshilfe Essen Süd, wie sich diese von mir ins Leben gerufene Initiative nun mittlerweile nannte.
„Ja, aber doch nicht bei Mord“, protestierte ich lahm.
„Warum denn das nicht?“ Verwundert schüttelte Bertold den Kopf. „Das war doch damals auch Mord, und du hast den Fall gelöst!“.
Drei
Und so war ich an den Fall geraten, wegen dem ich jetzt – knapp drei Wochen später – spürte, wie die Metallstreben meines luftigen Domizils unangenehme Riefen in mein Hinterteil drückten.
Zum dritten Mal innerhalb der letzten Stunde summte mein Handy unten auf dem Weg leise die Melodie ‚Ich brech die Herzen der stolzesten Frau’n’.
Zum dritten Mal innerhalb der letzten Stunde jaulte der Hund und legte die Pfote auf das Gerät, als wolle er es zum Schweigen bringen.
Und zum dritten Mal zog er erschrocken die Pfote zurück, als kurz darauf vibrierend eine SMS einging. Jemand versuchte hartnäckig, mich zu erreichen.
Ich verfolgte, wie ein fetter Mond seine Bahn zog, hörte die Bestie unter mir hecheln und wartete.
„Das ist Ruby. Sie braucht deine Hilfe“, stellte Bertold vor. „Eine äh...“ – er räusperte sich verlegen – „meine Freundin.“
Ich registrierte die leichte Röte, die plötzlich Bertolds Gesicht überzog. „Bertold, du hast ja Geheimnisse vor mir“, neckte ich ihn. Dann reichte ich der Frau meine Hand. „Hallo Ruby, ich bin Toni.“
Neugierig betrachtete ich sie. Walkürenhafte Erscheinung. Nicht dick, sondern groß mit kräftigem Knochengerüst und einer ungezügelten Flut rotblonden Haares. Den Lebensspuren in ihrem Gesicht nach schätzte ich sie auf Anfang Vierzig. Sie umarmte Bertold, drückte ihm einen Kuss auf den Mund, schälte sich aus ihrer dickledrigen Motorradkluft, unter der sie nur Shorts und ein rotes Top trug, nahm auf dem freien Stuhl an unserem Tisch Platz und unterzog mich dann ebenfalls einer neugierigen Musterung.
Schließlich lächelte sie mich an. Mehrere ihrer Vorderzähne tanzten schief aus der Reihe und verliehen ihrem Lachen etwas Verschmitztes und ungemein Ansteckendes.
Spontan lächelte ich zurück. Nett, befand ich. Sehr nett. Ich freute mich für Bertold. Er war sehr lange allein gewesen.
„Hat das etwa hiermit was zu tun?“, fragte ich und schob ihr die Zeitung hinüber.
Sie warf einen Blick auf die Schlagzeile und nickte. „Ja. Bertold hat gemeint, du könntest vielleicht helfen.“
„Ich bin kein Privatdetektiv“, wehrte ich ab. „Mit der Anzeige in der Tauschbörse habe ich den Mund etwas zu voll genommen.“
„Wissen wir“, mischte Bertold sich ein. „Aber trotzdem hast du im Winter einiges zur Aufklärung eines Mordes beigetragen. Und hierbei geht es eigentlich noch um viel mehr.“
Ablehnend hob ich beide Hände. „Dazu braucht man eine Lizenz.“ 007, Lizenz zum Töten, schoss es mir durch den Kopf. Prompt stellte mir vor, wie ich mit einem Flitzer à la Bond männernaschend und bösewichtmordend über die Serpentinen der Cote d’Azur raste. Ich grinste albern.
„Hör dir die Geschichte doch erst mal an, Toni, dann kannste doch immer noch entscheiden.“
„Ich will nicht, dass ihr euch falsche Hoffnungen macht“, verteidigte ich mich, plötzlich wieder ernst. „Worum geht’s denn überhaupt?“
„Lass gut sein, Bertold.“ Ruby winkte ab. Plötzlich sah sie sehr erschöpft aus.
Ich nippte an meinem Weizen und fühlte mich unbehaglich. „Immer noch affenheiß“, brummte ich schließlich verlegen, als das Schweigen anhielt. „Ich glaube, ich nehme noch mal ne kalte Dusche und versuche zu schlafen. Bis die Tage!“
Vier
Am nächsten Morgen hatte ich die Sache schon wieder vergessen. Mit Einkaufskarre und Rucksack zockelte ich zu Kaisers hinüber. Ich stockte meine Lebensmittel- und Getränkevorräte wieder auf. Obst, Salat, Gemüse, Quark, Yoghurt, viel Käse, zwei Großpackungen Eis, Kekse, diverse Tees, die auch kalt schmecken würden. Wein und Bier. Bei Peters kaufte ich noch ein Nussbrot.
Die bis zum Rand gefüllte Omakarre zog schwer an meinem Arm, der pralle Rucksack drückte mir ins Kreuz. Es war erst zehn, aber der Schweiß rann mir bereits in Bächen unter dem luftig geschnittenen Sommerkleid am Körper hinunter.
Aus dem Schlitz meines Briefkastens grinste mir hämisch die Post entgegen. Das Format verriet schon alles. Ich warf einen flüchtigen Blick auf die Absender, seufzte und klemmte mir die großen Couverts unter den Arm. Waren ohnehin nicht mehr zu gebrauchen, die Unterlagen, wenn sie so lieblos in den kleinen Kasten gestopft wurden. Dabei investierte ich viel Geld in diese Mappen. Die Umschläge, in denen ich sie versandte, hatten einen pappverstärkten Rücken, damit sie nicht geknickt werden konnten. Doch wenn ich überhaupt was von dem Zeug zurückbekam, dann steckte es in einem Billigumschlag, den irgendein Idiot von Postboten knicken und lieblos in einen zu kleinen Briefkasten quetschen konnte!
Resigniert zog ich die schwere Einkaufskarre hinauf, Stufe für Stufe. Plopp. Plopp. Rums.
Im dritten Stock rutschte mir die Post unter dem Arm hervor und landete vor der Tür der Kanzlei ’A & W Heuser’. Ich bückte mich mühsam, bemüht, die Lebensmittel dabei nicht aus dem Rucksack purzeln zu lassen. Die Tür ging auf und ich sah mich rotlackierten Zehennägeln in eleganten Lacksandalchen gegenüber. Ich hatte sie schon öfter gesehen. Die Dame. Die Sandalchen sahen neu aus. Welchem Teil der Kanzlei Heuser ich gerade im Weg war, dem A oder dem W, wusste ich trotzdem nicht.
„Tschuldigung“, murmelte ich. Hastig sammelte ich die Briefe vom Fußabtreter auf. Das verräterische Format der Couverts brannte mir ein fettes A auf die Stirn. A für Absage. A für arbeitslos. A für alt. A für asozial.
Blöder Gedanke, Blauvogel, ärgerte ich mich still. Als würde das einen besseren Menschen aus einem machen, nur weil man seine Arbeitskraft für einen monatlichen Scheck zur Verfügung stellten durfte!
Mit meinem hochmütigsten Nicken wünschte ich der Heuser einen schönen Tag, ließ die Karre stehen und brachte Post und Rucksack nach oben. In meinem Büro gegenüber meiner Wohnung suchte ich einen dicken Edding und schrieb Post bitte nicht knicken! Einfach in den Hausflur legen! auf ein Stück festes Papier.
Ich lief erneut nach unten, klebte das Schild auf meinen Briefkasten, stieg wieder in den dritten Stock hinauf und begann mit der vollen Einkaufskarre den restlichen Aufstieg. Plopp. Plopp. Rums. Das Eis war bereits ziemlich angetaut, als ich es oben auspackte.
Zwei Tage verstrichen. Die Vorbereitungen für das große nationale Sommerevent liefen auf Hochtouren. Deutschland schickte sich an, die Welt zu Gast bei Freunden zu bewirten. Auf den öffentlichen Plätzen wuchsen hohe Leinwände aus dem Boden und die Deutschen durften nicht nur, nein, sie sollten endlich wieder Flagge bekennen, was sie auch fleißig taten. Häuser wurden mit Fahnen geschmückt, wobei selbst Hammer, Zirkel und Ährenkranz wohlwollend toleriert wurden. Autos wurden mit kleinen Fähnchen zu Diplomatenkarossen aufgepeppt, die sich alsbald in Massen an den Straßenrändern wieder fanden. Die Modeindustrie machte einen riesigen Umsatz mit Klamotten in Goldrotschwarz, und selbst Menschen, die sich im Leben noch nie für Fußball interessiert hatten, wurden von der kollektiven Aufrüstung in Sachen Nationalstolz mitgerissen und malten sich schwarzrotgelbe Balken auf die Backen.
Die Welt zu Gast bei Freunden war eine gigantische Werbekampagne, die fast jeden in ihren Bann schlug. Die Hitze allerdings hatte sich in der Stadt eingenistet wie ein ungebetener Gast, der einfach nicht wieder gehen will. Baumärkte, Kaufhäuser und Elektroläden machten einen Riesenumsatz mit Klimaanlagen und Ventilatoren. Mein Ventilator wälzte nur die stickige Luft von einer Ecke des Raumes in die andere.
Ich bereute es fast, dass ich Max Angebot nicht angenommen hatte, ihn zu einem alten Freund an die friesische Küste zu begleiten. Aber nur fast. Wegen der vielen Bewerbungen, die in irgendwelchen Firmen vor sich hin schlummerten, machte ich mir vor. Und dem Arbeitsamt, das sich jederzeit melden und zu sich ordern konnte, was es jedoch nicht tat. Und dem leisen Ärger, der sich irgendwo tief in mir festgesetzt hatte wie eine latente Magenverstimmung und der mit Max zusammen hing, der nicht da war. Ich hatte keine Lust, mich damit auseinanderzusetzen.
Ich war gereizt, weil ich nicht schlafen konnte, gereizt, weil ich mich nicht aufraffen konnte, im Kunsthaus an meinen Skulpturen zu arbeiten, gereizt, weil mir die lautstarke Karnevalsstimmung zur WM-Eröffnung auf dem Isenbergplatz auf die Nerven ging, gereizt, weil ich lustlos und matt zu Hause herumhing, gereizt, weil es zu heiß war, sich ausreichend zu bewegen, gereizt, gereizt, gereizt... Ich war gefangen in einem tiefen, bodenlosen Sommerloch, dem Loch des Sommers, der bereits jetzt schon als neuer ‚Jahrhundertsommer’ bestaunt und bejubelt wurde.
Ich jubelte nicht. Mir ging es nicht gut. Und je weniger ich bereit war, mich mit den Gründen auseinander zu setzen, desto schlechter fühlte ich mich.
So ging es nicht weiter. Wo stehst du, Toni Blauvogel, fragte ich mich in dem verzweifelten Versuch, mich aus dem Loch zu befreien. Wo stehst du, und warum bist du da, wo du stehst?
Arbeitslos. Wie vier Millionen andere Menschen hier in diesem Land. Trotz angeblicher Konjunktur. Die war bei mir nämlich nicht angekommen. Na und?
Schön und gut, ich hatte immer gerne gearbeitet. Mein Beruf als DV-Organisatorin hatte mir Spaß gemacht, auch wenn ich die Arbeit primär als Mittel betrachtet hatte, um an das nötige Geld zu kommen, das man hier in dieser Gesellschaft nun mal zum Leben braucht. Trotz oder vielleicht auch gerade wegen dieser pragmatischen Einstellung war ich sehr gut in meinem Job gewesen.
Früher hatte ich es nicht verstanden, wenn Arbeitslose sich nutzlos fühlten oder sogar depressiv wurden. Ein Fehler, sich so über die Arbeit zu definieren. Nie alleiniger Lebensinhalt. Jetzt war ich selbst depressiv.
Ich schnaubte leicht durch die Nase. Du hast immer gejammert über zu wenig Zeit, Blauvogel. Erinnere dich gefälligst. Zu wenig Zeit! Und Zeit, die hast du jetzt. Also mach was Gescheites damit. Nutze sie!
Ich nutzte sie nicht. Hing weiter rum und fühlte mich schlecht. Dass Max nicht da war, machte die Sache noch schlimmer. Abgelehnt. Nutzlos. Und obendrein dumm, weil ich nicht gegen diese blödsinnigen Gedanken an konnte. Das machte mich noch gereizter.
Zwei weitere Tage in Selbstmitleid, das sich in der Hitze auszudehnen schien und als klebriger Film um den Verstand legte. Ich sagte eine Verabredung mit meiner Freundin Anja im Biergarten an der Ruhr ab. Ich ging nicht zur Grillfete in Martins schönem Garten. Ich gab nur einen zynischen Kommentar ab, als Werner und Monika mich zum Public Viewing ins Fritz locken wollte.
Ich fand mich in meiner Stimmung für andere unzumutbar, verkroch mich in meiner Wohnung, ignorierte die exstatischen Schreie, die das kollektive Wir auf dem Isenbergplatz mit sich brachten, verbrachte die Abende stattdessen mit Krimis und Litern von Wasser auf meinem Balkon und wartete, dass sich das Stimmungstief wieder verzog.
Fünf
Neun Uhr morgens. Ich hatte mir gerade den Schweiß einer weiteren weitestgehend schlaflosen Nacht lauwarm abgeduscht, als es klingelte. Flüchtig überlegte ich, ob ich überhaupt aufmachen sollte. Es klingelte erneut. Es klingelte Sturm und jemand bollerte mit Fäusten gegen meine Tür.
Das ist der Nachteil an einem Haus voller Arztpraxen und Kanzleien. Die Haustür steht tagsüber ständig offen. Jeder kann ungehindert rauf zu mir und vor meiner Tür Rabatz machen. Es bollerte wieder.
„Toni, mach auf“, hörte ich Bertold rufen.
Verblüfft öffnete ich. Er war noch nie unaufgefordert hier oben gewesen. Und dass Bertold seinen Kiosk um diese Tageszeit im Stich ließ, war mehr als ungewöhnlich.
Er stand nach Luft ringend vor mir, das sonst immer so blasse Gesicht hochrot und schweißgebadet, als wäre er die fünf Stockwerke zu meiner Wohnung hinauf gerannt. So außer sich hatte ich ihn noch nie erlebt. Er sah aus, als würde er gleich hyperventilieren.
Ich schob ihn auf mein Sofa, lief ins Bad, riss ein Handtuch vom Haken und hielt es unter den Wasserhahn. Das Wasser war lauwarm, aber das konnte ich nicht ändern. Ich klatsche Bertold das nasse Handtuch in den Nacken, eilte in die Küche und holte eine von den Eisteeboxen aus dem Eisfach, die ich vor einer halben Stunde dort hineingelegt hatte zwecks schnellerer Kühlung.
Gierig trank Bertold zwei Gläser. Sein japsendes Atmen wurde ruhiger, die schwere Röte wich langsam aus seinem Gesicht.
„Mein Gott, Bertold, hast du mir einen Schreck eingejagt!“ Auch meine Pulsfrequenz senkte sich wieder. Ich ließ mich neben ihm auf das Sofa fallen. „Was ist denn los?“
„Tut mir leid“, sagte Bertold. Dann begann der Hüne zu weinen. „Ruby“, schluchzte er und vergrub sein Gesicht in den Händen. „Ruby... sie haben Ruby verhaftet!“
Ruby? Verhaftet? Mit offenem Mund starrte ich Bertold an. Nur langsam sickerte der Inhalt dessen, was er mir mitgeteilt hatte, in mein Gehirn. Verhaftet. Eingelocht. Knast. Bertolds Ruby.
Eine Welle von Schuldgefühlen durchflutete mich. Sie hatten mich um Hilfe gebeten und ich hatte sie ihnen verweigert. Ich fühlte mich ziemlich mies, obwohl mir klar war, dass ich eine Verhaftung unmöglich hätte verhindern können. Und trotzdem: Mies!
Schuldbewusst nahm ich ihn in die Arme. Wiegte ihn sanft hin und her wie ein Kind, strich ihm über die schweißnasse Pläte und erstickte an den sinnlosen Worten, die man in einer solchen Situation von sich zu geben pflegt. Ich würgte an dummen Sprüchen wie es wird schon wieder gut... du wirst sehen, morgen sieht die Welt schon anders aus... schlaf erst mal eine Nacht drüber, dann klärt sich alles wie von selbst... heile, heile Gänschen, würgte daran, weil kein Kind in meinen Armen lag, sondern ein 51jähriger, nicht besonders sprachgewandter Mann, der in seinem Leben schon viele beschissene Dinge erlebt hatte und nun noch eins draufgesetzt bekam. Er hatte völlig Recht, verzweifelt zu sein. Denn dass man Ruby verhaftet hatte, war schlimm.
Und so flüsterte ich das einzige Versprechen in sein Ohr, das mir möglich war. „Ich versuche zu helfen“, flüsterte ich und wiegte ihn weiter hin und her. „Ich sehe zu, was ich tun kann. Ich lasse euch nicht im Stich.“
Als Bertold sich beruhigt hatte und halbwegs zuversichtlich wieder hinunter in seine Bude gegangen war, wurde mir die ganze Tragweite meines Versprechens bewusst. Mich packte die Panik. Was, zum Teufel, hatte ich da angerichtet! Ein Mord war passiert, eine Frau war deswegen verhaftet worden, und ich hatte zugesagt zu helfen. Weil ich Bertold mochte und seine neue Freundin sympathisch fand? Ich musste von allen guten Geistern verlassen sein, mich auf so ein bescheuertes Unterfangen einzulassen!
Wütend starrte ich mein Spiegelbild an. Sah leicht zerzauste, asymmetrisch bis zum Kinn gestufte braune Haare, dunkle, zornig funkelnde Augen unter dem leicht geschwungenen Bogen kräftiger Augenbrauen, den kleinen, erhabenen Leberfleck, der mein Kinn zierte wie eines dieser absurden Schönheitspflaster, die sich die Reichen in früheren Jahren freiwillig in die üppig gepuderten Gesichter geklebt hatten.
Blöde Kuh, schimpfte ich. Größenwahnsinnig geworden, Toni Blauvogel?
Dann registrierte ich den störrischen, entschlossenen Zug, der sich um meinen Mund gebildet hatte. Unwillkürlich musste ich grinsen. Ich kannte diesen Zug um den Mund nur zu gut. Und den dazugehörigen Blick. Es war das, was Max erst vor kurzem den Blauvogel-Kampfblick getauft hatte.
„Blöder blauer Vogel, du“, sagte ich zärtlich zu mir. Und wusste zwar nicht, wie ich diese Aufgabe bewerkstelligen sollte, aber ich wusste zumindest, dass ich es versuchen würde.
Ruby war verhaftet worden. Gefängnis. Knast. Untersuchungshaft. Bekannte Situation, in Tausenden von Filmen dargestellt. Kennt man doch.
Aber genau das stimmte nicht. Kannte ich nämlich überhaupt nicht. Und je länger ich darüber nachdachte, desto nebulöser wurde dieser Satz. Verhaftet. Was hieß das eigentlich genau?
Wie immer, wenn ich mich einem Thema nähern will, ohne zu wissen, wie ich das bewerkstelligen soll, ging ich erst mal ins Internet.
Untersuchungshaft, gab ich versuchsweise in Google ein. Eine halbe Stunde später war ich schlauer. Untersuchungshaft, erfuhr ich, bedeutet die Unterbringung eines Beschuldigten in einer speziellen Justizvollzugsanstalt. Darüber soll sichergestellt werden, dass der Beschuldigte zur Hauptverhandlung erscheint und das Hauptverfahren durchgeführt werden kann. Verhängt werden kann die Untersuchungshaft nur auf Antrag eines Staatsanwaltes von einem Richter. Außerdem müssen vier Voraussetzungen erfüllt sein.
Erstens: Der Beschuldigte ist dringend verdächtig, also mit hoher Wahrscheinlichkeit der Täter.
Zweitens: Es muss ein Grund bestehen, einen Menschen in diesem Stadium einer Untersuchung einzusperren. So was wie Fluchtgefahr zum Beispiel.
Drittens: Die Untersuchungshaft ist hierbei das letzte Mittel. Kann Fluchtgefahr beispielsweise durch Einkassieren der Reisepapiere oder das Hinterlegen einer saftigen Kaution gebannt werden, darf keine U-Haft wegen Fluchtgefahr verhängt werden.
Viertens: Die Untersuchungshaft muss zum Gewicht der Straftat und zu der voraussichtlichen Strafe in einem angemessenen Verhältnis stehen.
Ich überlegte kurz. Im Klartext heißt das: Ist nur eine geringe Strafe zu erwarten oder die Straftat, um die es geht, bloß geringfügig, darf keine U-Haft verhängt werden. Leider war Mord nicht geringfügig.
Diese vier Voraussetzungen müssen gleichzeitig, also gemeinsam vorliegen. Ist in einem bestimmten Fall auch nur eine Voraussetzung nicht erfüllt, so darf die Untersuchungshaft nicht verhängt werden. Fällt während der U-Haft auch nur eine Voraussetzung weg, so ist die U-Haft sogleich aufzuheben.
Ruby befand sich also mit ziemlicher Sicherheit nicht in Untersuchungshaft. Sie war vorläufig festgenommen worden. Und das war ein großer Unterschied. Vorläufige Festnahme, erfuhr ich nämlich, ist die vorübergehende Ingewahrsamnahme eines Beschuldigten für maximal achtundvierzig Stunden. Spätestens danach muss ein Ermittlungsrichter darüber entscheiden, ob der Festgenommene in U-Haft wandert oder entlassen wird.
Ingewahrsamnahme! Ich schüttelte mich. Was für ein Wort! Aber immerhin: Vermutlich war Ruby morgen Abend bereits wieder draußen. Jedenfalls, wenn es uns gelang, auch nur eine der Voraussetzungen zu entkräften, die für eine U-Haft vorliegen mussten.
Mit dieser frohen Botschaft ging ich hinunter zu Bertold an den Kiosk. Er sah immer noch schlecht aus, aber bei weitem nicht mehr so schlimm wie in dem Augenblick, als er vor meiner Wohnungstür gestanden hatte.
Wortlos holte er zwei angenehm beschlagene Colaflaschen aus dem Kühlschrank und schob zwei Frikadellen auf den obligatorischen Papptellern durch das gläserne Schiebefenster. Dann kam er raus und stellte sich zu mir an den sonnenschirmbeschirmten Stehtisch vor seiner Bude auf dem Bürgersteig.
Ich schüttelte mich innerlich. Viel zu warm für einen solchen Fleischklops. Aber Bertold biss beherzt zu.
„Wann haben sie Ruby festgenommen“, fragte ich und schob die Frikadelle ein Stück beiseite.
Bertold überlegte kurz. „Genau weiß ich das nicht“, sagte er. „Sie hat mich gegen halb neun heute Morgen angerufen. Da war sie aber schon auf dem Präsidium.“
„Also irgendwann heute früh“, rekapitulierte ich. „Länger als 48 Stunden dürfen sie sie erst mal nicht festhalten, ohne dass sie dann in U-Haft überführt wird.“
Bertold hatte schon wieder Panik im Blick. „Das geht nicht. Sie muss sich doch um Jimmy kümmern.“
„Jimmy?“
„Der Kleine. Er hat Leukämie. Der kann doch gar nicht ohne sie...“, sagte Bertold hilflos.
„Ist denn da sonst niemand?“
„Doch. Jan. Der ältere Bruder“, nickte Bertold.
„Na, der wird sich doch sicher um ihn kümmern“, versuchte ich zu trösten. „Aber kannst du die Jungs nicht erst mal zu dir holen, bis Ruby wieder da ist?“
„Das ist eine gute Idee“, sagte Bertold erleichtert. Offensichtlich war er froh, etwas Sinnvolles tun zu können.
„Ich halte hier im Kiosk die Stellung“, schlug ich vor. „Die sind sicher schon ganz durcheinander. Vorher möchte ich aber noch ein paar Dinge von dir wissen.“
„Willste nicht?“ Auffordernd schob Bertold mir die Frikadelle zu, die ich noch nicht angerührt hatte. „Ehe die hier in der Sonne ein zweites Mal schmort.“
„Nee, lass mal besser. Du weißt, wie gerne ich die sonst esse, aber bei der Hitze kann ich nicht.“
Abwesend schob Bertold den zweiten Klops in sich hinein.
Ich wartete, bis er fertig war. „Also besteht keine Fluchtgefahr", stellte ich schließlich fest.
„Was?“ Verwirrt zog er seine spärlichen, seltsam ausgebleichten Augenbrauen zusammen. „Fluchtgefahr?“
„Ich versuche rauszubekommen, ob es Gründe gibt, weswegen ein Haftbefehl nicht ausgesprochen werden darf. Wegen der Kinder, insbesondere dem Kleinen mit seiner Leukämie, würde Ruby doch sicherlich nicht einfach abhauen, wenn man sie freilässt.“
„Sag mal, spinnst du! Die würde sowieso nicht abhauen. Ruby hat doch nichts gemacht!“ Bertold war jetzt richtig sauer.
„He, komm mal wieder runter! Das behaupte ich auch gar nicht. Ich versuche auszuloten, was passieren kann. Und wegen der Kinder würde Ruby nicht abhauen. Das spricht für sie und gegen eine Haft, darum geht es!“
„Tut mir leid“, sagte Bertold zerknirscht.
„Also. Keine Fluchtgefahr“, fasste ich noch mal zusammen. „Und Wiederholungsgefahr oder Tatausführungsgefahr bestehen ja nun nicht“, dachte ich laut weiter.
„Was ist das denn nun schon wieder?“
„Einer der vier möglichen Haftgründe. Einen solchen Grund muss es geben, wenn man jemanden in U-Haft stecken will. Wenn Gefahr besteht, dass jemand die Tat wiederholt, bei einer Sexualstraftat oder einem Serienmord etwa, wäre das eine Wiederholungsgefahr. Bei einem Mordanschlag, der nicht erfolgreich war, bestünde eventuell die Gefahr, dass das Vorhaben zu Ende geführt wird, wenn der Verdächtige wieder auf freiem Fuß ist.“
Bertold wollte schon wieder loslegen. Mit seinem glatten Schädel und seiner hünenhaften Gestalt sah er äußerst bedrohlich aus, wenn er sich aufregte. Hätte ich es nicht besser gewusst, würde ich ihn wie viele andere auch für einen Skin halten.
„Hallo!“ Ich suchte seinen Blick und lächelte ihn an. „Das alles können sie ihr mit Sicherheit nicht ans Bein binden. Bleibt noch Verdunklungsgefahr. Und dazu fällt mir nicht viel ein. Wir müssen ohnehin einen Anwalt besorgen.“
„Den kann sie doch gar nicht bezahlen“, sagte Bertold müde. „Sie hat ihr Konto hoffnungslos überzogen. Im letzten Monat habe ich sogar ihre Einkäufe bezahlt, weil die Kreditkarte gesperrt ist.“
„Wieso das?“, fragte ich überrascht.
„Na, es hat ein paar Monate kein Geld mehr gegeben. Deshalb ist der Laden doch insolvent. Weil er seine Mitarbeiter nicht bezahlen kann!“
„Übel“, sagte ich betroffen. „Da bin ich ja richtig privilegiert in meiner auch nicht gerade privilegierten Lage!“
„Bist du“, bestätigte Bertold trocken. „Du kriegst nen Haufen Arbeitslosengeld, und das regelmäßig. Darauf hat Ruby in dieser Situation keinen Anspruch.“
Ich nickte langsam. In Existenznöten war ich noch lange nicht. Obwohl die Zeit erschreckend schnell verstrich und ein A nach dem nächsten herein flatterte. Doch an dieses leidige Thema wollte ich jetzt nicht schon wieder denken.
„Eine Kaution wird bestimmt nicht verlangt, weil ja keine Fluchtgefahr besteht“, versuchte ich zu trösten. „Hol du jetzt mal die Jungs, ich bleibe so lange hier im Kiosk.“
Dass dieses Vorhaben grenzenlos naiv war, ging mir erst auf, als Bertold knapp zwei Stunden später wutschnaubend wieder auftauchte.
„Die haben die Kinder zu so einer Jugendtussie gebracht“, schimpfte er aufgebracht. „So eine Tante von der Jugendfürsorge! Und weißt du, was man mir dort gesagt hat? Ich dürfe die Kinder nicht abholen. Da könne ja jeder kommen.“ Bertold ballte seine großen Hände.
Logisch, dachte ich hilflos. Das ist nur zu logisch. Natürlich lassen die keine Kinder allein zurück, wenn sie die Mutter einbuchten. Darauf hätte ich glatt selbst kommen können! Und natürlich lassen sie die Kinder nicht einfach mit jemandem mitgehen, nur weil er behauptet, der Freund der Mutter zu sein. Logisch. Und sogar richtig. Und doch so gottverdammt falsch in diesem Fall!
Langsam dämmerte mir, dass ich mich mit dieser Geschichte ernsthaft überheben würde, wenn ich nicht schnell einen versierten Juristen auftreiben würde.
Erschöpft stieg ich wieder hoch in meine Wohnung. Mit jedem Stockwerk, das ich nach oben klomm, wurde es wärmer. Als ich die Wohnungstür öffnete, schlug mir warme, abgestandene Luft entgegen.