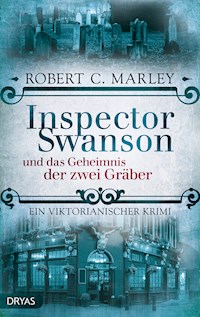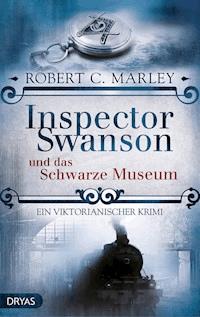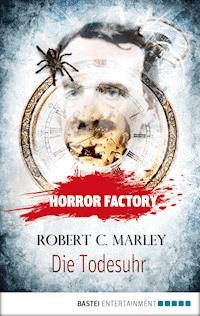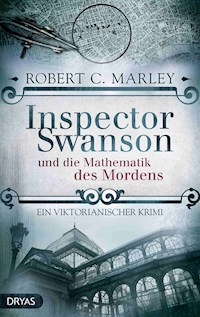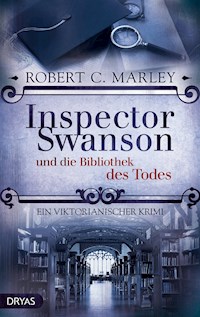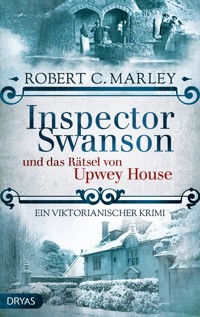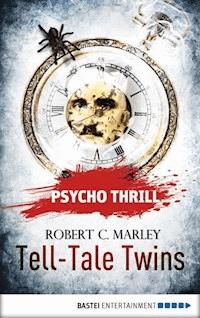Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Dryas Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Inspector Swanson: Baker Street Bibliothek
- Sprache: Deutsch
London 1893, Gordon Wigfield, ein ehrbarer Goldschmied und Damenfreund wurde in seiner Werkstatt auf bestialische Weise ermordet. Chief Inspector Donald Sutherland Swanson nimmt die Ermittlungen auf. Doch es bleibt nicht bei einer Leiche. Die Nachforschungen führen Swanson schließlich in die höchsten Kreise der Gesellschaft. Welche Rolle spielen Oscar Wilde und sein Geliebter Lord Douglas? Und was weiß Arthur Conan Doyle? Die Karten werden neu gemischt als sich herausstellt, dass der in den Kellern des Londoner Bankhauses Parr am Cavendish Square aufbewahrte "Blaue Hope-Diamant" eine Imitation ist...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 357
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inspector Swanson und der Fluch des Hope-Diamanten
Ein Kriminalroman aus dem Jahre 1893
Inhalt
Cover
Titel
Inhaltsverzeichnis
Vorbemerkung
Prolog
Erster Teil
Zweiter Teil
Dritter Teil
Vierter Teil
Fünfter Teil
Zur Baker Street Bibliothek
Impressum
Für Mario Sarto und Rolf Schepmann, wahre Meister der Goldschmiedekunst Und in Erinnerung an K.-J. Pilling, einen der besten Menschen, die ich je kannte
„Der Mensch liebt Gold so sehr und bedarf der Luft doch mehr. Ein Dieb, der dies bedenkt, wird selten aufgehängt.“ frei nach Logau
Vorbemerkung
Prolog
Paignton, Devon, 20. Dezember 1878
Die Zeit der Kerzen und der Gemütlichkeit. Die Zeit des dampfenden Kakaos und der duftenden Kekse. Die Vorweihnachtszeit. Das war es, worauf sich der blonde Junge und das blasse, kleine Mädchen, das ordentlich neben ihm auf dem Holzschemel saß und mit glänzenden Augen aufmerksam dem bunten Treiben in dem niedrigen Raum zuschaute, schon seit den Sommerferien gefreut hatten.
Als ihr Dad sich geschlagen gegeben hatte (nach all dem Bitten und Quengeln, dem unablässigen Zupfen an seinen Ärmeln, den zwinkernden hellen Kinderaugen und den flehenden „Bitte, Dad. Ja, Dad? Bitte, Daddy!“-Rufen) und sie ihm das Versprechen abgenötigt hatten, dass ihn in diesem Jahr um die Weihnachtszeit herum jeder einmal zur Arbeit begleiten dürfte, waren sie nicht mehr zu halten gewesen. Aus lauter Dankbarkeit und Freude darüber, dass er ihnen diesen Herzenswunsch tatsächlich erfüllen würde, waren sie dort, wo sie gerade standen (unweit der Stallungen in ihrem riesigen, verwilderten Garten nämlich), über ihn hergefallen und hatten ihn zu Boden gerissen. Gott sei Dank war er alles andere als ein strenger Vater. Er hatte sich einfach ins hohe Gras fallen lassen, die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und lauthals gelacht. Eine kindliche Übermacht. So einfach war das gewesen.
Seither hatten die vier Kinder an nichts anderes mehr gedacht.
Nun endlich war es so weit. Dad hatte sie zur Seite genommen und sie daran erinnert, dass sie schön brav sein müssten, wenn er seine beiden Jungs und die zwei Mädchen zur Arbeit mitnahm – allerdings nicht alle vier auf einmal. Sie könnten sich dann zwar alles ansehen, hatte er gesagt, nur anfassen dürften sie nichts. Und was noch wichtiger war: Sie sollten achtgeben, niemandem im Wege zu stehen, weil das Weihnachtsgeschäft, wie er es nannte (ein Wort, das in ihrer aller Ohren nach bunten Geschenkpackungen und farbigen Bändern klang), die wichtigste Zeit des Jahres war. Die Schmuckstücke müssten alle pünktlich fertig werden, und die Goldschmiede hätten alle Hände voll zu tun. Und wenn sie ganz besonders gehorsam wären, würde er ihnen vielleicht sogar den berühmten blauen Hope-Diamanten zeigen, über den sie schon so viele abenteuerliche Geschichten gehört hatten.
Sie hatten natürlich sofort eifrig genickt und ihm fest versprochen, dass sie sich ganz, ganz klein machen würden. Jetzt saßen sie hier, und es war noch viel schöner, als sie es sich vorgestellt hatten.
Über allem schien ein gewisser Zauber zu liegen, so als hinge glitzernder Goldstaub wie feiner Nebel in der Luft. Trotz der fieberhaft arbeitenden Männer war die Werkstatt von einer schier unbeschreiblichen und beinahe körperlich spürbaren Behaglichkeit erfüllt. Draußen, vor den hohen Fenstern, die in den Hof hinausblickten, war es mittlerweile dunkel geworden. Lediglich ein schmaler Streifen des schneebedeckten Kopfsteinpflasters war zu erkennen und funkelte im Schein der Gaslampen an der Decke. Die Werktische, von denen es an der Fensterseite acht oder neun gab, waren voll besetzt. An jedem Platz flackerten die Flämmchen der Lötrohre.
Lötrohre waren etwas extrem Geheimnisvolles für Colleen, so hieß das Mädchen. Sie bestanden aus einem dünnen, am oberen Ende gebogenen Metallröhrchen und hatten etwas unsagbar Magisches an sich. Ganz fasziniert beobachtete Colleen einen der Goldschmiede, um dem Geheimnis dieses merkwürdigen Dingsbums auf die Schliche zu kommen. Zwei Schläuche befanden sich am anderen Ende des Rohres. Der erste verschwand irgendwo in der Tischplatte, und sie konnte nicht erkennen, wohin er führte. Der zweite jedoch war nur kurz. Es war eine Art Mundstück daran, wie Großmutter es für ihre Zigaretten benutzte. Jedes Mal, wenn der Goldschmied es in den Mund nahm und hineinblies (während er einen zierlichen Hebel an dem Lötrohr in seiner Hand betätigte), bewegte sich oben das Flämmchen, wuchs, wurde größer und schrumpfte schließlich wieder zusammen.
Colleen stand von ihrem Beobachtungsposten in der Ecke auf und ging zu den Arbeitern hinüber. „Was tust du da?“
Der Mann mit dem lustigen Schnurrbart nahm das Schlauchende aus dem Mundwinkel und hängte das Rohr an einen Ständer. „Ich löte eine Schiene an den Ring, mein Kleines“, sagte er und tippte mit einer Pinzette an ein bräunlich-rotes Etwas, das Colleen unmöglich als Ring akzeptieren konnte.
„Das ist kein Ring“, sagte sie.
Der Mann schob die Unterlippe vor. „Vielleicht hast du recht.“ Dann lachte er leise. „Sieht wirklich nicht aus wie ein Ring, was?“
„Was ist eine Schiene?“
„Oh, das ist der Reif – der Teil vom Ring, durch den man den Finger steckt.“
Sie schien mit der Antwort zufrieden. Dann stützte sie beide Ellenbogen auf den Tisch. Ihr Kinn ruhte auf ihren Handflächen, als sie fragte: „Wie heißt du denn?“
„Für dich Mr Osbourne“, sagte der Goldschmied.
„Und du musst alles machen, was mein Dad dir sagt, Mr Osbourne, stimmt’s?“ Sie konnte mit ihren acht Jahren sehr wohl zwischen Chef und Arbeitern unterscheiden.
Zwar wusste Colleen, dass ihr Vater den Betrieb vor einigen Jahren übernommen hatte, aber sie hatte keinen blassen Schimmer, was er dort eigentlich tat. In Wahrheit kümmerte er sich nämlich allein um die Geschäfte. Er stand im Laden, ließ den betuchten Kunden eine hervorragende Beratung angedeihen und sorgte dafür, dass es ihnen an Luxusgütern nicht mangelte. Tagtäglich überprüfte er die Lagerbestände, kaufte bei Bedarf die gängigsten Juwelen und Perlen nach und achtete darauf, dass die Arbeiten für die Woche verteilt waren und die Termine eingehalten wurden. Colleens Dad war der Kaufmann – von der Fertigung der Schmuckstücke und dem Umgang mit den edlen Metallen hatte er allerdings keine Ahnung. Aus diesem Grund hatten die Goldschmiede, unter denen es Männer gab, die ihr halbes Leben nichts anderes getan hatten, als aus dem unansehnlichen Rohmaterial die kostbarste Augenschmeichlerei zu zaubern, im heimeligen Reich ihrer Werkstatt relativ freie Hand.
Der Goldschmied drehte das Stück pechschwarzer Holzkohle herum, das ihm als Unterlage für den halbfertigen Ring diente. „Jaaha.“ Er verstellte die Stimme, bis sie ganz tief und brummig klang, und verzog das Gesicht zu einer bedrohlichen Maske. „Und wenn ich es nicht tue, dann ...“ Das letzte Wort dehnte er, als bestünde es aus zwanzig Silben. Dann nichts. Er hob nur den Zeigefinger, denn ihm fiel offenbar nichts wirklich Schreckliches ein. Über das ganze Gesicht grinsend fuhr er mit seiner Arbeit fort.
„Du weißt, was Dad gesagt hat.“ Ihr Bruder blickte ihr koboldhaft über die Schulter. „Du störst den Mann. Dad hat gesagt, wir sollen nicht stören.“
„Hab ihn gar nicht gestört, Schlaumeier“, giftete sie zurück. Adam hatte es aber auch immer nötig, sich aufzuspielen, wenn sie zu zweit waren; dabei war er gerade mal ein Jahr älter als sie. Colleen beugte sich wieder über den Werktisch. „Ich hab dich nicht gestört, oder?“ Das war keine Frage, sondern eine Feststellung gewesen.
Der Goldschmied runzelte die Stirn.
„Was wird das?“, fragte Adam. Angestrengt sah er dem Mann zu.
„Ein Ring natürlich, du Dummkopf“, gab Colleen rasch zur Antwort. Sie bemerkte (nicht ohne Genugtuung), dass dem Mann mit dem lustigen Bart um ein Haar das Schlauchende aus dem Mund gefallen wäre, und sie musste sich ein Kichern verkneifen.
„Selber Dummkopf“, sagte Adam.
„Sei still.“ Sie stieß ihm ihren Ellenbogen in die Seite. „Jetzt wird’s spannend.“
Das Lötrohr kam erneut zum Einsatz. Der Goldschmied blies sachte in das Mundstück und die Flamme wurde größer und größer, wobei sie wie ein im Wind wehendes bläulich-rotes Tuch über den vermeintlichen Ring leckte, bis das Metall hell aufglühte. Unvermittelt erstarb die rauschende Flamme, und das Rohr wurde zurück auf den Haken gehängt. Colleen und ihr Bruder, der sich die Hände schützend vor die Augen hielt (was seine kleine Schwester zu einem gehässigen Grunzlaut veranlasste), wichen erschrocken zur Seite, als der Goldschmied den Ring mithilfe der Pinzette aufhob und in ein Glas mit Wasser tauchte. Zischend und gurgelnd erkaltete das Metall.
„Angsthase, Angsthase“, sang das Mädchen. Dabei hüpfte es von einem Bein auf das andere.
In diesem Augenblick schrillte die Ladenglocke.
Was für ein entsetzliches Geräusch, dachte Colleen, es hörte überhaupt nicht mehr auf. Der Mann mit dem lustigen Schnurrbart schnellte plötzlich in die Höhe, so als hätte er Sprungfedern unter den Schuhsohlen. Zwei, drei der anderen Arbeiter waren ebenfalls von ihren Stühlen aufgesprungen. Sie wusste nicht recht, was das zu bedeuten hatte.
Es war nicht die Türglocke, die da kreischte, es war ihr Dad. Er taumelte rückwärts in die Werkstatt hinein – ein schwarzes Tuch in der rechten Hand und die linke um den Schaft des Messers geschlossen, das aus seiner Brust ragte. Sein Schreien wurde kläglich leise, als er auf den kalten Steinboden schlug, und schließlich verstummte er.
Sie waren zu fünft.
Vier der Gesichter schwarze Schatten.
In ihren Fäusten blitzten Klingen. Wie eine Wand aus hässlicher Schwärze waren sie, und diese Wand begrub gerade ihren Dad unter sich.
Colleen schrie.
ERSTER TEIL
Morgenstund‘ hat Gold im Mund
Der Himmel über London war klar. Die nebelige Dunstglocke des Vortages hatte sich aufgelöst, und es versprach ein warmer und sonniger Morgen Mitte September zu werden. Es war das Jahr 1893. Jenes Jahr, in welchem die Welt ihr Augenmerk skeptisch auf Neuseeland gerichtet hatte. Man sprach vom Verfall der Moral, man sah sich einer unglaublichen Bedrohung ausgesetzt, man zitterte und schauderte bei dem Gedanken daran, eine Welle weiblicher Gewalt könne amazonenhaft und feministisch auf die heilen Kontinente männlicher Herrschaft schwappen und sie überspülen. Kurzum, die Erde war in ihren Grundfesten erschüttert worden, weil ein abtrünniges Land kapituliert und den Frauen das Wahlrecht zugesprochen hatte. Was dabei herauskam, wenn man dem schwachen Geschlecht zu viele Freiheiten gestattete, war der Kirche seit Adam und Eva hinlänglich bekannt, und als Murray’s Magazine in der Montagsausgabe einen Artikel über den steigenden Obstkonsum der britischen Damenwelt (mit dem Titel „Die Vertreibung aus dem Paradies“) veröffentlichte, sahen gelehrte Geistliche und bibelfeste Aristokraten bereits den Tag des Jüngsten Gerichts am Horizont heraufdämmern.
Mr Archibald Horne, dem es niemals in den Sinn gekommen wäre, sich als besonders gottesfürchtig zu bezeichnen, faltete, immer noch schläfrig, Murray’s Magazine zusammen und sah mit leisem Schrecken zur Obstschale auf dem Frühstückstisch hinüber. Er war viel zu spät aufgewacht, und in seinem Schädel schien ein Sturm zu tosen.
Catherine, seine Frau, die seit gut zwei Jahren ein mehr oder weniger strenges Regiment im Hause Horne führte, wog den Apfel wie ein Wurfgeschoss in der Hand, ehe sie hineinbiss. Zaghaft kauend sah sie Archibald an und lächelte. „Habe ich irgendeinen Ausschlag im Gesicht?“ Ihr Lächeln wurde breiter.
„Bitte was?“ Ihm wurde plötzlich klar, dass er sie mit großen Augen angestarrt hatte, und er blinzelte hektisch. „Nein, nein. Ich dachte nur gerade an diesen bemerkenswerten Artikel. Frauen seien gefährlich, schreiben sie da. Was meinst du?“ Trotz seiner pochenden Kopfschmerzen grinste er verschmitzt.
„Natürlich sind wir gefährlich. Sehr sogar. Und grins nur nicht so.“ Catherine lächelte und zog die Augenbrauen hoch. „Wir werden ziemlich unterschätzt, weil man uns für schwach und schutzbedürftig hält.“
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!