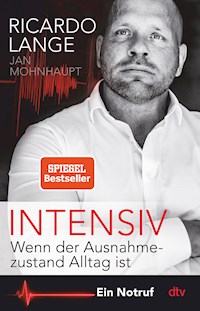
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Who cares? Ricardo Lange, Intensivpfleger, liebt seinen Beruf – und hadert mit ihm. So sehr, dass er seinem Ärger über die Missstände in der Pflege auf Facebook Luft macht und an die Öffentlichkeit geht. Deutschlandweite Berühmtheit erlangt er, als er von Jens Spahn zur Bundespressekonferenz eingeladen wird und dort über den ganz normalen Alltag im Krankenhaus spricht: die katastrophalen Arbeitsbedingungen, die permanente körperliche und emotionale Überlastung, den unerträglichen Personalmangel. Er beleuchtet viele wunde Punkte, macht sich Gedanken darüber, welche Schritte von wem gegangen werden müssen, und sucht nach praktikablen, zielführenden Lösungen, denn »diese Krise muss auch gute Seiten haben«.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 196
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Ricardo Lange
Intensiv
Wenn der Ausnahmezustand Alltag istEin Notruf
dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, München
Für alle, die auch in schwierigen Zeiten versuchen, ihr Bestes zu geben
1NACHTSCHICHT
Als ich das Zimmer betrete, fällt mein Blick sofort auf meine Kollegin aus der Spätschicht. Mit erhobenen Händen steht sie am Bett und drückt eine Blutkonserve fest zusammen. Der Stress ist ihr deutlich anzusehen, und der Überwachungsmonitor zeigt mir auch sofort den Grund dafür: Der Blutdruck der Patientin ist so extrem niedrig, dass die normale Verabreichung der Konserve am Ständer – Tropfen für Tropfen – nicht ausreicht. Die Kollegin presst das Blut regelrecht in den Körper, weil es die Patientin so schnell wie nur möglich braucht.
Zum Zuschauen ist keine Zeit. Ich ziehe mir Latexhandschuhe über, packe sofort mit an und lasse mich nebenbei auf den aktuellen Stand bringen: Die Patientin ist Mitte sechzig und ihr Zustand hoch kritisch. Der Hämoglobinwert sinkt stetig, irgendwo im Bauchraum blutet sie stark. Mir ist sofort bewusst: Das wird eine harte Nacht. Die lebensbedrohliche Situation der Patientin wird meine permanente Anwesenheit an ihrem Bett erfordern. Damit der fortlaufende Blutverlust ausgeglichen werden kann, wird sie in dieser Nacht noch viele Transfusionen benötigen. Zusätzlich ist sie kontinuierlich auf die Gabe von hoch dosiertem Noradrenalin angewiesen, ein sehr potentes, blutdrucksteigerndes Mittel. Kontinuierlich heißt: Die Spritzen in den Perfusoren – Pumpen, die das Medikament in einer von mir gesteuerten Geschwindigkeit injizieren – müssen nahtlos gewechselt werden, damit die Zufuhr nicht unterbrochen wird. Das würde den sicheren Tod der Patientin bedeuten. Zudem sind noch viele weitere Medikamente im Einsatz, wie das Narkosemittel Propofol, Elektrolyte und Insulin, die ich ebenfalls wechsle und immer wieder neu einstelle. Und zu allem Überfluss arbeiten auch ihre Nieren nicht mehr, weshalb sie an einer Dialyse angeschlossen ist. Fast stündlich nehme ich ihr Blut ab, um das Hämoglobinlevel und andere wichtige Werte im Auge zu behalten.
Ich bin vierzig Jahre alt und arbeite seit fast zehn Jahren als Intensivpfleger. In dieser Nacht bin ich auf der internistischen Intensivstation eines Berliner Krankenhauses eingesetzt. Von meinem Zuhause am Stadtrand sind es rund fünfundzwanzig Kilometer über Autobahn und Landstraße bis zur Klinik. Seit einer guten Stunde bin ich unterwegs, zuvor habe ich noch einen Energydrink zu mir genommen. Andere Pflegekräfte trinken Kaffee, bevor sie ihren Dienst antreten, jeder hat so seine Methode, um wach zu bleiben – denn die Verpflichtungen des Alltags lassen es meist nicht zu, tagsüber so viel zu schlafen, dass man einigermaßen ausgeruht ist. Das macht sich mit jeder weiteren Nachtschicht stärker bemerkbar.
Um 21:45 Uhr komme ich auf dem Parkplatz der Klinik an, wo Marc schon auf mich wartet. Marc ist sechs Jahre jünger als ich, ein guter Freund von mir und der Kollege, mit dem ich am liebsten zusammenarbeite. Wir kennen uns schon seit elf Jahren, er hat mit der Ausbildung ein Jahr nach mir angefangen. Als er noch Pflegeschüler war, habe ich ihn bei seinem ersten Einsatz im Rahmen des Projekts »Schüler leiten Schüler« begleitet und eingewiesen. Wir begrüßen uns und laufen gemeinsam vom Parkplatz zur Klinik, in der wir schon öfter eingesetzt waren. (Marc und ich arbeiten in einer Leiharbeitsfirma für Pflegekräfte. Warum wir das tun und nicht fest an einem Krankenhaus angestellt sind, werde ich später noch erklären.) Wir melden uns am Eingang. Im Umkleideraum legen wir den mintgrünen Kasack an, desinfizieren unsere Hände und gehen zur Station. Als externe Zeitarbeiter müssen wir dort klingeln. »Ja, bitte?«, ertönt es aus dem Lautsprecher. »Leasing Marc und Ricardo hier«, sage ich. »Okay, kommt rein.« Die Tür öffnet sich.
In der Regel führt uns unser Weg zunächst in den Aufenthaltsraum, wo der Spätdienst schon auf uns wartet, um die »große Übergabe« zu machen. Hierbei werden wir über alles unterrichtet, was in den letzten Stunden vorgefallen ist, was akut ansteht, wie viele Patienten wir betreuen müssen und was deren Befunde sind: wer eine Bluttransfusion bekommt, wer beatmet werden muss, wer an eine Dialyse angeschlossen ist. Und auch, wer aufgrund einer Patientenverfügung nicht mehr reanimiert oder beatmet werden darf. Aber an diesem Abend ist mal wieder alles anders. Auf der Station ist so viel zu tun, dass der Spätdienst noch beschäftigt ist und die große Übergabe ausfällt. Nur die allerdringlichsten Informationen werden ausgetauscht, dann muss jeder von uns sofort zu seinen ihm zugeteilten Patienten.
Außer für die Frau mit der Blutung im Bauch bin ich noch für zwei weitere Patienten verantwortlich: einen älteren Mann mit einem operierten Bauchaortenaneurysma, der ebenfalls kreislaufinstabil ist, und einen Patienten mit einer Pankreatitis, einer schweren Entzündung der Bauchspeicheldrüse. Seine Leber ist auch nicht mehr die beste, weil er sie über die Jahre hinweg durch Alkohol zerstört hat. Zudem leidet er an einer Blutvergiftung. Alle drei Patienten liegen im künstlichen Koma, alle drei werden beatmet und sind an die Dialyse angeschlossen, bei allen ist der Zustand höchst kritisch.
Ich bin entsetzt. »Wie sollen wir bei dem wenigen Personal alle Patienten lebend durch die Nacht bringen? Was sollen wir machen, wenn der nächste Notfall eingeliefert wird?«, frage ich meine Kollegin aus der Spätschicht. Sie ist nach acht Stunden völlig durch und hat die Nase voll, weil sie immer noch hier am Bett steht, obwohl sie längst Feierabend hätte. Sie weiß, dass auch die kommende Nacht schwierig wird: »Ja, was willste machen?«, blafft sie mich an. »Mehr als arbeiten kannste nicht. Wenn einer stirbt, dann ist es eben so«, sagt sie und verschwindet. Das klingt hart. Und es ist hart. Aber manchmal fällt es einfach verdammt schwer, unter den gegebenen Umständen, das heißt, wenn man selbst am Anschlag ist, mitfühlend zu sein und zu bleiben.
Das Leben dieser drei Menschen liegt jetzt mit in meinen Händen. Nun heißt es, für die bevorstehende Nacht alles effizient vorauszuplanen und mit der Ärztin abzustimmen. Welche Maßnahmen haben die höchste Priorität, welche können noch etwas warten? Bei welchen Patienten ist welches Medikament wann zu wechseln? Ich muss all das im Kopf behalten. Am Monitor stelle ich die jeweiligen Alarmgrenzen ein, damit ich ein Signal bekomme, wenn etwa der Puls oder der Blutdruck zu hoch oder zu niedrig ist. Die meiste Aufmerksamkeit erfordert die blutende Patientin.
Wie so häufig ist die heutige Nacht ein Dienst ohne Pause, mir bleibt höchstens mal ein kurzer Moment, in dem ich ein, zwei Schlucke trinke. Dann muss ich auch schon zurück ans Bett. Sich einfach mal hinzusetzen und durchzuatmen, das ist nicht drin. Ich komme nicht mal auf die Toilette, um zu pinkeln. Das ist aber nicht das Schlimmste. Was mich wirklich fertigmacht, ist das ständige Gefühl, nicht zu genügen, irgendetwas schuldig zu bleiben. Dass ich den Bedürfnissen meiner Patienten nicht vollends gerecht werden kann, passt nicht zu meinem eigenen Anspruch. Aber meine Aufmerksamkeit lässt sich nicht unendlich teilen. Das geht im Grunde allen Pflegekräften und auch Ärzten so. Viele von uns entwickeln klassische Berufskrankheiten wie eine Magenentzündung, weil wir selten in Ruhe essen können, sondern meist nur nebenbei schnell etwas in uns hineinstopfen. Rückenschmerzen und Nackenverspannung sind an der Tagesordnung – bis hin zum Bandscheibenvorfall. Kein Wunder: Zeitdruck und Personalmangel führen oft dazu, dass wir Patienten ohne zusätzliche Hilfe lagern müssen, obwohl dazu eigentlich mindestens zwei Leute benötigt werden. Das macht sich bei Patienten mit Übergewicht natürlich besonders stark bemerkbar.
Rund zwei Stunden sind seit meinem Schichtbeginn vergangen, doch die Patientin blutet immer noch. »Wir müssen ins CT«, sagt die zuständige Ärztin. Die Computertomografie wird meist in einem anderen Trakt des Krankenhauses durchgeführt, endlose Flure, schmale Gänge und den ein oder anderen Fahrstuhl entfernt. Für mich bedeutet das jetzt: die Patientin von der Dialyse abstöpseln, alle Kabel, Schläuche und überlebenswichtigen Geräte so im Bett verstauen, dass sich nichts verheddert, und die Patientin an das mobile Atemgerät anschließen. Den Monitor, der die Vitalwerte anzeigt, muss ich ebenfalls mitnehmen sowie einen Rucksack, der alle Medikamente und sonstiges Equipment enthält, das man für einen eventuellen Notfall braucht. Die Ärztin packt mit an, denn andere helfende Hände gibt es nicht.
Dieses Mal haben wir Glück, dass das CT nicht, wie so häufig, durch Schwerverletzte aus der Rettungsstelle belegt ist, sodass wir sofort aufbrechen können. Meine anderen beiden Patienten muss ich dafür zurücklassen. Der Kollegin aus dem Nachbarzimmer, die selbst mit ihren drei intensivpflichtigen Patienten schwer beschäftigt ist, rufe ich im Vorbeigehen noch die wichtigsten Informationen zu. Sie trägt jetzt bis zu meiner Rückkehr die Verantwortung für fünf Patienten.
Endlich im CT angekommen, ziehen wir die Patientin mit all den Gerätschaften auf den CT-Tisch. Unterstützt werden wir hier von den zwei MTAs, den medizinisch-technischen Assistenten. Beim Umlagern ist absolute Vorsicht geboten, sämtliche Zugänge und vor allem der Beatmungsschlauch dürfen auf keinen Fall herausrutschen. Das Kommando gibt die Ärztin, die den Kopf und den Tubus sichert. Nachdem die CT-Bilder gemacht sind, hieven wir die Patientin gemeinsam wieder zurück ins Bett und treten den Rückweg zur Intensivstation an, wo meine Kollegin schon sehnsüchtig auf uns wartet. Im Zimmer bleibt mir nichts anderes übrig, als den Kabelsalat, der bei einem solchen Hin und Her ganz zwangsläufig entsteht, zu entwirren. Allein das dauert mindestens zwanzig wertvolle Minuten.
CT-Fahrten dieser Art sind in einer Schicht keine Seltenheit. Sie stehen bei Patienten mit schweren Blutungen an, aber auch bei jenen mit Schädelhirntrauma und plötzlich auftretenden lichtstarren, weiten Pupillen, weil es dann das Ausmaß des Hirnschadens zu überprüfen gilt. Nicht immer habe ich drei Dialysen zu betreuen, sondern nur eine oder zwei. Das bedeutet aber nicht, dass es dann automatisch ruhiger zugeht, denn es werden ja auch Unfallopfer eingeliefert, Menschen, die versucht haben, sich das Leben zu nehmen, oder Opfer von Messerstechereien – wobei es nicht nur die »krassen« Fälle sind, die uns im Dienst fordern, sondern ebenso die vermeintlich unspektakulären: aggressive Alkoholiker, die sich im Entzugsdelir sämtliche Zugänge ziehen, mit ihren Fäkalien einschmieren und das medizinische Personal auch gerne mal treten, beißen oder anspucken. Oder Demenzkranke, die die ganze Nacht um Hilfe schreien, da man ihnen nicht begreiflich machen kann, wo sie sind und warum. Es kommt vor, dass solche Patienten bei dem Versuch, das Bett zu verlassen, stürzen und mit dem Kopf auf dem Boden aufschlagen. Wo es früher noch Sitzwachen gab, die das verhindern konnten, muss man heute aufgrund von Personalmangel eine Fixierung von Händen und Füßen zum Schutz vor Eigen- oder Fremdgefährdung vornehmen. Auch ganz normale Vorgänge, wie etwa die Verlegung eines Patienten, sind auf einer Intensivstation mit einem enormen Aufwand verbunden. Alle medizinischen Gerätschaften, wie Beatmungsgeräte und Absaugevorrichtungen, müssen abgerüstet, gereinigt, wieder aufgerüstet und getestet werden, damit sie bei einem Neuzugang sofort voll einsatzbereit sind.
Mittlerweile ist es draußen stockdunkel, auf der Station brennt nur diffuses Licht. Mein Körper kämpft gegen die wachsende Müdigkeit an, eigentlich möchte er schlafen. Die ununterbrochen notwendige Konzentration und die ständig neuen Anweisungen der Ärztin für alle drei Patienten kosten mich Kraft, denn alle Informationen soll mein Kopf gleichzeitig verarbeiten und speichern.
Wenn ich mental so ausgelastet bin, kann es auch mal passieren, dass ich den Fokus beim Aufziehen und Anmischen eines Medikaments verliere. Vor der Verabreichung frage ich mich dann: Hast du alles korrekt dosiert? Bist du dir wirklich sicher? Jeder wird es vermutlich aus dem Alltag kennen: Die Eingabe der PIN beim Bezahlen mit der EC-Karte ist Routine. Ohne groß darüber nachzudenken, tippen die Finger die bekannte Zahlenfolge. In dem Moment aber, wo man unter Stress steht und sich die Gedanken plötzlich um die Zahlen drehen, bremst der Kopf die Finger aus. Wo vorher die Geheimzahl war, ist nun völlige Leere. In meinem Fall können Zweifel oder Fehlentscheidungen Menschenleben kosten. Also schmeiße ich lieber die Spritze in den Müll und ziehe die Medikamente neu auf. Und wenn gar nichts mehr geht, hilft nur eine kurze Auszeit auf dem Klo. Das ist der einzige Ort, an dem ich ungestört bin und das Gedankenkarussell kurz anhalten kann.
So kämpfe ich mich durch die Schicht, bis um Viertel nach sechs. Dann steht endlich die Übergabe für die Frühschicht an. Alles, was im Nachtdienst passiert ist, dokumentiere ich in der sogenannten Patientenkurve: Wie lief es in der Computertomografie? Musste abgesaugt werden? Und vor allem: Wie ist der aktuelle Zustand der Patienten? Entschuldigen muss ich mich ebenfalls: für den Saustall, den ich dieses Mal aus Zeitmangel hinterlassen habe, die blutigen Bettlaken, die übervollen Müllsäcke und das verbrauchte Material, das ich nicht geschafft habe, wieder aufzufüllen.
Nach so einer Schicht bin ich einfach nur froh, dass alle überlebt haben. Dabei sind Schichten wie diese aufgrund des immer spürbarer werdenden Personalmangels kein Ausnahmezustand mehr, sondern Alltag. Ich verlasse das Krankenhaus und kann zum ersten Mal wieder richtig durchatmen. Ich genieße die frische Luft und spüre, wie die Anspannung von mir abfällt – das ist das schönste Gefühl überhaupt. Spätestens wenn ich im Auto sitze und der Adrenalinspiegel langsam sinkt, packt mich die Müdigkeit. Doch schon kommen neue Zweifel. Habe ich etwas vergessen? Habe ich alle wichtigen Informationen an den nachfolgenden Dienst weitergegeben? Wenn mir doch noch etwas einfällt, rufe ich auf der Station an.
Meinen Freund Marc habe ich an diesem Morgen nicht mehr getroffen, meine Übergabe hat etwas länger gedauert. Er ist schon losgefahren, weil er schnell nach Hause musste, um seine Kinder zur Schule zu bringen. »Schade, dass wir uns kaum gesehen haben«, schreibt er mir. Und dann noch: »Nächste Nacht wird ruhiger.« Mal sehen, ob er recht behält. Jedenfalls ahnen wir an diesem Tag noch nicht, welche zusätzlichen Herausforderungen das Frühjahr 2020 für uns bereithalten sollte.
2ENDLICH ANGEKOMMEN
Dieser Anblick geht mir nicht mehr aus dem Kopf: Auf der Trage liegt ein lebloser Körper, die Haut ist blass, die Arme hängen schlaff an den Seiten herunter. Alles ist voller Blut.
Ich bin im dritten Jahr meiner Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger und zum ersten Mal auf einer Intensivstation eingesetzt. Ivonne, meine Praxisanleiterin, kommt hektisch auf mich zugelaufen und fragt: »Ricardo, warst du schon mal bei einer Reanimation dabei? Traust du dir das zu?«
Ich bin so perplex, dass ich nur nicken kann, und folge ihr in den Herzkatheter, einen Raum, der sich außerhalb der Station befindet. Dort liegt ein älterer Herr mit Herzinfarkt. Die Ärzte haben versucht, ihm über die Leiste einen Stent in eines der verstopften Herzkranzgefäße zu setzen, doch das hat leider nicht geklappt. Sein Herz hat aufgehört zu schlagen.
Nach kurzer Anleitung durch den Oberarzt werde ich ins kalte Wasser gestoßen. Ich mache mich bereit, um auf sein Kommando nahtlos die Herzdruckmassage zu übernehmen. »3, 2, 1!«, sagt er. Schon presse ich meine Handflächen auf die Mitte des Brustkorbs – und bin schockiert. Wo ich den Widerstand der Rippen spüren müsste, drücke ich nur in eine weiche Masse. Dass es – wie in diesem Fall bereits passiert – bei einer Reanimation aufgrund der starken Kompression gar nicht so selten zu Rippenbrüchen kommt, weiß ich damals noch nicht. Der Oberarzt und ich wechseln uns regelmäßig ab, dennoch sind wir nach etwa einer halben Stunde ziemlich erschöpft. Und frustriert. Wir konnten den Patienten nicht zurückholen. Was bleibt, sind die Bilder in meinem Kopf: die Arme des Mannes, die während des Drückens auf und ab schaukeln, und seine Augen, die leer an die Decke starren.
Niedergeschlagen machen Ivonne und ich uns mit dem Verstorbenen auf den Weg zurück zur Station. Während der Oberarzt mit der Ehefrau spricht, kümmere ich mich um den Toten. Ich richte das Kopfteil des Bettes ein wenig auf, wasche das Blut von seinem Körper und ziehe ihm ein frisches Nachthemd über, denn ich möchte, dass er würdevoll aussieht, wenn seine nächsten Angehörigen kommen, um sich von ihm zu verabschieden. Dann lege ich Taschentücher für sie bereit, stelle eine Kerze auf und öffne das Fenster. Ich glaube daran, dass auf diese Weise die Seele den Raum verlassen kann. Ivonne begleitet die Ehefrau ins Zimmer, dann ziehen wir uns zurück.
Später bereite ich alles für den Transport in die Pathologie vor, wohin die Toten zur Kühlung gebracht werden. Zum ersten Mal in meinem Leben fülle ich einen Zehenzettel aus, ein Namensschild, das man am großen Zeh des Verstorbenen befestigt, um Verwechslungen zu vermeiden. Ein Pfleger bringt mir den vom Arzt ausgestellten Totenschein und sieht, dass der Oberkörper des Verstorbenen noch aufgerichtet ist. »Ricardo, vergiss nicht, das Kopfteil wieder waagerecht zu stellen. Wenn du das so lässt und die Leichenstarre einsetzt, kann der Bestatter ihn später nicht mehr in den Sarg legen.«
Als ich an diesem Tag nach Hause fahre, bin ich körperlich fit, aber innerlich total aufgewühlt. Im Laufe meiner Ausbildung habe ich zwar an einem Sterbeseminar teilgenommen, das uns an den Umgang mit dem Tod heranführen sollte, aber all die Theorie konnte mich nicht auf diesen Tag vorbereiten. Ich musste mit ansehen, wie ein Mensch stirbt, und das ganz mit mir alleine ausmachen. Niemand hatte Zeit, mit mir über mein Gefühl der Hilflosigkeit zu sprechen. Und eine Supervision, wie sie in vielen Berufszweigen Standard ist, gab es nicht. Noch heute ist ein solches Angebot im Krankenhaus die absolute Ausnahme (auch hierzu später mehr). Dabei ist der Tod ein ständiger Begleiter auf der Intensivstation – an den ich mich dennoch vermutlich nie gewöhnen werde.
Kein Glück im Job
Rund vier Jahre zuvor, während eines Klinikaufenthalts im September 2009, spielte ich zum ersten Mal mit dem Gedanken, Krankenpfleger zu werden, ohne zu ahnen, was alles damit verbunden sein und auf mich zukommen würde.
Noch geschwächt und etwas benommen, erwachte ich damals aus der Narkose. Mit den Händen ertastete ich die Schläuche, die in meinem Bauch steckten. »Herr Lange, sind Sie wach? Haben Sie Schmerzen?«, fragte mich der Pfleger an meinem Bett. »Ich bin Schwester Kevin und heute für Sie zuständig«, sagte er mit einem Grinsen. Kevin und seine Kollegen sollte ich in den nächsten Tagen noch besser kennenlernen. Sie kümmerten sich um mich, beantworteten geduldig alle meine Fragen und waren stets gut gelaunt. Mein Interesse war geweckt! »Eigentlich ist das ein cooler Beruf«, dachte ich. »Wäre das nicht auch was für dich, Ricardo? Krankenpfleger?«
Erst wenige Wochen zuvor hatte mich etwas ganz anderes beschäftigt. Eines Morgens konnte ich kein Wasser mehr lassen, egal, wie sehr ich auch presste. Unter Schmerzen fuhr ich ins Krankenhaus. Der Arzt schaute skeptisch auf den Ultraschallbildschirm. »Das gefällt mir gar nicht, was ich da sehe.«
Ich war verwirrt: »Was sehen Sie denn?«
»Das sieht aus wie ein Tumor«, sagte er.
Ich erinnere mich noch ganz genau, dass ich damals dachte: »Scheiße, Krebs!«
Der Arzt schien zu bemerken, was mir durch den Kopf ging. »Abwarten«, sagte er, »wir wissen doch noch gar nicht, ob er gut- oder bösartig ist.« Mithilfe eines Katheters ließ er den Urin aus meiner Blase ab, dann durfte ich wieder nach Hause. Weitere Untersuchungen in den nächsten Tagen ergaben, dass ich eine Zyste in der Blase hatte, die die Harnröhre einengte. Die Entscheidung, sie operativ entfernen zu lassen, zögerte ich trotzdem lange hinaus, da man mich darüber aufgeklärt hatte, dass dies unter Umständen meine Zeugungsfähigkeit beeinträchtigen könnte. Irgendwann aber war der Leidensdruck so groß, dass ich es nicht mehr aushielt. Ich stimmte zu.
Und dann war da ja noch die Berufsfrage. Die Vorstellung, in der Pflege tätig zu sein, gefiel mir immer mehr. Kaum war ich entlassen, erkundigte ich mich bei einem Krankenhaus in meiner Nähe, was ich tun müsste, um Krankenpfleger zu werden.
Zu diesem Zeitpunkt hatte ich schon eine Reihe von Berufen ausgeübt. »Handwerk hat goldenen Boden«, war die feste Überzeugung meiner Eltern, also begann ich mit sechzehn Jahren eine Ausbildung zum Gas- und Wasserinstallateur, die ich auch erfolgreich abschloss. Aber so richtig mein Ding war das nicht. Daher bewarb ich mich nach meinem Grundwehrdienst bei der Polizei.
Das entsprach mir deutlich mehr, weil ich Menschen gern helfe. Schon in der Schule konnte ich es nicht ertragen, wenn Schwächere gemobbt wurden. Damals lauerten meinem Kumpel und mir auf dem Heimweg ein paar Halbstarke in Springerstiefeln und Bomberjacken – damals ein typisches Erscheinungsbild in Berlin-Hellersdorf – auf. Sie wollten Geld und Zigaretten. Pech für uns, dass wir beides nicht hatten. Ungehalten durchsuchten sie unsere Schultaschen und verstreuten den Inhalt auf dem Weg. Am Schluss kassierten wir noch die eine oder andere Backpfeife. In den nächsten Tagen war der Schulweg für uns ein regelrechter Albtraum. Da habe ich für mich entschieden, dass ich mich nie wieder so herumschubsen lasse.
Ich begann, mehrmals die Woche Kraft- und Kampfsport zu betreiben. Schon bald stellten sich erste sichtbare Erfolge ein. Nun war ich nicht mehr der schmächtige Junge, der wegen seines Micky-Maus-T-Shirts gehänselt wurde, sondern der, den man lieber in Ruhe ließ. Von da an setzte ich mich aktiv für Schwächere ein, zum Beispiel für einen dickeren Jungen aus meiner Klasse, den sich ein paar Jungs ausgeguckt hatten. Im Sportunterricht warfen sie ihn immer wieder mit Bällen ab und machten sich über ihn lustig. Da bin ich dazwischengegangen. Schubser werden geschubst!
Ich war daher total glücklich, dass ich bei der Polizei tatsächlich eine Ausbildungsstelle bekommen hatte, auch weil ich davon ausging, dass ich als Beamter ein sicheres Einkommen hätte und mir nie wieder Sorgen um meinen Job machen müsste. Von wegen. Bei einer betriebsärztlichen Untersuchung kurz vor Ende der Ausbildung stellte der Arzt fest, dass mein Hörvermögen für den Polizeidienst nicht ausreichte. Das war das Aus bei der Polizei. Auf einen Schlag war ich dienstuntauglich und wurde entlassen. Dabei war bis dahin alles perfekt gelaufen.
Ich fiel in ein tiefes Loch, denn da ich Beamter auf Widerruf gewesen war, hatte ich nichts in die Arbeitslosenversicherung einbezahlt und bekam nun kein Arbeitslosengeld. Eine Krankenversicherung hatte ich auch erstmal nicht. Auch die Berufsunfähigkeitsversicherung griff nicht. Mir blieb nichts anderes übrig, als mich beim Jobcenter zu melden. Eine Tätigkeit in meinem erlernten Beruf als Gas- und Wasserinstallateur kam auf Anraten des Amtsarztes wegen des Baulärms nicht in Frage. Also machte ich mein Hobby zum Beruf und ließ mich zum Fitnesstrainer und Ernährungsberater ausbilden. Mit der Zeit merkte ich aber, dass mich das auf Dauer nicht glücklich machen würde. Ich fühlte mich wie in einer Zeitschleife gefangen – bis zu jenem Krankenhausaufenthalt im Herbst 2009 und der Entscheidung, die mein Leben grundlegend verändern sollte.
Volles Risiko
Bevor ich die Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger beginnen konnte, musste ich zunächst ein einmonatiges unbezahltes Pflegepraktikum absolvieren. So viele Urlaubstage hatte ich aber nicht mehr übrig. Deshalb setzte ich alles auf eine Karte und kündigte meinen Job als Fitnesstrainer. Um in dieser Zeit finanziell über die Runden zu kommen, putzte ich nebenbei in einem Fitnesscenter nachts die Geräte, die Klos und den Trainingsraum. Ich musste ja die Miete für meine Wohnung aufbringen, meine Hündin Sheila versorgen und mich für das Praktikum auf eigene Kosten gegen Hepatitis B impfen lassen. Arbeitslosengeld bekam ich auch diesmal nicht, stattdessen eine dreimonatige Sperre, da ich selbst gekündigt hatte.
Die ersten Tage im Klinikalltag waren für mich sehr gewöhnungsbedürftig: der Umgang mit schwerkranken Menschen, die ganzen Sinneseindrücke, Erbrochenes, Exkremente und tiefe, offene Wunden. Jeden Tag war ich mit neuen Herausforderungen konfrontiert. Ich musste mein Schamgefühl bei der Intimwäsche fremder Menschen ebenso überwinden wie meine Angst, zu grob zu sein oder etwas falsch zu machen. Schnell war ich allerdings fasziniert von den unterschiedlichen Krankheitsbildern und davon, wie man die Patienten medizinisch und pflegerisch versorgt. Ich lernte zum Beispiel, dass man Fliegenmaden auf schlecht heilende, infizierte Wunden aufbringen konnte, weil die das erkrankte Gewebe wegfraßen, und wurde mit den unterschiedlichsten Auswirkungen von Alkoholismus auf den menschlichen Körper konfrontiert, von denen ich zuvor noch nichts gehört hatte: Zum Beispiel haben die Suchterkrankten nicht selten Nervenschäden in den Beinen, sogenannte Polyneuropathien, wodurch ein hinkender Gang entsteht.





























