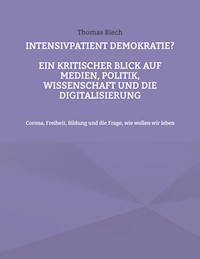
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In diesem Buch bespricht der Autor, welche Diskursmechanismen in unserer Demokratie dazu führen können, die eigenen demokratischen Grundlagen zu schwächen. Die Coronakrise dient immer wieder als Dreh- und Angelpunkt dazu, exemplarisch aufzuzeigen, dass die Gegner der Demokratie nicht nur von außen kommen können. Durch eine unzureichende Vielfalt der Sichtweisen (z. B. in den Medien) und einer mangelnden breiten kritischen Diskussion (z. B. in der Politik oder Wissenschaft) stärken wir die Gegner der Demokratie und schwächen uns selbst.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 216
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
1.
Einleitung
Kritik – eine kurze Hinführung
2.
Die Medien
3.
Die Wissenschaft
Vorab kurz etwas über den Menschen
Die Wissenschaft – die Herstellung von Wahrheit?
Exkurs: Leopoldina
Exkurs: Intuition
Menschenbilder – Bildung – Autonomie
Exkurs: Bleib gesund! – oder: Der pandemische Imperativ
Der pharmazeutisch-wissenschaftlich-politische Komplex
Die Impfung und andere Maßnahmen – Rettung und Erlösung ohne Nebenwirkungen
„Die Maske verrät mehr über den Menschen als sein Gesicht“ (Jean-Lous Barrault)
4.
Die Politik – was soll sie leisten? Was hält sie von ihren Bürgern?
Freiheit – Autonomie – Konformität
Moralisierung der Diskurse – Gift für die Demokratie
5.
Die Digitalisierung – alles gut, oder etwa nicht?
Einleitende Vorgedanken
Was heißt Medienkompetenz im Kindergarten? – Bildung und elektronische Medien
Überwachen, Kontrollieren und den neuen Menschen formen – warum lassen wir das zu?
Zusammenfassung
6.
Schlussbetrachtungen – wie wollen wir leben?
Gesundheit – Wert oder Zustand?
Selbstsorge, Selbstbestimmung und Demokratie
Vier abschließende Bemerkungen
Literaturverzeichnis
1.
Coronaliteratur
2.
Benutzte Bücher, Zeitungen und Zeitschriften
3.
Internetquellen:
1 Einleitung
Es gibt doch nicht wenige unter uns, die sich verwundert die Augen reiben und sich fragen, was da nur passiert ist. Es begab sich im Jahre 2020, da fielen einige Chinesen auf der Straße um (wir wissen mittlerweile, dass wir hier auf Fake News reingefallen sind). Im Januar sprach Herr Drosten noch von einer harmlosen Erkältung, hatte aber schon einen PCR-Test an die WHO geschickt, der dankbar angenommen wurde. Kurze Zeit später wurde noch einmal kräftig und ausgiebig Ski gefahren und Karneval gefeiert, um dann kurz danach eine Pandemie auszurufen. Eine Angst- und Panikwelle rauschte durch die Welt, getragen von einem Virus, das sich in die Institutionen und Seelen der Menschen hineinfraß und auf der einen Seite für eine merkwürdig anmutende Homogenität der Meinungen, Verhaltensweisen, Erkenntnissen und Handlungsanweisungen sorgte und auf der anderen Seite einen auf dauergestellten Angstpegel bei der Bevölkerung garantierte.
Warum nun dieses Buch? Schon wieder Corona? Haben wir nicht genug Bücher in den letzten Jahren gelesen?1 Nun, sicher ist die Erfahrung der letzten Jahre der Auslöser für diese Buch, denn die Krise hat die schon vorher existierenden Bruchstellen und feinen Risse, andere würden sagen, großen Löcher in den Institutionen der Demokratie sichtbarer werden lassen. Schon vor Corona bahnten sich eine Finanz-, Klima- und Wirtschaftskrise an. Sicher kann auch im Rahmen des Politikkapitels die Frage aufgeworfen werden, inwiefern Demokratien mit globalen Krisen umgehen und wie eine angemessene Umgangsweise in einer Demokratie mit einer bestimmten Krise auszusehen hätte.
Es sind vor allem die Medien, die Wissenschaft, das Gesundheitswesen und die Politik, die hier besprochen werden. Aber auch (geboostert wurde dann später nicht nur der Mensch) die digitale IT-Industrie, die im Rahmen der Digitalisierung ein eigenes Kapitel verdient, muss mit einbezogen werden, da sie mittlerweile mit dem Finanzkapital und dem Neoliberalismus einen Zusammenhang bildet und bei der ,Führung‘ (Foucault) der Bevölkerung eine zentrale Rolle spielt. Anhand eines Beispiels aus dem Bildungssystem, in dem sich der Autor auskennt, wird der Zusammenhang verschiedener globaler Akteure aufgezeigt.
Diese genannten Institutionen bzw. gesellschaftlichen Problemfelder werden nacheinander in ihren Funktionen, Zielen und inneren Logiken beschrieben. Selbstverständlich werden auch sie einer Kritik unterzogen. Entscheidend ist vor allem, wie diese zusammenhängen und durch etwas zusammengehalten werden, was als neoliberale Klammer bezeichnet werden kann. Die ,schleichende Revolution‘, wie Wendy Brown die Bedrohung der Demokratie durch den Neoliberalismus genannt hat, wird an zahlreichen Stellen auftauchen.
Abschließend muss auch die gegenwärtige Wertediskussion genauer untersucht werden. Ist die Gesundheit ein Wert? Oder ein Zustand? Muss alles getan werden, um die Gesundheit und das Leben jedes einzelnen zu schützen? Wer soll dies tun? Welche Mittel sind erlaubt? Sind Werte hierarchisierbar? Wer bestimmt über die Ordnung der Werte? Welche Bedeutung hat die Ethikkommission und wer sitzt dort? Auf welcher Grundlage entscheiden die Mitglieder dieser Kommission? Was genau ist die Leopoldina? Wie setzt sich diese zusammen und inwiefern ist die Politik involviert? Können wir uns letztendlich auf die Justiz verlassen? Sind die Urteile, gerade in der Zeit der Grundrechtseinschränkungen, nachvollziehbar und argumentativ gut begründet? Ruhen die Urteilsbegründungen auf soliden medizinischen Grundlagen und Einschätzungen? Dies sind einige wichtige Fragen, die hier diskutiert werden, ohne für sich in Anspruch zu nehmen, die einzig wahre Sicht auf diese Aspekte zu haben. Dafür ist die Sachlage zu komplex.
Letztendlich führen die Überlegungen im letzten Kapitel zu der zentralen Frage, wie wir zukünftig in unserer Demokratie leben möchten.
Vorab ein Disclaimer, der heute hin und wieder nötig ist, um nicht allzu geschwind in einer bestimmten Art und Weise etikettiert oder ,geframt‘ zu werden (siehe dazu: Die Medien – Haltung oder Berichterstattung?)
Es wird in diesem Buch die Meinung vertreten, dass die Demokratie die bestmögliche Staatsform ist, die der Mensch bisher entwickelt hat, da nur sie prinzipiell das größtmögliche Maß an Freiheit und Sicherheit garantiert. Allerdings verdient jede Demokratie, besser, sie benötigt ständiges kritisches Anfragen und Hinterfragen, Prüfen und Diskutieren, um lebendig und offen, stark und widerstandsfähig zu bleiben. Der Begriff der Kritik wird in diesem Buch eine wesentliche Rolle spielen. Es wird jegliche Literatur miteinbezogen, die zur Erhellung des Sachverhaltes beitragen kann.
Kritik – eine kurze Hinführung
Kritik? Was ist das eigentlich? In welchem Verhältnis steht diese sogar zur Wahrheit? Was ist das für ein großes Wort? Im Folgenden werden wir uns auf die Spurensuche machen, was Kritik eigentlich bedeutet, woher dieser Begriff kommt, wer Kritik ausüben soll und darf und wie die kritische Haltung in der heutigen Zeit eingeordnet bzw. bewertet werden kann. Wohlgemerkt: Wir sprechen über diesen Begriff unter den Bedingungen demokratischer Verhältnisse – unter anderen politischen Konstellationen müsste anders über die Möglichkeiten von Kritik gesprochen werden. Aber: Was dies nun ist, welchen Gegenstand sie haben kann und wie sie funktioniert, kann grundsätzlich geklärt werden.
Nun: Heutzutage begegnet uns Kritik schon als eine Art Verpflichtungsbegriff2, keiner könnte mehr in einem Diskurs, in einer Diskussion sagen, er sei unkritisch. Wir sind immer direkt „kritisch“ gegenüber bestimmten Meinungen, Serien, Politikern und – vielleicht auch im besonderen Falle, uns selbst gegenüber, in Form der Selbstreflexion oder -kritik.
Wie sieht die Form der Kritik aus? Kann jeder einfach irgendwas daherplappern und sagen, ich bin dagegen, da bin ich einfach mal kritisch? Klar kann er das, dies fällt unter die Meinungsfreiheit, doch Kritik bedarf noch etwas anderem: Es sollte eine sachangemessene Betrachtung, eine Beurteilung eines bestimmten Sachverhaltes sein, sicher im besten Falle theoriegeleitet und an der Wahrheit orientiert. Was? Wahrheit? Gibt es sowas wie das Konzept der Wahrheit überhaupt noch? Und wie hängt dieses mit der Kritik zusammen?
Der Reihe nach:
Der Begriff der Kritik (aus dem Griechischen – scheiden, trennen, urteilen, streiten, anklagen …) hat eine wechselvolle Geschichte hinter sich, die hier nicht referiert werden kann; sie findet in der Aufklärung einen ersten Höhepunkt. Immanuel Kant, ein deutscher Philosoph, formulierte es folgendermaßen: „Unser Zeitalter ist das eigentliche Zeitalter der Kritik, der sich alles unterwerfen muss“.3 Die Ausweitung des Kritikbegriffs bestand erstens in einer Generalisierung des Anwendungsbereichs bis hin zu einer Funktion für eine allgemeine Aufklärung. Selbst die Vernunft wurde einer Kritik unterzogen, freilich mit den Mitteln der Vernunft – wie auch sonst?
Wichtig ist: Alles kann grundsätzlich befragt, in eine Distanz zum Fragenden gebracht werden, um Fehler, Unstimmigkeiten, falsche oder ungenaue Begründungen aufzudecken.
Wir springen ins 20. Jahrhundert, wo Michel Foucault sich mit dem Begriff der Kritik, im Anschluss an Kant, beschäftigt hat. Foucault geht es um eine „kritische Haltung“, die einzunehmen der Mensch angehalten wird, um „nicht dermaßen regiert zu werden“.4 Ihm ging es um das Verhältnis des Individuums zu den ihn Regierenden – vor allem aber um eine Epoche, in der die Menschenregierung noch an der Autorität der Kirche gebunden war. In dieser Zeit (15./16. Jahrhundert) – so kann vereinfacht gesagt werden – entstand für Foucault die Kritik als eine Befragung der Wahrheit der Hl. Schrift als eine kritische Haltung gegenüber Gesetzen und als eine Haltung, „nicht unhinterfragt als wahr anzunehmen, was eine Autorität als wahr ansagt.“5
Wichtig ist hier, was wir für die heutige Zeit an Prinzipien mitnehmen können, dass die Befragung eines Sachverhalts diesen als Gegeben voraussetzt und ihn nicht durch die Kritik gänzlich negiert oder zerstört. Im Gegenteil: Da wir an dem Konzept der Wahrheit festhalten, d.h. dass wir zumindest einen Punkt anstreben, der nicht beliebig ist, kann uns nur die kritische Anfrage einen Erkenntnisfortschritt versprechen. Und genau so ist die Kritik auch immer schon Bestandteil der Wissenschaften gewesen, die sich nicht nur als Ordnung und Systematisierung der Welt verstehen, sondern immer auch als Wahrheitssuche. Klar, Wissenschaft ist ursprünglich die Befriedigung des menschlichen Bedürfnisses nach Ordnung, Orientierung, Verstehen und auch Erkennen. Aber, wie oben geschildert, geht es auch um einen Prozess der Wahrheitssuche, der Trennung des Falschen vom Wahren – nicht nur um eine Klassifizierung und Systematisierung der Dinge um uns herum (siehe das Kapital: Die Wissenschaft).
Wo stehen wir heute? Die Kritik, die Distanz zu bestimmten Sachverhalten, ist nach unserem Verständnis auch immer schon in den Wissenschaften angelegt und kann nicht von der Wahrheitssuche getrennt werden, obwohl es auch wissenschaftliche Positionen gibt, die das Konzept der Wahrheit veraltet finden (Postmoderne, Konstruktivismus). Selbstverständlich kann man auch kritische Äußerungen ohne Wissenschaftshintergrund formulieren – klar, das fällt dann unter die freie Meinungsäußerung und ist ein legitimer Beitrag für die öffentliche Debatte und darf nicht unterdrückt oder gering geschätzt werden.
Was an dieser Stelle wichtig ist: Wenn nicht die Beliebigkeit Standard werden soll, müssen wir an der Wahrheit festhalten, wir können auch sagen, am Konzept der Wahrheit; sie ist dem Menschen zumutbar, sagt Ingeborg Bachmann. Allerdings ist diese nicht leicht zu erkennen, vielleicht überhaupt nicht, da es immer neue Perspektiven auf einen Sachverhalt geben kann. Es ist problematisch, einfach auf den sogenannten ,Konsens‘ zu verweisen, der sich selbstverständlich auch den Voraussetzungen einer kritischen Anfrage stellen muss. Einen Konsens herzustellen heißt nicht, die Wahrheit eines Sachverhalts in den Händen zu halten, sondern eine vorläufige Einigung erzielt zu haben, mit der man arbeiten kann.
Ebenso verhält es sich im Bereich der Medien: Auch hier gilt es einer vermeintlichen Objektivität der Wirklichkeit nicht das Wort zu reden, sondern genau hinzuschauen, was die Medien zu leisten imstande sind. Vor allem ist es wichtig zu schauen, wer bestimmte Diskurse und Themen in welcher Weise formuliert, welche Entscheidungen im Vorfeld getroffen wurden und welche Akteure an diesen Entscheidungsprozessen beteiligt sind. Dies wird beispielhaft im Kapitel ,Wissenschaft‘ anhand der Einführung der Kompetenzorientierung gezeigt, die wiederum mit der Entwicklung und dem „Siegeszug“ des Neoliberalismus in einem Zusammenhang steht.
Genug der Einleitung, um die Begriffe Kritik, Wissenschaft und Wahrheit etwas zu skizzieren – dazu gäbe es mehr zu sagen. Es geht uns aber um die gegenwärtige Zeit und die Anwendung der Kritik auf den Ebenen der Medien, der Politik der Wissenschaften und der Zukunftsvision der IT-Industrie, die uns mit der „VerAppisierung“ nicht nur Lebenszeit stehlen, sondern auch Datenmissbrauch betreiben und unsere Verhaltens- und Denkweisen zunehmend formieren (siehe Kapitel Digitalisierung),6 was ebenfalls demokratieschädlich ist (hier werden nicht die allzu bekannten Vorteile der Technik und Digitalisierung wiederholt).
1 Siehe am Ende des Buches unter Coronaliteratur.
2 K. Röttgers, Europäische Enzyklopädie zu Philosophie und Wissenschaften, Hamburg 1990, S. 889.
3 I. Kant, Kritik der reinen Vernunft, Darmstadt 1983, Vorrede, S. 13.
4 M. Foucault, Was ist Kritik?, Berlin 1992, S. 12.
5 Ebd., S. 14.
6 Vgl. dazu: S. Zuboff, Das Zeitalter des Überwachungskapitalismus, F. a. M. 2018.
2 Die Medien
Wir meinen mit den Medien vor allem den öffentlich-rechtlichen Bereich, die großen Tages- und Wochenzeitungen und die nicht durch Gebühren finanzierten Medien (Internet, Blogs von freien Journalisten usw.). Sicherlich können wir von den öffentlich-rechtlichen und durch Milliarden Gebühren finanzierten mehr erwarten als von den „Alternativmedien“, die sich ausschließlich über Werbung und Spenden finanzieren.
Was sollte nun die Presse grundsätzlich leisten? Was sollte vor allem die freie und durch Rundfunkgebühren finanzierte Presse leisten?
Freie und unabhängige Medien nehmen in einer Demokratie eine zentrale und unersetzliche Rolle ein. Presse, Rundfunk und Fernsehen sollten die Bürger unabhängig von Staat und Parteien informieren und tragen so zu deren Meinungsbildung bei. Noch einmal pointierter ausgedrückt:
Die Presse hat die Aufgabe, den Prozess der öffentlichen Meinungsbildung zu unterstützen, indem sie den Rezipienten vielfältige Meinungen anbietet. Zur Wahrnehmung dieses Auftrages ist eine pluralistische Medienlandschaft mit unabhängigen Redaktionen unverzichtbar.
Deswegen, so könnte sinnvoll argumentiert werden, ist ein gebührenfinanzierter öffentlich-rechtlicher Rundfunk/TV notwendig, da hier die sorgfältige und mitunter länger andauernde Recherche ohne Finanzierungsdruck garantiert werden kann.
Die kritische Presse wurde durchaus als ein „Tor zur Demokratie“ angesehen. Das Werkzeug zum Öffnen des Schlosses, gewissermaßen der Schlüssel, stellen Pressefreiheit und damit einhergehend ein unabhängiger und kritischer Journalismus dar – Haltungen haben hier keinen Platz. Sie sollten zumindest nicht mit in die Berichterstattung miteinfließen oder als Kommentar gekennzeichnet werden.
Durch die Kontrollfunktion gegenüber den staatlichen Gewalten wurde die Bezeichnung „vierte Gewalt“ als Synonym für die Presse geprägt. In der Gewaltenteilung einer Demokratie kontrollieren sich die Inhaber der Exekutive, Judikative und Legislative (bestenfalls) gegenseitig – dieses System nennt sich „Checks und Balances“, was, frei übersetzt, so viel wie „Kontrolle und Gegengewichte“ bedeutet. Die drei staatlichen Gewalten werden zusätzlich durch die „vierte Gewalt“ Journalismus beobachtet und kritisiert, zumindest im besten Falle. Allerdings ist die Presse kein Organ rechtsstaatlicher Gewalt und somit ist der Begriff der ,vierten Gewalt‘ nicht wortwörtlich zu nehmen. Wichtig ist sicher noch, dass das Grundgesetz klar formuliert:
„Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt.“ Grundgesetz, Artikel 5
Nun kann die kritische Frage gestellt werden, ob sie in den letzten Jahren ihre Funktion als sogenannte vierte Gewalt ernstgenommen und wahrgenommen hat (der Regierung und ihren Maßnahmen, Gesetzen und auch ihrer Kommunikation gegenüber) und ob sie zweitens hinsichtlich der Medizin-Berichterstattung auf eine unangemessene sensationelle Darstellung verzichtete, die Hoffnungen oder Befürchtungen beim Leser erwecken könnte, oder ob sie Forschungsergebnisse, die sich in einem frühen Stadium befinden, als „abgeschlossen oder nahezu abgeschlossen dargestellt haben“, wie es im Pressekodex steht.
Einige Beispiele zu den oben genannten Fragen: Von Beginn der ausgerufenen Pandemie an wurden bestimmte Begriffe eingeführt, die die statistische Erfassung von „Fällen“ erläutern sollten. Zu Beginn hieß es lange, eine bestimmte Anzahl Corona-Infizierte sind zu vermelden. Schon im April konnte man von kritischen Wissenschaftlern7 hören, dass dies höchst unpräzise sei und eher dazu diene, einen bestimmten Angst- und Vorsichtigkeitspegel bei der Bevölkerung zu halten. Denn nicht alle mit einem bestimmten Test Gefundene sind auch krank. Es dauerte dann bis August, als DIE ZEIT dankenswerter Weise in ihrer 36. Ausgabe des Jahres 2020 ein kritisches Corona-Glossar zusammenstellte. Allerdings blieb dies wirkungslos und wir hörten auf allen Kanälen von tausenden Infizierten.
Noch heute (Stand Herbst 2022) spricht man von hunderttausenden Infizierten (und nicht positiv Getesteten) und suggeriert, die Pandemie endet vorerst nicht (laut Lauterbach bleiben wir im ,Ausnahmezustand‘, das sei nun normal. Dies ist nachvollziehbar, denn solange man testet, bleibt man in der sogenannten Pandemie und muss dann tatsächlich von einer „Test-Pandemie“ sprechen).8 Wir werden im Kapitel ,Politik‘ näher auf die Kommunikation einiger Politiker eingehen.
Ein weiteres Beispiel, wie kritiklos nahezu die gesamte Presse die Verlautbarungen des RKI (übrigens ist dies eine Bundesbehörde, keine unabhängige wissenschaftliche Instanz) übernahm, ist die Zählweise der Coronatoten. Kritiker der Kritiker der Zählweise echauffierten sich, das sei doch zynisch, hier Haarspalterei zu betreiben. Es sei doch unwichtig, ob die nun an oder mit dem Virus gestorben seien. Oder ob das Virus nur noch einen schon alten und vorerkrankten Menschen weiter so geschwächt habe, dass er stirbt. Hier ist es allerdings die Aufgabe der freien Medien zu differenzieren, um ein klares Bild der vermeintlichen Bedrohung für alle zu zeichnen und sich gegen Pauschalisierungen und Vereinfachungen zur Wehr zu setzen. Sonst entsteht ein verzerrtes Bild und eine Bedrohungslage, die der medizinischen Grundlage entbehrt, und ein Angstszenario wird weiter aufrechterhalten. Denn es gibt sicher auch zahlreiche andere Krankheitserreger, die alten und vorerkrankten Menschen schaden und zum Tode führen können. Aber Vergleiche mit anderen Krankheiten wurden lange Zeit abgelehnt, diese würden nur die eigentliche Krankheit verharmlosen, Corona sei keine Grippe, sondern viel gefährlicher. Rasch wurde die Gruppe der „Corona-Leugner“ von der Politik und vor allem den Medien konstituiert, ohne sich die Mühe zu machen, einmal genau hinzuhören. Denn der Vergleich mit anderen ähnlichen Erkrankungen (übrigens ist der Vergleich ein zentraler wichtiger Operator in den Klausuren zahlreicher Schulformen und auch gängige Praxis in der Wissenschaftstheorie) dient weder der Verharmlosung noch der Nivellierung der Bedeutung eines Phänomens. Es gilt, Gemeinsamkeiten und Unterschiede herauszufinden, um eine genauere Einschätzung eines Phänomens zu gewinnen. Dies geht selbstverständlich nur über einen Vergleich mit ähnlichen Phänomenen, in diesem Fall der Grippe. Die pauschale Ablehnung von Vergleichen ist wissenschaftlich wenig plausibel und verhindert eine differenzierte Sichtweise auf einen bestimmten Sachverhalt.
Auch haben sich weite Teile der Presse rasch gegen die Maßnahmenkritiker gestellt und nicht selten undifferenziert diese als Leugner/Covidioten (Saskia Esken), als Bekloppte (Ex-Bundespräsident Gauck hinsichtlich der Impfskeptiker) oder als „Gestalten, die wieder in ihre dunklen Keller kriechen sollen“ (Tauber) bezeichnet und als Beleg nur jene sogenannten Querdenker interviewt, die kaum gerade sprechen konnten und wilde Verschwörungen ausgebrütet haben. Die ersten Demonstrationen von Menschen, schon im April 2020, waren weder rechtsorientiert noch zynische Leugner einer für bestimmte Menschen bedrohliche Krankheit, wobei nicht auszuschließen ist, dass es immer sogenannte Trittbrettfahrer bei Demonstrationen gibt (man denke nur als ein Beispiel an den G-8-Gipfel in Hamburg, bei dem neben berechtigter Kritik am Finanzkapitalismus Linksextreme die halbe Stadt zerlegten). Um was ging es den Menschen? Was trieb sie an? Antidemokratische Gesinnung? Egoistischer Freiheitstrieb? Das hätte die freie Presse sorgfältig auseinanderlegen und schon früh die zahlreichen Grundrechtseinschränkungen kritisch diskutieren müssen. Doch davon war so gut wie nichts auffindbar. Es gab eine durchhomogenisierte Presselandschaft, die rasch die ,Querdenker‘ als jene Feinde der Demokratie definierte und berechtigte, sachliche Kritik, wenn sie nur nach Querdenker roch, weit von sich wies und nicht weiter diskutierte (z.B. PCR-Tests und ihre Verlässlichkeit, flächendeckendes und wenig begründetes Maskentragen,9 Ausgangssperren, weitere Lockdowns ohne gesicherte Datenlage).10
Breite Berichterstattung und Multiperspektivität ist erwünscht – eine sachliche Darstellung und Orientierung an den Prinzipien des Pressekodex unabdingbar.
Es kann konstatiert werden – (erste Forschungen wurden in der Schweiz und an der Uni Erfurt durchgeführt), dass Corona nicht nur alle anderen Themen verdrängte, sondern dass auch wenig in Erfahrung zu bringen war, was seriöse kritische andere Wissenschaftler von den Grundlagen der Pandemie hielten.11 Eine vierte Gewalt darf nicht einfach der verlängerte Informationsarm der Regierung sein, sondern die Verantwortlichen müssen selbst recherchieren, ob z.B. Lockdowns oder das flächendeckende Maskentragen wirksam sind, welche Schäden sie anrichten, was für andere Maßnahmen möglich wären und vieles mehr.
Es dauerte sehr lange, bis andere Perspektiven in den Medien auftauchten – allerdings wird bis heute häufig nicht auf eine „sensationelle Darstellung“ verzichtet, was die medizinische Berichterstattung angeht. Auch heute noch, im Jahr 2022, wird die harmlosere (nicht: harmlose!) Omikronvariante täglich mit hohen Zahlen (die immer noch nicht differenziert betrachtet werden) genutzt, um die Pandemie als solche im Bewusstsein der Bevölkerung zu halten, während nicht nur die Nachbarländer bei höheren Inzidenzen (entgegen der falschen Behauptung des heutigen Bundesgesundheitsministers, wir hätten die höchsten) längst weitergehende Öffnungsschritte veranlassten und kritische Wissenschaftler fordern, sehr viel mehr zu differenzieren und sich auf die vulnerablen Gruppen zu konzentrieren.
Als ein Beispiel kann eine Sendung des WDR5 vom 16. März 2022 herangezogen werden, wo wieder von „Coronainfektionen“ gesprochen wird und man trotz „hoher Zahlen, die steigen“ öffnen wolle. Und überhaupt, so die Moderatorin weiter, wie können die Österreicher bei diesen Zahlen die allgemeine Impfpflicht aussetzen? Auch hier fehlt die Darstellung der Begründung, warum Österreich dies getan hat. Einmal ganz von der problematischen Herstellung der hohen Zahlen abgesehen (darunter sind vermutlich sehr viel mehr Geboosterte als Ungeimpfte – meine These) mit einer Impfung, die kaum Infektionen verhindert, könnte man von öffentlich-rechtlichen Anstalten verlangen, sehr viel genauer mit den Begrifflichkeiten umzugehen. Für die Gründlichkeit werden sie von uns allen bezahlt.
All dies sind kritische Anfragen, die sich formulieren lassen und diskutiert werden müssen – entweder sind sie mit Belegen und guten Begründungen zu widerlegen oder es gilt, den eigenen Anspruch an kritischen Journalismus zu befragen und ggf. wieder anzuheben.
ZDF-Chefredakteur Peter Frey räumte erfreulicherweise Ende 2020 ein zeitweise unkritisches Verhältnis zwischen Medien und Politik in der Corona-Berichterstattung ein. „In den ersten sechs Wochen der Pandemie, etwa von Mitte März bis Ende April, gab es in der Tat eine gewisse Übereinstimmung zwischen politischer und medialer Landschaft, wie sie in demokratischen Verhältnissen der Ausnahmefall sein sollte.“6 Das Ansehen der Medien nahm im ersten Corona-Jahr messbar ab.
Was kann von den Medien – gerade auch in Krisenzeiten – erwartet werden? Das kritische Verhältnis zur Regierung muss immer gewahrt bleiben – eine „gewisse Übereinstimmung zwischen politischer und medialer Landschaft“, die Frey oben einräumt, würden sogar manche als untertrieben ansehen. Darüber könnte man diskutieren. Aber tatsächlich müsste die mediale Landschaft für eine sehr viel größere Vielfalt sorgen, auch hinsichtlich der sogenannten Experten – weiterhin gilt es, sich um die medizinisch-virologisch einseitige Schlagseite zu kümmern. Soziale Fragen, pädagogisch-philosophische Sichtweisen auf die Veränderungen in anderen Bereichen des Menschseins wurden nicht oder kaum herangezogen (H. Gabriel aus Bonn war einer der wenigen, der den ,virologischen Imperativ‘ thematisierte und es als problematisch ansah, diesen als zentrale Orientierung auszurufen). Aber schon früh gab es in den alternativen Medien (YouTube und Co.) zahlreiche Pädagogen, Philosophen, Juristen, Soziologen und Kindheitsforscher,12 die im Mainstream nicht aufgegriffen wurden oder sogar auf YouTube gelöscht wurden, wenn sie auf einem ,falschen‘ Kanal sendeten (die sogenannte Kontaktschuld) oder vermeintlich falsche Aussagen zur herrschenden Meinung formulierten.
Der sogenannte investigative Journalismus eines Spiegels der 80er- oder 90er-Jahre scheint weitestgehend verschwunden – nun geht es darum, mit dem „Finger auf die Ungeimpften zu zeigen“ (Spiegel-Chefredakteur Niklas Blome) und die „Tyrannei der Ungeimpften“ (Montgomery) zu beenden (übrigens hält Herr Montgomery auch noch heute, im Dezember 2022, an dieser Formulierung fest).
Wolfram Henn, immerhin Mitglied des Deutschen Ethikrates, sagte: „Keine Corona-Notfallbehandlung für Impfverweigerer!“ Und: „Ausreisestopp für Ungeimpfte!“ Hier kann die kritische Frage gestellt werden, wo er seine philosophische Grundausbildung erhalten hat.
Der Bundespräsident stellte fest: „Ungeimpfte gefährden uns alle!“ Und Oliver Welke findet, dass Impfverweigerer leider irgendwie asozial seien. Peter Maffay fordert dann folgerichtig: „Wer nicht geimpft ist, kann eigentlich nicht unter die Leute gehen.“ Noch vor dem Ukrainekrieg empfand sich Macron in einem „Krieg gegen das Virus“, der schnell in einem „Krieg“ gegen andere Sichtweisen und Meinungen mündete, da es ja offensichtlich nur eine wissenschaftliche Wahrheit über das Virus gab.
Anfang September forderte der Satiriker Böhmermann (kein Journalist) in einer Podiumsdiskussion mit dem Moderator Lanz, dass bestimmte Leute nicht in Talkshows eingeladen werden sollten, denen man „Menschenfeindlichkeit“ unterstellen könne.13
Es soll an dieser Stelle nicht auf die problematische, inhaltlich dünne Argumentation von Böhmermann eingegangen werden, sondern auf die Forderung eines Repräsentanten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, nur offensichtlich genehme Gäste, die der offiziellen Linie folgen, einzuladen. Erfreulicherweise hat Lanz dem widersprochen und auch die Rückendeckung des ARD erhalten. Doch die Idee, die hinter Böhmermanns Vorwurf bzw. Vorschlag steckt, ist zu diskutieren. Er möchte, dass „Meinungen im öffentlichen Raum (…) einer strengen, umfassenden medialen und gesellschaftlichen Qualitätskontrolle standhalten (sollten). Die öffentliche Repräsentation von Meinungen muss nach Qualität erfolgen.“14
Wer aber soll dies gewährleisten? Nach welchem Maßstab wird entschieden, was Qualität ist? Die Nähe zu den politischen Entscheidungen? Oder ausgewählte Mediziner und Modellierer aus der Physik bestimmen die Marschrichtung? Oder Herr Böhmermann? Oft sind gerade in diesen Reihen zahlreiche Verunglimpfungen Andersdenkender zu verzeichnen. Die Kraft des besseren Arguments muss sich im öffentlichen Raum bewähren und sollte nicht durch eine Auswahl im Vorfeld bestimmt werden. Doch es ist und war beobachtbar, dass sich innerhalb der Presselandschaft überwiegend ein bestimmtes Narrativ durchsetzte und die Bevölkerung die Sätze wortwörtlich nachsprach – bis in die Beleidigungen und sachlogisch falschen Vorwürfe hinein („… Ungeimpfte sind an allem schuld, Maske ist immer sinnvoll, ohne die Maßnahmen wäre alles nur schlimmer, die Maßnahmen wirken, das sieht man doch an den Zahlen, Impfen ist Freiheit, Ungeimpfte sollten nicht die gleichen Rechte haben, wer weiß, wie es ohne Impfung ausgegangen wäre“ usw. …).
Der grundsätzliche Skandal ist eigentlich, dass die weitestgehend gesamte Presse zu diesen offensichtlichen rhetorischen Entgleisungen zahlreicher Politiker, Personen des öffentlichen Lebens und Ärzteverbandschefs geschwiegen hat und auch gegen die Exkludierung der Ungeimpften weiterhin schweigt und hier keine offene Debatte initiiert.15
Die 2-G-Regel hatte keine medizinische Evidenz und war eine politische Entscheidung, wurde aber rasch zu einer pseudowissenschaftlichen Begründung formuliert, die auch die Bevölkerung dankbar annahm. Hauptsache, es wird etwas getan. Aus welchem Grund hat auch hier nahezu die gesamte Presse keine ausführliche Diskussion gestartet und auch wieder die Regierungsverlautbarungen wiederholt? Ist die innere Zensur schon so weit fortgeschritten, dass im Mainstream eine abweichende Diskussion aus Vorsicht oder sogar Angst nicht mehr zugelassen wird?
Wie groß die Angst ist, lässt sich auch daran ermessen, dass schon 2014 der damalige Außenminister Frank-Walter Steinmeier das Faktum anerkennen musste, dass es eine „erstaunliche Homogenität in deutschen Redaktionen“ gibt und dass ihm der „Konformitätsdruck in den Köpfen der Journalisten“ ziemlich hoch erscheint (Frankfurter Allgemeine Zeitung, 15.11.2014).
Steinmeier sah schon damals sehr hellsichtig die Verengung der Berichterstattung im Journalismus und die mangelnde breite Sicht auf die Geschehnisse der Welt.





























