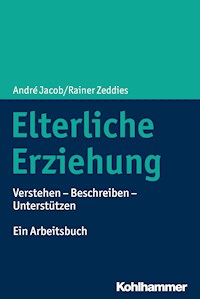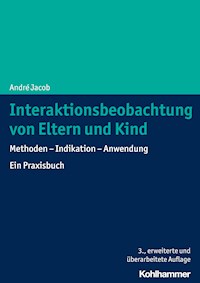
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Interaktionsdiagnostik als Spezialfall der Verhaltensbeobachtung von Eltern-Kind-Beziehungen wird inzwischen im Rahmen vieler Untersuchungen, Beratungen und Therapien angewandt. Bisher fehlten eine systematische Grundlegung und eine darauf aufbauende Bewertung dieser Methoden, die es den Praktikerinnen und Praktikern erleichtern, ihren eigenen Auswahlprozess zu begründen und zu steuern sowie eine Darstellung der themen- oder altersgruppenspezifischen Herangehensweisen. Das Arbeitsbuch schließt diese Lücken, denn es kombiniert methodische Grundlagen, umfassende Recherche und die Bewertung der gängigsten Verfahren mit einer ausführlichen Darstellung verschiedener diagnostischer und therapeutischer Vorgehensweisen. Der Praxiswert des Buchs erhöht sich, indem wichtige Beobachtungsverfahren komplett im Anhang publiziert werden, die in der dritten Auflage auch noch einmal überarbeitet und ergänzt worden sind.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 270
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Autor
Dr. André Jacob, Diplompsychologe und Psychologischer Psychotherapeut, leitet aktuell eine Berliner Erziehungs- und Familienberatungsstelle und war langjährig nebenberuflich als familienrechtspsychologischer Gutachter tätig. Er lehrt, unter anderem an der Psychologischen Hochschule Berlin, und publiziert in den Fachgebieten der Entwicklungs-, Erziehungs- und Familienpsychologie.
André Jacob
Interaktionsbeobachtung von Eltern und Kind
Methoden – Indikation – Anwendung
Ein Praxisbuch
3., erweiterte und überarbeitete Auflage
Verlag W. Kohlhammer
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen und sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche gekennzeichnet sind.
Es konnten nicht alle Rechtsinhaber von Abbildungen ermittelt werden. Sollte dem Verlag gegenüber der Nachweis der Rechtsinhaberschaft geführt werden, wird das branchenübliche Honorar nachträglich gezahlt.
Dieses Werk enthält Hinweise/Links zu externen Websites Dritter, auf deren Inhalt der Verlag keinen Einfluss hat und die der Haftung der jeweiligen Seitenanbieter oder -betreiber unterliegen. Zum Zeitpunkt der Verlinkung wurden die externen Websites auf mögliche Rechtsverstöße überprüft und dabei keine Rechtsverletzung festgestellt. Ohne konkrete Hinweise auf eine solche Rechtsverletzung ist eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten nicht zumutbar. Sollten jedoch Rechtsverletzungen bekannt werden, werden die betroffenen externen Links soweit möglich unverzüglich entfernt.
FürRalf-Rüdiger BohnundBärbel Derksen
3., erweiterte und überarbeitete Auflage 2022
Alle Rechte vorbehalten
© W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Gesamtherstellung: W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Print:
ISBN 978-3-17-041448-8
E-Book-Formate:
pdf: ISBN 978-3-17-041449-5
epub: ISBN 978-3-17-041450-1
Inhalt
Einleitung
Teil I: Theorie und Methodik
1 Begriffsbestimmungen, Problematisierung und Systematisierung
1.1 Inhaltlich-funktionale Kategorien
1.1.1 Perspektive »Kind«
1.1.2 Perspektive »Elternteil«
1.1.3 Perspektive der »Eltern-Kind-Beziehung« als Entität
1.1.4 Perspektive »Elternbeziehung«
1.2 Formale Operationalisierung
1.3 Beispiele für Indikatoren zur Beschreibung der Eltern-Kind-Interaktion
1.3.1 Perspektive des Kindes
1.3.2 Perspektive des Elternteils
1.3.3 Perspektive der Eltern-Kind-Beziehung
1.3.4 Perspektive der elterlichen Beziehung
1.4 Schlussfolgerungen für die Beurteilung von Instrumenten zur Beobachtung der Eltern-Kind-Interaktion
2 Methodik der Verhaltensbeobachtung
2.1 Beurteilungseffekte
2.2 Gütekriterien
2.3 Auswertungsmethodik
2.4 Beobachtung der nonverbalen und verbalen Kommunikation
2.5 Zur Methodik der videounterstützten Verhaltensbeobachtung
Teil II: Interaktionsdiagnostische Verfahren
3 Zur Systematik der interaktionsdiagnostischen Instrumente
4 Verfahrensübersicht in Steckbriefen
4.1 Ausführliche Steckbriefe (in alphabetischer Reihenfolge der Kurztitel)
4.2 Kurz gefasste Steckbriefe
4.3 Schlussfolgerungen
4.3.1 Verfahrensbeurteilung
4.3.2 Synoptische Betrachtung der Beurteilungskategorien
Teil III: Praxis der Interaktionsbeobachtung
5 Durchführung
5.1 Setting
5.1.1 Hochstrukturierte Interaktionsepisoden nach Marschak
5.1.2 Still-Face-Paradigma (SFP)
5.1.3 Strukturierte Interaktionsepisoden bei klinisch auffälligem Bindungsverhalten
5.2 Instruktion
5.3 Auswertung
5.3.1 Beurteilung des Schweregrades
5.3.2 Vorgehensweise
5.4 Kommunikation der Ergebnisse
6 Vorschläge zur Praxis der Interaktionsbeobachtung geordnet nach Altersgruppen
7 Vorschläge zur Praxis der Interaktionsbeobachtung bei verschiedenen Indikationsfragestellungen
7.1 Interaktionsbeobachtung bei Fragen zur Bindung des Kindes
7.2 Interaktionsbeobachtung bei Fragen zur elterlichen Erziehungsfähigkeit
7.3 Beobachtung der dyadischen Interaktion bei verschiedenen klinischen Fragestellungen
7.3.1 Interaktionsbeobachtung bei frühkindlichen Regulationsproblemen
7.3.2 Interaktionsbeobachtung bei postpartal depressiven Müttern und ihren Kindern
7.3.3 Interaktionsbeobachtung kommunikativer Schwierigkeiten des Kindes bei (Asperger-)Autismus, Störungen des Sozialverhaltens und Depression
7.4 Beobachtung der triadischen Interaktion
8 Ausgewählte Anwendungsfelder
8.1 Interaktionsbeobachtung zu primär diagnostischen Zwecken
8.1.1 Familienrechtspsychologische Untersuchung
8.1.2 Interaktionsbeobachtung zur Indikationsentscheidung bei Pflegeeltern
8.2 Interaktionsbeobachtung im Rahmen verschiedener Interventionsbereiche
8.2.1 Erziehungsberatung: Spezialfall »Eltern-Kind-Interaktionsberatung«
8.2.2 Interaktionsbeobachtung im Rahmen der stationären Eltern-Kind-Interaktionstherapie
8.2.3 Interaktionsbeobachtung im Rahmen der Video-Interventionstherapie (VIT) nach G. Downing
8.2.4 Interaktionsbeobachtung im Rahmen des Entwicklungs- und Erziehungstrainings mit Video: Marte Meo
8.2.5 Interaktionsbeobachtung im Rahmen der Frühen Hilfen: das STEEP-Programm
9 Literaturverzeichnis
10 Anhang
Anlage 1: Checkliste zu Konstrukt, Facetten und Indikatoren der Eltern-Kind-Interaktion
Anlage 2: Münchner klinische Kommunikationsskalen (MKK)
Übersicht – Kodiersystem für das spontane Zwiegespräch
Erläuterung des Kodiersystems für das spontane Zwiegespräch
Übersicht – Kodiersystem für die »Spielzeug-Sequenz«
Erläuterung des Kodiersystems »Spielzeug Sequenz«
Anlage 3: Fremdbeurteilungsskalen Eltern-Kind- Interaktions-Profil (EKIP)
Dokumentationsbogen
Anlage 4: Mannheimer Beurteilungsskalen zur Erfassung der Mutter-Kind-Interaktion im Säuglingsalter (MBS-MKI-S)
Manual
Literatur
Anlage 5: Kategorien zur Beschreibung interaktiver Episoden
nach G. Downing, A. Jacob u. a.
(Bearbeitungsstand: 2021)
Interaktionsbeobachtung nach Downing, Jacob u. a.
Anlage 6: Beobachtungskategorien zur Beschreibung elterlicher Erziehung mit dem Fokus auf »Interaktion« (nach Jacob und Wahlen 2006):
A: Elterliche Verhaltenssysteme
B: Interaktionsmechanismen
C: Elterliche Affektmuster
Anlage 7: Beavers Interaktionsskalen
Übersicht
Familienkompetenzskalen (FKS)
Familienstilskalen (FSS)
Stichwortverzeichnis
Einleitung
Im Juni 1999 erlebte ich am Kinderzentrum in München mein erstes und – wie sich leider bald zeigen sollte – auch eines der letzten noch vom Ehepaar Hanouš und Mechthild Papoušek1 gemeinsam veranstalteten Grundlagenseminare zu Regulationsproblemen der frühen Kindheit. Es eröffnete mir eine Welt in das Verstehen kindlicher Entwicklungsprozesse und ihrer Verwobenheit in Eltern-Kind-Interaktionen, wie dies bis dahin für mich kaum vorstellbar gewesen war. Einen besonderen Reiz übten die Untersuchungen zur »intuitiven Elternschaft« aus, bei der sich das Forscherpaar Papoušek nicht nur einer ausgefeilten Untersuchungsmethodik, sondern auch der damals neuesten technischen Möglichkeiten zur videografischen Aufzeichnung bediente. »Je jünger das Kind, um so unmittelbarer drückt es sich in seinem gesamten Verhalten aus, umso deutlicher erschließt das beobachtbare Verhalten den Zugang zur körperlichen, psychischen und sozialen Entwicklung und ihren Störungen« schrieben die Papoušeks bereits im Jahr 1981 (Papoušek & Papoušek, 1981, S. 20). Sie wiesen »außerdem darauf hin, dass der Einsatz von Film- und Videotechnik eine Ausdehnung des Gegenstandsbereichs bedeute. Sie ermöglicht auch eine Art mikroskopischer Betrachtung, eine Ausweitung der physiologischen Grenzen der Sinnesorgane bis in den Bereich des Unsichtbaren und Unhörbaren sowie eine hohe zeitliche Auflösung, die auch flüchtige, unwillkürliche Verhaltensweisen und feinste Interaktionsstrukturen verläßlich erfaßbar macht« (ebd.). Daraus ergäben sich entscheidende methodische Vorteile. Eine gute Aufzeichnung »ermöglicht dieselbe Szene einmal einfühlend, u. U. in wechselnden Rollen, mitzuerleben, einmal aus objektiver Distanz2 einzelne Elemente des Verhaltens auszuwerten, oder von mehreren Beobachtern unabhängig auswerten zu lassen. Was sich auf verschiedenen Ebenen oder bei mehreren Partnern parallel abspielt, kann nach und nach oder im zeitlichen Zusammenspiel bis ins Detail beschrieben werden. Und es ist möglich, zur selben Szene mit neuen Erkenntnissen und Fragestellungen zurückzukehren« (Papoušek & Papoušek, 1981, S. 21. zit. nach Thiel, 2011, S. 808).
Mir wurde allmählich klar, wie tiefgreifend diese Sicht- und Arbeitsweise die Untersuchung der frühkindlichen Entwicklung und ihrer Sozialisationsinstanzen beeinflussen dürfte und welche Konsequenzen dies für die Diagnostik und Beratung von Familien mit Säuglingen und Kleinkindern haben würde. Was ich im Jahr 1999 noch nicht ahnte, war, welch große Herausforderung an die eigene Fähigkeit zur Objektivierung, zur Systematisierung und zur theoretischen Reflexion ein solches Arbeiten mit sich bringt und wie sich immer wieder neue Fragen beim Lösen eines Problems in diesem Feld auftun. Um der eigenen inneren – nicht selten kaum auflösbar scheinenden – Verwirrung zu entgehen, entstand dieses Buch: Es zielt auf mehr Systematik und Vollständigkeit als bisherige Literatur; es ist jedoch vor allem dazu gedacht, diagnostisch Praktizierenden3 bei der Auswahl von Methoden und Instrumenten behilflich zu sein, indem von Kolleginnen und Kollegen als auch von mir selbst stammende Erfahrungen und Überlegungen als Praxisempfehlungen formuliert werden.
Das Praxisbuch beschränkt sich auf die Vorstellung und Analyse von verhaltensbeobachtenden interaktionsdiagnostischen Verfahren und schließt Verfahren und Methoden – nicht zuletzt auch wegen der kritischen Ausprägungen in den Gütekriterien (vgl. Gloger-Tippelt & Reichle, 2007, S. 404) – aus, die darüber hinausgehen, also beispielweise Fragebögen, Interviews oder szenisch-projektive Verfahren, die ebenfalls der Gruppe der interaktionsdiagnostischen Methoden zuzuordnen sind.
Zum Umgang mit dem Buch
Je nach Interesse der Lesenden kann das Buch auf unterschiedliche Weise rezipiert werden:
• Wer sich für theoretische und methodische Hintergründe interessiert, sollte den ersten Teil in die Lektüre miteinbeziehen.
• Wer sich zunächst nur einen Überblick über gängige Verfahren verschaffen möchte, sollte sich vor allem mit dem zweiten Teil beschäftigen.
• Wer Empfehlungen zur generellen Anwendung oder zu spezifischen Themen und Fragestellungen erhalten möchte, kann den Schwerpunkt auf den dritten Teil legen.
• Im Anhang finden sich einige Instrumente, die aufgrund ihrer Publikation oder durch freundliche Genehmigung der Autorinnen und Autoren für eine sofortige Nutzung zur Verfügung stehen.
Das Zustandekommen dieses Buches wäre nicht ohne die Hilfe einiger Menschen denkbar, denen ich an dieser Stelle ganz besonders danken möchte: Ursula Geißler, Anne Huber und Brit Bonin für ihre wertschätzend-kritische und anreichernde Durchsicht des Manuskriptes, George Downing für seine Ermutigung und seine hilfreichen Kommentierungen, Heike Morche und Brit Bonin für ihre jeweiligen Beiträge in diesem Buch und für ihre Hilfe beim Sichten der vielen Materialien sowie Peter Bertz und Sophia Kugler, die mich ebenfalls beim Recherchieren umfassend unterstützt haben.
Nicht zuletzt gilt auch dem Kohlhammer Verlag mein Dank für die wohlwollende und zugleich aufmerksam-kundige Bearbeitung des Manuskriptes sowie für die Möglichkeit, nun auch die dritte, aktualisierte Auflage dieses Buches fertigstellen zu können.
1 Hanouš Papoušek verstarb leider schon ein Jahr darauf (1922–2000).
2 Anstelle des Begriffs der »Objektivität« sollte eher der Begriff der »Beurteilerunabhängigkeit« stehen, um eine Verwechslung mit dem erkenntnistheoretischen Terminus der »objektiven Wahrheit« zu vermeiden.
3 Es werden, wenn möglich, gendergerechte Begriffe oder die Doppelschreibweise verwendet. Geschlechtsspezifische Formulierungen in Quellen oder Fachbegriffe werden in ihrer Form belassen.
Teil I: Theorie und Methodik
1 Begriffsbestimmungen, Problematisierung und Systematisierung
Zwei wesentliche Quellen münden in den aktuellen Strom der Eltern-Kind-Interaktionsbeobachtung.
Entwicklungsdiagnostik als erste Quelle
Den ersten Quell bildet die auf eine lange Tradition zurückreichende Entwicklungsdiagnostik. Im deutschsprachigen Raum war hinsichtlich der Methode der Verhaltensbeobachtung der von Charlotte Bühler und Hildegard Hetzer 1932 publizierte Kleinkindertest (Bühler & Hetzer, 1932) ein erster Meilenstein. Durch eine 24-stündige Dauerbeobachtung des Verhaltens von Kindern unter sechs Jahren wurden diagnostisch wichtige Beobachtungsdaten generiert. Bis zum heutigen Tag verweisen die Autorinnen und Autoren von Entwicklungstests (im Überblick z. B. Esser & Petermann, 2010, Kastner-Koller & Deimann, 2009) auf die Bedeutung der Verhaltensbeobachtung während der diagnostischen Untersuchung insbesondere im Kleinkindalter, da sie oftmals die einzige Möglichkeit darstelle, »Einblick in die Kompetenzen des Kindes zu erlangen, solange das Sprachverständnis die Befolgung von Testinstruktionen noch nicht erlaubt und die expressive Sprache, aber auch die kognitiven Fähigkeiten ein diagnostisches Interview noch nicht ermöglichen« (Kastner-Koller & Deimann, 2009, S. 98).
Familiendiagnostik als zweite Quelle
Die Notwendigkeit von Verhaltensbeobachtung in der Entwicklungsdiagnostik begründet sich jedoch nicht allein aus der Einschränkung der symbolischen Kommunikation im frühkindlichen Alter. Sie gewinnt als entwicklungsdiagnostische Methode auch zunehmend an Bedeutung, weil sie den Zugang zu komplexen, qualitativen und dynamischen Aspekten (wie z. B. der Affektivität des Kindes und dessen sozialer Kommunikationsfähigkeit) verspricht. Bei den damit verbundenen Fragestellungen besteht eine Schnittmenge zwischen der Entwicklungsdiagnostik und der zweiten Quelle der Verhaltensbeobachtung. Diese wird durch die Familiendiagnostik gebildet, zu deren Repertoire die Interaktionsbeurteilung seit den 1980er Jahren gehört. Heute gängige Entwicklungstheorien gehen systematisch davon aus, dass sich die menschliche Persönlichkeit in sozialen Beziehungen entfaltet. Diese Ansicht fußt auf einer langen Tradition (Kreppner, 2005), welche durch die Entdeckung und den Ausbau der systemischen Perspektive einen großen wissenschaftlichen und methodologischen Auftrieb erhielt (Gloger-Tippelt & Reichle, 2007). Der Hinwendung zur Familie als Sozialisationsinstanz (z. B. Bronfenbrenner, 1974, 1981) folgten Versuche, familiäre Kommunikation zu diagnostizieren (ältere Literatur referiert beispielsweise Brunner, 1984, eine Zusammenschau jüngerer Literatur bieten z. B. Cierpka, 2008 und Schneewind, 2005). Rasch wurde deutlich, dass Familiendiagnostik verschiedene Ebenen miteinander verknüpfen muss (Belsky, 1981; Kreppner, 1984), indem das kindliche – entwicklungspsychologisch determinierte – kommunikative Verhalten in Bezug gesetzt wird zur elterlichen – auf das Kind bezogenen – Kommunikation und dies hinsichtlich Qualität, Quantität, Dynamik und Performanz. Letztendlich erkannte man, dass es sich bei der wissenschaftlichen Beschreibung und möglichst objektiven Abbildung von Eltern-Kind-Kommunikation um hoch komplexe und dynamische Vorgänge handelt. Dies dürfte auch einer der Hauptgründe dafür sein, weshalb es bis heute so zahlreiche diagnostische Versuche und Instrumentarien in diesem Bereich gibt.
Einen wissenschaftlich-methodischen Schub bekam die Familiendiagnostik zu Beginn der 1990er Jahre durch die Möglichkeit, kommunikatives Handeln praktikabel und kostengünstig zu videografieren. Damit schien das gesamte kommunikative Verhaltensrepertoire der Diagnostik zugänglich zu werden. Zugleich jedoch vermehrte sich auch die Menge der beobachtbaren Items und Daten exponentiell. Die Auswertung solcherart Interaktionsbeobachtungen verlangte demzufolge wiederum ein Mehr an Systematik und Verdichtung. Bis heute ist diese Entwicklung nicht abgeschlossen. Für die Praxis jedoch ergibt sich ein Dilemma: Wie kann es gelingen, im Dschungel der Vorgehensweisen und im Dickicht der Interaktionsbeobachtungsinstrumente das für die jeweilige Fragestellung Passende auswählen? Um dies ein wenig zu erleichtern, wurde dieses Buch – nicht zuletzt der selbst erfahrenden Not des Autors geschuldet – verfasst.
Nachfolgend wird nun zunächst der Versuch unternommen, einige zentrale Begriffe zu definieren und ggf. so zu problematisieren, dass die anschließenden Erläuterungen des diagnostischen Potentials von Interaktionsbeobachtung für die Lesenden plausibel nachvollziehbar werden.
Kommunikation
Der Begriff der »Kommunikation« wird im Allgemeinen als ein Prozess des Informationsaustausches verstanden. Menschliche Kommunikation ist demnach der Informationsaustausch zwischen Menschen. Interaktives Verhalten kann unter der Perspektive der Kommunikation als informationsaustauschendes, psychisch reguliertes Handeln zwischen Personen beschrieben werden. Es »beinhaltet die durch Zeichen vermittelte Abbildung von Bedeutungen zwischen Individuen. Damit ermöglicht sie die Weitergabe menschlicher Erfahrungen in und zwischen den Generationen« (Hiebsch & Vorwerg, 1980, S. 275).
Kommunikation ist der Informationsaustausch von Personen, die zueinander in einer sozialen Beziehung stehen, wenn sie durch mindestens ein stabiles Interaktionsmuster miteinander verbunden sind.
Interaktion
Interaktionen werden Sprach- oder andere Handlungen von zwei oder mehr Personen genannt, die sich unmittelbar aufeinander beziehen (Richtungs- und Zielbezug; vgl. z. B. Bales, 1972). Diese Handlungen sind operationalisierbar, mithin beobachtbar. Sie sind praktisch »bezogenes Handeln«. Sie lassen auf die Beziehungsschemata der Beteiligten schließen und, bei einer größeren Stabilität und Konsistenz, auf deren Beziehungseinstellungen.
Unter einem Interaktionsmuster werden wiederkehrende in zentralen Merkmalen ähnliche Handlungen oder Handlungsketten verstanden, die Beobachterinnen und Beobachter auf eine Beziehung zwischen den Akteuren schließen lassen. Die Definition von Ähnlichkeit bzw. die Überschreitung der Grenze zur Unähnlichkeit wäre eine Anforderung an die Konstrukteure und Konstrukteurinnen von interaktionsdiagnostischen Instrumenten.
Beziehung
Beziehung ist ein Konstruktbegriff, der sich in seinem Konstruktcharakter von der beobachtbaren, damit auch operationalisierbaren »Interaktion« unterscheidet. Welches theoretische Konzept (Konstrukt) von »Beziehung« in das jeweilige interaktionsdiagnostische Instrument einfloss, sollte in der Publikation expliziert werden.
Beziehung ist nicht statisch zu verstehen, auch wenn Begriffe wie »Muster« oder »Einstellung« eine relative Stabilität suggerieren. Ein Konzept, das der Dynamik im wechselseitigen interaktiven Geschehen gerecht zu werden verspricht, scheint das der »Wieder-Herstellung von Passung« zu sein. Darauf verweisen Thomas und Chess (1977), die ein kumulatives und wechselseitiges Verhältnis von Anlage- und Umweltfaktoren postulieren und auf »den ursprünglich von Henderson (1913) vorgeschlagenen Begriff der Übereinstimmung (›goodness of fit‹)« zurückgreifen (Resch, 2004, S. 37).
Will man diesem Konzept folgend Beziehung erkennen und beschreiben, muss es gelingen, nicht nur die Fits oder Misfits (Largo & Benz-Catellano, 2004) zu erfassen, sondern Beziehung als ein dynamisches autopoietisches System (im Sinne Luhmanns, 1984) als »Match-Mismatch-Repair-Circle« (Tronick, 2007) zu verstehen und abzubilden. Mechthild und Hanouš Papoušek entwickelten diesen Ansatz bereits im Jahr 1990. Mechthild Papoušek baut ihn – nach dem Tode ihres Mannes – bis zum heutigen Tag aus (z. B. Papoušek, 1999) und stellt immer wieder eine Kompatibilität zu neueren Forschungsergebnissen und Paradigmen her (Papoušek, 2004; Papoušek, 2015).
Beziehungseinstellung steht für die allgemeine stabile Haltung einer Person zu Beziehungen. Auf sie ist zu schließen mit Hilfe des explorierenden Gesprächs sowie über die Erfassung von Interaktionsmustern (vgl. auch Asendorpf, Banse & Neyer, 2017).
Interaktionsbeobachtung
Die Arbeitsdefinition der hier gemeinten Interaktionsbeobachtung umfasst die Beobachtung und Beurteilung von bezogenem (interpersonalem) Verhalten.
Kommunikationsbeobachtung bezieht sich demzufolge auf die Beobachtung und Bewertung einer Teilmenge interaktiven Verhaltens, nämlich dem Verhalten, das dem Informationsaustausch der Beteiligten dient.
Mithilfe der Interaktionsbeobachtung soll also nicht nur Verhalten beobachtet werden, sondern auch aus beobachteten interaktiven Handlungen Schlüsse auf Beziehungsmerkmale und von diesen wiederum auf die grundlegende dyadische Beziehung (z. B. auf den Bindungscharakter) oder auf Kompetenzen zur Interaktionsgestaltung der Akteure (z. B. Feinfühligkeit) gezogen werden. Wie bedeutsam die Wahl des theoretischen Rahmens für die Schlussprozesse ist, betonen beispielsweise Gloger-Tippelt und Reichle (2007, S. 402) mit Verweis auf die Heuristik des Bindungskonzeptes nach Bowlby.
In der Praxis ist sehr exakt darauf zu achten, ob es sich bei den Interaktionsbeschreibungen um beobachtbares Verhalten oder bereits um Zuschreibungen/ Deutungen handelt. So wird beim CARE-Index, der in Kapitel 4 vorgestellt wird, beispielsweise versucht einzuschätzen, welche Funktionalität das kindliche Verhalten hat. Streng genommen ist dies bereits ein Schlussprozess, der in vielen Urteilsbildungen jedoch nicht entsprechend expliziert wird, obwohl sich damit sprunghaft der Grad von Subjektivität in der Beurteilung erhöht.
Einige interaktionsbeobachtende Instrumente erfüllen den Anspruch, nicht nur interpersonale (speziell kommunikative) Handlungen zu erfassen, sondern auch Schlussprozesse auf Handlungsmuster sowie auf diesen zugrunde liegende Einstellungen und Repräsentationen vorzunehmen. Dies ist für die Praxis von größtem Interesse, denn was soll man mit streng ausgezählten rein beobachtbaren Daten, wie z. B. den »Blickkontakten des Kindes zum Elternteil je Minute« anfangen, wenn ihnen kein inhaltliches Referenzsystem zur Verfügung steht?
Analysiert man die bisher vorliegenden Instrumente, so scheint es am angemessensten, die Beobachtungskategorien zur Einschätzung der Eltern-Kind-Interaktionen nach zwei Gesichtspunkten zu ordnen:
1. nach der Funktionalität der Interaktion möglichst aus vier Perspektiven: Kind, Elternteil, Elternteil-Kind sowie Elternbeziehung.
Der hier gemeinten Einschätzung von Funktionalität des interaktiven Verhaltens liegt bereits ein erster Deutungsprozess des Diagnostikers zugrunde. Daher ist es methodisch und psychologisch sinnvoll und erforderlich, diesen ersten Schlussprozess mit Hilfe eines Bewertungsinstrumentes auch plausibel4 zu begründen und methodisch so zu gestalten, dass eine möglichst große Übereinstimmung der Beurteilenden bezüglich Validität und Reliabilität erzielt wird.
2. Differenzierung der Kategorien zur Interaktionsbeobachtung unter formalen Gesichtspunkten
Diese beiden Aspekte der »Funktionalität« und der »formalen Operationalisierung« werden im folgenden Abschnitt in einer ersten Annäherung – und zwar jeweils geordnet nach der Perspektive »Kind«, »Eltern«, »Eltern-Kind-Beziehung als Entität« und »Elternbeziehung« – überblicksartig dargestellt. Auf diese Weise sollen die Lesenden die Möglichkeit erhalten, die dann im zweiten Teil folgenden inhaltlichen Bewertungen bei der Skizzierung einzelner Verfahren besser nachvollziehen zu können. Am Ende des 4. Kapitels (Kap. 4.3) wird schließlich eine synoptische Betrachtung der Facetten und Indikatoren der ausgewerteten Beobachtungsinstrumente vorgestellt, die als Grundlage für weitere Forschung aber auch bereits zur praktischen Nutzung als eine Art Checkliste verwendet werden könnte (Anlage 1).
1.1 Inhaltlich-funktionale Kategorien5
1.1.1 Perspektive »Kind«
Unter funktionalem Aspekt ist zu fragen, worauf die Eltern-Kind-Interaktion hinzielt? Entwicklungspsychologisch dient sie insbesondere:
1. der Befriedigung sinnlich-vitaler Bedürfnisse und der Regulation der Verhaltenssysteme des Kindes (vgl. z. B. Als & McAnulty, 2001; Ziegenhain & Fegert, 2018)
2. der Entwicklung der Mentalisierung des Kindes (vgl. im Überblick z. B. Fonagy, Gergely, Jurist, Target & Vorspohl, 2006; Bischof-Köhler, 2011; Kalisch, 2012; Taubner & Wolter, 2016)
3. der Entwicklung von »Autonomie« des Kindes (vs. Abhängigkeit) (vgl. z. B. Keller & Chasiotis, 2008; Keller, 2011)
4. der Entwicklung von Interdependenz (»Bezogenheit vs. Unbezogenheit«) (vgl. z. B. Keller & Chasiotis, 2008; Keller, 2011; Lohaus, Ball, & Lißmann, 2004)
5. der Entwicklung kognitiver und exekutiver Funktionen des Kindes (z. B. Berger, 2010; Lepach, Lehmkuhl, & Petermann, 2010; Pletschko et al., 2020)
6. der Entwicklung perzeptiver und motorischer Funktionen sowie der sensomotorischen Integration (z. B. Karnath & Thier, 2012; Pletschko et al., 2020)
7. der Entwicklung selbstregulativer Kompetenzen insbesondere der Impulskontrolle und der Affektregulation (z. B. Papoušek, 2012; Klinkhammer & von Salisch, 2015)
Diese zentralen entwicklungspsychologischen Themen sind teilweise verschränkt, jedoch (noch) nicht durch ein gemeinsames theoretisches Konzept gerahmt. Deshalb kann diese Aufzählung auch keineswegs als abgeschlossen gelten. Dennoch stellt sie den »Fluchtpunkt« interaktioneller Diagnostik in Bezug auf das Kind dar.
1.1.2 Perspektive »Elternteil«
Ebenfalls funktional betrachtet, denn dies wird quasi genuin aus dem Begriff »Elternschaft« definiert, stehen mit Blick auf ein Elternteil die folgenden – sich zum Teil ebenfalls überschneidenden – Themen im Fokus von Interaktionsbeobachtung:
1. Rahmung und Sicherung der Interaktionsepisode, insbesondere durch Strukturgebung in Raum und Zeit, Instruktion und Antizipation von Handlungen
2. Vermittlung von Sicherheit, insbesondere durch Gestaltung des affektiven Klimas (Wärme und Geborgenheit), durch Schützen und Trösten
3. Regulationshandlungen und Förderung selbstregulativer Handlungen des Kindes bei Stress, bei positiven, negativen und ambivalenten kindlichen Signalen, auch bei »Übergängen« (insbesondere durch affektregulierende Handlungen)
4. Unterstützung und Förderung des Kindes in Bezug auf dessen Autonomie- (Exploration), Bezogenheits- (Nähe) und Erholungswünsche
5. Unterstützung und Förderung des Kindes in Bezug auf dessen Mentalisierung; insbesondere durch Affektmarkierung und -spiegelung, durch Unterstützung des kindlichen Symbolspiels (im »Als-ob-Modus«) sowie die Kommunikation mit dem Kind über dessen Gedanken, Fantasien und die dadurch ausgelösten Empfindungen (dem sog. »psychischen Äquivalenzmodus« vgl. Kalisch, 2012; nach Gergely im Überblick z. B. Kohlhoff, 2018; Taubner & Wolter, 2016; Taubner, Fonagy & Bateman, 2019)
6. Unterstützung des prozeduralen Lernens (Papoušek & Papoušek, 1999, S. 121 f.)
7. Korrektur eigener kommunikativer Fehler und Missverständnisse
1.1.3 Perspektive der »Eltern-Kind-Beziehung« als Entität
Bei der Annäherung an diese Perspektive lassen sich mindestens drei verschiedene Zugänge voneinander unterscheiden.
1.1.3.1 Versuche, Beziehung mit Hilfe musikalischer Qualitäten zu beschreiben
Die Autorinnen des Eltern-Kind-Interaktionsprofils (EKIP) (Ludwig-Körner, Alpermann & Koch, 2006) und deren österreichische Vorgängerinnen (Cizek & Geserick, 2004) beschreiben das Eltern-Kind-Wechselspiel als eine eigene Qualität. Dass sie sich dafür an Metaphern aus der Musik bedienen, lässt den Ansatz einerseits nachvollziehbar und praktikabel scheinen, deutet aber zugleich auf ein begriffliches und damit auch theoretisches Defizit der Psychologie der Beziehung hin.
Die Autorinnen unterscheiden drei Beziehungsqualitäten, auf die weiter unten in Kap. 7.3. sowie in der Anlage 3 noch ausführlicher eingegangen wird:
1. Qualität der Grundmelodie bzw. Tonart: Tonalität vs. Atonalität, Balance, Harmonie vs. Disharmonie, Kongruenz vs. Dyskongruenz, Synchronizität vs. Dyssynchronizität
2. Grundrhythmus: Tempo (Allegro oder Adagio), »Speed«, Frequenz der Signalemission
3. Lautstärke: Wie laut und kräftig sind die Äußerungen? (Pianissimo bis Fortissimo), Temperament, Stärke, Kraft, Energielevel beider Dialogpartner
1.1.3.2 Beschreibung der »Eltern-Kind-Beziehung« mittels psychologischer Termini
1. Passung: Der Begriff der »Passung« kann nicht ohne seine funktionale Bedeutung definiert werden. Demnach ist jeweils die Frage zu beantworten, wozu denn die Passungsherstellung dient. Dies soll an einem Beispiel erläutert werden: Die Betrachtung einer Eltern-Kind-Fütter-Episode kann z. B. unter der Fragestellung erfolgen, ob es Elternteil und Kind gelingt, den Hunger des Kindes zu stillen. Die Beobachtung wird in diesem Fall auf Sättigungszeichen des Kindes gelenkt. Erst in zweiter Linie ist dann vielleicht von Interesse, wie effizient die Fütterung durch den Erwachsenen erfolgte. Eine Frage, die sich dagegen nicht selten bei essgestörten Eltern stellt, ist ob und inwiefern diese in der Fütter-Episode Schwierigkeiten haben, die kindlichen Affekte angemessen zu spiegeln. Weitere Fragestellungen sind denkbar. Ferner ist es erforderlich, die Passung in verschiedenen Situationen zu beobachten. Ritterfeld und Franke (1994/2009 und neuerdings: Franke & Schulte-Hötzel, 2019) inszenieren hierfür Aufgaben, die zum einen Stress evozieren und zum anderen emotionale Abstimmung und Kooperation erfordern. Die Passung kann dabei natürlich sehr unterschiedlich ausfallen. Mit Blick auf eine Gesamteinschätzung ist daher zu fragen, wie und wozu der Passungsbegriff verwendet werden kann. Ein einfaches quantitatives Urteil reicht nicht aus, da es unterschiedliche Interaktionshandlungen unzulässig miteinander verrechnen würde.
Passung
2. »Interaktionsverantwortung« legt den Fokus darauf, wer die Führung in welcher Interaktionsepisode sowie im gesamten Interaktionsprozess übernimmt (Franke & Schulte-Hötzel, 2019, in Weiterführung der Ideen von Ann M. Jernberg und Marianne Marschak).
Interaktionsverantwortung
3. »Kontakt« beschreibt, wer von beiden Interaktionsbeteiligten den kommunikativen Austausch auf welche Weise (Modus, Frequenz, Intensität) initiiert, aufrechterhält und beendet. Downing (2009) erweitert die Bedeutung um einen dynamischen Aspekt, nämlich den der Fehlerkorrektur (»match-mismatch-repair-cycles« in Anlehnung an Tronick, 2007; vgl. auch Favez, Scaiola, Tissot, Darwiche, & Frascolo, 2011). Es bleibt zu klären, ob dieser Aspekt nicht dem der »Passung« zuzurechnen ist, da diese die Wiederherstellung gelingender Kommunikation nach einem »Miss-Verstehen« impliziert.
Kontakt
4. Die Kategorie der »Entwicklungsadäquanz« (Kastner-Koller & Deimann, 2009) zielt auf die Einschätzung, inwieweit die Interaktion quantitativ für das Kind eine Unter- oder eine Überforderung bedeutet und ob sie qualitativ dem kindlichen Entwicklungsstand adäquat gestaltet wurde.
Entwicklungsadäquanz
5. Bindungsqualität: Diese Kategorie scheint in der Fachliteratur nicht vollständig ausdefiniert zu sein, weil in der Regel unklar bleibt, ob beobachtbares kindliches Bindungsverhalten beschrieben wird (was ja eher der Perspektive des Kindes zuzurechnen wäre) oder ob es sich tatsächlich um eine neue bidirektionale Gesamtqualität handelt, wofür die Autorinnen und Autoren auf die klassischen Bindungsmusterbegriffe bzw. die dazu passenden elterlichen Verhaltensweisen zurückgreifen.
Bindungsqualität
6. »Joint attention« (auch »geteilte Aufmerksamkeit«) »wird als Anzeichen einer triadischen Interaktion gewertet, weil Mutter, Kind und Objekt beteiligt sind, auf das beide fokussieren. […] Baron-Cohen […] interpretiert dies als einen Hinweis auf ein erstes Verständnis mentaler Zustände. Das Kind verstehe, dass die Mutter seine Aufmerksamkeit auf ein bestimmtes Objekt hinlenken möchte. Im umgekehrten Fall möchte das Kind die Mutter dazu bringen, dasselbe zu sehen wie es selbst, um ihre Aufmerksamkeit mit ihm zu teilen« (Bischof-Köhler, 2011, S. 248; vgl. auch Pauen, Frey & Ganser, 2012, S. 31; Siposova & Carpenter, 2019).
Joint attention
Diese Kategorien bilden – bis auf die der Entwicklungsadäquanz, die wohl eher der Elternperspektive zuzurechnen ist – eine erste Anregung zur weiteren Erforschung und fundierten Beschreibung der Eltern-Kind-Beziehung, wurden jedoch bisher wissenschaftlich noch nicht so weitgehend operationalisiert, dass eindeutige Beobachtungsindikatoren ableitbar sind.
1.1.3.3 »Beziehung« als »Gesamtindex«
Care-Index
Mit dem CARE-Index geht Patricia Crittenden (2005) schließlich einen dritten Weg, indem sie eine Art Gesamtindex aus verschiedenen Teilurteilen bestimmen lässt. Die entsprechenden Bewertungsvarianten der Beziehung lauten in diesem Fall: »sensitiv«, »adäquat«, »unbeholfen« oder »gefährdet«. Diese Beurteilungen scheinen deutlich aus der Perspektive der Eltern und mit dem Fluchtpunkt der kindlichen Entwicklung(-sgefährdung) formuliert zu sein (Kap. 4.1).
Es scheint plausibel, will man die Beziehung als Entität beurteilen, ein Beurteilungsziel wie die »Förderung bzw. Behinderung dieser oder jener entwicklungspsychologischen Kategorie des Kindes« zu implementieren. Aus pragmatischer Sicht verweist ein solches Vorgehen deutlich auf die Auswahl von Interventionszielen und -methoden. Allerdings stellt sich dann auch die Frage, ob es überhaupt noch einer holistischen Beziehungseinschätzung bedarf oder ob diese Einschätzung in die Beurteilung des Elternteils mit aufgenommen werden kann.
1.1.4 Perspektive »Elternbeziehung«
In zahlreichen Veröffentlichungen werden »elterliche Erziehungspartnerschaft«, »Eltern-Allianz« oder »Co-Parenting« als Beziehungstypus beschrieben (z. B. Gabriel & Bodemann 2006, Asendorpf, Banse & Neyer, 2017; Teubert, 2011). Allerdings findet sich einzig im Lausanner Trilogspiel (Fivaz-Depeursinge & Corboz-Warnery, 1999; Schwinn & Borchardt, 2012; Schröck & Eickhorst, 2019) eine ausgefeilte Dramaturgie zur Durchführung und zur Beschreibung der elterlichen Interaktion in triadischen Kontexten. Zur Beurteilung gelangen bei diesem Vorgehen die folgenden Kriterien, die in den Kap. 4.1 und Kap. 7.4 noch ausführlicher vorgestellt werden:
1. gegenseitige Unterstützung und Kooperation, Co-Parenting
2. Konflikte und Interferenzen
3. kommunikative Fehler und ihre Reparatur, Dynamik der Interaktion in Bezug auf den Elternpartner
1.2 Formale Operationalisierung
Bisher sind inhaltliche Kategorien für die Eltern-Kind-Interaktion herausgearbeitet worden. Für deren formale Operationalisierung empfiehlt es sich nun, jede Kategorie möglichst in gleicher Art zu differenzieren. Ein aus Sicht des Autors geeigneter Vorschlag stammt von Patry und Perrez (2003), die vier Bewertungsaspekte unterscheiden:
1. Quantität: Ist das Beobachtete zu viel (Exzess) oder zu wenig (Defizit) ausgeprägt?
2. Modus: In welcher Art und Weise wird operiert (z. B. körperlich, verbal, mimisch)?
3. Angemessenheit: Ist das Handeln in Bezug auf das Ziel (z. B. altersentsprechende Beruhigung des Kindes) angemessen?
4. Kontinuität: Tritt das beobachtbare Verhalten kontinuierlich auf (i. S. von verlässlich bzw. ausrechenbar für das Kind) oder diskontinuierlich?
Diese Bewertungsaspekte eignen sich nunmehr, um aus den inhaltlich-funktionalen Kategorien beobachtbare Indikatoren zu operationalisieren.
Wie bereits mehrfach erwähnt, sind nicht immer eindeutige Zuordnungsregeln bestimmbar; entweder weil das gleiche Verhalten verschiedenen Zwecken dient oder aber weil Verhalten selbst mehrdeutig ist. Die bisher am häufigsten benannten oder die am plausibelsten gelisteten Indikatoren in den jeweiligen Perspektiven werden ausschnittsweise in der folgenden Übersicht zusammengetragen. Allerdings lassen sich Überschneidungen mit den zuvor aufgeführten funktionalen Kategorien nicht vollständig vermeiden.
1.3 Beispiele für Indikatoren zur Beschreibung der Eltern-Kind-Interaktion
1.3.1 Perspektive des Kindes
Die folgenden Indikatoren helfen, die beim Kind zu beobachtenden Verhaltensmerkmale zu erfassen:
• Vitalität: Aktivierung und Wachheit
• Augenkontakt: Vermeidung, Aufrechterhaltung, Beendigung
• Körpergestik (speziell soziale Gesten): Vermeidung, Aufrechterhaltung, Beendigung, Zielorientierung
• Lautsignale (verbal, paraverbal)
• Spiel: Initiative, Aufrechterhaltung, Beendigung, Spielarten
• Ausrichtung der Aufmerksamkeit
• Reaktivität (Folgeverhalten)
• Initiative
• Verhalten bei Übergängen
• Affektausdruck (mimisch/gestisch/vokalisierend/dynamisch…) in Bezug auf: Teilnahme, Interesse, Ärger, Traurigkeit, Ängstlichkeit, Unsicherheit, Irritation, Aufmerksamkeit, Zufriedenheit, Freude, Ekel, Scham usw.
• Affektsharing (Spiegelung und Abstimmung)
• Affektregulation
1.3.2 Perspektive des Elternteils
Indikatoren, die vorwiegend das elterliche Verhalten in Bezug auf das Kind markieren, enthält die folgende Aufzählung:
• Rahmung: Zeit- und Lagestrukturgebung
• Affektausdruck (mimisch/gestisch/vokalisierend/dynamisch/etc.) in Bezug auf: Teilnahme, Interesse, Ärger, Traurigkeit, Ängstlichkeit, Unsicherheit, Irritation, Aufmerksamkeit, Zufriedenheit, Freude, Ekel, Scham usw.
• Wärme: Zärtlichkeit in Körperkontakt, Berührung und Körperposition
• Lautäußerungen: Satzbau, Lautstärke, Tonhöhe, Tempo und Kontingenz der Äußerungen
• (verbale) Instruktion: Verständlichkeit, Wiederholung
• Verbale Restriktion: Häufigkeit und Ausprägung von negativen Äußerungen in Inhalt und Tonfall
• verbale Ermunterung: Häufigkeit und Ausprägung von positiven, ermunternden Äußerungen in Inhalt und Tonfall
• Authentizität: Passung von Verhalten (alle sichtbaren Äußerungen) und Erleben in Ton, Mimik, Sprache, Gestik
• Variabilität: Abwechslungsreichtum elterlichen Handelns zur Lenkung der Aufmerksamkeit/Aktivität des Kindes
• Sensitivität auf kindliche Signale (die Belastung indizieren bzw. Zeichen von negativem oder positivem Erleben sind)
• Reaktivität: Kontingenz des Verhaltens
• Validierung des eigenen Verhaltens (Rückbindung und -reflexion) und Selbstkorrektur (bei Fehlern)
• Stimulation: Ausmaß, Intensität und Häufigkeit
• Sprechinhalt: Vorhandensein von Aufforderung, Rufen, Fragen, Feststellungen
• Spiele: Vorhandensein von Imitation, Vormachen, Präsentieren, Berührungs- und Bewegungsspiele, idiosynkratrische Spiele
• Regulationsverhalten bei Übergängen (Instruktion, Abstimmung)
1.3.3 Perspektive der Eltern-Kind-Beziehung
(nach Ludwig-Körner et al., 2006) SoftReturn
Die nun folgenden Indikatoren markieren die gesamte Eltern-Kind-Interaktion:
• Qualität der Grundmelodie bzw. Tonart: Tonalität/Atonalität, Balance, Harmonie/Disharmonie, Kongruenz/Dyskongruenz, Synchronizität/Dyssynchronizität
• Grundrhythmus: Tempo (Allegro oder Adagio), »Speed«, Frequenz der Signalemission
• Lautstärke: Wie laut und kräftig sind die Äußerungen? (Pianissimo bis Fortissimo), Temperament, Stärke, Kraft, Energielevel beider Dialogbeteiligten
1.3.4 Perspektive der elterlichen Beziehung
(wenn beobachtbar) (nach Favez, Scaiola, Tissot, Darwiche, & Frascolo, 2011) SoftReturn
Schließlich sind noch die Indikatoren aufzuführen, die das elterliche Verhalten zueinander, also zwischen den Eltern, erfassen:
• gegenseitige Unterstützung und Kooperation, Co-Parenting
• Konflikte und Interferenzen
• kommunikative Fehler und ihre Reparatur, Dynamik der gegenseitigen Interaktion
Es bleibt nun zukünftiger Forschung überlassen, Indikatoren zu definieren, zu systematisieren, zu gewichten sowie – wenn möglich – deren Verknüpfungsregeln mit den funktional-inhaltlichen Kategorien, Dimensionen oder Bereichen in ihren jeweils spezifischen formal-operativen Ausprägungen (z. B. orientiert an Patry & Perrez, 2003) zu explizieren. Wie bereits erwähnt, soll jedoch am Ende des Kap. 4 und in vollständiger Weise in Anlage 1 eine Synopse auf Basis der untersuchten Instrumente und der bisher diskutierten Kategorien und Indikatoren vorgestellt werden, die zu Forschungs- oder Anwendungszwecken weiter genutzt werden könnte.
1.4 Schlussfolgerungen für die Beurteilung von Instrumenten zur Beobachtung der Eltern-Kind-Interaktion
Es bleibt zunächst festzuhalten, dass interaktionsdiagnostische Instrumente
• erkennen lassen sollten, welchem theoretischen Konzept von »Beziehung« bzw. »Interaktion« sie folgen und welche abgeleiteten Kategorien, Dimensionen oder Bereiche insbesondere in Bezug zu deren funktionaler Bedeutung sich aus diesem Konzept ergeben;
• unterscheiden sollten zwischen beobachtetem Verhalten und Schlussprozessen auf Interaktionsmuster sowie Repräsentationen, Einstellungen und Motive;
• die Verknüpfungsregeln zur (Interaktions-)Musterbildung und zum Folgern auf interne Konzepte explizieren sollten;
• die Herstellung von Passung nach Erfahrungen nicht gelingender Abstimmung oder aber deren Aufrechterhaltung erfassen sollten, um damit dem dynamischen Moment von Beziehungen gerecht zu werden;
• möglichst in allen vier, mindestens jedoch in den drei Perspektiven »Kind«, »Elternteil«, »Eltern-Kind-Beziehung«, Bewertungen ermöglichen und schließlich
• hinsichtlich der formalen Differenzierung in den Indikatoren und Kategorien stimmig sein sollten.
Zum Abschluss dieses Kapitels soll auf ein bisher noch nicht diskutiertes Problem aufmerksam gemacht werden.
Interpersonale Dimension von Störungen
Bei einer systematischen Durchsicht von Störungsdefinitionen im Kindes- und Jugendalter fällt auf, dass sich erstaunlich wenige Kriterien auf die interpersonale Dimension der Störung beziehen. In Kap. 7.3.3. wird dies anhand von drei ausgewählten Beispielen belegt. Mit Ausnahme der Störungen des autistischen Spektrums, für die als einzige dysfunktionales Kommunikationsverhalten als Kardinalsymptom definiert wird, weist keine andere Störung eine systematische Betrachtung interpersonaler Aspekte auf. Diese Feststellung ist umso erstaunlicher, da doch der interpersonalen Frage bei vielen Störungsbildern hinsichtlich ihrer pathogenen Bedeutung und in Bezug auf die therapeutische Intervention eine zentrale Rolle eingeräumt wird. Weshalb dann darauf verzichtet wird, die sich aus der interpersonalen Relevanz ergebenden Implikationen erstens zur Beschreibung von diagnostischen Kriterien und zweitens zu deren Operationalisierung für den diagnostischen Prozess zu verwenden, lässt sich logisch nicht erklären. Stattdessen wird auf wissenschaftlich viel weichere Indikatoren wie das subjektive Erleben der Diagnostikerin/des Diagnostikers oder der Therapeutin/des Therapeuten (z. B. bei der Analyse von Übertragungs- und Gegenübertragungsprozessen) verwiesen.
Es bleibt zu hoffen, dass künftige Störungs- und Interventionsklassifikationen die interpersonale und damit auch interaktionelle Dimension in das Untersuchungsgeschehen systematisch und theoretisch begründet einbeziehen, was bei den so überarbeiteten Verfahren dann eine wesentlich verbesserte ökologische Validität, eine höhere Reliabilität sowie nicht zuletzt eine fachlich fundiertere und personalisiertere Indikationsempfehlung zur Folge hätte.
4 Die Plausibilität wurde jedoch bisher so gut wie nie beforscht. Eine interessante Ausnahme stellt die Untersuchung von Jörg et al., 1994 zur Blickvermeidung des Säuglings und dessen entwicklungspsychologische Relevanz dar.
5 Der Begriff der »Kategorien«, wird verwendet, um die inhaltliche Abgrenzung eines Aspektes oder Themas zu betonen, wohl wissend, dass dies bei vielen Aspekten oder Themen auch »dimensional« dargestellt werden kann. Später werden diese Begriffe durch den der »Facette« ersetzt.
2 Methodik der Verhaltensbeobachtung
Unter wissenschaftlicher Beobachtung