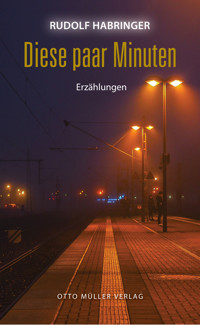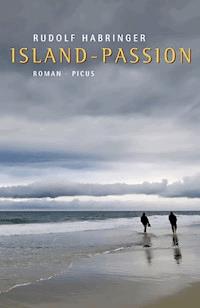
17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Picus Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Anlässlich des legendären Finales der Schach-Weltmeisterschaft zwischen Boris Spasski und Bobby Fischer gerät der junge Österreicher Richard Behrend 1972 zum ersten Mal nach Island. Durch Zufall stößt er dort auf die Spuren des Musikers Karl Wallek, der 1938 mit seiner Familie aus Graz fliehen musste und in Island nicht nur ein Zuhause, sondern auch berufliche Anerkennung fand. Walleks Geschichte lässt Behrend von da an nicht mehr los, und er begibt sich auf Spurensuche in Island und Österreich. Dabei trifft er auf irritierende Zusammenhänge und verdrängte Gefühle und erlebt, wie das Schicksal des Exilanten Wallek - eine Geschichte der Flucht, der Einsamkeit und des Neuanfangs - zum Spiegel seines eigenen Lebens wird, denn auch er wird schließlich Bekanntes hinter sich lassen und auf der Insel im Atlantik einen neuen Beginn wagen. Rudolf Habringer erzählt in seinem großen Entwicklungsroman nicht nur von leidenschaftlichen Gefühlen und ihren möglichen Auswirkungen auf das Leben eines jungen Menschen, sondern auch von nicht bewältigter Vergangenheit, deren Konsequenzen bis in die Gegenwart reichen. Eindringlich und sensibel zeichnet er den Lebensweg eines "angry young man" nach, der im Laufe der Jahre immer mehr zu sich selbst findet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 498
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Rudolf Habringer Island-Passion
Copyright © 2011 Picus Verlag Ges.m.b.H., Wien Alle Rechte vorbehalten Grafische Gestaltung: Dorothea Löcker, Wien Umschlagabbildung: © Schapowalow/Zoellner Datenkonvertierung E-Book: Nakadake, Wien ISBN 978-3-7117-5069-3 Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt
Informationen über das aktuelle Programm des Picus Verlags und Veranstaltungen unterwww.picus.at
RUDOLF HABRINGER
ISLAND-PASSION
ROMAN
PICUS VERLAG WIEN
How does it feel How does it feel To be without a home Like a complete unknown Like a rolling stone?
Bob Dylan
Sie gingen Hand in Hand wie Kinder.
Halldór Laxness
Prolog
Irgendwo in Deutschland, 1973
Lange nach Mitternacht: eine Raststätte an der Autobahn in einer kühlen Nacht im März. Nebelschwaden hingen über der Tankstelle, eine Kulisse, in fahles, gelbes Licht getaucht. Auf dem Parkplatz: ein paar Lkws mit zugezogenen Vorhängen, überquellende Abfallkörbe, die Picknicktische verwaist. Der Boden war feucht, Tau überzog die Zapfsäulen. Nach dem Tanken ging er in den Kiosk, kaufte Flaschenbier und begab sich zur Kasse. In einem Ständer steckten bereits die Tageszeitungen des nächsten Tages. Im Fenster klebte ein Fahndungsplakat der RAF: Dringend gesuchte Terroristen! 800.000 DM Belohnung. Einige Fahndungsbilder waren mit schwarzem Filzstift durchgestrichen worden. Die Gesichter waren ihm bekannt.
Er war der einzige Kunde im Tankstellenshop. Hinter dem Tresen hockte eine dicke Frau, ungefähr in seinem Alter. Sie trug ein T-Shirt, ihr Büstenhalter war verrutscht, ihr Haar war ungewaschen, ihr Gesicht glänzte fettig. Vor ihr eine leere Tasse, in der sich ein Rand abzeichnete, und ein Aschenbecher voller Zigarettenkippen. Aus kleinen Augen schaute sie ihn müde und desinteressiert an. Sie wirkte, als wäre sie eingenickt gewesen. Die Dicke nannte den Betrag, er zahlte und verließ den Kiosk.
Es hatte zu regnen begonnen. Sie standen zu zweit unter dem Dach der Tankstelle, rauchten und tranken Bier. Das Regengeräusch mischte sich mit dem sirrender Reifen vorbeifahrender Lkws, die flackernde Lichtkaskaden über das Gelände warfen. Erst jetzt merkte er am Geschmack der Zigarette, dass ihm der andere einen Joint gedreht hatte. Er sah den Kollegen an, hob fragend die Augenbrauen. Nichts für ungut, sagte der. Hält dich wach. Dann sprachen sie nicht mehr, sie waren müde, trugen nach Stunden noch immer die beruhigenden Mantras des Klavierspiels von Keith Jarrett in ihren Köpfen. Auf der Rückbank im VW-Bus schliefen die Mitfahrenden. Niemand war durch den Stopp wach geworden. Durch die Fensterscheibe betrachtete er eines der Mädchen, das den Kopf an die Schulter ihrer Freundin gelehnt hatte. Es schlief mit geöffnetem Mund, die Haare verdeckten die Augen, unter dem Kleid waren die Konturen der kleinen Brüste erkennbar: Ein Anblick, der in ihm noch immer das Begehren hervorrief, die junge Frau, die seine Geliebte gewesen war, in den Arm zu nehmen und zu küssen, ein Begehren, das er in der Zwischenzeit zu unterdrücken gelernt hatte.
Sie rauchten ihre Kippen aus, zwei glühende Pünktchen in der Dunkelheit. Sie froren, weil sie ihre Jacken im Wagen gelassen hatten. Er klopfte seine Schuhe an die Kante des Bordsteins, als ob er sich damit wärmen könnte. Dann hatten sie ausgetrunken. Er brachte die Bierflaschen zurück in den Kiosk, die Dicke hinter dem Tresen deutete wortlos auf eine Kiste, in die er die Flaschen zurückstellte. Er hatte das Gefühl, dass sie ihm misstrauisch nachstarrte. Später dachte er immer wieder daran, dass die Dicke an der Tankstellenkasse die letzte Zeugin gewesen war, bevor es geschehen war. Bevor hieß: als alles noch in Ordnung war. Irgendwie. Halbwegs. Im Lot. Er wusste, dass die Worte für den Zustand davor nicht stimmten. Es gab keine Worte dafür.
Sie gingen zum Bus zurück, der hinter den Zapfsäulen stand.
Wie spät ist es?
Er sah auf die Uhr.
Kurz vor halb drei.
Bist du fit?
Sicher. Jetzt fahre ich. War so abgemacht.
Dann hau ich mich aufs Ohr.
Mach das.
Sie stiegen ein. Sie hatten die Plätze gewechselt. Jetzt saß er am Steuer. Der am Platz neben ihm machte es sich zum Schlafen bequem. Sie fuhren los. Die Lichter der Tankstelle verschwanden im Rückspiegel.
Österreich, 1964
Sie saßen einander seit mehr als einer Stunde gegenüber. Zwei Dreizehnjährige, schweigend über ein Schachbrett gebeugt. Da entdeckte Richard Behrend die rettende Kombination. Sein Herzschlag beschleunigte sich, sein Puls hämmerte laut an den Schläfen, er zwang sich, seine Aufregung, seine plötzliche Gier, durch keine hektische Bewegung, kein heftiges Atmen zu verraten. Er spürte, wie in ihm augenblicklich der Wunsch entflammte, seinen Gegner in die Ecke zu drängen und vollständig zu schlagen. Auszulöschen. Zu vernichten. Es gelang ihm, sich zu sammeln, zu beruhigen. Schweiß stand auf seiner Stirn, nass und kalt fühlten sich seine Hände an. Er saß da, spannte die Muskeln, rührte sich nicht und hob den Blick nicht vom Brett. Ruhig bleiben, ruhig atmen. Von außen mochte er kaltblütig und konzentriert wirken. Ein paar Züge später brachte er, geschützt durch den König, seinen Bauern zur Dame. Zollner hatte gar keine andere Möglichkeit, als die eben ins Spiel gekommene Dame mit seinem ihm verbliebenen Turm zu schlagen. Das Spiel hatte die entscheidende Phase erreicht. Richard atmete tief durch, Zollners Turm wurde sofort Beute seines weißen Königs. Gerhard Zollner hielt den Kopf in beide Hände gestützt und sah nicht auf, sie hatten einander seit Beginn der Partie kein einziges Mal in die Augen gesehen. Auf der H-Linie standen sich zwei Bauern reglos gegenüber. Sie würden nicht mehr ins Spiel eingreifen. Zollners schwarzer König war jetzt Behrends König und Turm schutzlos ausgeliefert, eine eindeutige Gewinnsituation, die Präfekt Wagner, der ihnen Schachunterricht erteilte, oft mit ihnen geübt hatte.
Im Saal war es lauter geworden, Wagner zischte in den Raum, um Ruhe zu schaffen. Richard nahm wahr, dass ihre Partie die letzte war, die noch gespielt wurde. Um ihren Tisch hatte sich eine Traube von Mitschülern gebildet, die das Spiel aufmerksam beobachteten. Zwei aus seiner Mannschaft stießen sich aufmunternd in die Rippen. Behrend sah auf: Präfekt Wagner nickte ihm wohlwollend zu. Sein Blick fiel auf die Uhr, er sah, dass ihm weniger als eine Minute Zeit verblieb, ehe die Klappe fallen würde. Zollner hatte nach dem vernichtenden Schlag gegen seinen Turm keine andere Wahl mehr, als mit dem König die Flucht zu ergreifen.
Wichtig war jetzt, ruhig zu bleiben und dennoch rasch zu handeln. Richard merkte, wie seine Knie leicht zu zittern begannen. Die Aufmerksamkeit seiner Mannschaftskameraden war ganz auf ihn und den Ausgang seiner Partie gerichtet. Die anderen lagen einen halben Punkt vorne, nur wenn Richard gewann, konnte er den Sieg für seine Mannschaft sicherstellen. Behrend hörte sich gleichsam auf sich selbst einsprechen. Keine Zeit verlieren! In die Ecke mit ihm! Sie waren Kinder, eine Partie wurde so lange gespielt, bis sie tatsächlich zu Ende war. Zunächst schnitt Richard mit seinem Turm Gerhards König den möglichen Zugang zum verbleibenden Bauern ab. Zollner blieb nur der Rückzug. Abwechselnd mit König und Turm hetzte Richard den Gegner in die Ecke, ohne jede äußere Reaktion zog Zollner seinen König, hastig führten sie ihre Züge aus, die Sekunden verrannen. Richard nahm überdeutlich Geräusche wahr, die er in der Konzentration während der Partie ausgeblendet gehabt hatte, er hörte ein Rufen am Gang, das Plätschern der Wasserleitung, weil sich jemand die Hände wusch, das Klappern von Pantoffeln auf dem ausgetretenen Holzboden. Einer der Umstehenden zog eine Armbanduhr mit einem schnarrenden Laut auf, jemand lachte leise. Ein unterdrücktes Hüsteln, verstohlenes Flüstern. Zollners König floh in die Ecke seines Verderbens, unerbittlich setzte Richard nach.
Plötzlich gab es eine jähe Unterbrechung der gespannten Konzentration am Tisch. Gerhard Zollner blickte auf und schaute Behrend mit hochgezogenen Brauen an. Erst beinahe entsetzt, dann verblüfft, dann freudig überrascht. Die Energie, die sich zwischen ihnen aufgebaut hatte, verpuffte mit einem Schlag. Dann grinste Gerhard breit: Remis, sagte er mit Triumph in der Stimme und streckte Richard die Hand über das Brett entgegen. Ein Aufschrei der Enttäuschung ging durch den Saal, Präfekt Wagner griff sich entsetzt an den Kopf.
Behrend hatte noch nicht begriffen und schaute hinunter aufs Brett, um die Stellung zu analysieren. Irgendetwas hatte er mit seinem Turm falsch gemacht. In einem Moment der Unaufmerksamkeit hatte er nicht bemerkt, dass er dem schwarzen König weder Schach geboten noch eine Möglichkeit gegeben hatte, sich auch nur um ein Feld zu bewegen. Richard fühlte, wie ihm die Schamesröte ins Gesicht stieg. Er hatte den greifbaren Sieg in letzter Sekunde verspielt. Die Menschentraube um ihn herum: eine feindliche Mauer. Dann standen Gerhard und er auf. Erst jetzt gab er seinem Gegner die Hand. Sie fühlte sich kalt an, wie ein Stück vereistes Fleisch. Gerhard zog die Lippen schmal und zuckte mit den Schultern, sagte beinahe entschuldigend: Glück gehabt. Dann drehte er um, ging zu den Seinen und ließ sich feiern. Richard blieb wie betäubt an seinem Platz stehen. Später nahm er die Figuren vom Brett, klappte das Spiel zusammen und begann einzuräumen. Jemand klopfte ihm auf die Schulter: Nur ein Spiel, sagte eine dumme Stimme, die nichts begriff. Behrend spürte, wie Tränen drängten. Weinen durfte er nicht. Er verbiss sich den Schmerz.
Zwei Tage später begannen die Weihnachtsferien.
Garður, Island, 2004
Er zieht den Bademantel an, schlüpft mit nackten Füßen in die Sandalen und schlurft zur Toilette. Bjargey ist mit Anna lange vor ihm aufgestanden, er hört sie in der Küche hantieren. Das Klofenster ist einen Spalt geöffnet, es ist kalt, der Wind faucht gegen die Scheibe, Behrend sieht, wie sich draußen auf der Weide das hohe Gras unter den Böen bewegt, die Brise kommt vom Meer. Er verriegelt das Fenster.
Später geht er fertig angezogen in die Küche, Bjargey sitzt am Tisch und füttert Anna mit Obstbrei, glucksend weicht die Kleine der Mutter aus, die ihr den Löffel in den Mund stecken möchte. Eine Zeit lang schaut Richard ihnen zu, bis Bjargey den Kopf wendet, sie hat ihn nicht kommen hören. Mit einem röchelnden Laut rinnt Wasser durch die Kaffeemaschine, langsam füllt sich die Kanne, Bjargey hat das Licht nicht angemacht, draußen ist ein fahles, ungefähres Grau, der Tag hat sich noch nicht entschieden.
Er berührt Bjargey an der Schulter und streicht mit den Fingern über ihren Nacken. Bjargey lehnt sich an ihn, er steht genau hinter ihr und dem Kind. Anna hat den Löffel selbst in die Hand genommen und panscht im Brei herum. Du vergisst die Stunde heute nicht, sagt Bjargey. Ein Fax aus Frankreich sei früh am Morgen angekommen, von einem Ornithologen, das Fax liege im Büro auf dem Schreibtisch. Behrend beugt sich über seine Tochter, küsst sie auf die Stirn und fährt ihr mit der Hand durch die blonden Locken. Er macht Licht und gießt Kaffee in die Schalen. Tanken fahren musste jemand und einkaufen. Jetzt sieht er Bjargeys Liste, einen handgeschriebenen Zettel, auf dem Tisch liegen. Ich fahre nach Keflavík, sagt Bjargey, sieh nach, was fehlt, sagt sie und schiebt ihm den Zettel hin. Behrend fällt ein, dass er für die Probe am Abend üben sollte. Haraldur hat gesagt, wenn Zeit bliebe, würde er mit der Chormotette beginnen. Es gab da ein paar Takte Solo für die Orgel, die einem geübten Musiker leicht fielen, er würde, nachdem er so lange nicht gespielt hatte, die Stelle üben müssen, um den Chor nicht unnötig aufzuhalten. Bjargey wird Anna bei ihm lassen, in spätestens einer Stunde wird sie zurück sein. Wenn Anna genug gegessen hat, wird sie bald wieder einschlafen.
Behrend geht ins Büro, um im Kalender nachzusehen, wann er die Nachhilfestunde mit Diddas Sohn eingetragen hat, und entdeckt das Fax auf dem Schreibtisch. Es ist aus Lyon, auf Englisch geschrieben, der Ornithologe will das Appartement in Arnastapi für eine Woche mieten, er bittet ausdrücklich um das kleinste, so wie auf der Website beschrieben, und um eine rasche Antwort.
Behrend entscheidet, dass er das am Nachmittag erledigen wird. Vielleicht sollte er sich gleich jetzt, während Anna schläft, an das Keyboard setzen und die Partitur durchspielen. Behrend verspürt Lust dazu, mit Musik zu beginnen, so geht er gern in den Tag.
Bjargey hat Anna in ihr Gitterbettchen ins Schlafzimmer gelegt. Die Kleine trägt einen Pyjama, den sie bei einem Bummel in Kringlan gekauft haben, auf ihrer Brust prangt ein kleiner Bär. Bjargey kommt noch einmal von draußen herein, sie war beim Postkasten, doch der Briefträger war noch nicht da, sie legt das Fréttablaðið auf den Tisch. Im Vorraum schlüpft sie in Jacke und Stiefel. Den weißen Strickschal trägt sie außen, sie setzt ihre Wollmütze auf. Behrend steht an der Tür, Bjargey eilt zum Auto, sie hält sich wegen des Windes die Mütze an den Kopf. Sie sitzt im Auto, wendet, noch einmal dreht sie sich nach ihm um und winkt, dann fährt sie ab. Ein kalter Luftschwall stürzt ins Haus. Vorsichtig, um keinen Lärm zu machen, schließt Behrend die Tür.
Behrend überfliegt die Titelseite des Fréttablaðið, die Schlagzeilen, den Wetterbericht. In der Nähe von Grindavík hat sich ein Verkehrsunfall mit mehreren Schwerverletzten ereignet, Jugendliche auf dem Weg zu einer Diskothek. Solche Meldungen häufen sich in letzter Zeit, Bürger schreiben besorgte Leserbriefe. Keine bekannten Gesichter bei den Nachrufen.
Später ist Behrend in der Küche damit beschäftigt, Rotkraut zu schneiden. Zwischendurch schaut er nach Anna, die mit geschlossenen Augen im Bett liegt. Vorsichtig streicht er ihr über die Wange, das Mädchen reagiert nicht, es schläft, den Kopf leicht zur Seite geneigt. Durch das Fenster bemerkt Richard Ólafur mit der Post, der sich verspätet hat. Erst knapp vor zwölf hält der gelbe Wagen draußen an der Dorfstraße bei den am Zufahrtsweg aufgestellten Boxen. Als Behrend zum Postkasten kommt, ist der Briefträger bereits beim Haus am Útskálasíki, beim Teich an der Kirche. Zwischen Rechnungen und den Werbeprospekten findet sich ein Brief der Universität aus Reykjavík, von der Abteilung für Musikwissenschaft. Ungewöhnliche Post. Behrend kennt den Dozenten namentlich, hat ihn irgendwann einmal bei einem Vortrag gehört, persönlich sind sie einander nicht bekannt. Er geht zur Anrichte, um ein Messer zu holen, er schneidet das Kuvert auf, die Adresse ist mit der Hand geschrieben. Im Kuvert liegt ein weiteres Kuvert, verschlossen, und ein kurzer Brief der Uni, unterzeichnet von einer Sekretärin. Die Uni hat das geschlossene Kuvert bloß an ihn weitergeleitet. Auf dem Absender steht eine Adresse aus Österreich. Behrend öffnet den Brief.
Plötzlich schlägt sein Herz, das ruhig und ausgeglichen in den Tag gegangen ist, schneller. Ein paar Worte auf dem Papier, ein Name, ein paar Buchstaben, hingeschrieben Tausende von Kilometern weit entfernt, genügen, um ihn in Aufregung zu versetzen. Eine Art heimatlicher Muskel erwacht. Sehr selten, dass er noch Post von zu Hause bekommt, Jahrzehnte haben dazu beigetragen, dass die Erinnerungen allmählich abklangen, wie ein Ton, der unendlich langsam verhallt, schließlich in Schweigen, in Stille übergeht. Jetzt erfasst ihn eine Welle aus Neugier und Angst. Pochend melden die Schläfen Alarm.
Er wird gesucht. Jemand erkundigt sich nach ihm und bittet die Uni um Vermittlung. Der Verfasser des Briefes ist Student der Musikwissenschaft, ein gewisser Michael Bruckner aus Wien. Das Schreiben ist kurz und förmlich gefasst. Bruckner arbeite an einem Forschungsprojekt und recherchiere in diesem Zusammenhang über den Musiker Karl Wallek. Dabei sei er auf seinen, Behrends, Namen gestoßen. Gemeinsam mit einer Delegation der Uni Wien werde er in Kürze – das Datum ist angeführt – zu einer Studienreise nach Island kommen, um ein Symposium über emigrierte Musiker vorzubereiten. Er bitte um eine Kontaktaufnahme. Es gebe da eine Menge Fragen.
Behrend hat den Brief abgelegt, er sitzt in der Küche, der Kühlschrank knackt und schaltet sich ein, draußen auf der Straße fährt ein Auto vorbei. Auf dem Tisch steht die Medizin zum Gurgeln, Bjargey hat nicht gesagt, dass sie wieder Halsschmerzen hat. Bewegungslos sitzt Behrend da, ein paar Minuten vergehen in völliger Stille, da tickt auch keine Uhr, nichts. Nur ein nicht genau definierbares Brummen hängt in der Luft. Behrend geht in sein Büro und öffnet den Schrank neben dem Schreibtisch, in dem die Aktenordner und Mappen seiner täglichen Geschäfte lagern. Er findet nicht, was er sucht. Dann begibt er sich ins Schlafzimmer. Anna muss ihn gehört haben. Sie verzieht leicht schmatzend die Mundpartie, dreht sich um und schläft weiter. Auf der Truhe neben seinem Bett liegt Kleidung, die Hose, die er gestern getragen hat, ein Hemd, das nach Schweiß riecht und längst gewaschen gehört, schmutzige Unterwäsche. In der Truhe stapeln sich Handtücher, Bettwäsche, Kleinkram, der beim Aufräumen einmal hier gelandet ist, Teelichter, Streichhölzer, Heftpflaster, alte, unbrauchbar gewordene Buntstifte. Da liegt auch der Schlüssel mit dem blauen Bändchen daran. Er braucht ihn vielleicht ein-, zweimal im Jahr. Ein Brief verändert den Tag. Behrend beschließt, am Nachmittag, noch vor der Nachhilfestunde für Diddas Sohn, zum Kellerdepot beim Turm zu gehen.
Draußen hat es zu regnen begonnen, der Wind wuchtet kleine Tropfen gegen die Scheiben. Behrend sitzt am Küchentisch, er hat das Licht wieder ausgeknipst. Der Schlüssel liegt neben dem Frühstücksgeschirr, das noch nicht abgeräumt ist. Auf Rás 1 läuft klassische Musik, das Adagio for Strings von Samuel Barber. Dann schaut er wieder nach der Kleinen. Anna ruckelt im Schlaf hin und her. Her und hin. Und hin und her. So vergeht die Zeit.
Am Ortsende des isländischen Dorfes Garður, in Garðskagi, dort, wo an der Nordseite der Halbinsel Reykjanes eine winzige Landzunge in den Atlantik leckt, stehen zwei Leuchttürme, ein alter aus dem Jahr 1897, daneben ein neuer, der schon lange automatisch betrieben wird. Einmal die Woche kommt Askur, der eigentlich als Mädchen für alles an der Schule beschäftigt ist, um nach dem Rechten zu sehen und im Fall einer Störung Meldung nach Reykjavík zu machen. Das Leuchtturmwärterhaus ist schon jahrelang unbewohnt. Vor Jahren hat die Gemeinde im oberen Teil des Hauses ein winziges Regionalmuseum mit allerlei Kram aus Fischfang und der Anfangszeit des Turmes untergebracht. Als außergewöhnliches Schauobjekt dient eine Karte, in der die Strandungen und Schiffbrüche säuberlich registriert sind. Der Platz am Leuchtturm ist ein beliebtes Ausflugsziel, nicht nur für Touristen, die sich im Sommer an diesem abseits der bekannten Routen gelegenen Ort einfinden, sondern vor allem für Einheimische, die an den Wochenenden hierher kommen, um am Strand spazieren zu gehen und die Vögel zu beobachten. Mittsommer und zu Silvester geht es hier richtig turbulent zu, seit Jahren ist es in Garður üblich, zum Jahreswechsel, wenn das Wetter es zulässt, zum Leuchtturm zu fahren, Raketen und Böller abzuschießen und einander ein Gutes Neujahr zu wünschen. Weil das Museum längst zu klein geworden ist, hat sich die Gemeinde entschlossen, neben den Leuchttürmen ein neues Museum mit Kaffeehaus zu erbauen. Hauptattraktion sollte die wahrscheinlich größte Sammlung von Bootsmotoren auf Island und ein Laster werden, der genau fünfzig Jahre lang seinen Dienst als Schrotttrucker geleistet hatte. Sein Fahrer, Sigmundur Einarsson, hat all die Motoren gesammelt und gewartet und ist damit zu einer südisländischen Berühmtheit aufgestiegen.
Vor Jahren hat Behrend von Askur erfahren, dass es im Keller des Leuchtturmwärterhauses ein paar ungenutzte Lagerräume gibt. Das Haus, das Richard und Bjargey bewohnen, besitzt keinen Stauraum, weder Keller noch Dachboden. Askur hat ihm erlaubt, eines der Kellerabteile zu benutzen. Der Schulwart vertraut ihm und hat nicht einmal bei der Behörde um Erlaubnis dafür angesucht. Für ein paar Flaschen Wein aus dem ÁTVR in Reykjavík, wo es neuerdings sogar Veltliner aus Österreich zu kaufen gibt, händigte er Richard den Schlüssel für das Wärterhaus aus. Im Keller lagert nun, verpackt in ein paar Kisten, was sich an privatem Krempel über die Jahre bei Behrend angesammelt hat, was er nicht mehr benötigt und doch nicht übers Herz gebracht hat wegzuwerfen: Langspielplatten, alte Illustrierte, Zeitungen, die zu verwerten er sich einmal vorgenommen hat, Briefe in einer Schuhschachtel, Konzertprogramme, Mappen in zusammengebundenen Kartons, eine Schachtel mit Unterlagen, die er vor mehr als dreißig Jahren angelegt und noch bei jedem Umzug mitgeschleppt hat, darin Ordner, Hefte, Noten, schließlich die Magnetbänder: Skizzen und Aufzeichnungen über jenen Mann, dessen Namen er heute in dem Brief aus Österreich nach so vielen Jahren wieder gelesen hat: Karl Wallek.
Nach dem Mittagsschlaf bricht Behrend zur Nachmittagsrunde auf. Er will zunächst Diddas Sohn die Nachhilfestunde geben und anschließend zum Leuchtturm fahren. An der Dorfstraße kommt ihm der Toyota von Ólafur entgegen, der mit seiner Runde zu Ende ist, ansonsten ist um diese Zeit kein Mensch an der Landzunge zu entdecken. Wenige Meter über den Wellen segeln Möwen, feine Wassertropfen setzen sich in Behrends Barthaaren fest, der Wind braust in den Ohren. Er klappt die Ohrlöffel seiner Mütze herunter und stapft gegen die Brise an, es nieselt leicht, die Sonne schickt ihr Licht schräg in das Strandgras, das hellgrün und feucht aufstrahlt, das Meer rauscht und schlägt in schaumigen Wellen gegen den Strand.
Der Brief hat Behrends Tagesablauf verändert. Er ist eingerichtet gewesen auf üben, Essen kochen, Zeitung lesen, auf Mittagsschlaf, Spazierengehen und Nachhilfe geben. Als Bjargey vom Einkauf nach Hause kam, war er mit der Zubereitung des Mittagessens beschäftigt. Anna hat gerade in dem Moment aus Hunger zu weinen begonnen, als ihre Mutter in die Küche trat. Richard hat beschlossen, Bjargey vorerst nichts von dem Schreiben zu erzählen. Er weiß, dass sie ihn in Ruhe lassen wird. Selbst, wenn sie von dem Brief wüsste, würde sie nicht weiter in ihn dringen, eine Eigenschaft, die er an ihr schätzt.
Der Brief beunruhigt ihn, rührt an Gefühle und Erinnerungen, die er lange hinter sich und erledigt glaubte. Behrend fühlt sich gestellt, aufgestöbert nach so vielen Jahren. Statt den Kopf beim Gehen freizubekommen, kommt ihm alles wieder in den Sinn. Dabei liegen die Ereignisse so lange zurück, dass sie mit seinem gegenwärtigen Leben nichts mehr zu tun haben. Nichts mit Bjargey, nichts mit Anna, nichts mit seiner Beschäftigung beim lokalen Tourismusbüro, für das er als Reiseführer arbeitet. Selbst als er Bjargey, die er als Kind kennengelernt und dann aus den Augen verloren hat, als Erwachsener wieder begegnet ist, im Trubel einer warmen Augustnacht vor Beginn des Feuerwerks zum jährlichen Kulturtag in der Innenstadt von Reykjavík, lagen die Ereignisse, die der Brief aus Wien berührt, schon jahrzehntelang zurück. Bjargey weiß, dass er als Journalist zur Schachweltmeisterschaft auf die Insel gekommen ist. Das hat ihr zu seiner österreichischen Vorgeschichte immer genügt. Seine isländische Geschichte mit Þórdís*, mit der er Jón, einen gemeinsamen Sohn, hat, ist ihr wesentlich wichtiger. Weil sie dieser Teil seiner Geschichte auch selbst betrifft. Was vorher gewesen ist – Behrend nennt diese Zeit für sich seine Festlandepoche –, was in seiner Festlandepoche geschehen ist, darüber haben sie noch nie ausführlich gesprochen. Irgendwann, hat er versprochen, würden sie gemeinsam nach Österreich fahren, würde er Anna die Berge zeigen und die Hügel seiner Kindheit. Irgendwann würde sich die Gelegenheit ergeben.
Seine Festlandepoche war beinahe ausgelöscht in seinem Kopf, jetzt reißt ein Brief die Wunde neu auf. Er war geflohen, an der Küste Islands hat er sich versteckt, in einem verlassenen Winkel hinter dem Flughafen von Keflavík, dort, wo starke Winde um den Leuchtturm sirren und tückische Böen einem die Kappe vom Schädel reißen, hierhin hat er sich zurückgezogen und Zuflucht gesucht, im Haus mit Bjargey, in ihrer Nähe, bei Anna, im Hot Pot des Schwimmbads, beim Spazierengehen am Strand. Von Anfang an ist er zwar ein Fremder gewesen, die Menschen haben dieser Tatsache aber nie besondere Beachtung geschenkt. Die Leute hier sind Angestellte, Kindergärtnerinnen und pensionierte Polizisten, viele waren Fischer oder arbeiteten in der Fabrik, sie lesen im Morgunblaðið die Börsenkurse der großen Reedereien, welches Wetter vom Norden herunterzieht und ob Grindavík den großen Fußballklubs in der Hauptstadt ein Bein gestellt hat.
Einmal ist Walleks Geschichte an ihn herangetragen worden. Es ist so lange her, dass er sie fast schon wieder vergessen hat.
Wenn er nicht arbeitet, geht er mit Anna im Kinderwagen spazieren, der Leuchtturm und der Küstenstrich links und rechts des Leuchtturms prägen seine Tage. Am Vormittag der Sonne entgegen eine Strecke Richtung Leira, am Nachmittag Richtung Süden. Das ist genug. Das zu begreifen hat zwei Jahrzehnte seines Lebens gedauert. Seine Existenz hat sich eingependelt. Er ist zweiundfünfzig Jahre alt. Jetzt kommt ein Brief aus Österreich und wühlt alles wieder auf.
Diese Geschichte ist so kompliziert, dass er es auch deswegen unterlassen hat, Bjargey davon zu erzählen. Sie hat lange vor ihm begonnen, lange vor seiner ersten Islandreise, lange vor seiner Begegnung mit Þórdís, Behrend empfindet sie wie das Fragment einer Fuge mit mehreren Motiven und einer verästelten Durchführung, ein vielschichtiges Raunen, einen überlappenden Gesang unzähliger Stimmen. An seiner Geschichte ließe sich unentwegt ziehen und zerren, um einen Anfang zu finden. Zu behaupten, den tatsächlichen Beginn dieser Geschichte zu kennen, hätte Behrend sich als Lüge ausgelegt. Als blanke Anmaßung. Als überhebliche Vermessenheit.
Als Zollner am Beginn der dritten Klasse Gymnasium in der Klosterschule zu Behrends Jahrgang stieß. Als Alina am Ende seines Seminarvortrags über Ödön von Horváth vor allen Kommilitonen ihre Hand tröstend auf seine legte. Als er mit ihr im VW-Käfer quer durch Europa nach Mallorca fuhr, um Bobby Fischer im Interzonenturnier siegen zu sehen.
Das ist der Anfang seiner persönlichen Verstrickung in diese Geschichte gewesen. Zu diesem Zeitpunkt war schon viel entschieden. Da gibt es Zeitfluchten nach hinten, da existieren Biografien, deren Wege sich gekreuzt haben, als Behrend, Zollner, Alina, nicht einmal Bobby Fischer am Leben gewesen sind.
Als der österreichische Komponist Karl Wallek damals, 1936 oder 1937, auf seinen Kollegen Ernst Kossack getroffen ist. Vermutlich in den Gängen des Grazer Konservatoriums, vermutlich zu Beginn des neuen Studienjahres. Kossack war damals aus Ostdeutschland in den Ständestaat Österreich zurückgekehrt. Vielleicht war das der Anfang der Geschichte.
Wenn nicht gewesen wäre, was geschehen ist, würde Behrend jetzt nicht in Garður zwischen ihrem Haus und dem Leuchtturm und weiter die Küste entlang Richtung Sandgerði bis zum Golfplatz marschieren: seine tägliche Runde.
Es ist sinnlos, zu fragen, wie alles gekommen ist. Während Behrend gegen den Wind angeht, umklammert er den Schlüssel in seiner Manteltasche.
Die Überlebensstrategie des menschlichen Geistes als Gemeinheit empfinden: im Leben einen Sinn sehen, in allem, selbst in der Begegnung mit dem Schrecken einen roten Faden suchen, im Nachhinein den Frieden mit allem finden wollen.
Erster Teil Die Festlandepoche
Bei uns zu Hause, ich bin acht, vielleicht zehn Jahre alt. Papa und ich sind im Wohnzimmer, Papa sitzt am Tisch und liest Zeitung, ich hocke am Boden und spiele mit dem Zug aus Holz. Wir bekommen ein Baby, wir warten darauf, dass es bald so weit ist.
Das Telefon läutet, Papa bekommt den Anruf am Handy (das es damals noch gar nicht gab!) und geht im Zimmer hin und her. Helle Holzdielen in Gelb- und Brauntönen, die unter Papas Schritten laut knarren. Papa spricht mit Mama am Telefon, er ist besorgt, ja bestürzt. Dann gibt er mir den Hörer und sagt: Es hat zu schneien begonnen. Ein Moment des Schmerzes. In mir zerreißt etwas. Möglicherweise ist bei der Geburt ein Unglück geschehen. Ich lege das Handy an mein Ohr und frage: Mama? Keine Antwort. Stattdessen nur ein schweres Atmen, als ringe jemand um Fassung, als kämpfe jemand mit den Tränen. Ich frage nochmals nach: Mama? Nur das schwere Atmen. Keine Antwort. Ich wache auf.
Aufgeschrieben am 13. Juli, vier Uhr vierzig, Außentemperatur: vier Grad.
An einem milden Samstagmorgen im Juni 1969, ein paar Wochen, bevor Neil Armstrong als erster Mensch den Mond betrat, zwischen sieben und acht Uhr früh, schlenderte Richard Behrend in einer Schar von Maturanten um den kleinen Zierteich im Innenhof eines Klostergymnasiums. Die jungen Männer steckten in dunklen, schlecht sitzenden Anzügen, weiße Hemdkrägen kratzten, verhasste Krawatten schnürten Hälse zu, schwarze Schuhe, zu selten getragen, drückten. Die Schüler trabten allein oder zu zweit ihrem Klassensprecher nach, die Stimmung war gedämpft, niemand sprach. Das Scharren der Schuhe im Kies. Unruhiges Nesteln am Revers. In den Fenstern des Innenhofs klebten Augenpaare und beobachteten den grotesken Kreisgang: Pompes funèbres aus Angst und Nervenflattern, ein bizarres, orakelhaft anmutendes Ritual vor der entscheidenden mündlichen Prüfung. Acht Jahre Internat und Gymnasium lagen hinter den jungen Leuten. Vom Krieg geprägte Lehrer hatten ihnen vor allem Disziplin und Drill beigebracht. Nur wenige Pädagogen, so schien es Behrend im Nachhinein, hatten die individuellen Begabungen der Jugendlichen wertgeschätzt, nur wenige Lehrer, darunter der Musikprofessor, hatten das starre Korsett ihrer Vorgesetztenrolle – ein Großteil der Lehrer waren Mönche – und die Distanz aus Klerikalität und Kutte durchbrochen.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!