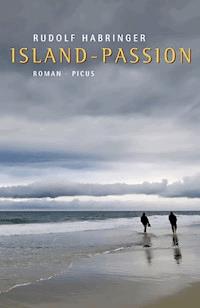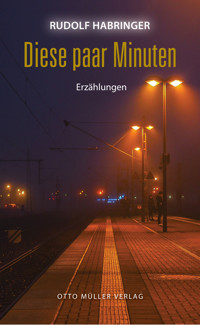
20,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Otto Müller Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Lebenswege kreuzen sich, Menschen begegnen einander, und wenn der Zufall mitspielt, entstehen Geschichten wie die von Rudolf Habringer. Sie sind lebendig, überraschend, raffiniert, manchmal schockierend, böse und traurig. Die Protagonistinnen und Protagonisten dieses Erzählbandes teilen einen gemeinsamen Lebensraum im "Hügelland" an der Donau und sind schicksalhaft miteinander verbunden – nur wissen nicht alle davon. Sie kämpfen mit ihrem Alltag, ihren privaten und beruflichen Beziehungen. Einige haben etwas zu verbergen, tragen ein Geheimnis mit sich oder haben sich schuldig gemacht. Sie sind verzweifelt Liebende, Einsame, psychisch Kranke, orientierungslose Jugendliche, die an der Abwesenheit von Glück laborieren und am Unvermögen, ihr Leben aktiv zu gestalten. Einer betrügt seine Frau, ein anderer seine Firma; einer begeht ein Verbrechen, während ein anderer ein solches deckt. Eine Frau wird zur Erpresserin, die nächste macht sich schuldig, um ihre Tochter zu schützen. Blitzlichtartig lassen uns die Figuren an ihrem Leben teilhaben – sie halten an, zeigen einen Ausschnitt ihres Alltags und reisen weiter. Dass Leser*innen um ihre Geheimnisse wissen und einem Rätselspiel gleich ihren Verbindungen nachspüren wollen – darin liegt der Reiz dieses Erzählbandes
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 241
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Rudolf Habringer
Diese paar Minuten
Erzählungen
OTTO MÜLLER VERLAG
Die Drucklegung dieses Buches wurde gefördert von:
www.omvs.at
ISBN 978-3-7013-1311-2
eISBN 978-3-7013-6311-7
© 2023 OTTO MÜLLER VERLAG SALZBURG-WIEN
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Christine Rechberger
Satz: MEDIA DESIGN: RIZNER.AT
Umschlaggestaltung: Leopold Fellinger
Druck und Bindung: Florjančič Tisk
„Ein Käfig ging einen Vogel suchen.“
Franz Kafka, Aphorismen
INHALT
Dann sage ich es ihm
Diese paar Minuten
Das hat nichts mit dir zu tun
Location Scout
Joker
Das Treffen
ICH weisZ, wer du Bist
Marili
Wenn es wieder losgeht
Irgendwie nervös
Der Weihnachtsmann fährt aus der Tiefgarage
Manchmal kommt alles zusammen
Dann sage ich es ihm
„Etwa auf der größten Erhöhung (…), wo nach und nach sich der Weg in das jenseitige Tal hinab zu senken beginnt, steht eine sogenannte Unglückssäule. Es ist einmal ein Bäcker, welcher Brot in seinem Korbe über den Hals trug, an jener Stelle tot gefunden worden.“
Adalbert Stifter
Wo ist der Mann mit dem Schäferhund, fragte eine Frau aus der Gegend vor einigen Tagen. Er ist doch dein Nachbar? Sie habe ihn schon lange nicht mehr gesehen.
Ich zog den Kopf ein und zögerte, eine Antwort zu geben. Am liebsten hätte ich gelogen. Weg, sagte ich. Schon seit fast einem Jahr. Mehr sagte ich nicht. Dann redeten wir von etwas anderem.
Das ist die Geschichte eines Unglücks. Hier wird keiner gesucht und keiner gerettet, ich wüsste nicht, wie. Der Heilige Abend ist vorbei. Spielen Kinder eine Rolle? Ja. Eines davon hat die Welt nicht gesehen. Vom Gebirge, vom Eis soll keine Rede sein, wir wohnen im Hügelland. Die Berge stehen bei Föhn als gezackte Formation am Horizont. Wenn ich aus dem Fenster schaue, kann ich die Unglücksstelle erahnen. Den Blick ins Tal durchkreuzt ein mächtiger Nussbaum, durch dessen Geäst ich im Winter hindurchsehen kann wie durch ein Spinnennetz. An schönen Tagen spiegelt sich weit unten das Sonnenlicht in der Donau. In einer Schale auf meinem Schreibtisch liegt ein Stein, kleiner als eine Murmel. Der bringt Glück, der baut dich wieder auf, sagte Färber, als er ihn mir schenkte.
Die Tage nach Weihnachten waren grau und regnerisch. Endlich kam der Schnee und mit ihm ein heftiger, kalter Wind. Das Windrad vor dem Haus schnarrte in schnellen Umdrehungen. Die Tage waren kurz. Rasch kam die Dämmerung, schwarz fiel die Nacht auf die Gegend. Verstreute Häuser zwischen Hügeln, weit unten blinkten bei guter Sicht die Lichter der Siedlungen.
Färber muss mich vom Balkon aus gesehen haben, denke ich heute. Als ich gegen Abend noch einmal in mein Büro zurückgekehrt bin. Der Begriff Büro ist übertrieben. Es handelt sich um eine Schreibstube in einem Bauernhof, hoch oben im Hügelland über dem Donautal. Die Wände zwischen den Zimmern sind dünn. Ich hörte Färbers kratzigen Husten, das Geräusch, wenn er ausspuckte, ich hörte, wenn sein Fernseher lief, wenn er mit lauter Stimme telefonierte, ich bildete mir ein, ihn gestikulieren zu hören.
Dreimal schon hatten meine Nachbarn gewechselt. Den ersten, Wall, einen ehemaligen Briefträger, hatte ein unbekanntes Schicksal aus der Bahn geworfen. Eines Tages verirrte sich Wall in seinem Rayon, verfehlte einen Teil seiner Kunden, Briefe und Pakete verschwanden. Er wurde entlassen und sitzt seither als Frühpensionist und Stammgast in den Wirtshäusern der Gegend, er gilt als verrückt, aber umgänglich. Als ich meine Schreibstube bezog, bereitete er gerade seinen Umzug vor, ein freundlicher Mensch, der unentwegt das Gespräch suchte, in endlosen Schleifen seine Misere nacherzählte, das Brevier seiner Leiden herunterbetete, ohne aber zum Eigentlichen zu kommen. Wall schleppt seinen Körper wie eine Entschuldigung, geduckt, devot. Als ginge es darum, um Nachsicht zu bitten, dass er noch da sei. Sein Körper eine einzige Geste der Beschwichtigung: Was soll ich denn machen, was hätte ich denn tun sollen? Wall, der Manisch-Depressive, mit flinker Zunge, wenn er sich im emotionalen Aufwind befand, wochenlang nicht zu sehen, wenn er vollgepumpt mit Medikamenten sich in seinem Zimmer verkroch. Als Wall auszog, folgte Kubek, ein Lastwagenfahrer mit wirrem Blick und krausen Gedanken. Ich tippte auf Schizophrenie, eine reine Vermutung, ich bin ja kein Arzt. Jetzt noch ein Lottogewinn und dann wandere ich nach Australien oder Kanada aus, sagte Kubek immer, wenn ich ihn traf. Die Behörde sei schon verständigt. Ich bin Kubek aus dem Weg gegangen, ich habe ihn gefürchtet. Ich kann meine Furcht, gebastelt aus reinem Vorurteil, bis heute nicht begründen. In meiner Voreingenommenheit halte ich Leute wie Kubek für fähig, Amok zu laufen, wenn sie den Augenblick für richtig halten. Kubek verschwand, während ich einmal für eine Woche nicht in meiner Schreibklause war. Angeblich hat man ihn in die Psychiatrie gesteckt. Kanada und Australien hat er sicher nie gesehen.
Dann zog Färber in das Zimmer neben mir. Er rauchte viel, er trank, wenn er sich nicht beherrschen konnte, und er konnte sich nicht beherrschen, wenn er unter Menschen war. Deswegen ist er aus der Stadt aufs Land gezogen. In der südlichen Vorstadt hat er als berüchtigter Raufer gegolten. In jungen Jahren muss er ein schöner Mann gewesen sein, dem es vermutlich nicht schwergefallen war, mit Frauen in Kontakt zu kommen. Die Jahre hatten ihn altern lassen, verlebt sah er jetzt aus, tiefe Falten furchten seine Wangen. Ich erwähne noch, dass Färber einen Hund besaß, einen Schäfer. Ich fürchte Hunde, vor allem große. Aber ich habe noch keinen besser abgerichteten Hund als den von Färber gesehen. In den Jahren, in denen Färber im Zimmer neben mir lebte, habe ich den Hund niemals aggressiv erlebt, kein einziges Mal.
Wir sprachen nicht oft miteinander, meist hörte ich Färber nur in seinem Zimmer hantieren, wenn er sich Abendessen kochte und sein rasselnder Atem ging. Er half den Bauern bei der Stallarbeit, um sich die Sozialhilfe aufzubessern. Da er kein Auto besaß, ging er meistens zu Fuß. Zum Einkaufen stiefelte er, seinen Hund an der Seite, zu Tal ins Dorf hinunter. Manchmal nahm ich ihn im Auto mit. Der Schäfer sprang routiniert in den Kofferraum und verhielt sich ruhig. Später trieb Färber irgendwo ein Fahrrad auf. Manchmal, wenn ich abends nach Hause fuhr, sah ich ihn, wie er das Fahrrad, bepackt mit Einkaufssäcken, den Hügel heraufschob. Bei einer Anhöhe, die Donaublick heißt, wenige hundert Meter vor dem Bauernhof, an einem Platz, an dem die Gemeindeverwaltung eine Bank und einen Tisch für Wanderer aufgestellt hatte, machte er gern Rast.
Seine Alkoholsucht war mir bald aufgefallen. Ich habe ihn direkt darauf angesprochen. Ihn störte das nicht. Er spürte, dass ich ihn mochte. Er klopfte an meine Tür und schenkte mir Kaffee und Kakao in riesigen Packungen. Er kannte den Besitzer einer Bar in der Vorstadt, von dem er manchmal eine Ration abbekam. Vielleicht handelte es sich um Spielschulden, die auf diese Art eingelöst wurden. Das reimte ich mir später zusammen. Der Kakao ist für deinen Sohn, sagte er.
Den genauen Grund, weshalb Färber zu uns auf den Berg gezogen ist, habe ich nie erfahren. Irgendwo existierte seine geschiedene Frau, irgendwo lebte sein Sohn, ein schlaksiger junger Mann. Färber trug sein Foto in der Geldbörse mit sich. Manchmal traf ich Färber draußen am Gang, wenn er gerade zur Toilette schlurfte und ich vor meiner Tür den Schlüssel suchte. Wie geht’s, fragte ich, und wir redeten Alltägliches. Übers Wetter. Über die Gesundheit. Über das, was er vorhatte. Da kenne ich nichts, sagte er oft. Einmal erzählte er mir, dass er vor Jahren als Arbeiter für eine Firma in Weißrussland gewesen sei. Beim Bau eines Stahlwerkes. Mitten in der Taiga. Dort habe er die Mitternachtssonne gesehen. Er sei fast verrückt geworden, die Sonne sei wochenlang nicht untergegangen. Er habe unter einer unerträglichen Schlaflosigkeit gelitten, die Helligkeit habe ihn fast umgebracht. So viel ich weiß, gibt es die Mitternachtssonne nur nördlich des Polarkreises, hatte ich vorsichtig eingewandt, und Weißrussland liege bekanntlich weit darunter. Mein Argument hatte ihn nicht beeindruckt. Er sei in Weißrussland gewesen, er habe die Mitternachtssonne erlebt, er wisse, wovon er spreche. Später schlug ich in einem Atlas nach, um mich meiner Behauptung zu vergewissern.
Er musste mich an jenem Abend, als ich mit meinem Sohn zum Hof gefahren bin, um ihm die Mitteilung zu machen, die ich den ganzen Tag lang aufgeschoben hatte, beobachtet haben. Färber ist auf dem Balkon, der vor den Fenstern unserer Zimmer an der Südfront des Hauses verläuft, gestanden und hat geraucht, habe ich später gedacht. Färber hat alles gehört. Deswegen hat er zwei Tage später an meine Tür geklopft.
Ein Mann mittleren Alters, ein nicht mehr ganz junger Vater, sitzt auf der Zuschauertribüne einer Dorfturnhalle und beobachtet eine Gruppe von Kindern beim Fußballtraining. Der Mann trägt einen warmen Anorak, die Halle ist nur schwach beheizt. Neben ihm liegt eine Zeitung auf der hölzernen Sitzbank, ungelesen. Kommandos von zwei Trainern schallen durch die Halle, in der sich ein gutes Dutzend Buben bemüht, den Ball ins Tor der jeweils gegnerischen Mannschaft zu befördern. Es wird mehr gebolzt als gespielt, den meisten Buben fehlt noch jede technische Fertigkeit. Mitten unter den Kindern: der Sohn des Mannes, der Jüngste der Gruppe. Mit rot erhitzten Wangen stürmt er dem Ball nach, ganz in seinem Element. Manchmal winkt er seinem Vater auf der Tribüne zu. Der Vater hat sein Kind vorhin im Kindergarten wie vereinbart abgeholt, noch ist alles so, wie es sein sollte. Der Vater sitzt nicht nur als Wartender auf der Tribüne, wie ein paar andere Mütter, die ihre Söhne anfeuern. Er sitzt heute auch als Bote dort, als Überbringer einer Nachricht. Etwas Unvorhergesehenes ist geschehen. Der Vater denkt: Jetzt dann, nach dem Ende des Trainings, wird er seinem Sohn sagen, was auch er erst am Vormittag erfahren hat. Er hat lange überlegt, wie er seinem Sohn die Nachricht beibringen soll, und hat sich entschlossen, das Ende des Trainings abzuwarten. Warum dem Kleinen den Spaß am Spiel vergällen? An diesem Nachmittag in der schlecht geheizten Turnhalle gelingen dem Buben sogar mehrere Tore. Nach dem Training sage ich es ihm. Das hat der Vater beschlossen. Er weiß, dass es ihm schwerfallen wird. Er weiß nicht, wie man so etwas macht. Er blickt auf die Uhr. Es ist halb fünf. Die Zeitung bleibt ungeöffnet neben ihm liegen. Die Schlagzeilen bilanzieren ein abgelaufenes Jahr. Es ist dreiviertel fünf. Um fünf ist das Training zu Ende. Dann sage ich es ihm. Der Vater blickt auf die Uhr. In einer Stunde habe ich es ihm bereits gesagt. Gestern um diese Zeit habe ich es selbst noch nicht gewusst. Die Zeit ist etwas Seltsames. Wenn ich es ihm gesagt habe, werden wir beide anderesein als vorher. Die Hände des Vaters werden vor Nervosität feucht, er lässt sich seine Unruhe nicht anmerken. Eine andere Mutter, deren Sohn auch unten am Parkett kickt, spricht ihn an, lenkt ihn ab. Noch zehn Minuten. Ich möchte es ihm sagen, wenn wir allein sind, ich möchte mit ihm allein sein, entscheidet der Mann. Das Auto steht draußen auf dem Parkplatz. Vielleicht sage ich es ihm im Auto. Nein, im Auto sage ich es ihm nicht. Ich möchte ihn ansehen, ich muss ihn ansehen, wenn ich es ihm sage, denkt der Mann. Ich muss es ihm ins Gesicht sagen. Ich kann ihm die Wahrheit nicht ersparen, denkt er.
Das Training ist zu Ende. Die Mannschaft seines Sohnes hat gewonnen. Der Bub strahlt über das ganze runde, rot geschwitzte Gesicht. Der Vater streicht ihm zärtlich über den Kopf. Nichts trübt die Freude des Sohnes. Er ist der Sieger des Tages. Der Tag ist gerettet. Die Welt kann ihm nichts anhaben. Er ist der Größte. Er ist ein Kind, sechs Jahre alt. Jetzt gehen wir umziehen und dann fahren wir nach Hause, sagt der Vater.
Zwei Tage später klopfte Färber an meine Tür, schon vorher hatte ich ihn in seinem Zimmer unruhig auf und ab gehen hören. Sein Husten war wieder stärker geworden, ein raues, rhythmisches Bellen. Ob ich Zeit hätte, mit ihm Kaffee zu trinken, fragte Färber. Meine Schreibklause ist für Besuche nicht eingerichtet, hier herrscht eine Unordnung, die selbst mir auf die Nerven geht, Berge von Papier stapeln sich auf verschiedenen Stößen, ein kleines Tischchen, eine Liege, ein Stuhl sind ständig belegt, wenn ich etwas suche, ist immer erst ein Stoß umzuschlichten. Vor Fremden wäre mir diese Unordnung, die mir allmählich über den Kopf zu wachsen droht, peinlich gewesen. Bei Färber wusste ich, woran ich war, ich wusste Bescheid, wie er hauste. Ich sehe den Tisch vor mir, an dem er Hundefutter stapelte und seine Zigaretten drehte, ich habe den Herd mit den schwarzen Schlieren in Erinnerung, es war nicht selten vorgekommen, dass Färber aus Versehen Essen angebrannt hatte, der Geruch hatte sich schnell im Flur vor unseren Zimmern verbreitet. Ich schaffte Ordnung auf dem kleinen Tisch und stellte Kaffee auf. Nach kurzer Zeit saßen wir einander gegenüber, irgendwo hatte sich eine Packung Kekse gefunden, die ich auf einen Teller legte. Färber trank den Kaffee schwarz, die Kekse rührte er nicht an.
Erst Tage später, nachdem alles passiert war, schloss ich aus einigen von Färber hingeworfenen Andeutungen, dass er mich zwei Tage zuvor beobachtet und gehört haben musste. Färber war gekommen, um mich zu trösten, um mir Mut zuzusprechen. Später dachte ich: Er ist als einer gekommen, der sich auskennt, der hat sich selbst was mitgemacht. Aber Färber wurde nicht eindeutig, er sagte nicht, dass er mich mit meinem Sohn gesehen hatte, sein Trost kam indirekt, hingesprochen wie im Scherz, ohne als solcher zu wirken: Wir haben es nicht leicht, aber leicht hat es einen. Das sagte Färber und zupfte mich am Arm. Er hustete stark, ich fragte ihn, ob er denn nicht zum Arzt gehen wolle, um sich untersuchen zu lassen, Färber winkte nur ab und sagte, es handle sich um eine üble Verkühlung, die schon wieder abklingen werde, er werde sich doch das Rauchen, wahrlich sein letztes Laster, nicht auch noch nehmen lassen.
Wir tranken Kaffee, draußen war das junge Jahr, ein kalter Jännertag. In den vergangenen Tagen hatte es erst geschneit, dann angezogen, wie wir sagen, die Felder waren mit Schnee bedeckt, der Atem dampfte in kleinen Wölkchen vor einem her, die schmale, kurvige Straße ins Dorf hinunter war glatt und gefährlich zu befahren, unregelmäßig wurde Split gestreut. Plötzlich begann Färber aus seinem Leben zu erzählen, erst im Nachhinein hatte ich das Gefühl, als hätte er an jenem Tag etwas loswerden wollen, ich weiß nicht, warum. Ein paar Fragen genügten und Färber brachte sein verunglücktes Berufsleben, das Ausbüchsen nach Frankreich und seinen Eintritt in die Fremdenlegion auf den Tisch. Als Legionär sei er nach Tahiti verlegt und dort in einer Kaserne stationiert gewesen. Färber erzählte von seinem Vorgesetzten, einem Deutschen, viel jünger als er, einem Hund, der die gesamte Truppe aufs Ärgste schikaniert hatte, Wochen und Monate. Eines Abends sei er gemeinsam mit einem Freund dem Vorgesetzten, der sich dienstlich auf einem abgelegenen Strandabschnitt aufgehalten habe, nachgegangen und habe ihn aus dem Hinterhalt mit einem gezielten Schuss zur Strecke gebracht und getötet. Der Deutsche sei einfach umgestürzt und in den Sand gefallen. Ich weiß nicht, sagte Färber, umgelegt? abgeknallt? Ich habe es vergessen.
Ich war sprachlos, verdutzt. Woran ich mich noch erinnere: Während Färber erzählte, war ich aufgestanden und hatte in einem Lexikon den Artikel über Tahiti nachgeschlagen. Färber fuhr fort. Trotz einer sofort eingeleiteten Untersuchung sei der Anschlag niemals aufgeklärt worden, er sei nicht einmal unter Verdacht geraten. Kurze Zeit danach war die Truppe abgezogen worden, später desertierte Färber und kehrte nach einigen Umwegen nach Österreich zurück. Jetzt lebe er seit über zwanzig Jahren als Staatenloser im Land, er habe sich nicht wieder um einen Pass bemüht. Als Staatenloser brauche er nicht zur Wahl zu gehen, er reise auch nirgends mehr hin. Jetzt, da er sich hier auf den Berg zurückgezogen habe, denke er oft: Am Hof, bei der Arbeit mit den Tieren, fühle er sich wohl. Ich existiere nicht mehr für die da unten, ich existiere nicht mehr für die da oben, sagte Färber und lachte ein Lachen aus der Tiefe.
So verging der Vormittag. Wir vereinbarten, uns öfter zum Plaudern zu treffen. Ich saß wieder an meiner Arbeit, als Färber kurz darauf noch einmal in mein Zimmer kam. Er drückte mir einen kleinen, geschliffenen Stein in die Hand. Habe ich einmal geschenkt bekommen, sagte er, kannst du behalten, der soll dir Glück bringen.
Das Kind hat sich umgezogen. In verschwitzter Unterwäsche ist es in seine warme Kleidung geschlüpft. Jetzt gehen Vater und Sohn zum Auto, der Vater trägt die Sporttasche mit den Utensilien. Ist die Mama schon zu Hause, fragt der Sohn. Der Vater bejaht. Das kann er bejahen. Ja, die Mutter sei schon zu Hause. Sie steigen ins Auto ein. An der ersten Kreuzung biegt er rechts ab. Es ist dunkel geworden, die Scheinwerfer werfen einen schmalen Streifen Licht auf die Fahrbahn. Es hat wieder zu schneien begonnen, die Flocken flirren vor der Windschutzscheibe. Wohin fahren wir, fragt der Sohn. Wir fahren noch schnell ins Büro, ich habe etwas vergessen, sagt der Vater und setzt die Fahrt fort. Im Büro sage ich es ihm. Ich sage es ihm im Büro. Der Vater stellt das Radio nicht an.
Mitten am Vormittag läutet das Telefon.
Du bist es, fragt er. Wir geht es dir? Was machst du? Bist du nicht in der Arbeit? Ich bin bei der Ärztin, sagt sie. Du musst kommen. Bitte, sagt sie. Es ist etwas passiert. Das Kind ist tot. Die Ärztin hat keine Herztöne mehr festgestellt. Ich muss es tot zur Welt bringen.
Das war am Vormittag. Am Abend fährt der Vater mit seinem Sohn ins Büro. Hinter den Fenstern des Bauernhofes brennt Licht. Rechts daneben steht eine Tanne, mit Lichtergirlanden geschmückt. Komm mit nach oben, sagt der Vater zu seinem Sohn. Er öffnet dem Kleinen die Wagentür. Munter hopst sein Sohn vor ihm her durch den Schnee. Ich sage es ihm oben. Wenn wir oben sind, dann sage ich es ihm.
Zwei Tage nach dem Gespräch mit Färber, an einem Freitag, kurz nachdem ich in mein Büro gekommen war und die Arbeit aufgenommen hatte, klopfte er erneut an die Tür. Draußen glänzte der Schnee in der Sonne, kleine weiße Wolken standen unbeweglich am Himmel. Ob ich ihn ins Dorf hinunter zum Einkaufen mitnehmen könne, fragte Färber. Als ich erklärte, dass ich erst mit der Arbeit begonnen habe, er aber gern am Nachmittag mit mir hinunterfahren könne, brach es aus ihm heraus. Es habe Streit mit Konrad, dem Bauern, gegeben. Jetzt sei ein für allemal Schluss mit dem Mithelfen am Hof, er habe die Schnauze voll, erklärte Färber wild gestikulierend, von Hustenanfällen unterbrochen. Alles habe ich für die Bauersleute gemacht, Geld hätten die genug, jetzt habe Konrad wieder irgendwo oben im Hügelland eine baufällige Keusche gekauft und ich Trottel habe zugesagt, Konrad bei der Renovierung zu helfen, aber mich unterstützen sie nicht bei der kleinsten Bitte, fluchte Färber. Er habe Konrad gebeten, ihn mit ins Dorf zu nehmen, es sei kalt, die Straße vereist, er habe schon im Auto von Konrad Platz genommen gehabt. Als er Konrad bat, auch den Hund mitzunehmen, habe dieser ihn geheißen, auszusteigen. Ich bin schon im Auto gesessen und dieser Idiot, so Färber, hat mich wieder aussteigen lassen. Das brauche er sich nicht bieten zu lassen. Da kenne er nichts. Wir standen auf dem Gang, ich hatte Färber die Tür geöffnet, ihn aber nicht ins Zimmer gebeten, weil ich mich auf meine Arbeit konzentrieren wollte. Ich versuchte ihn zu beruhigen und versprach, ihn am Nachmittag gemeinsam mit dem Hund ins Dorf zu fahren. Scheinbar besänftigt zog sich Färber darauf in sein Zimmer zurück. Minuten später klopfte erneut jemand an die Tür. Draußen stand Konrad, ein seltener Vorgang, und bat um eine Unterschrift wegen einer Nachzahlung oder dergleichen, ich habe das vergessen.
Viel zu tun, fragte ich beiläufig.
Ich sprach Konrad auf den Streit mit Färber an, worauf dieser eintrat und die Tür hinter sich schloss. Mit leiser Stimme, als wolle er vermeiden, dass uns Färber durch die dünne Wand hörte, sagte mir Konrad, dass er sich seit Tagen um Färber sorge. Die Krankheit habe sich offenbar verschlimmert, es habe den Anschein, dass es mit dem Trinken immer ärger werde. Konrad habe Färber deswegen nicht zum Einkauf mit ins Dorf genommen, weil er ihm nicht geglaubt habe. Entgegen seiner sonstigen Gewohnheit habe Färber auch den Hund mitnehmen wollen. Nur deswegen habe er Färber aufgefordert, wieder auszusteigen. Ich weiß, sagte Konrad, dass Färber immer dann, wenn er den Hund mit ins Dorf nimmt, die Absicht hat, in die Stadt zu seinen Kumpanen zu fahren. Dann taucht er für einige Tage ab und betrinkt sich fürchterlich. Bereits im vergangenen Jahr sei er nach einer Zechtour mit gebrochenen Rippen und einer zerschmetterten Hand wieder auf den Hof zurückgekehrt. Ich habe Färber nur vor sich selbst schützen wollen, sagte Konrad verlegen. Verständlich, dass Färber jetzt aufgebracht ist, aber das wird sich wieder einrenken, sagte der Bauer in leisem Ton zu mir. Ich brauche ihn ja, er ist geschickt. Demnächst beginnen wir mit dem Umbau dieses Häuschens, das wir kürzlich erworben haben. Ein paar Ferienwohnungen werden das, sagte Konrad. Die Sommerfrische ist wieder im Kommen. Ich nickte zum Zeichen, dass ich Konrads Verhalten verstünde, wir wünschten einander ein Gutes neues Jahr, dann ging ich wieder an meine Arbeit.
Der Sohn geht mit dem Vater die Treppe zum Büro hinauf, wie immer, wenn er den Vater am Bauernhof besucht. Irgendwo bellt ein Hund. Der Vater sperrt die Tür zum Büro auf. Er bittet seinen Sohn, sich zu setzen. Er liebt sein Kind, er möchte ihm nicht weh tun. Der Vater weiß, wie sehr sich der Sohn auf einen Bruder, eine Schwester freut. Komm, setz dich, sagt der Vater, ich muss dir etwas erzählen. Später weiß er nicht mehr, was genau er gesagt hat. Vielleicht sagte er: Ich muss dir leider etwas sehr Trauriges sagen. Diese Situation hat der Vater noch nicht erlebt. Diese Situation hat der Sohn noch nicht erlebt.
Das Kind ist zum Stuhl gesprungen und hat dort Platz genommen, wie immer, wenn es auf eine Geschichte, eine spannende Erzählung wartet. Die Haare des Knaben sind von Schweiß verklebt, seine Wangen von der Anstrengung des Trainings noch immer gerötet. Er hat die Jacke nicht abgelegt, draußen ist es kalt, das Gespräch wird nicht lange dauern.
Das Kind sagt mit klarer Stimme: Das ist nicht wahr. Die Ärzte haben sich geirrt. Der Vater schüttelt den Kopf und sagt: Es ist wahr, ich habe es heute erfahren. Der Vater beobachtet seinen Sohn. Als das Kind das ist nicht wahr gesagt hat, hat der Vater die Hände seines Sohnes betrachtet, die sich ineinander verkrallen. Ungläubig, ratlos suchen die zarten Finger Halt. In diesem Augenblick wird der Vater selbst zum Kind. Ihm fällt ein, was wir hier nicht erzählen wollen. Alles ist so frisch. Der Vater kann seine Gefühle nicht unterdrücken. Er sinkt auf die Knie, umklammert seinen Sohn und bricht in Tränen aus.
Später sagt das Kind den Satz: Und es hat doch die Welt nicht gesehen.
Stimmt, denkt der Vater. Dann versperrt er das Büro, sie gehen durch den Flur, sie gehen die Treppe hinunter, sie gehen zum Fahrzeug.
Draußen ist es dunkel, eine sternklare Nacht. Es hat zu schneien aufgehört. Die Luft ist frisch. Ich kann die Welt sehen, denkt der Vater, eine Tatsache, die ich meist vergesse.
Er öffnet seinem Sohn die Autotür, das Kind springt hinein, der Vater schließt dem Kleinen den Gurt. Fahren wir nach Hause, sagt der Vater. Dann fahren sie los.
Eine halbe Stunde später, an jenem sonnigen Freitag im Jänner, klopfte Färber erneut an meine Tür. Später erfuhr ich, dass er in der Zwischenzeit getrunken haben musste, ich habe davon nichts gemerkt. Färber bat um Geld, er habe sich entschlossen, nun doch mit dem Rad ins Dorf hinunter zum Einkauf zu fahren. Ich drückte ihm einen Geldschein in die Hand und fragte nicht weiter nach, um mich rasch wieder an den Schreibtisch setzen zu können. Gegen Mittag verließ ich den Hof, ohne jemanden anzutreffen, und kehrte erst, da wir für einige Tage verreisten, nach einer Woche wieder zurück. Ich erfuhr, was an jenem Freitag weiter geschehen war: Färber hatte sich offenbar betrunken und wahrscheinlich in einem Zustand unbändiger Wut auf das Fahrrad geschwungen und war Richtung Tal gefahren. Genau an der Stelle, wo der kurze Fußweg zur Rastbank Donaublick von der Straße abzweigt und die Straße scharf nach rechts führt, ist Färber, ob aufgrund der herrschenden Straßenglätte oder in voller Absicht ist nicht geklärt, geradeaus gefahren und die steile Böschung hinuntergestürzt. Seine Verletzungen sind so schwer gewesen, dass man ihn mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus in die Stadt transportierte, wo er am Sonntag, zwei Tage nach dem Unfall, gestorben ist. Als ich eine Woche nach diesem Vorfall an den Hof zurückkehrte, war Färbers Zimmer bereits geräumt, sein Namensschild entfernt. Der Schäferhund ist weggebracht worden. Von Färbers Begräbnis habe ich erst erfahren, als es schon vorüber war. Ich weiß nicht, wo er begraben liegt.
Täglich, wenn ich zur Arbeit fahre, fahre ich an der Unglücksstelle vorbei. Auf meinem Schreibtisch liegt ein Stein, kleiner als eine Murmel.
Diese paar Minuten
Danach duschte er. Es war ein kleines Ritual, bevor er Klara verließ. Wenn er sich ihren Geruch mit Seife aus den Fingern wusch, verspürte er jedes Mal diesen Anflug von Traurigkeit, ehe er losfuhr. In wenigen Minuten würde er schon auf der Straße sein und in Richtung Grenze fahren.
In der Dusche und auf den Badezimmerregalen standen die Kosmetikartikel von Harald, Klaras Mann, sein Deo, sein Rasierschaum, seine Zahnbürste, die Zahnseide, die Pflegesalben, ein alter Rasierapparat, von dem eine Ecke des Gehäuses abgebrochen war. Er griff nach der Shampooflasche, die Harald am Vortag vielleicht noch selbst verwendet hatte. Es war wichtig, dass er so wenige persönliche Gegenstände wie möglich dabei hatte, wenn er Klara besuchte, um nicht versehentlich Spuren zu hinterlassen. Einmal hatte er einen Kamm auf dem Sims im Badezimmer vergessen. Noch während der Fahrt war ihm aufgefallen, dass ihm ein Fehler unterlaufen war. Er hatte Klara eine SMS geschickt, sie hatte den Kamm verschwinden lassen, bevor ihr Mann nach Hause gekommen war.
Mit Klaras Mann verband ihn, dass sie beide in einem Beruf arbeiteten, der häufige Dienstreisen notwendig machte. Harald hatte oft in Wien zu tun, er wiederum fuhr regelmäßig in die entgegengesetzte Richtung nach Deutschland. Ein- bis zweimal im Jahr traf man sich zufällig im Dorf. Vielleicht im Sommer am Sportplatz bei einem Fußballspiel oder im Dezember beim Weihnachtsmarkt vor der Kirche. Beide stammten sie nicht aus dem Dorf, beide galten als Zugereiste.
Das Badezimmerfenster zum Fluss hinaus stand offen, das Rauschen des Wassers, das sich dort draußen seinen Weg zwischen großen Granitsteinen suchte, war überlaut zu hören. Ein heißer Sommertag war vergangen. Bald würde es ein starkes Unwetter geben. Von fern begann es bereits zu grollen. Im Süden, dort wo die Bergkette lag, kündigte sich das Gewitter mit einem unentwegten Flackern an.
Er stieg aus der Dusche und trocknete sich ab. Klara würde die feuchten Handtücher sofort in die Waschmaschine stecken. Er zog sich an, trocknete sein Haar mit dem Fön, den Klara und ihre Familienmitglieder verwendeten. Er durfte nichts vergessen. Er sah auf die Armbanduhr. Es war Zeit, dass er aus dem Haus kam. Bald würde Sina, Klaras Tochter nach Hause kommen.
Klara wartete in der Küche auf ihn. Sie fragte ihn, ob er noch etwas trinken wolle. Sie holte Orangensaft aus dem Kühlschrank, goss den Saft in ein Glas und streckte ihn mit Leitungswasser. Er trank in zwei gierigen Zügen aus. Auf der Fahrt würde er bei einer Autobahnraststätte noch einmal Halt machen und einen Espresso trinken. Auch so ein Ritual, das er pflegte.
Er nahm Klara in den Arm. Sie legte den Kopf an seine Schulter, er roch ihr Haar, er leckte an ihrem Ohrläppchen, das mit einem kleinen Ring geschmückt war. Er spürte, wie sie sich an ihn drückte. Sie schüttelte den Kopf. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch so aushalte, flüsterte sie.
Vielleicht können wir uns bald wieder in einer Stadt treffen, sagte er. Ein paarmal war Klara ihm schon nachgereist. Er deutete auf die Uhr. Klara nickte. Sina wird gleich nach Hause kommen, sagte sie.
Sina ging in der Stadt aufs Gymnasium. Nach der Schule nahm sie den Zug aufs Land hinaus. Am Bahnhof hatte sie ein Fahrrad stehen, mit dem sie das letzte Stück nach Hause fuhr.
Es donnerte nun deutlich hörbar. Das Gewitter kam rasch näher. Ich hoffe, dass sie es noch trocken nach Hause schafft, sagte Klara.
Sie begleitete ihn zur Tür. Sie flüsterten, obwohl niemand da war, der sie hören konnte. Nichts vergessen, fragte sie. Er griff nach seiner Geldbörse, seinem Handy, dem Schlüsselbund.