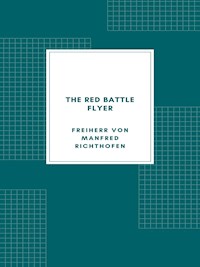Jagdflieger im Ersten Weltkrieg – Band 244 in der gelben Buchreihe – bei Jürgen Ruszkowski E-Book
Manfred von Richthofen
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: gelbe Buchreihe
- Sprache: Deutsch
n diesem Buch schildern Manfred von Richthofen und Oswald Bölcke aus Sicht kaisertreuer Offiziere die Ereignisse und dramatischen Abläufe des ersten Weltkrieges von Anfang August 1914 bis zu ihrem "Heldentod". Besonders interessant für den historisch interessierten Leser sind die bis ins Detail beschriebenen wilden Kämpfe zwischen deutschen und feindlichen Flugzeugen. Die martialische Sprache der Autoren erscheint uns heutigen Lesern kaum noch verständlich. Jagd-Instinkte werden gegen gegnerische Menschen ausgetobt. Mit vielen Bildern und Zusatzinformationen wird dieser Band neu herausgegeben von Jürgen Ruszkowski. – Rezession: Ich bin immer wieder begeistert von der "Gelben Buchreihe". Die Bände reißen einen einfach mit. Inzwischen habe ich ca. 20 Bände erworben und freue mich immer wieder, wenn ein neues Buch erscheint. oder: Sämtliche von Jürgen Ruszkowski aus Hamburg herausgegebene Bücher sind absolute Highlights. Dieser Band macht da keine Ausnahme. Sehr interessante und abwechslungsreiche Themen aus verschiedenen Zeit-Epochen, die mich von der ersten bis zur letzten Seite gefesselt haben! Man kann nur staunen, was der Mann in seinem Ruhestand schon veröffentlicht hat. Alle Achtung!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 284
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Manfred von Richthofen
Jagdflieger im Ersten Weltkrieg – Band 244 in der gelben Buchreihe – bei Jürgen Ruszkowski
Band 244 in der gelben Buchreihe
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Vorwort des Herausgebers
Der Autor Manfred von Richthofen
Manfred von Richthofen – Der rote Baron – 1917
Einiges von meiner Familie
Meine Kadettenzeit – 1903 – 1909 Wahlstatt, 1909 – 1911 Lichterfelde
Eintritt in die Armee – Ostern 1911
Erste Offizierszeit – Herbst 1912
Kriegsausbruch
Überschreiten der Grenze
Nach Frankreich
21./22. August 1914
Patrouillenritt mit Loen
Langeweile vor Verdun
Das erste Mal in der Luft
Beobachtungsflieger bei Mackensen
Mit Holck in Russland – Sommer 1915
Russland – Ostende – Vom Zweisitzer zum Großkampfflugzeug
Ein Tropfen Blut fürs Vaterland – Ostende
Mein erster Luftkampf – 1. September 1915
In der Champagne-Schlacht
Wie ich Boelcke kennen lernte
Der erste Alleinflug – 10. Oktober 1915
Aus meiner Döberitzer Ausbildungszeit
Erste Zeit als Pilot
Holck † 30. April 1916
Ein Gewitterflug
Das erste Mal auf einem Fokker
Bombenflüge in Russland
Endlich!
Mein erster Engländer – 17. September 1916
Somme-Schlacht
Boelckes Ende † 29. Oktober 1916
Der Achte
Major Hawker
Pour le mérite
„Le petit rouge“
Englische und französische Fliegerei – Februar 1917
Selbst abgeschossen – Mitte März 1917
Ein Fliegerstückchen – Ende März 1917
Erste Dublette
Mein bisher erfolgreichster Tag
„Moritz“
Englischer Bombenangriff auf unseren Flughafen
Schäfers Notlandung zwischen den Linien
Das Anti-Richthofen-Geschwader – 25. April 1917
Der „alte Herr“ kommt uns besuchen
Flug in die Heimat
Mein Bruder
Lothar ein „Schießer“ und nicht ein Weidmann
Der Auer-Ochs
Infanterie-, Artillerie- und Aufklärungs-Flieger
Unsere Flugzeuge
Oswald Bölcke: Feldberichte aus dem ersten Weltkrieg
Der Autor Oswald Bölcke
Hauptmann Bölkes Feldberichte
Einleitung
Erster Abschnitt – Vom Kriegsbeginn bis zum ersten Sieg
Zweiter Abschnitt – Der Kampfflieger
Dritter Abschnitt – Auf Urlaub
Vierter Abschnitt – Bis zum vierzigsten Sieg
Die letzten Meldungen
Der letzte Brief
Die maritime gelbe Buchreihe
Weitere Informationen
Wie ich auf Patrouille zum ersten Mal die Kugeln pfeifen hörte
Impressum neobooks
Vorwort des Herausgebers
Vorwort des Herausgebers
Von 1970 bis 1997 leitete ich das größte Seemannsheim in Deutschland am Krayenkamp am Fuß der Hamburger Michaeliskirche.
Dabei lernte ich Tausende Seeleute aus aller Welt kennen.
Im Februar 1992 entschloss ich mich, meine Erlebnisse mit den Seeleuten und deren Berichte aus ihrem Leben in einem Buch zusammenzutragen. Es stieß auf großes Interesse. Mehrfach wurde in Leser-Reaktionen der Wunsch laut, es mögen noch mehr solcher Bände erscheinen. Deshalb folgten dem ersten Band der „Seemannsschicksale“ weitere.
2023 Jürgen Ruszkowski
Ruhestands-Arbeitsplatz
Hier entstehen die Bücher und Webseiten des Herausgebers
* * *
Der Autor Manfred von Richthofen
Der Autor Manfred von Richthofen
https://www.projekt-gutenberg.org/autoren/namen/richthof.html
Manfred Albrecht Freiherr von Richthofen, * 2. Mai 1892 im Breslauer Vorort Kleinburg – † 21. April 1918 bei Vaux-sur-Somme, Département Somme, war ein deutscher Offizier und Jagdflieger im Ersten Weltkrieg.
https://de.wikipedia.org/wiki/Manfred_von_Richthofen#
* * *
Geboren am 2. Mai 1892 in Breslau; gestorben am 21. April 1918 bei Vaux-sur-Somme.
Manfred von Richthofen war ein deutscher Jagdflieger im Ersten Weltkrieg. Er erzielte die höchste Zahl von Luftsiegen, die im Ersten Weltkrieg von einem einzelnen Piloten erreicht wurde. Den berühmten Beinamen „Der Rote Baron“ erhielt von Richthofen, der einen Großteil seiner Einsätze in mehr oder weniger rot gestrichenen Flugzeugen flog, erst nach dem Krieg.
* * *
Manfred von Richthofen – Der rote Baron – 1917
Manfred von Richthofen – Der rote Baron – 1917
https://www.projekt-gutenberg.org/richthof/rotbaron/rotbaron.html
Rittmeister Manfred Freiherr von Richthofen
* * *
Einiges von meiner Familie
Einiges von meiner Familie
https://www.projekt-gutenberg.org/richthof/rotbaron/chap001.html
Die Familie Richthofen hat sich in den bisherigen Kriegen an führender Stelle eigentlich verhältnismäßig wenig betätigt, da die Richthofens immer auf ihren Schollen gesessen haben. Einen Richthofen, der nicht angesessen war, gab es kaum. War er's nicht, so war er meistenteils in Staatsdiensten. Mein Großvater, und von da ab alle meine Vorväter, saßen in der Gegend von Breslau und Striegau auf ihren Gütern.
Striegau – Foto: SchiDD
Erst in der Generation meines Großvaters wurde ein Vetter meines Großvaters als erster Richthofen General.
In der Familie meiner Mutter, einer geborenen von Schickfuß und Neudorf, ist es ähnlich wie bei den Richthofens: wenig Soldaten, nur Agrarier. Der Bruder meines Urgroßvaters Schickfuß fiel 1806. In der Revolution 1848 wurde einem Schickfuß eines seiner schönsten Schlösser abgebrannt. Im Übrigen haben sie's alle bloß bis zum Rittmeister der Reserve gebracht.
Auch in der Familie Schickfuß sowohl wie Falckenhausen – meine Großmutter ist eine Falckenhausen -- kann man nur zwei Hauptinteressen verfolgen. Das ist Reiten, siehe Falckenhausen, und Jagen, siehe den Bruder meiner Mutter, Onkel Alexander Schickfuß, der sehr viel in Afrika, Ceylon, Norwegen und Ungarn gejagt hat.
Albrecht von Richthofen, * 1859 – † 1920 (Vater)
Kunigunde Freifrau von Richthofen, *1868 – † 1962), geborene von Schickfus und Neudorff (Mutter)
Mein alter Herr ist eigentlich der erste in unserem Zweig, der auf den Gedanken kam, aktiver Offizier zu werden. Er kam früh ins Kadettenkorps und trat später von dort bei den 12. Ulanen ein. Er ist der pflichttreueste Soldat, den man sich denken kann. Er wurde schwerhörig und musste den Abschied nehmen. Seine Schwerhörigkeit holte er sich, wie er einen seiner Leute bei der Pferdeschwemme aus dem Wasser rettete und nachher seinen Dienst beendete, ohne die Kälte und Nässe zu berücksichtigen.
Unter der heutigen Generation sind natürlich sehr viel mehr Soldaten. Im Krieg ist jeder waffenfähige Richthofen bei der Fahne. So verlor ich gleich zu Anfang des Bewegungskrieges sechs Vettern verschiedenen Grades. Alle waren Kavalleristen.
Genannt bin ich nach einem großen Onkel Manfred, in Friedenszeiten Flügeladjutant Seiner Majestät und Kommandeur der Gardedukorps, im Krieg Führer eines Kavalleriekorps.
Nun noch von meiner Jugend. Der alte Herr stand in Breslau bei den Leibkürassieren 1, als ich am 2. Mai 1892 geboren wurde. Wir wohnten in Kleinburg. Ich hatte Privatunterricht bis zu meinem neunten Lebensjahr, dann ein Jahr Schule in Schweidnitz, später wurde ich Kadett in Wahlstatt. Die Schweidnitzer betrachteten mich aber durchaus als ein Schweidnitzer Kind. Im Kadettenkorps für meinen jetzigen Beruf vorbereitet, kam ich dann zum 1. Ulanen-Regiment.
Was ich selbst erlebte, steht in diesem Buch.
Mein Bruder Lothar ist der andere Flieger Richthofen.
Lothar von Richthofen, * 27. September 1894 in Breslau- † 4. Juli 1922 in Hamburg-Fuhlsbüttel, war ein deutscher Jagdflieger im Ersten Weltkrieg. Lothar wurde als drittes von vier Kindern geboren.
Ihn schmückt der Pour le mérite. Mein jüngster Bruder ist noch im Kadettenkorps und wartet sehnsüchtig darauf, sich gleichfalls zu betätigen.
Elisabeth ‚Ilse‘ Therese Freiin von Richthofen, *1890 – † 1963, verheiratete Freifrau von Reibnitz – im Krieg als Krankenschwester tätig.
Meine Schwester ist, wie alle Damen unseres Familienkreises, in der Pflege der Verwundeten tätig.
* * *
Meine Kadettenzeit – 1903 – 1909 Wahlstatt, 1909 – 1911 Lichterfelde
Meine Kadettenzeit – 1903 – 1909 Wahlstatt, 1909 – 1911 Lichterfelde
https://www.projekt-gutenberg.org/richthof/rotbaron/chap002.html
Als kleiner Sextaner kam ich in das Kadettenkorps. Ich war nicht übermäßig gerne Kadett, aber es war der Wunsch meines Vaters, und so wurde ich wenig gefragt.
Die strenge Zucht und Ordnung fiel einem so jungen Dachs besonders schwer. Für den Unterricht hatte ich nicht sonderlich viel übrig. War nie ein großes Lumen. Habe immer so viel geleistet, wie nötig war, um versetzt zu werden. Es war meiner Auffassung nach nicht mehr zu leisten, und ich hätte es für Streberei angesehen, wenn ich eine bessere Klassenarbeit geliefert hätte als „genügend“. Die natürliche Folge davon war, dass mich meine Pauker nicht übermäßig schätzten. Dagegen gefiel mir das Sportliche: Turnen, Fußballspielen usw., ganz ungeheuer. Es gab, glaube ich, keine Welle, die ich am Turn-Reck nicht machen konnte. So bekam ich bald einige Preise von meinem Kommandeur verliehen.
Alle halsbrecherischen Stücke imponierten mir mächtig. So kroch ich z. B. eines schönen Tages mit meinem Freund Frankenberg auf den bekannten Kirchturm von Wahlstatt am Blitzableiter herauf und band oben ein Taschentuch an. Genau weiß ich noch, wie schwierig es war, an den Dachrinnen vorbeizukommen. Mein Taschentuch habe ich, wie ich meinen kleinen Bruder einmal besuchte, etwa zehn Jahre später, noch immer oben hängen sehen.
Mein Freund Frankenberg war das erste Opfer des Krieges, das ich zu Gesicht bekam.
In Lichterfelde gefiel es mir schon bedeutend besser. Man war nicht mehr so abgeschnitten von der Welt und fing auch schon an, etwas mehr als Mensch zu leben.
Meine schönsten Erinnerungen aus Lichterfelde sind die großen Korso-Wettspiele, bei denen ich sehr viel mit und gegen den Prinzen Friedrich Karl gefochten habe.
Friedrich Karl von Preußen, * 13. März 1919 im Jagdschloss Glienicke – † 19. Juni 2006 auf Mallorca, war ein Mitglied des ehemaligen preußischen Königshauses der Hohenzollern.
Der Prinz erwarb sich damals so manchen ersten Preis. So im Wettlauf, Fußballspiel usw. gegen mich, der ich meinen Körper doch nicht so in der Vollendung trainiert hatte wie er.
* * *
Eintritt in die Armee – Ostern 1911
Eintritt in die Armee – Ostern 1911
https://www.projekt-gutenberg.org/richthof/rotbaron/chap003.html
Natürlich konnte ich es kaum erwarten, in die Armee eingestellt zu werden. Ich ging deshalb bereits nach meinem Fähnrich-Examen in die Front und kam zum Ulanen-Regiment Nr. 1 „Kaiser Alexander III.“.
Ich hatte mir dieses Regiment ausgesucht; es lag in meinem lieben Schlesien, auch hatte ich da einige Bekannte und Verwandte, die mir sehr dazu rieten.
Der Dienst bei meinem Regiment gefiel mir ganz kolossal. Es ist eben doch das schönste für einen jungen Soldaten, „Kavallerist“ zu sein.
Über meine Kriegsschulzeit kann ich eigentlich wenig sagen. Sie erinnerte mich zu sehr an das Kadettenkorps und ist mir infolgedessen in nicht allzu angenehmer Erinnerung.
Eine spaßige Sache erlebte ich. Einer meiner Kriegsschullehrer kaufte sich eine ganz nette dicke Stute. Der einzige Fehler war, sie war schon etwas alt. Er kaufte sie für fünfzehn Jahre. Sie hatte etwas dicke Beine. Sonst aber sprang sie ganz vortrefflich. Ich habe sie oft geritten. Sie ging unter dem Namen „Biffy“.
Etwa ein Jahr später beim Regiment erzählte mir mein Rittmeister v. Tr., der sehr sportliebend war, er habe sich ein ganz klobiges Springpferd gekauft. Wir waren alle sehr gespannt auf den „klobigen Springer“, der den seltenen Namen „Biffy“ trug. Ich dachte nicht mehr an die alte Stute meines Kriegsschullehrers. Eines schönen Tages kommt das Wundertier an, und nun soll man sich das Erstaunen vorstellen, dass die gute alte „Biffy“ als achtjährig in dem Stall v. Tr.s sich wieder einfand. Sie hatte inzwischen einige Male den Besitzer gewechselt und war im Preis sehr gestiegen. Mein Kriegsschullehrer hatte sie für fünfzehnhundert Mark gekauft, und v. Tr. hatte sie nach einem Jahr als achtjährig für dreitausendfünfhundert Mark erworben. Gewonnen hat sie keine Springkonkurrenz mehr, aber sie hat wieder einen Abnehmer gefunden – und ist gleich zu Beginn des Krieges gefallen.
* * *
Erste Offizierszeit – Herbst 1912
Erste Offizierszeit – Herbst 1912
https://www.projekt-gutenberg.org/richthof/rotbaron/chap004.html
Endlich bekam ich die Epaulettes. So ungefähr das stolzeste Gefühl, was ich je gehabt habe, mit einem Mal „Herr Leutnant“ angeredet zu werden.
Mein Vater kaufte mir eine sehr schöne Stute, „Santuzza“ genannt. Sie war das reinste Wundertier und unverwüstlich. Ging vor dem Zug wie ein Lamm. Allmählich entdeckte ich in ihr ein großes Springvermögen. Sofort war ich dazu entschlossen, aus der guten braven Stute ein Springpferd zu machen. Sie sprang ganz fabelhaft. Ein Koppel-Rick von einem Meter sechzig Zentimeter habe ich mit ihr selbst gesprungen.
Ich fand große Unterstützung und viel Verständnis bei meinem Kameraden von Wedel, der mit seinem Chargenpferd „Fandango“ so manchen schönen Preis davongetragen hatte.
So trainierten wir beide für eine Springkonkurrenz und einen Geländeritt in Breslau. „Fandango“ machte sich glänzend, „Santuzza“ gab sich große Mühe und leistete auch Gutes. Ich hatte Aussichten, etwas mit ihr zu schaffen. Am Tag, bevor sie verladen wurde, konnte ich es mir nicht verkneifen, nochmals alle Hindernisse in unserem Springgarten mit ihr zu nehmen. Dabei schlitterten wir hin. „Santuzza“ quetschte sich etwas ihre Schulter, und ich knackte mir mein Schlüsselbein an.
Von meiner guten dicken Stute „Santuzza“ verlangte ich im Training auch Leistungen auf Geschwindigkeit und war sehr erstaunt, als von Wedels Vollblüter sie schlug.
Ein andermal hatte ich das Glück, bei der Olympiade in Breslau einen sehr schönen Fuchs zu reiten. Der Geländeritt fing an, und mein Wallach war im zweiten Drittel noch ganz und munter, so dass ich Aussichten auf Erfolg hatte. Da kommt das letzte Hindernis. Ich sah schon von weitem, dass dies etwas ganz Besonderes sein musste, da sich eine Unmenge Volks dort angesammelt hatte. Ich dachte mir: „Nur Mut, die Sache wird schon schief gehen!“ und kam in windender Fahrt den Damm heraufgesaust, auf dem ein Koppel-Rick stand. Das Publikum winkte mir immer zu, ich sollte nicht so schnell reiten, aber ich sah und hörte nichts mehr. Mein Fuchs nimmt das Koppel-Rick oben auf dem Damm, und zu meinem größten Erstaunen geht's auf der anderen Seite in die Weistritz. Ehe ich mich versah, springt das Tier in einem Riesensatz den Abhang herunter, und Ross und Reiter verschwinden in den Fluten. Natürlich gingen wir „über Kopf“. „Felix“ kam auf dieser Seite raus und Manfred auf der anderen. Beim Zurückwiegen nach Schluss des Geländerittes stellte man mit großem Erstaunen fest, dass ich nicht die üblichen zwei Pfund abgenommen hatte, sondern zehn Pfund schwerer geworden war. Dass ich glitschenass war, sah man mir Gott sei Dank nicht an.
Ich besaß auch einen sehr guten Charger, und dieses Unglückstier musste alles machen. Rennen laufen, Geländeritte, Springkonkurrenzen, vor dem Zug gehen, kurz und gut, es gab keine Übung, in der das gute Tier nicht ausgebildet war. Das war meine brave „Blume“. Auf ihr hatte ich sehr nette Erfolge. Mein letzter ist der im Kaiserpreis-Ritt 1913. Ich war der einzige, der die Geländestrecke ohne Fehler überwunden hatte. Mir passierte dabei eine Sache, die nicht so leicht nachgemacht werden wird. Ich galoppierte über eine Heide und stand plötzlich Kopf. Das Pferd war in ein Karnickelloch getreten, und ich hatte mir beim Sturz das Schlüsselbein gebrochen. Damit war ich noch siebzig Kilometer geritten, hatte dabei keinen Fehler gemacht und die Zeit innegehalten.
* * *
Kriegsausbruch
Kriegsausbruch
In allen Zeitungen stand weiter nichts als dicke Romane über den Krieg. Aber seit einigen Monaten war man ja schon an das Kriegsgeheul gewöhnt. Wir hatten schon so oft unseren Dienstkoffer gepackt, dass man es schon langweilig fand und nicht mehr an einen Krieg glaubte. Am wenigsten aber glaubten wir an einen Krieg, die wir die ersten an der Grenze waren, das „Auge der Armee“, wie seinerzeit mein Kommandierender uns Kavalleriepatrouillen bezeichnet hatte.
Am Vorabend der erhöhten Kriegsbereitschaft saßen wir bei der detachierten Schwadron, zehn Kilometer von der Grenze entfernt, in unserem Kasino, aßen Austern, tranken Sekt und spielten ein wenig. Wir waren sehr vergnügt. Wie gesagt, an einen Krieg dachte keiner.
Hasso von Wedel, * 20. November 1898 in Stargard in Pommern –m † 3. Januar 1961 in Gehrden, war ein deutscher Offizier, zuletzt Generalmajor.
Wedels Mutter hatte uns zwar schon einige Tage zuvor etwas stutzig gemacht; sie war nämlich aus Pommern erschienen, um ihren Sohn vor dem Krieg noch einmal zu sehen. Da sie uns in angenehmster Stimmung fand und feststellen musste, dass wir nicht an Krieg dachten, konnte sie nicht umhin, uns zu einem anständigen Frühstück einzuladen.
Wir waren gerade sehr ausgelassen, als sich plötzlich die Tür öffnete und Graf Kospoth, der Landrat von Öls, auf der Schwelle stand.
Karl August Graf von Kospoth, * 22. Oktober 1836 in Briese, Provinz Schlesien – † 21. März 1928 ebenda, war fünfter Fideikommissherr.
Der Graf machte ein entgeistertes Gesicht.
Wir begrüßten den alten Bekannten mit einem Hallo! Er erklärte uns den Zweck seiner Reise, nämlich, dass er sich an der Grenze persönlich überzeugen wolle, was von den Gerüchten von dem nahen Weltkrieg stimme. Er nahm ganz richtig an, die an der Grenze müssten es eigentlich am ehesten wissen. Nun war er ob des Friedensbildes nicht wenig erstaunt. Durch ihn erfuhren wir, dass sämtliche Brücken Schlesiens bewacht wurden und man bereits an die Befestigung von einzelnen Plätzen dachte.
Schnell überzeugten wir ihn, dass ein Krieg ausgeschlossen sei, und feierten weiter.
Am nächsten Tag rückten wir ins Feld.
* * *
Überschreiten der Grenze
Überschreiten der Grenze
Das Wort „Krieg“ war uns Grenzkavalleristen zwar geläufig. Jeder wusste haarklein, was er zu tun und zu lassen hatte. Keiner hatte aber so eine rechte Vorstellung, was sich nun zunächst abspielen würde. Jeder aktive Soldat war selig, nun endlich seine Persönlichkeit und sein Können zeigen zu dürfen.
Uns jungen Kavallerieleutnants war wohl die interessanteste Tätigkeit zugedacht: aufklären, in den Rücken des Feindes gelangen, wichtige Anlagen zerstören; alles Aufgaben, die einen ganzen Kerl verlangen.
Meinen Auftrag in der Tasche, von dessen Wichtigkeit ich mich durch langes Studium schon seit einem Jahr überzeugt hatte, ritt ich nachts um zwölf Uhr an der Spitze meiner Patrouille zum ersten Mal gegen den Feind.
Die Grenze bildete ein Fluss, und ich konnte erwarten, dass ich dort zum ersten Mal Feuer bekommen würde. Ich war ganz erstaunt, wie ich ohne Zwischenfall die Brücke passieren konnte. Ohne weitere Ereignisse erreichten wir den mir von Grenzritten her wohlbekannten Kirchturm des Dorfes Kielcze (Russisch-Polen) am nächsten Morgen.
Ohne von einem Gegner etwas gemerkt zu haben oder vielmehr besser ohne selbst bemerkt worden zu sein, war alles verlaufen. Wie sollte ich es anstellen, dass mich die Dorfbewohner nicht bemerkten? Mein erster Gedanke war, den Popen hinter Schloss und Riegel zu setzen. So holten wir den vollkommen überraschten und höchst verdutzten Mann aus seinem Haus. Ich sperrte ihn zunächst mal auf dem Kirchturm ins Glockenhaus ein, nahm die Leiter weg und ließ ihn oben sitzen. Ich versicherte ihm, dass, wenn auch nur das geringste feindselige Verhalten der Bevölkerung sich bemerkbar machen sollte, er sofort ein Kind des Todes sein würde. Ein Posten hielt Ausschau vom Turm und beobachtete die Gegend.
Ich hatte täglich durch Patrouillenreiter Meldungen zu schicken. So löste sich bald mein kleines Häuflein an Meldereitern auf, so dass ich schließlich den letzten Melderitt als Überbringer selbst übernehmen musste.
Bis zur fünften Nacht war alles ruhig geblieben. In dieser kam plötzlich der Posten zu mir zum Kirchturm gelaufen – denn in dessen Nähe hatte ich meine Pferde hingestellt – und rief mir zu: „Kosaken sind da!“ Es war pechfinster, etwas Regen, keine Sterne. Man sah die Hand nicht vor den Augen.
Wir führten die Pferde durch eine schon vorher vorsichtshalber durch die Kirchhofsmauer geschlagene Bresche auf das freie Feld. Dort war man infolge der Dunkelheit nach fünfzig Metern in vollständiger Sicherheit. Ich selbst ging mit dem Posten, den Karabiner in der Hand, nach der bezeichneten Stelle, wo die Kosaken sein sollten.
Ich schlich an der Kirchhofsmauer entlang und kam an die Straße. Da wurde mir doch etwas anders zumute, denn der ganze Dorfausgang wimmelte von Kosaken. Ich guckte über die Mauer, hinter der die Kerle ihre Pferde stehen hatten. Die meisten hatten Blendlaternen und benahmen sich sehr unvorsichtig und laut. Ich schätzte sie auf etwa zwanzig bis dreißig. Einer war abgesessen und zum Popen gegangen, den ich am Tag vorher aus der Haft entlassen hatte.
Natürlich Verrat! zuckte es mir durchs Gehirn. Also doppelt aufpassen. Auf einen Kampf konnte ich es nicht mehr ankommen lassen, denn mehr als zwei Karabiner hatte ich nicht zur Verfügung. Also spielte ich „Räuber und Gendarm“.
Nach einigen Stunden Rast ritten die Besucher wieder von dannen.
Am nächsten Morgen zog ich es vor, jetzt aber doch einen kleinen Quartierwechsel vorzunehmen. Am siebenten Tag war ich wieder in meiner Garnison und wurde von jedem Menschen angestarrt, als sei ich ein Gespenst. Das kam nicht etwa wegen meines unrasierten Gesichts, sondern vielmehr weil sich Gerüchte verbreitet hatten, Wedel und ich seien bei Kalisch gefallen. Man wusste Ort, Zeit und nähere Umstände so haargenau zu erzählen, dass sich das Gerücht schon in ganz Schlesien verbreitet hatte. Selbst meiner Mutter hatte man bereits Kondolenzbesuche gemacht.
Es fehlte nur noch, dass eine Todesanzeige in der Zeitung stand.
* * *
Eine komische Geschichte ereignete sich zur selben Zeit. Ein Pferdedoktor bekam den Auftrag, mit zehn Ulanen Pferde aus einem Gehöft zu requirieren. Es lag etwas abseits, etwa drei Kilometer. Ganz erregt kam er von seinem Auftrag zurück und berichtete selber folgendes:
„Ich reite über ein Stoppelfeld, auf dem die Puppen stehen, worauf ich plötzlich in einiger Entfernung feindliche Infanterie erkenne. Kurz entschlossen ziehe ich den Säbel, rufe meinen Ulanen zu: ‚Lanze gefällt, zur Attacke, marsch, marsch, hurra!‘ Den Leuten macht es Spaß, es beginnt ein wildes Hetzen über die Stoppeln. Die feindliche Infanterie entpuppt sich aber als ein Rudel Rehe, die ich in meiner Kurzsichtigkeit verkannt habe.“
Noch lange hatte der tüchtige Herr unter seiner Attacke zu leiden.
Abgeschossen und an der Starkstromleitung verbrannt.
Am Kanal zwischen Brebières und Vitry
Abgeschossener Vikkers-Zweisitzer bei Noyelle-Godault
* * *
Nach Frankreich
Nach Frankreich
In meinem Garnisonort wurden wir nun verladen. Wohin? – Keine Ahnung, ob West, Ost, Süd, Nord.
Gemunkelt wurde viel, meistens aber vorbei. Aber in diesem Fall hatten wir wohl den richtigen Riecher: Westen.
Uns stand zu viert ein Abteil zweiter Klasse zur Verfügung. Man musste sich auf eine lange Bahnfahrt verproviantieren. Getränke fehlten natürlich nicht. Aber schon am ersten Tag merkten wir, dass so ein Abteil zweiter Klasse doch verflucht eng ist für vier kriegsstarke Jünglinge, und so zogen wir denn vor, uns etwas mehr zu verteilen. Ich richtete mir die eine Hälfte eines Packwagens zur Wohn- und Schlafstätte ein und hatte damit ganz entschieden etwas Gutes getan. Ich hatte Luft, Licht usw. Stroh hatte ich mir in einer Station verschafft, die Zeltbahn wurde darauf gedeckt. Ich schlief in meinem Schlafwagen so fest, als läge ich in Ostrowo in meinem Familienbett. Die Fahrt ging Tag und Nacht, erst durch ganz Schlesien, Sachsen, immer mehr gen Westen. Wir hatten scheinbar Richtung Metz; selbst der Transportführer wusste nicht, wo es hinging. Auf jeder Station, auch da, wo wir nicht hielten, stand ein Meer von Menschen, die uns mit Hurra und Blumen überschütteten. Eine wilde Kriegsbegeisterung lag im deutschen Volk; das merkte man. Die Ulanen wurden besonders angestaunt. Der Zug, der vorher durch die Station geeilt war, mochte wohl verbreitet haben, dass wir bereits am Feind gewesen waren – und wir hatten erst acht Tage Krieg. Auch hatte im ersten Heeresbericht bereits mein Regiment Erwähnung gefunden. Ulanen-Regiment 1 und das Infanterieregiment 155 eroberten Kalisch.
Wir waren also die gefeierten Helden und kamen uns auch ganz als solche vor. Wedel hatte ein Kosakenschwert gefunden und zeigte dies den erstaunten Mädchen. Das machte großen Eindruck. Wir behaupteten natürlich, es klebte Blut daran, und dichteten dem friedlichen Schwert eines Gendarmerie-Häuptlings ein ganz ungeheures Märchen an. Man war doch schrecklich ausgelassen. Bis wir schließlich in Busendorf bei Diedenhofen ausgeladen wurden.
Kurz bevor der Zug ankam, hielten wir in einem langen Tunnel. Ich muss sagen, es ist schon ungemütlich, in einem Tunnel in Friedenszeiten plötzlich zu halten, besonders aber im Krieg. Nun erlaubte sich ein Übermütiger einen Scherz und gab einen Schuss ab. Es dauerte nicht lange, so fing in diesem Tunnel ein wüstes Geschieße an. Dass keiner verletzt wurde, ist ein Wunder. Was die Ursache dazu war, ist nie herausgekommen.
In wurde ausgeladen. Es war eine derartige Hitze, dass uns die Pferde umzufallen drohten. Die nächsten Tage marschierten wir immer nach Norden, Richtung Luxemburg. Mittlerweile hatte ich herausgekriegt, dass mein Bruder vor etwa acht Tagen dieselbe Strecke mit einer Kavalleriedivision geritten war. Ich konnte ihn sogar noch einmal fährten, gesehen habe ich ihn erst ein Jahr später.
In Luxemburg wusste kein Mensch, wie sich dieses Ländchen gegen uns verhielt. Ich weiß noch wie heute, wie ich einen Luxemburger Gendarm von weitem sah, ihn mit meiner Patrouille umzingelte und gefangen nehmen wollte. Er versicherte mir, dass, wenn ich ihn nicht umgehend losließe, er sich beim Deutschen Kaiser beschweren würde. Das sah ich denn auch ein und ließ den Helden wieder laufen. So kamen wir durch die Stadt Luxemburg und Esch durch, und man näherte sich jetzt bedenklich den ersten befestigten Städten Belgiens.
Auf dem Hinmarsch machte unsere Infanterie, wie überhaupt unsere ganze Division, die reinen Friedensmanöver. Man war schrecklich aufgeregt. Aber so ein Manöver-Vorpostenbild war einem ab und zu ganz bekömmlich. Sonst hätte man ganz bestimmt über die Stränge geschlagen. Rechts und links, auf jeder Straße, vor und hinter uns marschierten Truppen von verschiedenen Armeekorps. Man hatte das Gefühl eines wüsten Durcheinanders. Plötzlich wurde aus dem Kuddelmuddel ein großartig funktionierender Aufmarsch.
Was unsere Flieger damals leisteten, ahnte ich nicht. Mich versetzte jedenfalls jeder Flieger in einen ganz ungeheuren Schwindel. Ob es ein deutscher war oder ein feindlicher, konnte ich nicht sagen. Ich hatte ja nicht einmal eine Ahnung, dass die deutschen Apparate Kreuze trugen und die feindlichen Kreise. Folglich wurde jeder Flieger unter Feuer genommen. Die alten Piloten erzählen heute noch immer, wie peinlich es ihnen gewesen sei, von Freund und Feind gleichmäßig beschossen zu werden.
Wir marschierten und marschierten, die Patrouillen weit voraus, bis wir eines schönen Tages bei Arlon waren. Es überlief mich ganz spaßig den Buckel 'runter, wie ich zum zweiten Mal die Grenze überschritt. Dunkle Gerüchte von Franktireurs (Heckenschützen) und dergleichen waren mir bereits zu Ohren gekommen.
* * *
Ich hatte einmal den Auftrag, die Verbindung mit meiner Kavalleriedivision aufzunehmen. Ich habe an diesem Tag nicht weniger als hundertzehn Kilometer mit meiner gesamten Patrouille geritten. Nicht ein Pferd war kaputt, eine glänzende Leistung meiner Tiere. In Arlon bestieg ich nach den Grundsätzen der Taktik des Friedens den Kirchturm, sah natürlich nichts, denn der böse Feind war noch weitab.
Man war damals noch ziemlich harmlos. So hatte ich z. B. meine Patrouille vor der Stadt stehenlassen und war ganz allein mit einem Rad mitten durch die Stadt zum Kirchturm gefahren. Wie ich wieder 'runterkam, stand ich inmitten einer murrenden und murmelnden Menge feindselig blickender Jünglinge. Mein Rad war natürlich geklaut, und ich konnte nun eine halbe Stunde lang zu Fuß laufen. Aber das machte mir Spaß. Ich hätte so eine kleine Rauferei ganz gern gemocht. Ich fühlte mich mit meiner Pistole in der Hand ganz kolossal sicher.
Die Einwohner hatten sich, wie ich später erfahren habe, sowohl einige Tage vorher gegen unsere Kavallerie als auch später gegen unsere Lazarette sehr aufrührerisch benommen, und man hatte eine ganze Menge dieser Herren an die Wand stellen müssen.
* * *
Am Nachmittag erreichte ich mein Ziel und erfuhr dort, dass drei Tage vorher, ganz in der Gegend von Arlon, mein einziger Vetter Richthofen gefallen war. Ich blieb den Rest des Tages bei der Kavalleriedivision, machte dort noch einen blinden Alarm mit und kam nachts spät bei meinem Regiment an.
Man erlebte und sah eben mehr als die anderen, man war eben doch schon mal am Feind gewesen, hatte mit dem Feind zu tun gehabt, hatte die Spuren des Krieges gesehen und wurde von jedem einer anderen Waffe beneidet. Es war doch zu schön, wohl doch meine schönste Zeit im ganzen Krieg. Den Kriegsanfang möchte ich wieder mal mitmachen.
* * *
21./22. August 1914
Wie ich auf Patrouille zum ersten Mal die Kugeln pfeifen hörte
21./22. August 1914
Ich hatte den Auftrag, festzustellen, wie stark die Besetzung eines großen Waldes bei Virton wohl sein mochte. Ich ritt mit fünfzehn Ulanen los und war mir klar: Heute gibt es den ersten Zusammenstoß mit dem Feind. Mein Auftrag war nicht leicht, denn in so einem Wald kann furchtbar viel stecken, ohne dass man es sieht.
Ich kam über eine Höhe. Wenige hundert Schritte vor mir lag ein riesiger Waldkomplex von vielen tausend Morgen. Es war ein schöner Augustmorgen. Der Wald lag so friedlich und ruhig, dass man eigentlich gar keine kriegerischen Gedanken mehr spürte.
Jetzt näherte sich die Spitze dem Eingang des Waldes. Durch das Glas konnte man nichts Verdächtiges feststellen, man musste also heranreiten und abwarten, ob man Feuer bekäme. Die Spitze verschwand im Waldweg. Ich war der nächste, neben mir ritt einer meiner tüchtigsten Ulanen. Am Eingang des Waldes war ein einsames Waldwärterhäuschen. Wir ritten daran vorbei. Mit einem Mal fiel ein Schuss aus einem Fenster des Hauses. Gleich darauf noch einer. Am Knall erkannte ich sofort, dass es kein Büchsenschuss war, sondern dass er von einer Flinte herrührte. Zur gleichen Zeit sah ich auch Unordnung in meiner Patrouille und vermutete gleich einen Überfall durch Franktireurs. Von den Pferden 'runter und das Haus umstellen war eins. In einem etwas dunkeln Raum erkannte ich vier bis fünf Burschen mit feindseligen Augen. Eine Flinte war natürlich nicht zu sehen. Meine Wut war groß in diesem Augenblick; aber ich hatte noch nie in meinem Leben einen Menschen getötet, und so muss ich sagen, war mir der Moment äußerst unbehaglich. Eigentlich hätte ich den Franktireur wie ein Stück Vieh 'runterknallen müssen. Er hatte mit dem Schuss eine Ladung Schrot in den Bauch eines meiner Pferde gejagt und einen meiner Ulanen an der Hand verletzt.
Mit meinem kümmerlichen Französisch schrie ich die Bande an und drohte, wenn sich der Schuldige nicht umgehend melden würde, sie allesamt über den Haufen zu schießen. Sie merkten, dass es mir Ernst war, und dass ich nicht zaudern würde, meinen Worten die Tat folgen zu lassen. Wie es nun eigentlich kam, weiß ich heute selbst nicht mehr. Jedenfalls waren die Freischützen mit einem Mal aus der Hintertür heraus und vom Erdboden verschwunden. Ich schoss noch hinterher, ohne zu treffen. Zum Glück hatte ich das Haus umstellt, so dass sie mir eigentlich nicht entrutschen konnten. Sofort ließ ich das Haus nach ihnen durchstöbern, fand aber keinen mehr. Mochten nun die Posten hinter dem Haus nicht ordentlich aufgepasst haben, jedenfalls war die ganze Bude leer. Wir fanden noch die Schrotspritze am Fenster stehend und mussten uns auf andere Weise rächen. In fünf Minuten stand das ganze Haus in Flammen.
Nach diesem Intermezzo ging es weiter.
An frischen Pferdespuren erkannte ich, dass unmittelbar vor uns starke feindliche Kavallerie marschiert sein musste. Ich hielt mit meiner Patrouille, feuerte sie durch ein paar Worte an und hatte das Gefühl, dass ich mich auf jeden meiner Kerls unbedingt verlassen konnte. Jeder, so wusste ich, würde seinen Mann in den nächsten Minuten stehen. Natürlich dachte keiner an etwas anderes als an eine Attacke. Es liegt wohl im Blut eines Germanen, den Gegner, wo man ihn auch trifft, über den Haufen zu rennen, besonders natürlich feindliche Kavallerie. Schon sah ich mich an der Spitze meines Häufleins eine feindliche Schwadron zusammenhauen und war ganz trunken vor freudiger Erwartung. Meinen Ulanen blitzten die Augen. So ging es dann in flottem Trab auf der frischen Spur weiter. Nach einstündigem scharfem Ritt durch die schönste Bergschlucht wurde der Wald etwas lichter, und wir näherten uns dem Ausgang. Dass ich damit auf den Feind stoßen würde, war mir klar. Also Vorsicht! bei allem Attacken-Mut, der mich beseelte. Rechts von dem schmalen Pfad war eine viele Meter hohe, steile Felsenwand. Zu meiner Linken war ein schmaler Gebirgsbach, dann eine Wiese von fünfzig Metern Breite, eingefasst von Stacheldrähten. Mit einem Mal hörte die Pferdespur auf und verschwand über eine Brücke in den Büschen. Meine Spitze hielt, denn vor uns war der Waldausgang durch eine Barrikade versperrt.
Sofort war es mir klar, dass ich in einen Hinterhalt geraten war. Ich erkannte plötzlich Bewegung im Buschwerk hinter der Wiese zu meiner Linken und konnte abgesessene feindliche Kavallerie erkennen. Ich schätzte sie auf eine Stärke von hundert Gewehren. Hier war nichts zu wollen. Geradeaus war der Weg durch die Barrikade versperrt, rechts waren die Felswände, links hinderte mich die mit Draht eingefasste Wiese an meinem Vorhaben, der Attacke. Zum Absitzen, um den Gegner mit Karabinern anzugreifen, war keine Zeit mehr. Also blieb nichts anderes übrig, als zurück. Alles hätte ich meinen guten Ulanen zutrauen können, bloß kein Ausreißen vor dem Feind. – Das sollte so manchem den Spaß verderben, denn eine Sekunde später knallte der erste Schuss, dem ein rasendes Schnellfeuer aus dem Wald drüben folgte. Die Entfernung betrug etwa fünfzig bis hundert Meter. Die Leute waren instruiert, dass sie, im Fall ich die Hand hob, schnell zu mir stoßen sollten. Nun wusste ich, wir mussten zurück, hob den Arm und winkte meinen Leuten zu. Das mögen sie wohl falsch verstanden haben. Meine Patrouille, die ich zurückgelassen hatte, glaubte mich in Gefahr und kam in wildem Karacho herangebraust, um mich herauszuhauen. Alles das spielte sich auf einem schmalen Waldweg ab, so dass man sich wohl die Schweinerei vorstellen kann, die sich nun ereignete. Meinen beiden Spitzenreitern gingen die Pferde infolge des rasenden Feuers in der engen Schlucht, wo der Laut jedes Schusses sich verzehnfachte, durch, und ich sah sie bloß die Barrikade mit einem Sprung nehmen. Von ihnen habe ich nie wieder etwas gehört. Gewiss sind sie in Gefangenschaft. Ich selbst machte kehrt und gab meinem guten „Antithesis“, wohl zum ersten Mal in seinem Leben, die Sporen. Meinen Ulanen, die mir entgegengebraust kamen, konnte ich nur mit Mühe und Not zu erkennen geben, nicht weiter vorzukommen. Kehrt und davon! Neben mir ritt mein Bursche. Plötzlich stürzte sein Pferd getroffen, ich sprang darüber hinweg, um mich herum wälzten sich andere Pferde. Kurz und gut, es war ein wüstes Durcheinander. Von meinem Burschen sah ich nur noch, wie er unter dem Pferd lag, scheinbar nicht verwundet, aber durch das auf ihm liegende Pferd gefesselt. Der Gegner hatte uns glänzend überrumpelt. Er hatte uns wohl von Anfang an beobachtet und, wie es den Franzosen nun mal liegt, aus dem Hinterhalt seinen Feind zu überfallen, so hatte er es auch in diesem Fall wieder versucht.
Freude machte es mir, als nach zwei Tagen mit einem Mal mein Bursche vor mir stand; allerdings zur Hälfte barfüßig, denn den einen Stiefel hatte er unter seinem Pferd gelassen. Er erzählte mir nun, wie er entkommen war: Mindestens zwei Schwadronen französischer Kürassiere waren später aus dem Wald gekommen, um die vielen gefallenen Pferde und tapferen Ulanen zu plündern. Er war gleich aufgesprungen, unverwundet die Felsenwand hinaufgeklettert und in fünfzig Metern Höhe vollständig erschöpft in einem Gebüsch zusammengebrochen. Nach etwa zwei Stunden, nachdem der Feind sich wieder in seinen Hinterhalt begeben hatte, hatte er seine Flucht fortsetzen können. Nach einigen Tagen gelangte er so wieder zu mir. Von dem Verbleib der anderen Kameraden konnte er wenig aussagen.
* * *
Patrouillenritt mit Loen
Patrouillenritt mit Loen