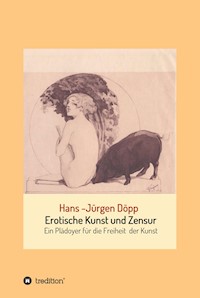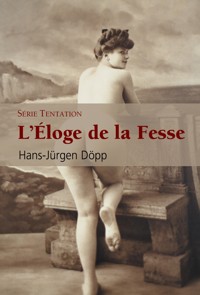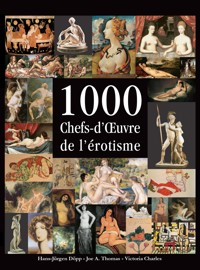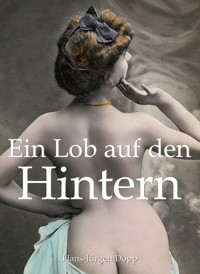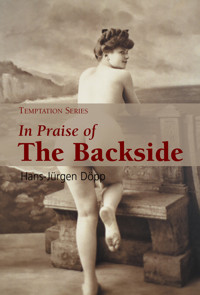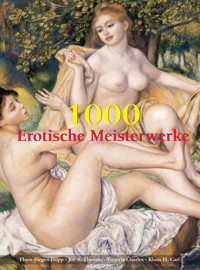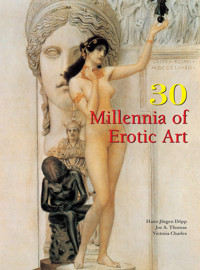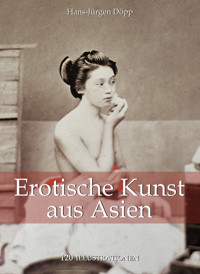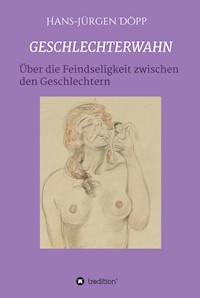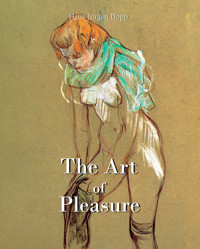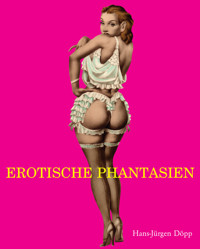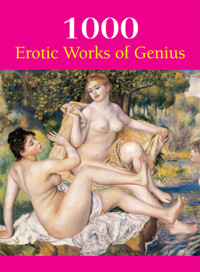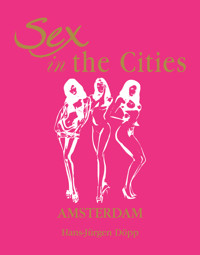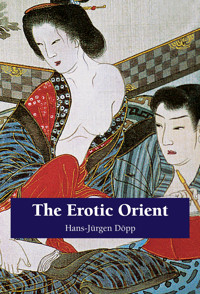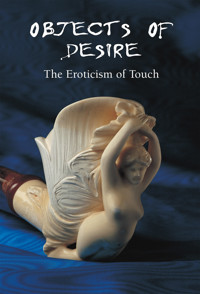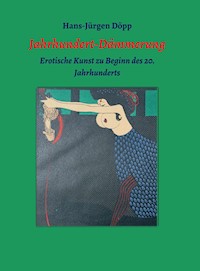
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Konträr stehen nebeneinander: Sigmund Freuds erhellende "Traumdeutung" aus dem Jahr 1900 - und die düstere Lithographie von Otto Greiner, "Der Mörser", erschienen 1900. Das Datum 1900 erscheint als Merkzeichen des Übergangs: Man sieht sich im Übergang zweier Zeitalter. Mit dem Beginn des neuen Jahrhunderts hebt in Deutschland eine erotische Bilderproduktion an, die Ausdruck eines neuen Lebensgefühles ist, das sich auch in einer neuen Kunstauffassung niederschlägt. Bislang ins Unbewusste verdrängte sexuelle Wünsche drängen ans Tageslicht und werden in der Kunst zur Darstellbarkeit gebracht. Diese produktive kulturelle Atmosphäre soll in den beiden Essays von Hans-Jürgen Döpp und Isabelle Azoulay anhand von Äußerungen von Schriftstellern, Soziologen, Künstlern u.a. skizziert werden mit dem Ziel, den Aufbruch verständlich zu machen. Zugleich wird zu erklären versucht, warum sich so viel Düsteres in diesem Aufbruch zeigte. Die Geschichte der erotischen Kunst beginnt in Deutschland, der »verspäteten Nation« mit recht dunklen Bildern. Beispiele aus der Geschichte der Erotischen Kunst illustrieren die beiden Essays.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 47
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Willi Geiger, „Geburt auf hoher See“, Tuschzeichnung, 1905
Impressum:
© Sammlung Hans-Jürgen Döpp, Frankfurt 2020
www.aspasia.de
© Isabelle Azoulay, Berlin
ISBN: 978-3-347-08000-3 (Paperback)
978-3-347-08002-7 (e-Book)
Verlag und Druck: tredition GmbH, Halenreie 40 – 44, 22 359 Hamburg
Der Essay „Jahrhundert-Dämmerung“ wurde zuerst publiziert in dem Buch „Liebe im Kapitalismus, hg.v. H.-J.Busch und A.Ebrecht, Gießen 2008
Hans-Jürgen Döpp
Jahrhundert-Dämmerung
Erotische Kunst zu Beginn des 20. Jahrhunderts
Mit einem Essay von Isabelle Azoulay,
Deutsche erotische Graphik 1900- 1920
Otto Greiner, „Der Mörser“, Lithographie 1900
Hans-Jürgen Döpp
Jahrhundert-Dämmerung
Erotische Kunst zu Beginn des 20. Jahrhunderts
elten waren Aufschwung und Umbruch so hautnah zu spüren. Stefan Zweig erwähnt in seinem Buch Die Welt von Gestern den Optimismus und das Weltvertrauen, das die jungen Menschen seit der Jahrhundertwende beseelte. Ein Aufschwung begann, der in allen Ländern Europas fast gleichmäßig zu spüren war.
»Eine wunderbare Unbesorgtheit war damit über die Welt gekommen, denn was sollte diesen Aufschwung unterbrechen, was den Elan hemmen, der aus seinem eigenen Schwung immer neue Kräfte zog? Nie war Europa stärker, reicher, schöner, nie glaubte es inniger an eine noch bessere Zukunft« (Zweig 1999, S. 224).
Die ganze Generation entschloss sich, jugendlicher zu werden. Jungsein, Frischsein wurde die Parole, nicht länger das »Würdig-Tun«.
Mit dem Beginn des neuen Jahrhunderts hebt in Deutschland eine erotische Bilderproduktion an, die Ausdruck eines neuen Lebensgefühles ist, das sich auch in einer neuen Kunstauffassung niederschlägt. Diese produktive kulturelle Atmosphäre soll im Folgenden anhand von Äußerungen von Schriftstellern, Soziologen, Künstlern u.a. skizziert werden mit dem Ziel, den Aufbruch verständlich zu machen, zugleich aber auch, warum sich so viel Düsteres in diesem Aufbruch zeigte. Dass ein Bild, wie das vorangestellte von Otto Greiner, im gleichen Jahr erschien wie Freuds Traumdeutung (1900), wird sich als kein Zufall erweisen.
Optimismus und Melancholie
Das Datum 1900 erscheint als Merkzeichen des Übergangs: Man sieht sich im Übergang zweier Zeitalter. Ende und Aufbruch mischen sich im Zeitbewusstsein: Jugendlichkeit wird kontrastiert durch »Decadence«, Vitalismus durch Morbidität, Technik- und Großstadt-Euphorie durch Technik- und Großstadt-Flucht. Diese Kontrastphänomene sind geradezu konstituierend für das Fin de Siécle. 1900: Um diese Zeit überlagern sich zwei kulturelle Kampfzonen. Das Neue scheint auf, ohne schon gekräftigt zu sein; und das Alte kämpft noch um seinen Erhalt. Das Leben blüht auf, doch im aufblühenden Leben ist zugleich der Verfall zu erkennen. Der kleine Hanno in Thomas Manns »Buddenbrooks« (1901) versteht es, in allem die Symptome des Verfalls wahrzunehmen und sieht das Leben als Vorgang »des Abbröckelns, des Endens, des Abschließens, der Zersetzung an« (Mann 1974, S. 699). Eine Sichtweise, die für die »Decadence« bezeichnend ist.
Der Soziologe Ferdinand Tönnies hat sich in einer frühen Schrift (1897) mit Nietzsche auseinandergesetzt. Er spricht hier von der »immer sichtbarer werdenden Zerrüttung der modernen Kultur«, von einem »Prozeß der Zersetzung« (Tönnies 1990, S. 20f.). »Daß aber die alten Ordnungen des Lebens […] in ungeheuer beschleunigtem Tempo im jetzt zu Ende gehenden Jahrhundert in Zersetzung begriffen sind«, das, meint er, sei »hinlänglich deutlich« (ebd., S. 101).
»Es ist nicht leicht, jung zu sein in einer alten, satten, regulierten Kultur, die euch vorzeitig vernünftig und altklug macht« (ebd., S. 22) – so redet Tönnies die Jugend an.
Aufbruch mischt sich mit Spätzeit-Bewusstsein. Ende 1896 berichtet Dilthey dem Freund Yorck von Wartenburg von den durch die Konflikte um die Vergabe des Schillerpreises entstandenen geistigen Unruhen in Berlin:
»Sehen müssen Sie. Ein paar Tage in das uferlose und formlose Meer dieser Gegenwart eintauchen. Ein Ding dergleichen seit der Renaissance nicht da war, so formlos, so chaotisch, so in den letzten Tiefen des Menschlichen bewegt, fin de siècle mit Zukunft unfaßlich vermischt« (Dilthey 1974, S. 228).
»Décadent zugleich und neuer Anfang«, diese Selbstbestimmung Nietzsches (1960, S. 1071) ist zugleich die Formel für die Bewusstseinslage am Ende des Jahrhunderts.
Der Fortschrittsglaube, den Stefan Zweig überall am Werke sah, stand nicht auf sicherem Boden: »Wir mussten Freud recht geben, wenn er in unserer Kultur, unserer Zivilisation nur eine dünne Schicht sah, die jeden Augenblick von den destruktiven Kräften der Unterwelt durchstoßen werden kann« (Zweig 1999, S. 19).
So war dieses optimistische Denken begleitet von einer ständigen Analyse des eigenen Bewusstseins, die das Denken melancholisch einfärbte.
Die moderne Ner vosität
Ein beredtes Zeugnis für die Angst, die das Neue erzeugte, war die Entdeckung und Propagierung der Nervosität im 19. Jahrhundert. Für ihre Zunahme machte man die Großstädte und den Fortschritt selbst verantwortlich: Nervenschwäche sei die Folge der mit dem Fortschritt der Kultur veränderten Lebensweise, die den Geist beanspruche und den Körper vernachlässige. Die moderne Kultur wühle die Sinnlichkeit auf und erhitze die Vergnügungssucht.
1893 wurde von einem Expertenteam ein »Handbuch der Neurasthenie« veröffentlicht, das eine Bibliografie mit mehr als 100 Titeln enthielt, die allein in deutscher Sprache seit 1881 erschienen waren! Doch jahrzehntelang blieb es, worauf Peter Gay in seinem Buch Die zarte Leidenschaft hinweist, still um die sexuellen Implikationen der »nervösen Nervositäts-Panik« (Gay 1987, S. 351). Sie wurden ein Opfer der Verdrängung. Erst mit Freuds (1908) Abhandlung über »Kulturelle Sexualmoral und die moderne Nervosität« traten diese sexuellen Aspekte hervor. In seiner Schrift erhob er die erotische Komponente der Neurasthenie zur Hauptursache des Phänomens. Statt, wie bisher, Nervosität als Preis der Kultur zu verstehen, stellte er eine viel irritierendere Diagnose: Nervosität sei der Preis der Verdrängung.
Für Freud reduziert sich der schädigende Einfluss der Kultur im Wesentlichen auf die schädliche Unterdrückung des Sexuallebens der Kulturvölker (oder Schichten) durch die bei ihnen herrschende »kulturelle Sexualmoral«. Ganz allgemein jedoch sei unsere Kultur »auf Unterdrückung von Trieben aufgebaut« (Freud 1908, S. 149). Doch die moderne Mittelschichts-Zivilisation erzwingt exzessive Entsagung. Sie treibt die Selbstverleugnung ins Extrem. Die moderne Nervosität ist der Preis bürgerlicher Sexualverdrängung. Kunst, insbesondere die erotische, begehrte gegen diese Macht der Verdrängung auf.