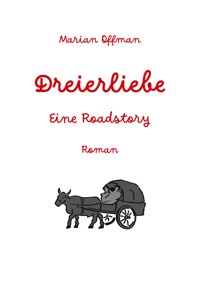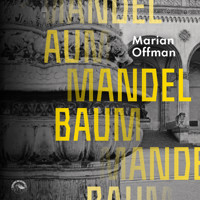Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Pogrom 1285 in München. Der jüdische Tuchhändler Jakov bleibt vom Feuertod in der Synagoge verschont, weil er bei seiner christlichen Freundin Maria die Nacht verbringt. Auf einem Ochsenkarren fliehen sie nach Südtirol und treffen den jüdischen Minnesänger Süskind von Trimberg. Wegen ihres Glaubens werden sie oft ausgegrenzt und müssen um ihr Leben bangen. Auf dem Rückweg retten sie ein Sinti-Mädchen und nehmen es als Tochter an. Es ist auch die Geschichte der Liebe von Maria, Jakov und Süskind, mit unfassbaren Folgen. Obwohl auf der Flucht, erleben sie beglückende Augenblicke im warmen, langen Sommer. Gelingt es der bunten Familie unter feindlich gesonnenen Menschen zu überleben? Rene Hofmann schreibt in der Süddeutschen Zeitung: Mit seinem Roman Jakov der Municher verspricht Marian Offman, eine Roadstory im Mittelalter. Diesem Versprechen wird er gerecht. Und so ungewöhnlich es zunächst klingen mag, Leserinnen und Leser im Jahr 2023 auf die gemütliche Art des Fortkommens mitzunehmen, das Wagnis geht auf. Auf den gut 300 Seiten passiert viel. Jede Begegnung von Jakob und Maria birgt Spannung, ihr Schicksal bleibt stets ungewiss. "Mandelbaum", der erste Roman des Autors, erschien im April 2022. Joachim Käppner schreibt darüber in der Süddeutschen Zeitung: "Offman ist ein begabter Erzähler, spielt (...) mit untergründiger Selbstironie und feinem Humor."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 454
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Handlung und Charaktere sind fiktiv. Die Figur „Süßkind von Trimberg“ ist inspiriert vom Buch des Autors Friedrich Torberg. Das Geschehen im vorliegenden Roman um Süskind ist frei erfunden.
Dieser Roman ist allen jungen Familien auf der Flucht gewidmet.
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Abraham der Municher stirbt
Jakov der Tuchverkäufer
Jakov trifft Maria
Judenpogrom 1285 in München
Flucht aus der Herzogsstadt
Jakov ist beschnitten
Wir kaufen den Ochsenkarren
Jakov isst Schweinefleisch
Zehn Kinder und ein Mönch
Marias Mutter wurde als Hexe verbrannt
Wir treffen Albert Hüfner
Auf Burg Wallstein
Wir treffen Süskind von Trimberg
Liebespaar zu dritt
Süskind singt vor geschundenen Bauern
Fahrt auf die Burg Werdenfels
Süskind singt sein letztes Lied
Flucht aus der Burg
In der Karawane
Süskind flieht mit dem jungen Mädchen
Maria wird geschlagen
Fahrt nach Bozen
Treffen mit Rabbiner Bonisak
Maria und Jakov unter der Chuppa
Ein Sinti-Mädchen überlebte
Honig als Lebensretter
Mönch Arnfried stoppt unsere Fahrt
Zurück in München
Auf dem Weg zur Herzogin
Jakov bekommt einen Schutzbrief
Auf dem St.-Jakobs-Platz
Schutzbrief und Schlüssel zur Münzwerkstatt
Ist Maria guter Hoffnung?
In der Geldleihe
Ein alter Bekannter
Die Geburt
Hoher Besuch
Die Abfahrt
Epilog
Register
Prolog
Heute Abend werde ich eine Inszenierung des neuen Intendanten im Volkstheater ansehen. Er kommt aus Hamburg und sie werden eine Adaption der „Ulysses“ von James Joyce geben. Vor mehr als einem halben Jahrhundert war ich in der Welt des irischen Dichters gefangen. Vielleicht führt mich das Stück zurück in meine Jugendzeit.
Da ich zu früh bin, warte ich an diesem warmen Herbstabend auf einer Bank im Maßmannpark. Gegenüber steht ein Sandkasten. Die Kinder sammeln mit ihren Müttern im milden Licht der untergehenden Sonne verstreute Spielsachen ein. Als meine Tochter in die Schule kam, schrieb ich für sie eine Geschichte über Abraham den Municher, den ersten namentlich bekannten Münchner Juden. Im Mittelalter lag dieser Ort weit vor den Stadtmauern und war für die Juden der Stadt eine geheime Grabstätte.
Je älter ich werde, desto öfter verweile ich in meinen Fantasien. Abraham der Municher wurde einige Monate vor dem Pogrom 1285 beerdigt.
Mein Großvater Jakov, nach dem ich benannt wurde, kam im Holocaust um. Ich schließe meine Augen und sehe mich in der kleinen Synagoge in der Judengasse nach dem Morgengebet. Großvater Abraham starb in den frühen Morgenstunden.
Abraham der Municher stirbt
Wir haben uns um Abrahams Bett versammelt. Es ist früh am Morgen. Er liegt im Sterben. Schon seit Tagen wartet er auf seinen Tod. Er atmet unregelmäßig und röchelt. Ich streiche über seine kühle Stirn. Er blickt mit einem letzten Lächeln ins Leere und geht mit einem tiefen Seufzer von uns. Nathan, mein Vater, verschließt zärtlich seine Augen, senkt den Kopf auf seine Brust und weint leise. Wir sind sehr traurig und planen noch heute, wie das Gesetz es vorschreibt, ihn zu bestatten. Vorher werden wir Großvater in einer kleinen Kammer neben der Synagoge waschen und sein weißes Totengewand anlegen, das er traditionell an den hohen Feiertagen trug.
Vor den Toren der Stadt im Westen befindet sich eine kleine Waldlichtung, ein verborgener kleiner Friedhof. Offiziell dürfen die Juden Münchens ihre Toten nur in Regensburg zu Grabe tragen. Mein Großvater überführte mehrere Male Verstorbene unserer Gemeinde in diese Stadt. Es war stets ein beschwerliches und gefährliches Unterfangen auf den staubigen Landstraßen und dauerte Tage, bis er mit seinen Helfern erschöpft zurückkam. Ihm wird diese letzte lange Reise erspart bleiben. Nun duldet der Rat das Ritual vor den Stadtmauern.
Wir werden ihn am frühen Nachmittag zu unserem von hohen Tannen umgebenen, geheimen Friedhof bringen. Um nicht aufzufallen, gehen wir in einer kleinen Gruppe durch das Kreuzviertel zum Neuhauser Tor und verlassen die Stadt. Abwechselnd ziehen die Männer den Leiterwagen, auf dem über dem Leichnam meines Großvaters Stoffballen verteilt liegen, worüber sich zum Schutz eine dicke Wolldecke befindet. Wir erwecken den Eindruck von Hausierern auf dem Weg zu den Bauern der Umgebung. Die Passanten sehen an unserer Kleidung, dass wir Juden sind, aber ahnen nichts vom letzten Gang meines Großvaters. Wüssten sie von dem Leichnam in diesem Leiterwagen, gäbe es schnell Tumulte und böse Unterstellungen.
So erreichen wir am frühen Nachmittag unbehelligt die Waldlichtung. Wir suchen nach einer freien Stelle und Vater und ich heben abwechselnd mit einer kurzen Schaufel kniend das Grab bis zu einer Tiefe von etwa vier Ellen aus. Es ist kühl geworden an diesem schönen Sommertag. Wir haben den Kaftan abgelegt und nur die Schaufäden unserer kleinen Hemden zittern leicht im Abendwind. Inzwischen sind auf verschiedenen Umwegen weitere Trauernde zu uns gelangt. Nun wird der Leichnam in seinem weißen Sterbemantel auf meinen und meines Vaters Händen sowie mithilfe anderer sanft in das Grab gelegt. Es ist eine letzte Berührung des Toten. Mit Tränen in den Augen schließen wir behutsam das Grab mit der daneben liegenden Erde. Mein Vater spricht das Kaddisch.
Da die Wächter bei uns Juden besondere Strenge walten lassen, sollten wir vor Einbruch der Nacht das Tor erreichen. Dennoch ist es schon stockfinster, als wir müde nach dem beschwerlichen Rückweg davorstehen.
Obwohl wir keine Gäste, sondern Bürger dieser Stadt sind, fordert der Wächter von uns ein höheres Torgeld unter der Androhung, den Inhalt des Leiterwagens zu kontrollieren oder zu beschlagnahmen. Mein Vater zahlt anstandslos die geforderte Summe und legt noch eine Münze drauf. Wir ziehen leise durch das Tor, zurück durch das Kreuzviertel in die Judengasse. In der Synagoge angelangt, verrichten wir das Abendgebet, mein Vater sagt das Kaddisch und darf nun sieben Tage das Haus nicht verlassen.
Jakov der Tuchverkäufer
Leise, mit brüchiger Stimme bittet mein Vater: „Jakov, nimm morgen früh den Barchant aus dem Leiterwagen und trage ihn zu St. Peter. Bleibe dort, bis du die Tücher verkauft hast. Du musst mit uns nicht Schiwa sitzen. Wir brauchen das Geld, denn die Leute des Herzogs sitzen mir wieder im Nacken.“
Die Pfarrei duldet, dass wir in einer Nische an der südlichen Fassade der Kirche unsere Stoffe anbieten. Wir beziehen den Barchant, eine Mischung aus Wolle und Leinen, von meinem Onkel in Ulm. Er hat dort eine Weberei und besucht uns regelmäßig und bringt neue Ware. Ich befreie zunächst die Abdeckung des mehrere Ellen breiten Mauervorsprungs vom Schmutz, belege sie mit einem dicken Filztuch, lagere darauf zwei Stoffballen und warte auf Kundschaft. Neben mir werden in einem Stand Schuhe verkauft. Ich mag den herben Geruch des Leders. Es sind noch einige Stunden bis zum Mittagsläuten, es ist Sommer, die Sonne wärmt die Steinmauer, vor der ich stehe, und von Westen weht ein lauer Wind.
Zwei junge Mägde sprechen mich an. Sie streichen mit ihren Händen sanft über den Stoff, riechen daran, neigen sich nach vorne und meine Blicke streifen ihre reizvollen Dekolletés. Eine der beiden hüllt sich mit meiner Hilfe in das dunkelgrüne Tuch, das hervorragend zu ihren braunen Augen und ihrem schwarzen Haar passt. Interessiert sehe ich sie an, meiner Berührung beim Festhalten des Stoffes widersetzt sie sich nicht, und sage ihr, wie gut sie darin aussähe und dass der Barchant sich besonders für einen Winterumhang eignen würde. „Liebes Fräulein, der Stoff ist von ganz besonderer Qualität, kommt aus einer bekannten Weberei in Ulm, ist eine Mischung aus Wolle und Leinen und deshalb besonders strapazierfähig und langlebig.“ Sie meint, ich hätte ein ehrliches Gesicht, dennoch wisse sie nicht, ob sie einem jüdischen Tuchhändler trauen dürfe. Sie diskutieren untereinander aufgeregt und am Ende bekommen sie den Stoff weit unter Preis. Mit einem scharfen Messer trenne ich vom grünen Tuch ein Stück in der vereinbarten Länge und überreiche es den beiden Damen. Sie zählen ihre Münzen in meine Hand, verabschieden sich freundlich und eilen schnell davon.
Bei keinem anderen Händler hätten sie einen Stoff von vergleichbarer Güte zu diesem Preis bekommen. Dies hatte sich wohl herumgesprochen, denn bald kommen weitere Kundinnen und am Spätnachmittag sind beide Stoffballen fast verkauft. Mit gefülltem Geldsack gehe ich zurück in die Judengasse zu unserer Wohnung. Meine Eltern sitzen Schiwa, mehrere Gäste aus unserer kleinen Gemeinde brachten Essen. Zum Gebet gehen wir gemeinsam in die Synagoge. Vorher gab ich Vater das Geld. Er erklärte mir, dass meine Preisgestaltung ihn noch in den Ruin treiben würde, er aber dennoch zufrieden sei, dass die Kasse wieder etwas aufgefüllt wurde. „Die Schicksen haben dir schöne Augen gemacht, du bist dahingeschmolzen und hast die Ware fast verschenkt.“ Das sagt er stets an solchen Abenden, ohne sich dafür zu bedanken, dass ich stundenlang bei jedem Wetter wegen seiner Stoffe hinter der Kirche stehe. Zumeist verhandle ich mit älteren Damen, gelegentlich mit jungen Frauen. Ich mag ihre Gesellschaft und oftmals erlebe ich sie anziehend, ich werfe ihnen vertraute Blicke zu. Sie sind nicht jüdisch und für mich unerreichbar. Sie wissen das und begegnen mir herablassend. Ihr Begehren gilt niemals meiner Person, sondern einem Stück Stoff aus meiner Hand um ihrer Attraktivität willen anderen Männern gegenüber. In einem oberflächlichen Spiel gestatten sie die eine oder andere Berührung in der Gewissheit, dass ich daraus niemals eine Verpflichtung ableiten könnte.
Jakov trifft Maria
Am nächsten Morgen holt mein Vater zwei weitere Ballen aus dem Lager. Es ist die gleiche Qualität in Dunkelbraun und Schwarz. Wieder laufe ich mit dem Tuch unter dem Arm hinter die Kirche. Vor dem Gebet in der Synagoge war es noch bewölkt und nun reißt der Himmel auf, die Sonne sticht durch die Wolken und es wird wärmer. Ich breite den Stoff aus und warte auf Kundinnen. Der Gottesdienst ist längst vorüber und ich sehe eine jüngere Frau mit ihrem Mann und einem Säugling im Arm vorübereilen. Sicherlich waren sie zur Taufe ihres Neugeborenen in St. Peter. Sie würdigen mich keines Blickes.
Kurz vor dem Mittagläuten spricht mich eine ältere, gut gekleidete und etwas untersetzte Dame mit der Bitte an, das braune Tuch näher ansehen zu dürfen. Ich entrolle den Ballen auf dem Mauervorsprung. Sie berührt den Barchant gleichzeitig von beiden Seiten mit Daumen und Zeigefinger, prüft die Dicke und Festigkeit des Gewebes, zieht fest daran und hält den Stoff nach oben gegen das Sonnenlicht. Sie scheint sehr sachverständig zu sein und auf ihre Frage nach der Herkunft der Ware berichte ich von der Weberei meines Onkels in Ulm. Sie ist interessiert, ich nehme das Tuch und drehe den Ballen, bis er vollends aufgerollt ist. Sie blickt mir in die Augen und sagt mit fester Stimme. „Ich bin die Schneiderin des Herzogs und suche nach Stoffen für die Aussteuer seiner Tochter. Eigentlich kaufen wir nicht beim Juden. Unterbreitet Ihr ein gutes Angebot für die gesamte Rolle, würde ich eine Ausnahme machen. Die Qualität der Ware scheint mir gerade akzeptabel.“ Ich erwidere: „Es gibt keinen Zweifel, die Tuche von meinem Onkel sind von hervorragender Güte.“ Nach längerer Diskussion verkaufe ich ihr den gesamten Ballen etwas günstiger als gestern den beiden Mägden.
Es ist Mittagszeit, die Sonne steht hoch am Himmel und es ist nun heiß geworden. Mit dem schwarzen Stoff unter dem Arm mache ich mich hungrig auf den Nachhauseweg.
Am Ende der Kirchenwand sitzt auf einem niedrigen Hocker eine schwarz gekleidete jüngere Frau. Ihre gekreuzten Beine sind von einer bunten Schürze vollends verdeckt. Vor ihr stehen auf einem fleckigen Leinentuch mehrere dunkle Holzschalen mit verschiedenen Gewürzen. „Gewürze, beste Gewürze aus dem Orient“, ruft sie den Passanten zu. Sie blickt mich mit einem einladenden Lächeln an, das ich verlegen erwidere. Als ich mich ihr nähere und mich bücke, nimmt sie eine der Holzschalen und hält sie mir vor die Nase. Ich atme tief ein und mir wird leicht schwindlig von dem starken, wohltuenden Geruch. Sie sagt, es seien Myrtenblätter aus Griechenland.
Der Duft erinnert mich an den Geruch der Besamimbüchse bei Schabbat Ausgang. Ich reiche ihr die Schale zurück, die wir für mehrere Sekunden gemeinsam halten, und blicke in ihr schmales Gesicht und ihre mandelförmigen, braunen Augen. Ihre Haut ist dunkel und sie hat schwarzes Haar mit rötlichem Glanz. „Du also bist der Judenjunge, der Tuchhändler von St. Peter.“ Sie erhebt sich langsam, nimmt den schwarzen Barchant und hält ihn vor ihren Körper. „Der Stoff ist weich und anschmiegsam und er ist schwarz. Wie du siehst, gehe ich in Trauer. Mein Gatte wurde vor einem Jahr auf dem Weg nach Tirol von Räubern getötet. Nun lebe ich vom Verkauf von Gewürzen aus Italien. Dein Tuch könnte ich mir nie leisten. Wie heißt du?“ Ich nenne ihr meinen Namen, sie nickt und lächelt, ich bitte um den Barchant und bedeute ihr, dass ich nun zum Mittagessen nach Hause gehen würde. Das trifft sich gut, meint sie und erzählt, dass sie in einer kleinen Dachkammer in der Dienergasse, unweit der Judengasse wohnen würde. „Du kannst mich gerne mit meinem Namen Maria ansprechen.“ Nachdem sie die Gewürzschalen mit einem Holzdeckel verschlossen und in einen Jutesack gelegt hatte, bittet sie mich, ihr beim Tragen des Schemels zu helfen. Mit meinem Stoff und dem Schemel schlendere ich an ihrer Seite vorbei am Eingangsportal der Kirche langsam in die Dienergasse. Uns bleiben die spöttischen Blicke von Vorübergehenden nicht verborgen. Was für ein seltsames Paar? Der jüdische Tuchhändler von St. Peter geht mit der Kräuter-Witwe.
Judenpogrom 1285 in München
Kurz vor der Einmündung in die Dienergasse kommt uns eine aufgeregte, schwergewichtige ältere Magd entgegen. Sie humpelt und geht in Lumpen. „Die Juden haben schon wieder unsere Kinder geschlachtet.“ Mit gesenktem Kopf läuft sie weiter in Richtung Synagoge. Maria lächelt spöttisch und sagt: „Sie ist verrückt, das ist bekannt in unserer Straße und du solltest dir darüber keine Gedanken machen.“ Als wir vor ihrer Haustür ankommen, stelle ich den Schemel ab und will schnell nach Hause. „Jakov, mach dir keine Sorgen, sondern hilf mir bitte, die Sachen in meine Wohnung zu tragen.“ Sie sieht mich an und nickt, als hätte ich schon zugestimmt, und sagt: „In wenigen Minuten bist du frei und kannst zu deiner Familie laufen.“ Wir gehen in den dunklen Flur des schmalen Hauses und klettern über die engen knarzenden Holztreppen in das oberste Stockwerk. Das Treppenhaus ist von einem feuchten und modrigen Geruch erfüllt. Oben angelangt, schließt sie die Wohnungstür auf, geht voran und bittet mich, ihr zu folgen. Es ist eine kleine Kammer mit einem Bett, einem Tisch mit einigen Stühlen und einem Kleiderschrank. Das Mansardenfenster spendet wenig Licht. Sie öffnet es sofort, damit die stickige und warme Luft nach außen strömen kann. Ich blicke durch das Fenster in den Hof und sehe den Stadtbach mit einem langsam fließenden Rinnsal von brackigem Wasser. Dann stelle ich den Schemel in eine Ecke neben den Kleiderschrank und gehe in die Richtung des Treppenhauses.
Sie bittet mich, noch auf ein Glas Wein bei ihr zu bleiben. Außerdem könne sie mir Brot mit würzigem Käse anbieten. Da ich hungrig bin, setze ich mich zu ihr. Nach dem ersten Glas bin ich leicht angetrunken. Obwohl sicherlich nicht koscher, esse ich vom Käse und vom Brot. Ich hoffe, dass niemand davon erfahren und sie sicherlich nichts davon erzählen wird. Nun steht sie auf und ich sehe im dämmrigen Licht dieser Kammer, wie schön Maria mit ihren dunklen großen Augen und den feinen Gesichtszügen ist. Sie entledigt sich ihrer Jacke und ihres Wollrockes und drapiert den schwarzen Stoff um ihren Körper. Betört vom Wein und von diesem Anblick umfasse ich sie an der Hüfte. Sie lässt mich gewähren, der Stoff fällt langsam zu Boden, weil sie mit beiden Händen zart durch mein Haar fährt. „Du gefällst mir, Jakov, mit deinem Lächeln, den lustigen Locken und den dunkelbraunen Augen.“ Ich drücke sie fest an mich und möchte gerne Stunden so verweilen. Wir lieben uns in dem schmalen Bett in dieser kleinen Kammer. Dann falle ich in einen tiefen Schlaf und erst das Glockengeläut von St. Peter weckt mich. Maria war schon aufgestanden, sie sitzt neben mir, blickt mich lächelnd an und streicht wieder durch mein Haar. Wie wohltuend sind diese menschlichen Berührungen, die ich zu Hause so vermisse. „Nun geh endlich. Sie werden dich schon suchen und wir sehen uns vielleicht morgen an den Buden vor St. Peter.“ Ich binde meine Hose zu, nehme den Stoffballen, drücke ihr einen Kuss auf die Stirn und eile die Treppen hinab. Die Abenddämmerung hat bereits eingesetzt. Am Himmel verdecken lange, rötliche Wolken die untergehende Sonne.
Auf der Straße kommt mir ein beißender Geruch entgegen. Es riecht nach verbranntem Holz, nach Feuer. Ich denke an die ältere Magd von vorhin und an ihre Lügen und eile wie von Sinnen mit meinem Stoffballen unter dem Arm mit großer Angst zur Synagoge. Sie ist ausgebrannt und die verbliebenen Mauern sind mit schwarzem Ruß bedeckt. In einigen Holzbalken lodert noch die Glut. Um die Ruine ist es menschenleer und still. Keine Seele verweilt an diesem Ort und ich gehe langsam in die gebrandschatzte Synagoge. Ein fürchterlicher Gestank ist in den Räumen und ich sehe überall entstellte Leichname. Der Thoraschrein ist vom Feuer zerstört und das angekohlte Pergament der Thorarolle liegt auf dem Boden. Ich denke an meine Familie und mich erfasst die Panik. Vielleicht sind sie in der Mikwe im Keller. Überall liegen Leichenteile. Zitternd steige ich die Treppe zur Mikwe hinab. Im Wasserbecken steht wie immer das schmutzige Wasser. Niemand ist zu sehen und meine Schritte hallen gespenstisch. Verzweifelt verlasse ich das zerstörte Gotteshaus und eile in die Judengasse zu unserer Wohnung. Ich betrete das Treppenhaus und sehe die Tür zu unserer Wohnung weit geöffnet. Tische und Stühle wurden umgeworfen, zerrissene Gebetsbücher und Tellerscherben bedecken den Boden. In meinem Zimmer liegen die Federn des Bettes und Kleidungsstücke, besudelt von Exkrementen und Urin. Von meiner Familie gibt es keine Spur.
Während ich mit Maria in ihrem Bett lag, wurde in der Synagoge das Nachmittagsgebet verrichtet. Es kann doch nicht sein, dass während des Gebets die Synagoge in Brand gesetzt wurde und die Menschen dabei in den Flammen umgekommen sind. Unter ihnen war auch meine Familie. Ich will das nicht glauben und stürze von Panik ergriffen die Treppen hinab, laufe nochmals zur Synagoge und schreie laut die Namen meiner Eltern und meiner Schwester. Der beißende Geruch liegt nach wie vor in der Luft. Der Platz vor der verkohlten Ruine der Synagoge ist menschenleer. Meine Rufe verhallen ungehört. Ich zittere am ganzen Leib und könnte schreien vor Wut und Verzweiflung. Aus der Judengasse höre ich Stimmen und erkenne in der Ferne, wie fremde Menschen Stühle, Tische und Kochgeschirr davonschleppen. Ich kehre zurück und frage einen finster blickenden Mann, der unsere Wohnung verlässt, voller Zorn, was er sich erlaube. Er hat den Stoffballen unter seinem Arm, den ich in meiner Panik in unserer Wohnung vergaß, blickt mich mit einer bösen Fratze an und schreit laut: „Da hat noch ein Jüdlein überlebt. Fasst ihn und tötet ihn!“
Plötzlich bin ich von mehreren Menschen umringt. Einige Gesichter kenne ich von St. Peter. Sie versuchen mich aufzuhalten und einige spucken mir ins Gesicht und schlagen auf mich ein. „Ihr habt Jesus Christus ans Kreuz genagelt und schlachtet unsere Kinder wegen ihres Blutes.“ Mit beiden Händen schiebe ich die Angreifer auseinander und entkomme in letzter Sekunde ihrer Umklammerung. Niemals in meinem Leben bin ich so schnell gelaufen, bis ich am Ende der Judengasse rechts in die Dienergasse einbiege und in den Hof von Marias Haus schleiche.
Ich kauere mich in eine Ecke neben dem Hofeingang, zittere am ganzen Leib und weine laut und ungehemmt. Immer wieder nenne ich die Namen der Eltern und meiner Schwester und frage schluchzend, wo sie geblieben sind. War einer der verkohlten Leichname, den ich in gekrümmter Haltung sah, mein Vater? Sollen sie mich doch töten, dann werde ich meine Familie bei HaSchem treffen. Vielleicht sind sie vor dem Feuer geflohen, kehren zurück und abends treffen wir uns in der Wohnung.
Der warme Sommerwind streicht durch den Hof und dennoch ist mir kalt. Ich fürchte, sie nie mehr zu sehen, und bei diesem Gedanken nenne ich flehend die Namen von Vater, Mutter und Schwester und beginne, das Schma Israel in Hebräisch wie eine Zauberformel zu sagen. Plötzlich spüre ich zwei warme, feuchte Hände auf meinen Augen und neige meinen Kopf nach oben. Über mir steht Maria und sieht mich mit großen Augen an. „Was ist passiert, Jakov, du siehst fürchterlich aus.“ Mit wenigen Worten erzähle ich von der verbrannten Synagoge, meinen verschwundenen Eltern und unserer zerstörten Wohnung sowie den Drohungen, mich zu töten: „Ich bin wie von Sinnen und möchte am liebsten sterben. Wenn ich in die Wohnung zurückkehre, werden sie mich töten. Wo soll ich meine Eltern suchen? Wo kann ich bleiben? HaSchem hat mich verlassen.“ Maria streicht über mein Haar und führt mich nach oben in ihre Kammer. Ich kann kaum auf den Beinen stehen. Sie füllt aus einem Krug Wasser in einen Becher, den sie mir mit einem Stück Brot reicht. Meine Kehle ist wie zugeschnürt. Ich kann weder trinken noch essen. „Jakov, ich gehe jetzt in den Ausschank im Tal und höre mich um, was geschehen ist und was vielleicht noch geschehen wird. Bist du sicher, dass ihr für eure Riten keine Kinder getötet habt?“ „Was für ein Unsinn. Wir würden das nie tun. Wir lieben Kinder. Es gibt nichts, was deren Tötung rechtfertigt.“ Sie blickt mich besorgt an. „Ich bin geneigt, dir zu glauben. Hier bist du sicher. Bleibe, bis ich zurückkomme, und dann sehen wir weiter.“ Sie hüllt sich in ein breites, schwarzes Tuch und steigt die Treppe hinab. Die Tür zur Kammer verschließt sie von außen.
Während ich schlief, hatte sie am Nachmittag heimlich vom Stoffballen ein kleines Stück abgetrennt, das sie nun vor meinen Augen um ihre schönen Schultern schwang. In meinem Elend lächle ich für einen kurzen Augenblick, lege mich auf die Bettdecke und versinke schnell in einen traumlosen Schlaf. Als ich aufwache, sehe ich Maria am Tisch sitzen und Brot essen. Es muss schon spät sein. Am dunklen Himmel über dem Dachfenster glitzert eine Vielzahl von Sternen. Ich sehe sie fragend an. Sie ist kreidebleich und erzählt, dass am späten Nachmittag eine aufgebrachte Menschenmenge vor die Synagoge gezogen sei und mit dem lauten Vorwurf der Tötung von Christenkindern meine Leute aufgefordert hätte, herauszukommen. „Nachdem die Juden sich verbarrikadiert hatten, entzündete der Mob mit brennenden Fackeln das Judenhaus. Nach wenigen Minuten stand es in Flammen. Wegen der geschlossenen Tore gab es für die Eingeschlossenen kein Entkommen. Sie alle starben. Der Mob ist dann durch die Judengasse gezogen, forderte den Tod aller Juden und plünderte deren Wohnungen. Jakov, du kannst nicht zurück in dein Zuhause, sie warten auf dich und würden dich auf offener Straße meucheln. In der Schenke war die Rede von einem Jüdlein, das überlebt hätte und noch daran glauben müsse. Du darfst bis morgen bei mir bleiben. Dann musst du weg.“ Ich verstehe, dass mein Leben an einem seidenen Faden hängt. „Wenn du leben willst, kannst du dich nicht als Jude auf der Straße zeigen.“ Sie reißt den gelben, schon vergilbten Judenstern von meiner Jacke und gibt mir ein Messer, mit dem ich meinen noch jugendlichen, tiefschwarzen Bart stutzen soll. Ich zögere. Sie will, dass ich mein Judentum verleugne, und ich habe meine Eltern vor Augen. „Ich kann das nicht, lieber will ich sterben.“ Sie blickt mich mitleidsvoll an, wieder rinnen Tränen über mein Gesicht. Sie legt ihren Arm um meine Schultern und zieht mich zu sich. Ich spüre ihre Brüste an meinem Oberkörper. Die Berührung vertreibt meine Ängste für wenige Sekunden. „Wir fahren morgen zusammen nach Tirol. Es ist schönes Wetter und ich benötige für das Herbstgeschäft frische Kräuter. Du kürzt nun deinen Bart und ich besorge morgen Vormittag für dich ein kleines Kreuz an einem Lederband, das du umhängen wirst. Dein Gott wird dir verzeihen, wenn er will, dass du weiterlebst.“ Vielleicht leben Teile meiner Familie und nicht alle waren während der Brandstiftung in der Synagoge. Maria kann meine Gedanken von den Lippen ablesen. „Jakov, sie haben alle deine Leute ermordet und dies brutal, mit fester Absicht. Weder Ludwig der Strenge noch die Kirchenleute haben sie davon abgehalten. Wenn ich dich nicht so gern hätte, müsste ich dich aus meiner kleinen Kammer jagen.“ Wir legen uns ins Bett, sie schmiegt sich eng an mich und ich falle in einen tiefen, betäubenden Schlaf. Als es langsam hell wird, erwache ich, stehe auf, trinke ein Glas Wasser und nach wenigen Sekunden erfasst mich wieder das Grauen. Ich denke an die Ermordung meiner Familie und dann an die Lebensgefahr, in der ich mich befinde. Maria steht auf, sie entkleidet und wäscht sich. In meinem unendlichen Elend möchte ich sterben. Während Maria etwas Brot und Käse isst, schnürt sich mir beim Anblick des Essens die Kehle zu. „Du darfst auf keinen Fall unsere Kammer verlassen. Ich gehe runter, hole Proviant für die Reise und besorge für dich das Kreuz.“ Vom Verkauf der Stoffballen habe ich noch Münzen und lege zwei Silberstücke auf den Tisch. Sie nimmt das Geld, verlässt das Haus und läuft auf die Straße.
Ich erinnere mich an das Versteck meines Vaters in unserer Wohnung, in dem er Geld und Schmuckstücke aufbewahrte. Unter den Holzdielen des Schlafzimmers der Eltern lag die kleine Schatztruhe verborgen. Um meine düsteren Gedanken von Tod und Untergang zu vertreiben, überlege ich, wie wir unbemerkt in die Wohnung gelangen könnten, um das zu holen, was uns gehört.
Mit dem spärlichen Rest des Wassers aus dem Krug wasche ich mich, falle auf das Bett und schlafe unruhig, bis mich Maria aufrüttelt. Ich drehe mich zu ihr, sie lächelt und streicht über mein Haar. Mir ist übel und ich zittere am ganzen Leib.
Sie bemerkt, wie bleich und krank ich aussehe, und bindet ein Lederband mit einem kleinen Kreuz um meinen Hals, welches ich sofort unter meinem Hemd verberge. Sie meint, ich würde es schon noch lernen und mich daran gewöhnen müssen. Will sie mich retten oder will sie mich missionieren? Was für ein Unsinn, denke ich und erzähle von der kleinen Kiste mit Münzen und Schmuck in der geplünderten Wohnung. Sie sieht mich an und ihre Augen beginnen zu leuchten. Damit könnten wir uns vielleicht einen Wagen mit Pferd kaufen, unsere Reise wäre nicht so beschwerlich und sicherer.
Am frühen Nachmittag steigt sie mit ihrem Jutesack das Treppenhaus hinunter in die Dienergasse. Sie pfeift, da die Straße menschenleer ist, und ich folge ihr. Der Brandgeruch liegt noch in der Luft. Langsam schleichen wir zur Judengasse und betreten das Haus meiner Eltern. Mein Herz beginnt schnell zu pochen. Vielleicht warten sie schon auf uns?
Wir steigen die Treppen hinauf und gehen durch die weit geöffnete Türe in die Wohnung. Alle Möbelstücke und aller Hausrat sind geplündert. Auf dem Boden liegen Scherben, Federn und Exkremente. Es riecht wie in einer Kloake. Die dicken, in Blei gefassten Fenstergläser sind zerschlagen. Die Wohnung meiner Familie wurde verwüstet. Teile der Thorarollen liegen zerfetzt auf den Holzdielen und sind gelblich gefärbt, weil der Mob darauf urinierte. Wieder durchfährt ein Zittern meinen Körper. Im Elternschlafzimmer finden wir tatsächlich unter den Bodendielen den Holzkasten mit Münzen und Schmuck. Welch eine Fügung des Schicksals! Maria steckt den Kasten in ihren Jutesack, den sie geschickt über die Schultern schwingt, und wir verlassen schnell diesen mir so vertrauten und dennoch nun grausamen Ort. Von der Tür entferne ich die angestochene Mesusa und lasse sie in meiner Hosentasche verschwinden, ohne dass Maria dies bemerken konnte. Wir gehen so unauffällig langsam, wie wir gekommen waren, zurück zur Dachkammer. Nach wie vor sind die Straßen menschenleer. Über die Stadt kam ein großes Unglück und die Menschen fürchten mögliche Konsequenzen. Aus Angst meiden sie die Straßen. Vielleicht kommt der Rächer in Gestalt des schwarzen Todes. Dieses wäre mein sehnlichster Wunsch. Doch vorher werde ich mit Maria fliehen. In der Dachkammer angekommen, öffnen wir den Holzkasten. Er ist gefüllt mit Münzen, Goldschmuck und einer kleinen Thorarolle für die Reise. Maria schwärmt, wir sind nun reich und werden noch heute Nacht diese Stadt des Grauens verlassen. Wir überlegen, uns als Geschwisterpaar auszugeben, das seine Eltern verloren hat und nun Schutz und Geborgenheit bei einem Onkel nahe am Schloss Tirol bei Meran suchen will.
Flucht aus der Herzogsstadt
Vor Einbruch der Dunkelheit dürfen wir uns nicht auf den Weg machen Maria verbirgt einen Teil der Münzen, Schmuckstücke und Ringe unter ihrem Rock. Das alles hat sich mein seliger Vater vom Munde abgespart, um damit die Aussteuer meiner ermordeten Schwester zu finanzieren. Ich bin von Gewissensbissen geplagt. Was würden sie sagen, wenn sie wüssten, dass ich einer fremden, nichtjüdischen Frau ihr Vermögen anvertraute? Mit diesen in mir bohrenden Fragen verlassen wir nach dem Abendläuten die Kammer.
Die Gassen sind noch immer menschenleer, nur das entfernte Rufen des Nachtwächters und das gelegentliche Klagen von Eulen sind zu hören. Ich trage den Jutesack, unser spärliches Reisegepäck, und nach kurzer Zeit sind wir am Isartor. Davor steht ein Ochsenkarren und wir sehen einen Mönch mit dem Torwärter verhandeln. Der Wachmann sagt laut, niemand dürfe die Stadt verlassen, man wolle den Juden die Flucht verwehren. Der Mönch zeigt mit fragendem Blick auf sich selbst. Maria sieht mich an, zieht das kleine Kreuz unter meinem Hemd hervor und legt es gut sichtbar auf das Revers meiner Jacke. Ich erinnere mich an meinen Vater in ähnlichen Situationen und verspreche dem Torwärter einen Kreuzer. Er mustert mich aufmerksam, ich stecke ihm eine kleine Münze zu. Er blickt ängstlich nach allen Seiten und öffnet langsam beide Torflügel. Wir passieren zu dritt mit einem Ochsenkarren das Stadttor. Nur der Torwärter, der uns nicht kannte, sah uns die Stadt im Schutze der Dunkelheit verlassen.
Vor der Stadtmauer kniet der Mönch nieder und spricht ein Gebet. Maria flüstert mir zu, wir sollten es ihm gleichtun. Nach wenigen Minuten erhebt er sich und sagt: „Dank sei der Muttergottes, dass sie mich haben ziehen lassen. Liebe Christenmenschen, ich bin auf dem Weg zu meinem Kloster nach Benediktbeuern. Ihr könnt gerne auf den Karren klettern. Der kräftige Ochse wird uns langsam in den Isarauen entlang des Flusses ziehen.“ Es ist schon stockdunkel und ich kann nur die Umrisse des frommen Mannes erkennen. Er sitzt in der Mitte, links und rechts sitzen Maria und ich. In einem Kasten vor seinen Füßen, den er öffnet, liegen Brot und ein kleines Fass mit Bier. Während er die Zügel hält und den Ochsen immer wieder zum Laufen anhält, schneidet Maria mit einem sehr stumpfen Messer einige Scheiben vom Brot ab. Dann füllt sie einen Holzbecher mit dem schon schalen Bier, aus dem wir abwechselnd trinken.
Der Mönch drückt sich an Maria. Sie lässt ihn gewähren. Kurze Zeit später schläft er und ich übernehme die Zügel. Das Tier merkt schnell, dass es nicht mehr sein Herr ist, der es lenkt, und bleibt bald stehen. Ich klettere vom Wagen und ziehe den Ochsen, der sich sträubt, zu einem naheliegenden Baum. Maria und ich lehnen uns sitzend gegen ein Wagenrad. Es ist so dunkel, dass man die Hand vor den Augen nicht sehen kann. Nur einige Sterne blinken am Firmament. Aus der Ferne sind das Heulen von Wölfen und gelegentlich lang gezogene Schreie von Eulen zu hören. Es ist gespenstisch. Wir fürchten die Räuberbanden, die in dieser Gegend ihr Unwesen treiben. Ihrer hätten wir uns ohne Waffen nicht erwehren können. Dem Mob in der Stadt war ich entkommen. Nun bin ich den Mordgesellen auf dem Weg in den Süden ausgeliefert.
Während Maria eingeschlafen ist, kann ich kein Auge zutun und lausche ängstlich in die schwarze Nacht. Der Mönch schnarcht laut und unablässig. Maria seufzt gelegentlich und bald übermannt mich doch die Müdigkeit. Ich träume von meinen Eltern und meiner Schwester, wie sie in den Flammen in der Synagoge schreiend untergehen. Der Torwächter steht vor dem Gotteshaus, hüpft wie ein Wichtelmann von einem Bein auf das andere und reibt sich die Hände. Seine Augen sind vom beißenden Rauch gerötet und er ruft unaufhörlich: „Weg mit den Juden, weg mit den Juden.“
Das laute Zwitschern einer vorüberziehenden Vogelschar weckt mich. Neben mir sitzen Maria und der Mönch, essen die Reste des Brotes und trinken vom Bier. Er sagt: „Na, mein lieber Jakov, hast du schön geträumt und tief geschlafen?“ Ich nicke und bitte um ein Stück Brot. Der Mönch reicht mir die Schale mit Bier und stellt sich mit seinem Namen vor. „Deine Schwester hat mir schon eure Familiengeschichte erzählt und mir deinen Namen genannt. Ihr habt noch einen langen und gefährlichen Weg in Richtung Süden vor euch und unser Herr, Jesus Christus, möge euch schützen. Ihr dürft mich gerne bis zu meinem Kloster begleiten. Übrigens, ich bin Bruder Richolf. Wir werden in zwei bis drei Tagen ankommen und heute Abend erreichen wir ein kleines Dorf. Dort können wir vielleicht Brot, etwas Speck und Bier kaufen. Ich bin bettelarm, wie es ein Mönch eben ist, aber ich habe gesehen, Jakov, dass du einige Münzen im Sack hast. Meinen Ochsen habe ich noch nicht vorgestellt. Er heißt Sepp. Der Mönch befreit ihn von der Deichsel, zieht das Tier auf eine nahe Wiese und bindet es mit einem langen Strick an einem Baum fest, sodass es bequem grasen kann. Als wir außerhalb der Sichtweite des Mönches sind, küsst mich Maria zärtlich am Nacken. Ein wohliger Schauer durchfährt mich und sofort drängt sich mir das Bild meiner Eltern in der brennenden Synagoge wieder auf.
Er kehrt zurück, füllt sich einen Becher mit Bier, den er schnell austrinkt, zieht einen Rosenkranz aus seiner Tasche und kniet einige Meter entfernt zum Gebet nieder. Maria ist, wie sie mir erzählte, seit dem Tod ihres Mannes mit Gott uneins und betet nicht. Ich kann schlecht neben dem Mönch das „Schma Israel“ sagen, so brumme ich Unverständliches vor mich hin, bis auch der Kirchenmann am Ende seiner Litanei angelangt ist. Danach klopft er wohlwollend auf meine Schulter. Es ist nun früher Morgen, die ersten Sonnenstrahlen tauchen die Isarauen in ein rötliches Licht, Richolf legt Sepps Geschirr an, wir steigen auf den Wagen und fahren langsam entlang der Isar in den Süden. Maria hält die Zügel, doch ob sie zieht oder den Lederriemen lockerlässt, Sepp schleppt uns langsam und unbeirrt entlang des schmalen Weges, ohne seinen schweren Schädel nach rechts oder links zu drehen.
Aus der Ferne hören wir das stete Rauschen des Flusses, das Zirpen von Grillen und das Surren von lästigen Fliegen und Mücken, die uns behelligen. Es ist heiß geworden, Maria entledigt sich ihrer Jacke und sitzt nur mit einem dünnem Hemd bekleidet auf dem Kutschbock. Mir ist nicht entgangen, dass Bruder Richolf seine Augen nicht von ihr abwenden kann.
Es ist Mittag. Die Sonne steht im Süden hoch am Himmel. Wir lenken den Karren nahe zum Fluss und bleiben im Schatten eines Baumes stehen. Ich mag das laute Rauschen der Isar und den kühlenden Wind, der zu uns weht. Der Mönch holt ein Netz aus dem Wagen und bittet mich, ihn zum Fluss zu begleiten. Im Wasser waten wir bis zu einer schmalen, seichten Stelle eines Seitenarmes, den wir mit dem Netz versperren und warten, bis Fische sich in den engen Maschen verfangen. So haben wir nach weniger als einer halben Stunde mehrere Forellen gefangen. Bruder Richolf erweist sich als listiger und erfahrener Netzfischer. Mit einem großen Stein tötet er die Tiere, die wir am Lagerfeuer grillen. Maria würzt sie mit frischen Kräutern vom Flussufer. Nach einem kurzen Mittagsschläfchen machen wir uns wieder auf den Weg und Sepp zieht den Karren entlang der Isar, bis wir am frühen Abend in der Ferne einige Hütten sehen. Es ist das kleine Dorf, das der Mönch angekündigt hatte. Als wir den Dorfplatz erreichen, umringen ärmlich gekleidete Kinder unseren Karren und Erwachsene schlagen das Kreuz, als sie den Mönch erblicken. Ich sehe in die von Angst erfüllten, schmalen, verhärmten Gesichter dieser Menschen. Sie haben kaum was zu essen und werden, wie mir Richolf erzählte, von den Schergen des Herzogs schamlos ausgebeutet.
An einer großen Linde inmitten des Dorfes machen wir halt und binden unseren Karren fest. Maria befreit Sepp von seinem Geschirr und führt ihn auf eine Wiese. Er ist an einem langen Seil festgebunden und beginnt sofort zu weiden. Sie streichelt zärtlich sein braunweißes Fell über den Augen, verscheucht die Fliegen, die ihn umschwirren, und kommt zu uns. Wir setzen uns auf die Bank, die an den wuchtigen Stamm des Baumes lehnt, und haben noch einige Scheiben Brot, etwas Bier und einen der gegrillten Fische vom Lagerfeuer übrig. Maria verteilt das Essen.
Es ist noch hell, am Himmel zeichnen sich rötliche Streifen ab, aber bald wird es dunkel. Ein älterer Mann, ärmlich gekleidet, kommt mit einem verzagten Lächeln auf uns zu. Er stellt sich als Dorfältester mit dem Namen Answalt vor und fragt nach unserem Reiseziel. Bruder Richolf erzählt von seinem Kloster und unserem Onkel in Tirol. Answalt lädt uns in sein nahe gelegenes Haus ein.
Es ist eine Holzhütte mit nur einem großen Raum und viel Ruß an den Wänden. In einer seitlich gelegenen, offenen Feuerstelle mit Kamin züngeln bläuliche Flammen über angekohlten Holzscheiten. Wir sitzen gemeinsam um den runden Tisch und es gibt in Holzschüsseln Brotsuppe mit Zwiebeln. Mit dabei sind seine Frau und seine sechs Kinder. Vor dem Essen spricht der Mönch ein Gebet und nachdem sich alle bekreuzigt hatten, beginnen wir die noch dampfende Suppe zu löffeln. Maria und ich beteiligen uns nicht am Gebet. Richolf mustert uns kurz mit ernstem Blick.
Nach dem Essen gibt es ein kurzes Dankesgebet und die Kinder stürzen hinaus, umringen unseren Ochsen Sepp und streicheln ihn vorsichtig. Er lässt sie gewähren, senkt dann schnell seinen Kopf und grast weiter.
Answalt und seine Frau bitten den Mönch, ihnen die Beichte abzunehmen. Wir verstehen, dass sie ungestört sein wollen, und gehen hinaus in die Abenddämmerung, sehen die Kinder Sepp liebkosen und gehen zurück zur Bank, die an einer mächtigen Eiche hinter der Holzhütte lehnt. Maria setzt sich und ich lege mich auf die Bank und meinen Kopf in ihren Schoß. Wir fühlen uns unbeobachtet, Maria streicht durch mein dichtes Haar, beugt sich über mein Gesicht und gibt mir einen flüchtigen Kuss. Eines der Kinder, ein schon älteres Mädchen, hat uns, während ich meinen Kopf langsam nach oben hob, gesehen und fragt, ob wir ein Paar wären. Maria sagt: „Ja, das sind wir, allerdings ein Geschwisterpaar.“ Das Mädchen, ärmlich in Sackleinen gekleidet, nickt und läuft zurück zu seinen Geschwistern.
Als die Sonne untergegangen ist und die ersten Sterne am Himmel stehen, holt uns Richolf zurück in das Holzhaus. Die Frau sitzt mit geröteten Augen an ihrem Platz nahe am Kamin. Es ist dunkel. Nur eine Kerze brennt. Der Dorfälteste Answalt sagt mit heiserer Stimme: „Es ist schwer, an der Seite eines vom Teufel besessenen Weibes zu leben. Ich hoffe, Bruder Richolf hat ihr die bösen Geister ausgetrieben. Ihr könnt heute Nacht im Stall übernachten. Morgen früh bekommt ihr Proviant mit auf die Reise. Bruder Richolf versprach uns einige Münzen dafür.“ Ich nicke beiläufig und wir gehen mit Richolf in den Stall, in dem zwei Ziegen und eine Kuh angebunden sind. Unseren Karren mit Sepp schieben wir zum Stalleingang und befestigten ihn dort. Durch das halb geöffnete, brüchige Tor haben wir einen steten Blick auf Sepp und den Wagen. So liegen wir zu dritt auf dem Stroh und nach wenigen Sekunden war ich eingeschlafen. Ein kurzer Schrei von Maria weckt mich. Bruder Richolf hat sie liegend umklammert und erst, als ich mich nach oben beuge und ihn wütend an den Schultern ziehe, lässt er sie los. Maria streicht ihr Haar zurecht, wirft dem Gottesmann einige böse Blicke zu und beruhigt sich schnell. „Deinem Jesus wird das nicht gefallen.“ Der Mönch steht auf, kniet dann vor Maria und bittet mit Tränen in den Augen um Verzeihung. Als sie nickt, weint er leise und beginnt mit brüchiger Stimme das Vaterunser zu beten. Er wiegt uns mit dem sonoren Ton seines Klagens in den Schlaf.
Am frühen Morgen weckt uns das laute Krähen des Dorfhahnes. Bald stehen wir auf, schütteln das Stroh von unserer Kleidung und gehen hinaus in die frühe Morgendämmerung. Sepp steht vor uns, brummt und kaut. Richolf bringt ihm Wasser. Das Tier leert mit wenigen Zügen den Bottich. Nun kommen Answalt und seine Frau und stellen einen Korb mit Verpflegung auf den Boden. Darin finden sich ein wenig Speck, mehrere rote Äpfel, Brot und zwei große Kohlrabi. Erwartungsvoll sieht er mich an und ich gebe ihm zwei Geldstücke. Bruder Richolf streckt mir drei Finger entgegen und ich gebe ihm eine weitere Münze. Der Dorfälteste scheint zufrieden, wir verabschieden uns, klettern auf den Wagen und Sepp zieht uns gemächlich weiter in den Süden entlang der Isar.
Jakov ist beschnitten
Nach einigen Stunden rasten wir am Fluss. Maria geht ans Ufer hinter ein Gebüsch und wäscht sich am Wasser. Bruder Richolf versucht vergebens, seine Blicke in eine andere Richtung zu lenken. Bald kommt sie mit nassen Haaren zurück und fordert mich auf, es ihr gleichzutun. Der Mönch und ich gehen nun hinunter zur grünen Isar, die an dieser Stelle träge vorbeifließt. Wir entkleiden uns und waten knöcheltief im kalten Fluss. Es ist angenehm, sich vom Staub der letzten Tage zu befreien. Bruder Richolf mustert mich, während wir uns anziehen. Wir gehen zurück zu Maria und unserem Karren. Während Sepp grast, sitzen wir am Ufer der Isar und essen nur wenig vom Proviant, der schließlich bis in den späten Abend reichen soll. In einer Holzschale holt Maria Wasser. Wir trinken davon. Der Mönch schaut versonnen zum Wasser, wir hören das Rauschen des Flusses. Er blickt nun ernst in meine Richtung und sagt: „Ich hoffe, den gottesfürchtigen Dorfältesten und seine Frau konnte ich versöhnen. Jakov, ich habe vorhin am Wasser gesehen, dass du beschnitten bist. Warum habt ihr mir eure Herkunft verschwiegen? Ich nehme an, ihr seid wegen der Kindermorde durch eure Sippschaft aus der Stadt verjagt worden.“ Maria und ich blicken uns gegenseitig an. „Jetzt verstehe ich, dass ihr Geld habt.“ Marias Augen verengen sich. Sie ist kreidebleich. „Du siehst doch, dass Jakov ein Kreuz trägt. Ich bin als Christin geboren, doch als mein Gatte von Räubern gemeuchelt wurde, habe ich meinen Glauben verloren.“ Der Mönch schneidet sich ein Stück vom Speck und Brot ab und kaut langsam und bedächtig, während er unseren Blicken ständig ausweicht. Er scheint angestrengt nachzudenken. Ich bin wütend auf den Mönch. Er behauptet, wir hätten Kinder ermordet, lässt mich für sich bei Answalt bezahlen, belästigt Maria und musterte wohl sehr interessiert mein Geschlecht. Meine Frage, was er von uns wolle, lässt er unbeantwortet. Ich sage ihm, dass wir auch ohne ihn zu Fuß weiterlaufen könnten und dann eben langsamer vorankämen.
Nun blickt er auf und mit dem Versuch eines angedeuteten, milden Lächelns spricht er leise: „Sie haben in München die Kirche der Juden angezündet und alle sind umgekommen. Das war nicht richtig und sicherlich nicht Gottes Wille. Ich nehme an, dass du entkommen und mit Maria auf der Flucht bist. Ich glaube, ihr seid ein Paar und keine Geschwister. Maria, du solltest Jakov zu unserem einzigen richtigen Glauben bekehren. Er muss sich im Kloster taufen lassen.“ Niemals würde ich meinen Glauben verraten, meinen Glauben an den einen Gott und an sonst keinen. Ich schüttele heftig den Kopf und Bruder Richolf fragt, ob wir aufsteigen wollen. Nach wenigen Minuten setzt sich der Ochsenkarren in Bewegung und wir fahren weiter den Alpen entgegen. Gelegentlich verschwindet der Fluss aus unserem Blickfeld. Nach einer Biegung wird das Rauschen des Wassers lauter und der frische Wind vom Fluss kühlt angenehm an diesem heißen Sommertag. Am späten Nachmittag rasten wir abseits der Straße und weil hungrig, laufen wir zum Fluss, um dort zu angeln. Da es für unser Netz keine geeignete Stelle in der starken Strömung gibt, ist es schwierig und wir fangen nur zwei kleine Forellen. Wir grillen sie über dem von Richolf geschickt entfachten Feuer und teilen den Fisch gerecht auf.
Ich hoffe, dass wir bald unsere Reisebegleitung loswerden. Das Versteckspiel muss aufhören und ich will mit Maria allein sein.
Wir kaufen den Ochsenkarren
Als wir wieder im Wagen sind, den nun Maria lenkt, frage ich Bruder Richolf: „In Benediktbeuern angekommen, was ist dann Euer Plan?“ Nach längerem Überlegen antwortete er: „Wir werden erst zu später Stunde dort sein. Im Kloster dürft ihr nicht übernachten. Ihr lebt in Sünde und du bist zudem Hebräer. Unser Kloster benötigt für die Erneuerung des Daches dringend Unterstützung. Zur sicheren Weiterreise braucht ihr den Ochsenkarren mit Sepp. Juden sind doch reich, gebt mir einige Goldmünzen oder ein schönes Schmuckstück und ich überlasse euch den Karren und die Freiheit weiterzureisen.“ Maria hat mitgehört und fragt ihn wütend, inwieweit unsere Freiheit des Weiterreisens von ihm abhinge. „Ein Wort von mir an die Knechte des Herzogs, die häufig bei uns im Kloster verkehren, und ihr landet schnell im Kerker. Ich glaube, ihr seid gute Menschen, deshalb helfe ich gerne und möchte euch nicht im Kerker sehen. Wir hatten Glück, dass die Leute des Herzogs bisher nicht vorbeigeritten kamen. Viele meiden den Fluss wegen der Mücken, die uns bisher verschonten. Die schnellen Reiter bevorzugen die naheliegende Salzstraße. Ich habe diesen Weg gewählt, um euch unangenehme Begegnungen zu ersparen.“ Maria blickt ihn an und dann zum Ochsen, der unbeirrt weiterzockelt.
Wir legen eine kurze Pause ein, lassen ihn in Ruhe grasen und ich hole eine Schüssel mit Wasser, die er mit drei großen Zügen schnell leert. Angesichts der vorangegangenen Diskussion bin ich ratlos und verärgert. Zudem, das Bild vom grausamen Tod meiner Familie quält mich unablässig. Ich habe Maria an meiner Seite, aber wie lange würde sie bei mir, dem Juden, bleiben? Sie muss gesehen haben, wie sich mein Blick verdüstert hat, lächelt und herrscht den Mönch an, er solle ihr doch den Preis für seinen klapprigen Karren und den alten Ochsen nennen. „Ich bin Gewürzhändlerin und ich lasse mich nicht betrügen. Deinen schamlosen Annäherungsversuch habe ich nicht vergessen.“ Das rundliche Gesicht von Bruder Richolf läuft rot an. Eine dermaßen schwere Anschuldigung von Maria hatte ich nicht erwartet. Ich blicke fragend zu ihm. „Für meine Stoffballen bekam ich bei St. Peter einen Silbergulden und einige Kreuzer.“ Ich zeige ihm die Silbermünze und frage, ob dies ausreichen würde. Maria sieht mich böse an. Ein Silbergulden für dieses wacklige Gefährt sei zu viel. So verhandeln wir zu dritt über eine halbe Stunde, während langsam die Sonne untergeht. Am Ende einigen wir uns auf den Silbergulden und erreichen am späten Abend einen Abzweig am Waldrand, der zum Kloster führt. Wir bleiben dort stehen, der Mönch steigt langsam vom Wagen, geht zunächst zu Sepp und streichelt zärtlich seine Stirn. Dieser schüttelt dabei sein mächtiges Haupt. Dann geht Richolf zu Maria, sieht ihr in die Augen und sagt: „Mea culpa.“ Er scheint sichtlich gerührt. Ich gebe ihm die Silbermünze und er versteht, dass ich mich nicht bekehren lassen würde, umarmt uns beide, schwingt den Sack mit seinen wenigen Habseligkeiten über seine Schultern, wendet sich von uns ab und geht langsam auf dem Waldweg zu seinem Kloster. Wir sehen ihm lange nach, er blickt nicht zurück, so als wären wir uns nie begegnet.
Maria hat Tränen in den Augen, was ich nicht verstehen kann und will. Wir steigen auf den Karren, ich rufe zum Ochsen ein leises Hü-Hott. Er reagiert nicht. Maria springt vom Wagen und zieht an seinem Halfter, bis das Tier sich langsam in Bewegung setzt und wir in der Dunkelheit weiterfahren. Es ist finster und der angehende Vollmond spendet ein mattes, graues Licht. Die schmale, holprige Landstraße ist auf der rechten Seite von hohen, dunklen Fichten gesäumt. Maria schmiegt sich an mich und legt ihren Kopf auf meine rechte Schulter, während ich den Wagen lenke. Sie hat wohl meine Verstimmung während des Abschiedes von Richolf gespürt. Wir müssen für die Nacht einen sicheren Rastplatz finden. Das Rauschen des Flusses zur linken Seite ist lauter geworden. Nachdem ich den Karren von der Straße gelenkt hatte, zieht uns Sepp unbeirrt in die Richtung des Isarufers. Auf einer Wiese mit hohem Gras bremse ich ihn fluchend, bis er endlich langsam zum Stehen kommt. Ich fürchtete schon, er würde uns in die Isar ziehen und wir könnten ertrinken. Maria, vom Lärm geweckt, springt vom Wagen. Wir stehen in der Dunkelheit zwischen hohen Gräsern und Schilf. Mehr ist momentan nicht zu erkennen. Das Tier befestige ich mit dem Seil, das uns der Mönch im Wagen gelassen hat, an einem nahegelegenen Baum. In einer Schüssel hole ich vom noch schmalen, aber reißenden Fluss frisches Wasser für uns und den Ochsen. Er säuft das Isarwasser, kaut in der Dunkelheit beharrlich zermahlend das Gras und das Schilf. Maria und ich sitzen auf dem Boden neben dem Wagen auf einer groben Leinenplane, die ich zusammengefaltet mit dem Seil im hinteren Wagen fand. Bald liegen wir auf dem Rücken, schauen in die Sterne und lieben uns. Diese schönen Momente der Lust vertreiben das dumpfe Gefühl der Trauer für eine Weile, die Sehnsucht nach meiner verlorenen Familie. Anschließen sinkt Maria in einen tiefen Schlaf.
Ich schaue in den Sternenhimmel und bin dankbar für diese wenigen Sekunden der Unbeschwertheit. Sofort plagt mich wieder das schlechte Gewissen, weil ich im Bett meiner Freundin das Massaker an meinen Leuten überlebte. Nachdem ich aufgestanden war, bete ich neben dem Wagen stehend Teile des „Schma“. Dann singe ich leise die „Keduscha“ des „Schmone Esre“ und lege mich wieder zu Maria. Sepp frisst unbeirrt weiter. Neben dem Rauschen des Wassers erfül-len der Gesang der Nachtigallen und das Raunen des Windes in den Tannen die Luft. Es hört und fühlt sich paradiesisch an. Marias Gatte wurde auf einer Reise von Räubern getötet. In der Gegend leben Wölfe und Bären und wir liegen hier scheinbar unbeschwert neben unserem Ochsenkarren. Ich darf jetzt nicht einschlafen, sondern muss bis zum Morgengrauen wachen. Aus dem Wagen hole ich einen dicken Holzprügel, den der Mönch zu seinem Schutz stets mitführte und uns überließ.
Bald übermannt mich die Müdigkeit und ich schlafe ein. Wieder erscheinen meine Eltern im Traum und ich bilde mir ein, das entfernte, bedrohliche, sonore Brummen eines Bären zu hören. Plötzlich schüttelt mich Maria. Es ist bereits hell geworden. Sie ruft laut: „Wo ist unser Wagen?“. Ich stehe schnell auf, ich schwanke und kann mich kaum auf den Beinen halten. In einiger Entfernung sehen wir den Karren und das straffe Seil, mit dem wir Sepp am Abend festgebunden hatten. Der Ochse zieht kräftig und bald würde der Baum umknicken. Wir haben versäumt, ihn von der Deichsel loszubinden, und er suchte mit dem Wagen wohl den Weg zurück zu Richolf. Wir nehmen schnell die Plane, den Knüppel und die Wasserschüssel und eilen zu Sepp. Das Tier neigt seinen Kopf zur Seite, es sieht und hört uns kommen. Dann senkte es seinen Schädel und zermalmt weiter das Gras. Maria steigt auf den Karren und sucht nach Essensresten. Sie findet nur leicht angeschimmeltes Brot und ein Stück Käse in einem kleinen Beutel, den sie noch zu Beginn unserer Reise unter ihrem Rock verborgen hatte. Wir binden das Seil vom Baum und vom Ochsen los und verstauen es mit der Plane im Wagen. Nach dem kargen Frühstück fahren wir zurück auf die Straße. Der Himmel ist nun bewölkt und es weht ein kühler Wind. Bruder Richolf versicherte uns beim Abschied, dass dies der Weg zur Salzstraße in den Süden sei.
Um uns vor Regen und Staub zu schützen, versuchen wir, die Plane auf dem schiefen Gestell über dem Wagen zu befestigen, was nach vielen Versuchen endlich gelingt. Nun haben wir ein Dach über dem Kopf und neben mir liegt, für alle Fälle am Boden verstaut, der Holzprügel. Sepp trottet gemächlich los, der Wagen rollt langsam zur Straße. Maria legt ihren Arm um meinen Hals und fragt lächelnd, wovon wir uns an diesem Tag ernähren sollten, denn allein von der Liebe könnten wir nicht lange leben. Es beginnt für kurze Zeit leicht zu regnen. Nun kommt zum Rauschen des Flusses das dunkle Klopfen der Regentropfen auf die Dachplane hinzu. So zieht uns Sepp langsam durch die Pfützen dieser kleinen, einsamen Landstraße.
Als die Wolken etwas aufreißen, springt Maria vom Wagen, beschwert sich über ihren Hunger und läuft in den dichten Wald auf der rechten Seite unseres Weges. Auch mir knurrt der Magen. Es regnet noch leicht und gleichzeitig bricht die Sonne durch die grauen Wolken. Am fernen Horizont sehe ich einen angedeuteten Regenbogen. Ich lächle still vor mich hin. Der Regenbogen nach der Flut und der Rettung der Arche soll ein Zeichen des Friedens zwischen Gott und den Menschen gewesen sein. Warum hat er die Ermordung meiner Familie zugelassen? Die Sonne vertreibt die Wolken. Der Regenbogen verblasst schnell und verflüchtigt sich am Himmel. Ich kann mit HaSchem keinen Frieden finden. Nach einiger Zeit sehe ich Maria aus dem Dickicht des Waldes laufen. In ihrer Schürze hat sie rote und blaue Beeren gesammelt. Ein süßlicher Geruch nach diesen Früchten strömt von ihr. Sie steigt auf den Wagen und wir essen gemeinsam von diesen köstlichen, frisch geernteten Beeren.
Ich laufe zur Isar, um Wasser zu holen, und sehe auf dem Fluss ein Floß aus der Ferne herannahen. Bald zieht es schnell an mir vorüber. Die Flößer sehen mich und winken. Sie befördern mächtige Baumstämme. Ich winke zurück, laufe dann mit dem Wasser zu unserem Rastplatz und erzähle Maria von dieser Begegnung. „Gott sei's gedankt, sie können uns nichts anhaben, denn ob sie wollen oder nicht, das Wasser treibt sie weiter. Das sind sonst recht grobe Gesellen.“ Zur Mittagszeit könnte es sehr heiß werden. Wir nutzen die Morgenstunde zur Weiterfahrt und denken uns eine neue, glaubwürdige Lebensgeschichte aus: „Seit einigen Jahren verheiratet, besuchen wir als fahrende Gewürzhändler die Märkte in Bayern und verkaufen orientalische Gewürze. Deshalb auch in diesem Sommer die beschwerliche Reise nach Tirol.“
Der Weg führt uns langsam weg vom Fluss, sein Rauschen ist verstummt. Aus weiter Ferne erklingt leises Glockengeläut. Nach einer starken Rechtsbiegung erkennen wir vor uns eine befestigte, mit groben Steinen gepflasterte Straße. Das muss die Salzstraße sein, von der Bruder Richolf berichtete. In der Mitte befinden sich zwei Rinnen, welche die großen Räder unseres Karrens aufnehmen. Wir sind erstaunt, um wie viel schneller Sepp den Karren zieht. Einige Reiter eilen vorüber, grüßen kurz und verschwinden wieder schnell aus unserem Blickfeld. Die Zeit des einsamen Reisens ist vorüber.