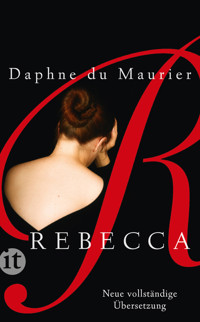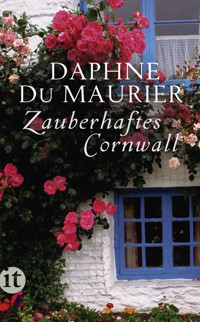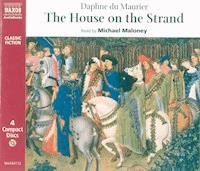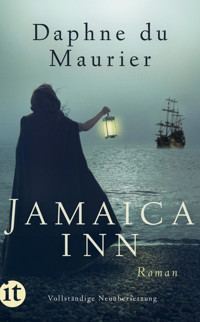
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Insel Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Düstere Geheimnisse umgeben das berüchtigte Jamaica Inn, das einsam im Moor von Cornwall liegt.
Dorthin verschlägt es die junge Waise Mary nach dem Tod ihrer Mutter. Bei ihrer Tante Patience und ihrem Onkel Joss soll sie ein neues Zuhause finden. Doch das Gasthaus nahe der zerklüfteten, sturmgepeitschten Küste beherbergt dunkle Gestalten, die üblen Geschäften nachgehen – und ihr Anführer scheint Marys Onkel zu sein. Mehr und mehr wird Mary in die Machenschaften der Männer verstrickt und gerät in Lebensgefahr. Welches undurchsichtige Spiel treibt dabei Joss‘ jüngerer Bruder Jem, in den Mary sich verliebt hat?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 517
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Daphne du Maurier
Jamaica Inn
Roman
Aus dem Englischen von Christel Dormagen und Brigitte Heinrich
Insel Verlag
Das Jamaica Inn gibt es heute noch, ein Temperenzlerhaus, gastfreundlich und liebenswert, auf der Zwanzig-Meilen-Strecke zwischen Bodmin und Launceston.
In der folgenden Abenteuergeschichte habe ich mir ausgemalt, wie es vor mehr als hundertzwanzig Jahren aussah; und auch wenn tatsächlich existierende Ortsbezeichnungen in diesem Text vorkommen, entstammen die dargestellten Charaktere und Ereignisse ausschließlich meiner Fantasie.
Daphne du Maurier
Bodinnick-by-Fowey
Im Oktober 1935
1
Es war ein kalter, grauer Tag Ende November. In der Nacht war das Wetter umgeschlagen, und ein steifer Wind hatte einen granitschwarzen Himmel und Nieselregen gebracht. Obwohl es erst kurz nach zwei Uhr nachmittags war, schien sich bereits ein blasser Winterabend auf die Hügel gesenkt und sie in Nebel gehüllt zu haben. Um vier Uhr würde es dunkel sein. Die Luft war kalt und klamm und drang trotz der fest geschlossenen Fenster ins Innere der Kutsche. Die Ledersitze fühlten sich feucht an. Das Dach hatte offenbar ein kleines Leck, durch das gelegentlich sachte ein Regentropfen fiel und dunkelblaue Flecken wie Tintenkleckse auf dem Leder hinterließ. Ein böiger Wind wehte, der die Kutsche immer wieder erfasste und durchschüttelte, sobald sie um eine Kurve bog. An höher gelegenen, exponierten Stellen blies er mit solcher Macht, dass die ganze Kutsche erzitterte und auf ihren hohen Rädern schwankte und torkelte wie ein Betrunkener.
In dem schwachen Versuch, zwischen den eigenen Schultern Schutz zu finden, hockte der Kutscher, bis über die Ohren in seinem Mantel vergraben, auf seinem Bock, während die müden Pferde schwerfällig dahintrotteten. Von Regen und Wind erschöpft, nahmen sie die Peitsche kaum wahr, die in den tauben Fingern des Kutschers pendelte und hin und wieder über ihren Köpfen knallte.
Die Räder der Kutsche knarrten und ächzten, wenn sie in den Wegfurchen versanken, und schleuderten manchmal Schlamm gegen die Fenster, der sich mit dem unaufhörlich strömenden Regen vermischte und jeden Ausblick auf die Landschaft hoffnungslos verhinderte.
Die wenigen Fahrgäste drängten sich aneinander, um sich zu wärmen, und stöhnten unisono auf, wenn die Kutsche in einer noch tieferen Furche versank. Ein alter Mann, der seit seinem Zusteigen in Truro ununterbrochen geklagt hatte, erhob sich wütend von seinem Sitz und machte sich am Schiebefenster zu schaffen, das krachend hinuntersauste und ihn selbst und seine Mitreisenden mit einem Tropfenregen überzog. Er streckte den Kopf hinaus und beschimpfte den Kutscher mit quengelnder Fistelstimme als Schurken und Mörder; sie würden allesamt noch vor Ankunft in Bodmin den Tod finden, wenn er weiterhin mit solch halsbrecherischer Geschwindigkeit weiterfahre; ihnen gehe ohnehin schon die Puste aus, und was ihn selbst betreffe, so werde er nie wieder per Kutsche reisen.
Ob der Kutscher ihn hörte, war ungewiss. Wahrscheinlicher war, dass seine Suada vom Wind davongetragen wurde, denn nach kurzem Abwarten, währenddem das Kutscheninnere gründlich auskühlte, schob der Alte das Fenster wieder zu, richtete sich aufs Neue in seiner Ecke ein, murmelte etwas in seinen Bart und wickelte seine Decke um die Knie.
Seine Sitznachbarin, eine muntere, rotgesichtige Frau in einem blauen Umhang, stieß einen tiefen, mitfühlenden Seufzer aus und bemerkte mit einem Zwinkern an die Adresse aller, die zufällig gerade hersahen, und einem ruckartigen Nicken in Richtung des alten Mannes mindestens zum zwanzigsten Mal, dies sei die schlimmste Nacht, an die sie sich erinnern könne, und sie habe schon einige erlebt, ein wahrhaftiges Mistwetter, das man unmöglich als Sommer bezeichnen könne. Dann wühlte sie in den Tiefen eines großen Korbs und förderte ein mächtiges Stück Kuchen zutage, dem sie mit kräftigen weißen Zähnen herzhaft zu Leibe rückte.
Mary Yellan saß ihr gegenüber in der anderen Ecke, wo der Regen durch das marode Dach sickerte. Gelegentlich fiel ihr ein kalter Tropfen auf die Schulter, den sie ungeduldig abwischte.
Das Kinn in die Hände gestützt, den Blick auf das schlamm- und regenverschmierte Fenster gerichtet, hoffte sie beinahe verzweifelt, dass wenigstens für einen Moment ein Lichtstrahl durch die bleiernen Wolken brechen und eine Spur des verlorenen blauen Himmels aufscheinen lassen möge, der am Vortag noch wie ein Versprechen auf Glück Helford überspannt hatte.
Schon jetzt, kaum vierzig Meilen von dem Ort entfernt, der dreiundzwanzig Jahre ihr Zuhause gewesen war, begann die Hoffnung in ihrem Herzen zu verblassen, und die große Tapferkeit, die sie auszeichnete und mit der sie die lange Leidenszeit ihrer Mutter und deren Tod durchgestanden hatte, wurde von diesem ersten Regenguss und dem widerwärtigen Wind nachdrücklich erschüttert.
Die Landschaft war ihr fremd, was an sich schon eine Niederlage war. Wenn sie aus dem beschlagenen Kutschenfenster spähte, sah sie eine andere Welt als jene, die sie noch bis zum gestrigen Tag gekannt hatte. Wie fern und für sie nun vielleicht für immer unerreichbar waren die schimmernden Wasser von Helford, die grünen Hügel und die sanft gewellten Täler, die Ansammlungen weißgetünchter Cottages am Ufer. In Helford fiel ein anderer Regen, der leise auf die zahlreichen Bäume niederrieselte, sich im üppigen Gras verlor und Bäche und Rinnsale bildete, die sich in den breiten Fluss ergossen, in der dankbaren Erde versickerten und von ihr in Form von Blumen zurückgezahlt wurden.
Hier war der Regen eine peitschende, unbarmherzige Flut, die mit Wucht gegen die Kutschenfenster trommelte und die harte, unfruchtbare Erde durchweichte. Hier gab es keine Bäume, allenfalls ein, zwei, die ihre kahlen Äste in alle Himmelsrichtungen reckten, von jahrhundertelangen Stürmen gebeugt und gekrümmt und von Zeit und Witterung so geschwärzt, dass, selbst wenn sich an einem Ort wie diesem ein Hauch von Frühling zeigen sollte, aus Angst vor dem tödlichen Spätfrost kein junger Trieb es wagen würde, sich zum Blatt zu entfalten. Es war eine karge Landschaft, ohne Hecken und Wiesen, eine Landschaft voller Steine, schwarzem Heidekraut und verkrüppelten Ginsterbüschen.
Hier würde es nie eine milde Jahreszeit geben, dachte Mary, entweder grimmigen Winter wie an diesem Tag oder die trockene, ausdörrende Hitze des Hochsommers, und weit und breit kein Schutz und Schatten spendendes Tal, nur Gras, das sich schon vor Ende Mai grau-gelb verfärbte. Das Land war mit dem Wetter ergraut. Selbst die Menschen auf der Straße und in den Dörfern passten sich ihrer Umgebung an. In Helston, wo sie die erste Kutsche bestiegen hatte, hatte sie sich auf vertrautem Terrain bewegt. So viele Kindheitserinnerungen waren mit Helston verbunden. Ganz früher die wöchentliche Fahrt zum Markt mit ihrem Vater, und später, als er ihnen genommen worden war, die Seelenstärke, mit der ihre Mutter seinen Platz einnahm und genau wie er sommers und winters mit ihren Hühnern, den Eiern und der Butter hinten auf dem Karren hin- und hergefahren war, während Mary neben ihr, das kleine Kinn auf den Henkel gestützt, einen Korb so groß wie sie selbst umklammert hielt. Die Menschen in Helston waren freundlich. Yellan war im Ort ein bekannter und respektierter Name, denn die Witwe hatte nach dem Tod ihres Mannes einen harten Kampf zu fechten gehabt. Es gab nicht viele Frauen, die mit einem Kind und einem Hof, die zu versorgen waren, allein gelebt hätten, ohne auch nur an einen neuen Mann zu denken. In Manaccan gab es einen Bauern, der sie gern gefragt hätte, wenn er sich denn getraut hätte, und flussaufwärts, in Gweek, einen weiteren, doch sie konnten es an ihren Augen ablesen, dass sie keinen von ihnen haben wollte und mit Leib und Seele dem Verstorbenen gehörte. Es war die schwere Arbeit auf dem Hof, die am Ende ihren Tribut forderte, denn sie schonte sich nie, und so sehr sie sich in den siebzehn Jahren ihrer Witwenschaft stets energisch angetrieben hatte, der Belastung der letzten Prüfung hielt sie nicht mehr stand, und ihr Herz setzte aus.
Nach und nach hatten sie die Anzahl der Tiere reduzieren müssen, und da die Zeiten schlecht waren – so sagte man ihr in Helston – und die Preise vollständig zusammenbrachen, gab es nirgendwo Geld zu verdienen. Weiter im Norden war es das gleiche Bild. Eher früher als später würde man auf den Höfen Hunger leiden. Dann brach eine Krankheit aus und tötete in den Dörfern rund um Helston den Viehbestand. Eine namenlose Krankheit, für die man kein Gegenmittel fand. Es war ein Übel, das alles ergriff und zerstörte, ähnlich wie ein Spätfrost zur falschen Zeit, der mit dem Neumond kommt und beim Verschwinden mit Ausnahme einer schmalen Schneise abgestorbener Pflanzen keine Spuren hinterlässt. Für Mary Yellan und ihre Mutter war es eine aufreibende, angstvolle Zeit. Sie mussten zusehen, wie, eins nach dem anderen, die Hühner und Entlein, die sie großgezogen hatten, erkrankten und starben; das junge Kalb fiel auf der Weide einfach um. Am beklagenswertesten war die alte Stute, die ihnen zwanzig Jahre treue Dienste geleistet hatte und auf deren breitem gedrungenen Rücken die kleine Mary zum ersten Mal geritten war. Sie starb eines Morgens in ihrer Box, den lieben Kopf in Marys Schoß gelegt. Als man im Obstgarten unter dem Apfelbaum ein Loch aushub und sie darin begrub und ihnen klar wurde, dass sie sie nie mehr nach Helston zum Markt tragen würde, drehte sich die Mutter zu Mary um und sagte: »Mit der armen Nell ist auch ein Teil von mir ins Grab gegangen, Mary. Ich weiß nicht, was es ist, ob es vielleicht an meinem Glauben liegt, aber mein Herz ist müde, und ich kann nicht mehr.«
Sie ging ins Haus und setzte sich in die Küche, blass wie ein Leintuch, und sah um zehn Jahre älter aus. Als Mary den Arzt holen wollte, zuckte sie die Schultern. »Es ist zu spät, Kind«, sagte sie, »siebzehn Jahre zu spät.« Dann fing sie leise an zu weinen, sie, die bis dahin nie geweint hatte.
Mary holte den alten Arzt, der in Mawgan wohnte und sie zur Welt gebracht hatte, und als er in seinem Einspänner mit ihr zurückfuhr, schüttelte er den Kopf. »Ich sage dir, was es ist, Mary«, meinte er, »deine Mutter hat seit dem Tod deines Vaters weder ihren Geist noch ihren Körper geschont, und jetzt ist sie schließlich zusammengebrochen. Das gefällt mir nicht. Es kommt zu einem schlechten Zeitpunkt.«
Sie fuhren auf dem gewundenen Sträßchen zu dem Bauernhaus oberhalb des Dorfes. Am Tor kam ihnen eine Nachbarin entgegen, um beflissen die schlechte Nachricht zu überbringen: »Deiner Mutter geht es schlechter«, rief sie. »Sie kam vorhin aus der Tür, schaute drein wie ein Geist und zitterte am ganzen Leib, dann fiel sie auf einmal um. Mrs Hobyn ist gekommen und Will Searle; sie haben sie aufgehoben und hineingebracht, die arme Seele. Sie sagen, ihre Augen seien geschlossen.«
Resolut schob der Arzt die kleine gaffende Menge von der Tür zurück. Gemeinsam mit Will Searle hob er die reglose Gestalt vom Fußboden auf und trug sie nach oben ins Schlafzimmer.
»Ein Schlaganfall«, sagte der Arzt, »doch sie atmet, und ihr Puls geht regelmäßig. Das habe ich befürchtet – dass sie eines Tages plötzlich zerbricht, so wie jetzt. Warum gerade heute, nach all den Jahren, das weiß nur Gott und sie selbst. Du musst dich jetzt als Kind deiner Eltern erweisen, Mary, und ihr beistehen. Du bist die Einzige, die das kann.«
Mehr als ein halbes Jahr pflegte Mary ihre Mutter während ihrer ersten und letzten Krankheit, doch trotz aller Fürsorge, die Mary und der Arzt ihr angedeihen ließen, war die Witwe nicht mehr gewillt, sich zu erholen. Sie verspürte keinen Wunsch, um ihr Leben zu kämpfen.
Es war, als sehne sie sich nach Erlösung und bete heimlich, dass es schnell so weit wäre. Sie sagte zu Mary: »Ich möchte nicht, dass du dich so abrackerst wie ich. Daran zerbricht man, körperlich und seelisch. Es gibt keinen Grund für dich, nach meinem Tod in Helford zu bleiben. Am besten, du gehst zu deiner Tante Patience nach Bodmin.«
Vergeblich erklärte Mary ihrer Mutter, dass sie nicht sterben werde. Sie hatte es sich in den Kopf gesetzt, und dagegen war Mary machtlos.
»Ich möchte den Hof nicht verlassen, Mutter«, sagte sie. »Ich bin hier geboren und vor mir mein Vater, und du selbst stammst aus Helford. Die Yellans sind hier verwurzelt. Ich habe keine Angst vor Armut und dass es mit dem Hof weiter bergab geht. Du hast siebzehn Jahre allein hier gearbeitet, warum sollte ich das nicht auch können? Ich bin stark, ich kann die Arbeit eines Mannes verrichten, das weißt du.«
»Das ist kein Leben für ein Mädchen«, erwiderte ihre Mutter. »Deinem Vater und dir zuliebe habe ich es all die Jahre getan. Für jemanden zu arbeiten macht eine Frau ruhig und zufrieden; wenn man für sich selbst arbeitet, ist das ganz anders. Dann ist man nicht mit dem Herzen dabei.«
»Ich würde nicht in eine Stadt passen«, sagte Mary. »Ich habe nie etwas anderes kennengelernt als dieses Leben am Fluss, und ich möchte es auch nicht. Helston ist Stadt genug für mich. Ich bin am liebsten hier, mit den paar Hühnern, die uns noch geblieben sind, dem Grünzeug im Garten und dem alten Schwein und dem kleinen Boot auf dem Fluss. Was soll ich denn in Bodmin bei Tante Patience?«
»Ein Mädchen, das allein lebt, Mary, wird komisch im Kopf oder gerät in schlechte Gesellschaft. Entweder das eine oder das andere. Hast du die arme Sue vergessen, die bei Vollmond um Mitternacht über den Friedhof spazierte und nach dem Liebsten rief, den sie nie hatte? Und dann gab es vor deiner Geburt noch ein junges Mädchen, das mit sechzehn Waise wurde. Sie rannte davon, nach Falmouth, und ging mit den Matrosen. Ich fände keine Ruhe im Grab und dein Vater auch nicht, wenn wir dich nicht in Sicherheit wüssten. Du wirst deine Tante Patience mögen; sie hat früher immer gern gespielt und gelacht, und sie hatte ein großes Herz. Weißt du noch, wie sie vor zwölf Jahren hierherkam? Sie hatte Bänder an ihrer Haube und einen seidenen Unterrock. In Trelowarren gab es jemanden, der hatte ein Auge auf sie geworfen, aber sie fand, sie sei zu gut für ihn.«
Ja, Mary erinnerte sich an Tante Patience mit ihren Stirnlocken und den großen blauen Augen, auch daran, wie sie lachte und schwatzte und ihre Röcke raffte und auf Zehenspitzen über den schlammigen Hof stakste. Sie war so hübsch gewesen wie eine Fee.
»Was dein Onkel Joshua für ein Mann ist, kann ich nicht sagen«, meinte ihre Mutter, »denn ich habe ihn nie gesehen und kenne auch niemanden, der ihm je begegnet ist. Aber als deine Tante ihn heiratete, vergangenen Michaelistag vor zehn Jahren, schrieb sie einen Haufen Unsinn, wie man es von einem jungen Mädchen erwarten würde und nicht von einer Frau über dreißig.«
»Sie werden mich grobschlächtig finden«, sagte Mary langsam. »Ich habe nicht die feinen Manieren, die sie erwarten. Wir hätten einander nicht viel zu sagen.«
»Sie werden dich um deiner selbst lieben und nicht wegen irgendwelcher vornehmer Umgangsformen. Kind, du musst mir versprechen, dass du nach meinem Tod deiner Tante Patience schreibst und ihr mitteilst, es sei mein letzter, innigster Wunsch gewesen, dass du zu ihr gehst.«
»Ich verspreche es«, antwortete Many, doch ihr wurde das Herz schwer bei dem Gedanken an eine so unsichere, veränderte Zukunft, in der alles, was sie gekannt und geliebt hatte, verlorenginge, und nicht einmal mehr die vertraute Umgebung bliebe, die sie trösten und ihr durch die schlimmen Tage helfen könnte.
Ihre Mutter wurde täglich schwächer; jeden Tag sickerte das Leben ein wenig mehr aus ihr. Sie hielt sich noch während der Erntezeit und des Obstpflückens, bis zu den ersten fallenden Blättern. Doch als morgens die Nebel aufzogen, Bodenfrost einsetzte und der angeschwollene Fluss über die Ufer trat, um sich ins tobende Meer zu ergießen, und die Wellen Helfords kleine Strände zerstörten, drehte sich die Witwe ruhelos in ihrem Bett und zupfte an den Laken. Sie redete Mary mit dem Namen ihres toten Mannes an und sprach von der Vergangenheit, von Menschen, die Mary nie gekannt hatte. Drei Tage lebte sie noch in ihrer eigenen kleinen Welt, am vierten starb sie.
Nach und nach musste Mary zusehen, wie die Dinge, die sie geliebt und auf die sie sich verstanden hatte, in andere Hände übergingen. Die Tiere landeten auf dem Markt in Helston. Die Möbel wurden Stück für Stück von den Nachbarn aufgekauft. Ein Mann aus Coverack verliebte sich in das Haus und erwarb es. Mit der Pfeife im Mund durchmaß er den Hof und wies auf die Veränderungen hin, die er vornehmen, und die Bäume, die er fällen wollte, um die Aussicht zu verbessern, während Mary ihm in stummer Abscheu vom Fenster aus zusah und ihre spärlichen Habseligkeiten in den Reisekoffer ihres Vaters packte.
Dieser Fremde aus Coverack machte sie zu einem Eindringling in ihrem eigenen Heim. Sie erkannte in seinem Blick, dass er sie fortwünschte, und sie dachte inzwischen nur noch daran, fort zu sein, weg von allem, und dem Ganzen für immer den Rücken zu kehren. Noch einmal las sie den Brief ihrer Tante, in krakeliger Schrift auf einfachem Papier verfasst. Darin hieß es, die Verfasserin sei schockiert von dem Schlag, den ihre Nichte erlitten habe; sie habe von der Erkrankung ihrer Schwester keine Ahnung gehabt, ihr Besuch in Helford sei schon so lange her. Weiter schrieb sie: »Bei uns hat es Veränderungen gegeben, von denen Du nichts wissen kannst. Ich lebe nicht mehr in Bodmin, sondern beinahe zwanzig Meilen außerhalb, an der Straße nach Launceston. Es ist ein wilder, einsamer Ort, und wenn Du zu uns kommen solltest, würde ich mich im Winter über Deine Gesellschaft freuen. Ich habe Deinen Onkel gefragt, und er hat nichts dagegen. Er sagt, wenn Du nicht zu laut bist und nicht zu viel plapperst, wird er Dich in der Not unterstützen. Er kann Dir weder Geld geben noch Dich umsonst verköstigen, das verstehst Du sicher. Er erwartet, dass Du ihm als Gegenleistung für Kost und Logis in der Bar zur Hand gehst. Dein Onkel ist der Wirt des Jamaica Inn.«
Mary faltete den Brief zusammen und legte ihn in ihren Koffer. Ein merkwürdiger Willkommensgruß von der strahlend lächelnden Tante Patience, die sie in Erinnerung hatte.
Ein kalter, inhaltsleerer Brief ohne ein Wort des Trostes oder des Entgegenkommens, lediglich der Hinweis, dass die Nichte nicht um Geld bitten dürfe. Tante Patience mit ihrem seidenen Unterrock und den feinen Manieren die Frau eines Gastwirts! Mary entschied, dass ihre Mutter dies nicht gewusst haben konnte. Der Brief war ganz anders als der, den die glückliche Braut vor zehn Jahren geschrieben hatte.
Doch Mary hatte ein Versprechen gegeben und konnte ihr Wort nicht brechen. Ihr Zuhause war verkauft, hier war kein Platz mehr für sie. Wie auch immer man sie aufnehmen würde, ihre Tante war die Schwester ihrer Mutter, und das war das Einzige, was zählte. Das alte Leben lag hinter ihr, der geliebte, vertraute Hof und das schimmernde Wasser von Helford. Vor ihr lag ihre Zukunft – und das Jamaica Inn.
Und so kam es, dass Mary Yellan in der quietschenden, schwankenden Kutsche von Helston nach Norden reiste, durch Truro an der Quelle des Fal, die Stadt mit den zahlreichen Dächern und Türmen, den breiten Pflasterstraßen und dem blauen Himmel, der noch den Süden verriet, wo die Menschen in den Türen lächelnd der ratternd vorbeifahrenden Kutsche zuwinkten. Doch nachdem sie Truro und das Tal hinter sich gelassen hatten, zogen Wolken auf, und das Land zu beiden Seiten der Hauptstraße wurde rau und war nicht mehr bestellt. Die Dörfer lagen nun weit auseinander, und in den Türen der Cottages sah man nur wenige lächelnde Gesichter. Bäume waren selten, Hecken gab es nicht. Dann kam Wind auf, und mit dem Wind setzte der Regen ein. So gelangte die Kutsche rumpelnd nach Bodmin, das genauso grau und abweisend wirkte wie die Hügel, die es umgaben. Ein Fahrgast nach dem anderen packte nun, bereit zum Ausstieg, seine Sachen zusammen – alle außer Mary, die noch immer in ihrer Ecke saß. Der Kutscher, dem der Regen über das Gesicht lief, schaute zum Fenster herein.
»Fahren Sie weiter nach Launceston?«, fragte er. »Das wird eine wilde Fahrt übers Moor heute Abend. Sie könnten über Nacht in Bodmin bleiben und morgen mit der Kutsche weiterfahren. In dieser Kutsche wären Sie ganz allein.«
»Meine Freunde erwarten mich«, erwiderte Mary. »Ich fürchte mich nicht vor der Fahrt. Und ich will nicht bis ganz nach Launceston; bitte setzen Sie mich am Jamaica Inn ab.«
Der Mann betrachtete sie neugierig. »Das Jamaica Inn?«, fragte er. »Was wollen Sie denn im Jamaica Inn? Das ist kein Ort für ein junges Mädchen. Da müssen Sie sich geirrt haben.« Er musterte sie durchdringend, glaubte ihr nicht.
»Oh, ich habe schon gehört, dass es dort einsam ist«, sagte Mary, »aber ich gehöre auch nicht in die Stadt. In Helford, am Fluss, wo ich herkomme, da ist es ruhig, sommers wie winters, und ich habe mich dort nie einsam gefühlt.«
»Ich habe nicht von Einsamkeit gesprochen«, antwortete der Mann. »Ich glaube, Sie verstehen nicht, weil Sie hier oben fremd sind. Ich meine nicht die zwanzig Meilen über das Moor, obwohl die die meisten Frauen abschrecken würden. Einen Moment.« Er rief über die Schulter einer Frau etwas zu, die im Türrahmen des Royal stand und die Verandalampe anzündete, denn es dämmerte bereits.
»Hören Sie«, sagte er zu der Frau, »kommen Sie kurz und reden Sie mit diesem jungen Mädchen. Mir hat man gesagt, sie wolle nach Launceston, aber sie hat mich gebeten, sie am Jamaica Inn abzusetzen.«
Die Frau kam die Treppe herunter und spähte in die Kutsche. »Es ist wild und rau dort oben«, meinte sie, »und falls Sie Arbeit suchen, werden Sie auf den Farmen keine finden. Die mögen keine Fremden auf dem Moor. Hier unten in Bodmin wären Sie besser dran.«
Mary lächelte. »Mir passiert schon nichts«, sagte sie. »Ich gehe zu Verwandten. Mein Onkel ist der Wirt vom Jamaica Inn.«
Ein langes Schweigen folgte. Im grauen Licht der Kutsche konnte Mary sehen, wie die Frau und der Mann sie anstarrten. Plötzlich wurde ihr kalt vor Angst. Sie hätte sich von der Frau ein beruhigendes Wort gewünscht, doch das kam nicht. Die Frau zog sich vom Fenster zurück. »Es tut mir leid«, sagte sie langsam. »Es geht mich natürlich nichts an. Gute Nacht.«
Der Kutscher, ziemlich rot im Gesicht, begann zu pfeifen wie jemand, der einer unangenehmen Situation entrinnen möchte. Besorgt beugte Mary sich nach vorn und berührte ihn am Arm. »Würden Sie mir sagen, was los ist?«, bat sie. »Egal, was es ist. Wird mein Onkel nicht geschätzt? Stimmt irgendetwas nicht?«
Dem Mann war die Situation sehr unangenehm. Er antwortete barsch und vermied es, ihr in die Augen zu sehen. »Das Jamaica hat einen schlechten Ruf«, sagte er, »man erzählt sich seltsame Geschichten, Sie wissen ja, wie das ist. Aber ich will keinen Ärger. Vielleicht stimmen sie auch nicht.«
»Was für Geschichten?«, fragte Mary. »Wollen Sie sagen, dass dort zu viel getrunken wird? Zieht mein Onkel schlechte Gesellschaft an?«
Der Mann wollte nicht mit der Sprache heraus. »Ich will keinen Ärger«, wiederholte er, »und ich weiß nichts. Die Leute reden halt. Anständige Menschen gehen nicht mehr ins Jamaica. Das ist alles, was ich weiß. Früher haben wir dort immer die Pferde getränkt und gefüttert und auch selbst einen Happen gegessen und was getrunken. Aber jetzt halten wir dort nicht mehr. Wir scheuchen die Pferde ohne anzuhalten weiter bis Five Lanes, und dort bleiben wir auch nicht lange.«
»Warum gehen die Leute denn nicht mehr hin? Aus welchem Grund?«, beharrte Mary.
Der Mann zögerte; er schien nach Worten zu suchen.
»Sie haben Angst«, meinte er schließlich und schüttelte dann den Kopf; mehr würde er nicht sagen. Vielleicht hatte er das Gefühl, etwas Ungehöriges gesagt zu haben, und sie tat ihm leid, denn kurz darauf schaute er wieder zum Fenster herein und fragte: »Möchten Sie vor der Weiterfahrt nicht noch eine Tasse Tee trinken?«, fragte er. »Sie haben eine lange Fahrt vor sich, und auf dem Moor ist es kalt.«
Mary schüttelte den Kopf. Ihr Appetit war verflogen. Auch wenn eine Tasse Tee sie gewärmt hätte, verspürte sie nicht den Wunsch, aus der Kutsche zu steigen und das Royal zu betreten. Dort würde sie von der Frau angestarrt, und die Leute würden zu flüstern anfangen. Außerdem gab es diesen kleinen, bohrenden Feigling in ihr, der ihr zuflüsterte: »Bleib in Bodmin, bleib in Bodmin«, und wer weiß, vielleicht hätte sie ihm im Schutz des Royal nachgegeben. Sie hatte ihrer Mutter versprochen, zu Tante Patience zu gehen, und dieses gegebene Wort durfte sie unter keinen Umständen brechen.
»Dann fahren wir besser weiter«, sagte der Kutscher. »Sie sind heute Abend die einzige Reisende. Da ist noch eine Decke für Ihre Knie. Ich gebe den Pferden die Peitsche, sobald wir hinter Bodmin den Hügel hinauf sind, denn es ist keine gute Nacht für eine solche Fahrt. Ich bin erst wieder ruhig, wenn ich in Launceston in meinem Bett liege. Nicht viele sind bereit, im Winter das Moor zu überqueren, nicht bei schlechtem Wetter.« Dann schlug er die Tür zu und kletterte auf seinen Bock.
Die Kutsche rumpelte die Straße entlang, vorbei an den sicheren, soliden Häusern, den zahllosen blinkenden Lichtern und den vereinzelten Menschen, die, gegen Wind und Regen gestemmt, zum Abendessen nach Hause hasteten. Hinter geschlossenen Fensterläden sah Mary einladenden Kerzenschein aufblitzen; dort würde im Kamin ein Feuer brennen, der Tisch würde gedeckt, eine Frau würde sich mit ihren Kindern zum Essen setzen, während der Mann sich an den fröhlich züngelnden Flammen die Hände wärmte. Sie dachte an die gutgelaunte Bauersfrau, die mit ihr gereist war, und überlegte, ob auch sie jetzt wohl mit ihren Kindern bei Tisch saß. Wie gemütlich sie gewesen war, mit ihren Apfelbäckchen, ihren rauen, abgearbeiteten Händen! Wie viel tröstliche Sicherheit ihre tiefe Stimme vermittelt hatte! Und Mary erfand eine kleine Geschichte, wie sie ihr von der Kutsche aus folgte und sie um ihre Gesellschaft und ein Zuhause bat. Sie wäre nicht abgewiesen worden, dessen war sie sich sicher. Sie hätte ein Lächeln bekommen, eine freundliche Hand und ein Bett. Sie hätte der Frau gedient und sie mit der Zeit liebgewonnen, einen Teil ihres Lebens mit ihr geteilt, ihre Familie und ihre Bekannten kennengelernt.
Jetzt erklommen die Pferde den steilen Hügel stadtauswärts, und beim Blick aus dem Heckfenster der Kutsche sah Mary, wie die Lichter von Bodmin, eins ums andere, rasch verschwanden, bis nur noch ein letzter Lichtschein aufglomm und flackernd erlosch. Nun war sie mit Regen und Wind allein, und zwölf lange Meilen einsames Moor lagen zwischen ihr und dem Ziel ihrer Reise.
Sie dachte, ob sich ein Schiff wohl so fühlte, wenn es den sicheren Hafen hinter sich ließ. Kein Schiff konnte sich verlassener fühlen als sie, nicht einmal, wenn der Wind in der Takelage heulte und die Brecher das Deck überspülten.
Inzwischen war es in der Kutsche dunkel, denn Mary hatte die Fackel lieber gelöscht, weil sie nur einen kränklichen gelben Schein verbreitete, der durch die Zugluft vom Dach hierhin und dorthin geweht wurde und das Leder gefährdete. Sie kauerte in ihrer Ecke, von einer Seite auf die andere geworfen, wenn die Kutsche durchgeschüttelt wurde, und ihr schien, als habe sie noch nie zuvor erlebt, dass Einsamkeit so feindselig sein konnte. Dieselbe Kutsche, die sie den ganzen Tag über sanft gewiegt hatte, wirkte jetzt mit ihrem Ächzen und Stöhnen bedrohlich. Seit sie den Schutz der Hügel verlassen hatten, zerrten Wind und Regen mit zunehmender Gewalt am Dach und peitschten mit neuer Tücke gegen die Fenster. Zu beiden Seiten der Straße verlor sich das Gelände irgendwo in der Dunkelheit. Keine Bäume, keine Wege, weder Weiler noch Dörfer, sondern nur Meile um Meile trostloses Moor, das sich wüstengleich dunkel und unbegangen zu einem unsichtbaren Horizont erstreckte. In dieser unwirtlichen Landschaft kann kein Mensch leben und sein wie jeder andere, dachte Mary; schon die Kinder würden entstellt geboren, wie die geschwärzten Ginsterbüsche, gebeugt von dem unaufhörlichen Wind, der aus allen Himmelsrichtungen zugleich zu wehen schien. Auch ihr Verstand wäre entstellt, bösartig im Denken, weil sie inmitten von Marschland und Granit, rauem Heidekraut und bröselndem Gestein leben mussten.
Sie wären von seltsamen Eltern geboren, die mit dieser Erde als Kopfkissen und unter diesem schwarzen Himmel schliefen. Sie hätten immer noch etwas vom Teufel in sich. Weiter ging es auf der kurvigen Straße über das dunkle, schweigende Land, ohne dass ein einziger Lichtschimmer der Reisenden in der Kutsche ein kleines Zeichen der Hoffnung gesandt hätte. Vielleicht gab es keine Siedlung auf dieser zwanzig Meilen langen Strecke zwischen Bodmin und Launceston, vielleicht nicht einmal eine armselige Schäferhütte am Rand der einsamen Landstraße – nichts außer diesem düsteren Außenposten, dem Jamaica Inn.
Mary verlor das Gefühl für Zeit und Raum; es hätten hundert Meilen und hätte schon Mitternacht sein können, sie wusste es nicht. Sie begann, sich an die Sicherheit der Kutsche zu klammern, zumindest versprach sie einen Hauch von Vertrautheit. Mary kannte sie schon seit dem frühen Morgen, und das war lange her. So groß der Albtraum dieser endlosen Fahrt auch war, zumindest gab es diese engen vier Wände, die sie beschützten, und in Rufweite die tröstliche Gegenwart des Kutschers. Ihr kam es vor, als würde er die Pferde zu immer höherem Tempo antreiben. Sie hörte, wie er ihnen etwas zurief, wie der Wind seinen Ruf an ihrem Fenster vorbeitrug.
Sie schob das Fenster auf und blickte hinaus. Ein regennasser Windstoß fuhr ihr ins Gesicht und blendete sie kurz. Nachdem sie sich das Haar aus den Augen gestrichen hatte, sah sie, dass die Kutsche im wilden Galopp eine Hügelkuppe erklomm, während zu beiden Seiten der Straße in Nebel und Regen tintenschwarz das unwirtliche Moor dräute.
Vor ihr, auf der Kuppe zu ihrer Linken, stand ein Stück von der Straße zurückgesetzt ein Gebäude. In der Dunkelheit waren schattenhaft hohe Schornsteine zu erkennen. Es gab kein anderes Gebäude, kein weiteres Cottage. Falls dies das Jamaica war, stand es da in einsamer Pracht, von allen vier Himmelsrichtungen den Elementen ausgesetzt. Mary zog ihren Umhang enger um sich und schloss die Schnalle. Die Pferde waren pariert und standen in eine dampfende Wolke gehüllt schwitzend im Regen.
Der Kutscher kletterte von seinem Bock und lud ihren Reisekoffer ab. Er schien es eilig zu haben und blickte immer wieder über die Schulter zum Haus.
»Da wären Sie nun«, sagte er, »dort hinten über den Hof. Wenn Sie an die Tür hämmern, werden sie Sie einlassen. Ich muss weiter, sonst komme ich heute Abend nicht mehr nach Launceston.« Kurz darauf saß er wieder auf seinem Bock und nahm die Zügel auf. Er rief seinen Pferden etwas zu und gab ihnen, fahrig vor Angst, die Peitsche. Die Kutsche rumpelte und schwankte, und einen Augenblick später war sie fort, die Straße hinunter und von der Dunkelheit verschluckt und verschwunden, als wäre sie nie da gewesen.
Mary stand da, den Koffer zu ihren Füßen. Sie hörte, wie in dem dunklen Gebäude hinter ihr ein Riegel zurückgezogen und die Tür aufgerissen wurde. Eine Laterne schwenkend, trat eine große Gestalt auf den Hof.
»Wer ist da?«, ertönte ein Ruf. »Was wollen Sie hier?«
Mary trat vor und blickte hoch in das Gesicht des Mannes.
Das Licht schien ihr in die Augen und verhinderte, dass sie etwas sah. Er schwenkte weiter die Laterne vor ihr, lachte plötzlich, ergriff ihren Arm und zerrte sie grob auf die Veranda.
»Ah, du bist das, ja?«, sagte er. »Dann bist du also doch gekommen. Ich bin dein Onkel, Joss Merlyn, und heiße dich willkommen im Jamaica Inn.« Er zog sie in den Schutz des Hauses, lachte erneut, schloss die Tür und stellte die Laterne im Flur auf einem Tisch ab. Dann betrachteten sie einander von Angesicht zu Angesicht.
2
Er war ein Koloss von einem Mann, über zwei Meter groß, mit gefurchten schwarzen Augenbrauen und der Hautfarbe eines Zigeuners. Das dichte schwarze Haar fiel ihm in Fransen über die Augen und verdeckte die Ohren. Er wirkte stark wie ein Pferd, mit den unglaublich kräftigen Schultern, den langen Armen, die bis fast zu den Knien reichten, und den schinkengroßen Fäusten. Sein Körper war so massig, dass der Kopf gewissermaßen zwergenhaft wirkte, wie zwischen die Schultern gesunken, wodurch, im Verein mit den schwarzen Augenbrauen und dem dichten Haarschopf, der Eindruck einer halb gebeugten, gorillaähnlichen Gestalt entstand. Ungeachtet der langen Gliedmaßen und des mächtigen Körperbaus hatten seine Züge nichts Affenhaftes; er hatte eine Hakennase und einen Mund, der inzwischen zwar verzerrt war, früher aber einmal perfekt geschnitten gewesen sein musste, und seine großen dunklen Augen wiesen trotz Falten, Tränensäcken und roten Äderchen immer noch eine gewisse Schönheit auf.
Das Beste, was ihm geblieben war, waren seine Zähne, alle noch in gutem Zustand und schneeweiß; wenn er lächelte, bildeten sie einen deutlichen Kontrast zu seinem gebräunten Gesicht und verliehen ihm das hungrige Aussehen eines mageren Wolfs. Obwohl der Unterschied zwischen dem Lächeln eines Mannes und den gebleckten Fängen eines Wolfs eigentlich sehr groß sein sollte, bei Joss Merlyn war beides ein und dasselbe.
»Dann bist du also Mary Yellan«, sagte er schließlich und beugte den Kopf, hochgewachsen, wie er war, um sie besser in Augenschein nehmen zu können, »und du bist so weit gereist, um nach deinem Onkel Joss zu sehen. Das nenne ich sehr nett von dir.«
Er lachte erneut, machte sich vermutlich über sie lustig. Sein Lachen schallte durchs Haus und wirkte wie ein Peitschenhieb auf Marys angespannte Nerven.
»Wo ist meine Tante Patience?«, fragte sie und blickte sich suchend in dem trübe beleuchteten Flur um, der mit seinen kalten Steinfliesen und der wackligen, schmalen Treppe trostlos wirkte. »Erwartet sie mich denn nicht?«
»›Wo ist meine Tante Patience?‹«, äffte der Mann sie nach. »Wo ist mein liebes Tantchen, die mich herzen und küssen und gewaltiges Aufhebens um mich machen wird? Kannst du nicht einen Augenblick warten, ehe du zu ihr rennst? Hast du denn keinen Kuss für deinen Onkel Joss?«
Mary wich zurück. Ein abstoßender Gedanke, ihn zu küssen. Er war ohnehin entweder verrückt oder betrunken. Wahrscheinlich beides. Sie wollte ihn jedoch nicht verärgern, dafür war sie zu verängstigt.
Er sah, dass sie abwägte, was sie tun sollte, und lachte wieder.
»O nein«, sagte er, »ich werde dich nicht anrühren; du bist bei mir sicher wie in der Kirche. Ich mochte noch nie dunkle Frauen, meine Liebe. Ich habe Besseres zu tun, als mit meiner eigenen Nichte Fadenspiele zu spielen.«
Er blickte höhnisch auf sie herab, behandelte sie wie eine Idiotin, seiner eigenen Scherze müde. Dann wandte er den Kopf Richtung Treppe.
»Patience«, brüllte er, »was machst du, zum Teufel? Das Mädchen ist angekommen und jammert nach dir. Sie ist meinen Anblick jetzt schon leid.«
Es raschelte oben an der Treppe, dann waren schlurfende Schritte zu hören. Eine Kerze flackerte, und jemand rief etwas. Eine Frau kam die schmale Treppe herab, schirmte ihre Augen ab gegen das Licht. Sie trug eine schmuddelige Haube auf dem dünnen grauen Haar, das ihr in strähnigen Locken um die Schultern hing. Sie hatte die Haare an den Spitzen aufgewickelt in dem vergeblichen Versuch, ihre Löckchen wiederzuerlangen. Ihr Gesicht war eingefallen, und die Haut spannte sich über den Wangenknochen. Ihre Augen waren groß und scheinbar in einer immerwährenden Frage erstarrt, der Mund mahlte unablässig. Sie trug einen verblichenen, ehemals kirschfarbenen, mittlerweile rosa verwaschenen gestreiften Unterrock und um die Schultern einen vielfach geflickten Schal. Offenbar hatte sie gerade erst ein neues Band in ihre Haube eingezogen – ein bescheidener Versuch, ihre Kleidung aufzufrischen –, was allerdings einen Missklang erzeugte. Denn das Band leuchtete scharlachrot und stand in schrecklichem Kontrast zur Blässe ihres Gesichts. Mary starrte sie wortlos und voller Sorge an. War diese armselige, zerrupfte Gestalt, gekleidet wie eine Schlampe und zwanzig Jahre älter aussehend, tatsächlich die bezaubernde Tante Patience ihrer Träume?
Die kleine Frau kam die Treppe herunter in den Flur. Sie nahm Marys Hände und studierte ihr Gesicht. »Bist du wirklich gekommen?«, flüsterte sie. »Meine Nichte, Mary Yellan, nicht wahr? Das Kind meiner toten Schwester?«
Mary nickte und dankte Gott, dass ihre Mutter sie jetzt nicht sehen konnte. »Liebe Tante Patience«, sagte sie sanft, »ich freue mich, dich wiederzusehen. Es ist so viele Jahre her, seit du uns in Helford besucht hast.«
Die Frau strich weiter mit den Händen über ihre Kleider, betastete sie, und plötzlich umklammerte sie Mary, vergrub den Kopf an ihrer Schulter, holte keuchend Luft und brach in lautes, furchtsames Schluchzen aus.
»Ach, hör auf«, knurrte ihr Ehemann. »Was für eine Begrüßung ist das denn? Was plärrst du herum, du blödes Weib? Siehst du denn nicht, dass dieses Mädchen ihr Abendessen will? Mach, dass du in die Küche kommst, und gib ihr ein wenig Speck und was zu trinken.«
Er bückte sich und schulterte Marys Koffer, als wiege er weniger als eine Pappschachtel. »Ich bringe den in ihr Zimmer«, sagte er, »und wenn du nicht etwas zu essen auf dem Tisch hast, wenn ich wieder runterkomme, dann gebe ich dir einen echten Grund zum Weinen. Und dir auch, wenn du willst«, fügte er hinzu, schob sein Gesicht ganz dicht an das Marys heran und legte ihr einen großen Finger auf den Mund. »Bist du zahm oder beißt du?«, sagte er, lachte erneut bellend dem Dach entgegen, dann polterte er, den schwankenden Koffer auf der Schulter, die schmale Treppe hinauf.
Tante Patience riss sich zusammen. Sie gab sich einen gewaltigen Ruck, lächelte, strich mit einer Geste, an die sich Mary noch halb erinnerte, ihre dünnen Locken zurecht. Dann führte sie Mary unter nervösem Geblinzel und mit unablässig mahlendem Mund in einen weiteren düsteren Flur und von dort in die Küche, wo drei Kerzen brannten und im Herd ein kleines Torffeuer glühte.
»Kümmere dich nicht um deinen Onkel Joss«, sagte sie und benahm sich plötzlich ganz anders, beinahe schmeichlerisch, wie ein winselnder Hund, der durch ständige Grausamkeit zu blindem Gehorsam abgerichtet ist und ungeachtet aller Tritte und Flüche wie ein Tiger für seinen Herrn eintritt. »Man muss deinen Onkel einfach gewähren lassen. Er ist sehr eigen, und Fremde verstehen ihn nicht gleich. Er ist mir ein sehr guter Ehemann, und das seit dem Tag unserer Hochzeit.«
Sie plapperte mechanisch weiter, während sie in der gefliesten Küche hin und her ging und den Tisch fürs Abendessen deckte, Brot, Käse und Schmalz aus dem großen Schrank hinter der Wandverkleidung holte. Mary kauerte unterdessen neben dem Feuer in dem hoffnungslosen Versuch, ihre eiskalten Hände zu wärmen.
Der Torfrauch hing schwer in der Küche. Er kroch an die Decke und in die Ecken, stand wie eine dünne blaue Wolke in der Luft. Er brannte Mary in den Augen, stieg ihr in die Nase und legte sich auf ihre Zunge.
»Du wirst deinen Onkel Joss bald gernhaben und dich an seine Art gewöhnen«, fuhr ihre Tante fort. »Er ist ein sehr guter Mann und sehr tapfer. Er hat in der Gegend einen ausgezeichneten Ruf und wird allgemein respektiert. Niemand würde über Joss Merlyn ein schlechtes Wort sagen. Hier ist manchmal sehr viel los. Es ist nicht immer so ruhig wie jetzt. Die Straße ist stark befahren, jeden Tag kommen die Kutschen hier vorbei. Und der Landadel behandelt uns sehr zuvorkommend, wirklich sehr zuvorkommend. Erst gestern schaute ein Nachbar herein, und ich habe ihm für zu Hause einen Kuchen gebacken. ›Mrs Merlyn‹, hat er gesagt, ›Sie sind die einzige Frau in ganz Cornwall, die einen ordentlichen Kuchen backen kann.‹ Genau das waren seine Worte. Und selbst der Gutsbesitzer – Squire Bassat von North Hill, dem das ganze Land hier gehört – ritt kürzlich auf der Straße an mir vorbei – am Dienstag war das –, und lüpfte den Hut. ›Guten Morgen, Madam‹, grüßte er und verbeugte sich hoch zu Pferd vor mir. Man sagt, er sei früher ein großer Frauenheld gewesen. Dann kommt Joss aus dem Stall, wo er das Kutschenrad repariert hatte. ›Wie geht's, Mr Bassat?‹, fragt er. ›Genauso gut wie Ihnen, Joss‹, antwortet der Squire, und dann lachten beide.«
Mary murmelte irgendeine Antwort auf diese kleine Rede, doch es schmerzte und bekümmerte sie, dass Tante Patience beim Erzählen ihrem Blick auswich; allein ihr Redestrom war schon verdächtig. Sie plapperte fast wie ein Kind mit blühender Fantasie, das sich selbst eine Geschichte erzählt. Ihr Verhalten bedrückte Mary, und sie wünschte nur, sie würde aufhören und schweigen, denn dieser Redeschwall war in mancher Hinsicht entsetzlicher als ihre Tränen. Vor der Tür waren jetzt Schritte zu hören, und Mary begriff beklommen, dass Joss Merlyn wieder nach unten gekommen war und die Ausführungen seiner Frau höchstwahrscheinlich mit angehört hatte.
Auch Tante Patience hörte ihn. Sie wurde blass, und ihr Mund begann zu mahlen. Er betrat den Raum und blickte von einer zur anderen.
»Die Hennen glucken also schon?«, sagte er, Lächeln und Lachen waren verschwunden, die Augen zusammengekniffen. »Deine Tränen trocknen schnell, sobald du nur reden kannst. Ich habe dich gehört, du dummes, schwatzhaftes Weib – plapper, plapper, plapper, wie eine Truthenne. Meinst du, deine kostbare Nichte glaubt auch nur ein Wort von dem, was du da erzählst? Schließlich würdest du nie ein Kind aufnehmen, erst recht keinen Haufen Unterröcke wie sie.«
Er zog einen Stuhl heran, stellte ihn krachend an den Tisch und ließ sich schwerfällig darauf nieder, dass der Stuhl unter der Last knarrte. Dann griff er nach dem Brotlaib, schnitt sich einen dicken Kanten ab und bestrich ihn mit Schmalz. Er stopfte ihn sich in den Mund, dass das Fett ihm über das Kinn tropfte, und machte Mary ein Zeichen, an den Tisch zu treten. »Du musst etwas essen, das sehe ich«, sagte er und schnitt sorgfältig eine dünne Scheibe Brot ab, viertelte und butterte sie, alles sehr zart und bedacht und in auffallendem Kontrast zu der Art und Weise, wie er sich selbst bedient hatte – so sehr, dass dieser Wechsel von brutaler Grobheit zu delikater Sorgfalt Mary geradezu mit Entsetzen erfüllte. Es war, als verfügten seine Finger über eine heimliche Fähigkeit, sich von Knüppeln in geschickte, gewiefte Diener zu verwandeln. Hätte er ihr einen Kanten Brot abgeschnitten und hingeworfen, hätte ihr das weniger ausgemacht; es hätte zu dem gepasst, was sie bereits von ihm gesehen hatte. Doch diese unvermittelte Anmut, diese flinken, eleganten Handgriffe waren eine plötzliche und eher unheilvolle Offenbarung, unheilvoll, da sie unerwartet war und ihm nicht entsprach.
Ihre Tante, die kein Wort mehr geäußert hatte, seit ihr Mann den Raum betreten hatte, briet Speck über dem Feuer. Niemand sagte etwas. Mary war sich bewusst, dass Joss Merlyn sie über den Tisch hinweg beobachtete, und hinter sich hörte sie ihre Tante mit ungeschickten Fingern mit der heißen Bratpfanne hantieren. Gleich darauf ließ sie sie mit einem bekümmerten kleinen Aufschrei fallen. Mary erhob sich von ihrem Stuhl, um ihr zu helfen, doch Joss brüllte, sie solle sich wieder setzen.
»Eine Närrin ist schlimm genug, da braucht es nicht auch noch eine zweite«, schrie er. »Bleib sitzen und lass deine Tante die Sauerei beseitigen. Es ist schließlich nicht das erste Mal.« Er lehnte sich auf seinem Stuhl zurück und begann, mit den Fingernägeln in seinen Zähnen zu pulen. »Was willst du trinken?«, fragte er Mary. »Kognak, Wein oder Bier? Du wirst hier vielleicht Hunger leiden, aber verdursten wirst du nicht. Im Jamaica wird uns die Kehle nicht trocken.« Er lachte spöttisch, zwinkerte ihr zu und streckte ihr die Zunge heraus.
»Ich hätte gern eine Tasse Tee, wenn das möglich ist«, sagte Mary. »Ich bin es nicht gewohnt, Alkohol zu trinken, auch keinen Wein.«
»Oh, ist das so. Nun, dein Pech, muss ich sagen. Heute Abend kannst du deinen Tee haben, aber bei Gott, in ein, zwei Monaten wirst du Kognak wollen.«
Er griff über den Tisch nach ihrer Hand.
»Deine Pfote ist ganz hübsch für eine, die auf einem Hof gearbeitet hat«, meinte er. »Ich hatte befürchtet, sie wäre rot und rau. Wenn es etwas gibt, was einen Mann abschreckt, dann ist es eine hässliche Hand, die ihm sein Bier einschenkt. Nicht, dass meine Kunden übermäßig heikel wären, aber wir hatten bisher noch nie eine Barfrau im Jamaica Inn.« Mit einer spöttischen Verbeugung ließ er ihre Hand wieder los.
»Patience, meine Liebe«, sagte er, »hier ist der Schlüssel. Geh und hol mir in Dreiheiligsnamen eine Flasche Kognak. Ich habe einen Durst, den nicht einmal der Dozmary-Teich löschen könnte.« Sofort eilte seine Frau aus der Küche und verschwand im Flur. Wieder begann er, in seinen Zähnen zu stochern und zwischendurch zu pfeifen, während Mary ihr Butterbrot aß und den Tee trank, den er ihr hingestellt hatte. Sie litt unter bohrenden Kopfschmerzen und war kurz vor dem Umfallen. Ihre Augen tränten vom Torfrauch. Doch trotz ihrer Müdigkeit ließ sie ihren Onkel nicht aus den Augen, denn schon jetzt war etwas von der Nervosität ihrer Tante Patience auf sie übergegangen, und sie hatte das Gefühl, sie seien beide wie Mäuse in einer Falle, außerstande zu entkommen, während er wie eine riesige Katze mit ihnen spielte.
Ein paar Minuten später kehrte seine Frau mit dem Kognak zurück, stellte ihn vor ihren Mann hin, und während sie den Speck fertig briet und Mary und sich selbst bediente, fing er an zu trinken, düster vor sich hin zu starren und gegen das Tischbein zu treten. Plötzlich schlug er mit der Faust auf den Tisch, dass Teller und Tassen wackelten und eine Platte zu Boden fiel und zerbrach.
»Ich sage dir eins, Mary Yellan«, rief er. »Ich bin hier der Herr im Haus, und ich werde dafür sorgen, dass du das nicht vergisst. Wenn du tust, was man dir sagt, im Haus hilfst und meine Gäste bedienst, werde ich dir kein Härchen krümmen. Aber, bei Gott, falls du den Mund aufmachst und herumkreischst, breche ich dich, bis du mir aus der Hand frisst wie deine Tante dort drüben.«
Mary sah ihm über den Tisch hinweg in die Augen. Ihre Hände hielt sie im Schoß, damit er ihr Zittern nicht bemerkte.
»Ich verstehe Sie«, sagte sie. »Ich bin von Natur aus nicht neugierig, und ich habe in meinem ganzen Leben noch nie getratscht. Es interessiert mich nicht, was Sie in diesem Gasthof tun und mit wem Sie Umgang pflegen. Ich werde im Haus meine Arbeit verrichten, und Sie werden keinen Grund haben, sich zu beschweren. Doch wenn Sie meiner Tante etwas zuleide tun, dann sage ich Ihnen eines – dann verlasse ich das Jamaica Inn auf der Stelle. Ich suche den Friedensrichter auf und lasse Sie vor Gericht bringen; dann können Sie gern versuchen, mich zu brechen, wenn Sie wollen.«
Mary war leichenblass geworden. Sie wusste, wenn er sie jetzt niederbrüllte, würde sie die Nerven verlieren und anfangen zu weinen, und er hätte für immer die Oberhand. Die Worte waren ihr wider besseres Wissen herausgerutscht. Voller Mitleid für ihre Tante, dieses arme, gebrochene Wesen, hatte sie sich nicht zurückhalten können. Hätte sie es nur gewusst, aber damit hatte sie sich gerettet, der Mann war von ihrem Widerspruchsgeist beeindruckt und lehnte sich entspannt wieder auf seinem Stuhl zurück.
»Das ist sehr hübsch«, sagte er, »wirklich sehr hübsch gesagt. Jetzt wissen wir wenigstens, was für eine Sorte Logiergast wir haben. Kratz sie, und sie zeigt ihre Krallen. In Ordnung, meine Liebe – du und ich, wir sind einander ähnlicher, als ich dachte. Wenn wir schon spielen, dann spielen wir zusammen. Vielleicht habe ich hier im Jamaica eines Tages Arbeit für dich, Arbeit, wie du sie noch nie getan hast. Männerarbeit, Mary Yellan, bei der es um Leben und Tod geht.« Mary hörte, wie ihre Tante Patience neben ihr nach Luft schnappte.
»O Joss«, flüsterte sie. »O Joss, bitte.«
Ihre Stimme hatte eine solche Dringlichkeit, dass Mary sie überrascht anstarrte. Sie sah, wie ihre Tante sich vorbeugte und ihrem Mann bedeutete, zu schweigen, und ihr vorgeschobenes Kinn und das Entsetzen in ihrem Blick ängstigten Mary mehr als alles andere an diesem Abend. Ihr wurde unheimlich zumute, ihr war kalt und sehr übel. Was hatte Tante Patience so in Panik versetzt? Was hatte Joss Merlyn gerade sagen wollen? Plötzlich war sie von einer ganz schrecklichen, fieberhaften Neugier erfüllt. Ihr Onkel wedelte ungeduldig mit der Hand.
»Geh zu Bett, Patience«, sagte er. »Ich bin deinen Totenschädel an meinem Abendbrottisch leid. Dieses Mädchen und ich, wir verstehen einander.«
Die Frau stand sofort auf und ging mit einem letzten hilflosen, verzweifelten Blick zur Tür. Sie hörten sie die Treppe hinaufsteigen. Joss Merlyn und Mary waren allein. Er schob das leere Kognakglas von sich und verschränkte die Arme auf dem Tisch.
»In meinem Leben gibt es eine Schwäche, und ich sage dir, was es ist«, sagte er. »Es ist der Alkohol. Er ist ein Fluch, ich weiß es. Ich kann mich nicht beherrschen. Eines Tages wird er mich fertigmachen, und er wird seine Arbeit gut machen. Es gibt Tage, da rühre ich kaum einen Tropfen an, so wie heute Abend. Und dann spüre ich wieder, wie mich der Durst überkommt, und dann saufe ich. Saufe stundenlang. Das ist dann alles auf einmal: Macht und Triumph, Frauen und das Reich Gottes. Dann fühle ich mich wie ein König, Mary. Ich habe das Gefühl, mit meinen zwei Händen die ganze Welt an Schnüren tanzen zu lassen. Es ist Himmel und Hölle. Dann rede ich, rede, bis ich jede verdammte Tat, die ich je begangen habe, in alle vier Winde hinausposaunt habe. Ich schließe mich in meinem Zimmer ein und schreie meine Geheimnisse in mein Kissen. Deine Tante dreht hinter mir den Schlüssel um, und wenn ich wieder nüchtern bin, hämmere ich an die Tür, und sie lässt mich heraus. Niemand weiß das außer ihr und mir, und jetzt habe ich es dir erzählt. Ich habe es dir erzählt, weil ich bereits ein bisschen angetrunken bin und meinen Mund nicht halten kann. Aber ich bin nicht betrunken genug, um den Kopf zu verlieren. Ich bin nicht betrunken genug, um dir zu erzählen, warum ich an diesem gottverlassenen Ort gelandet und Wirt vom Jamaica Inn geworden bin.« Seine Stimme klang heiser, und er sprach jetzt fast im Flüsterton. Das Torffeuer im Kamin war in sich zusammengesunken, und dunkle Schatten streckten ihre langen Finger über die Wand. Auch die Kerzen waren niedergebrannt und warfen ein monströses Schattenbild von Joss Merlyn an die Decke. Er lächelte sie an und legte mit einer albernen, alkoholisierten Geste den Finger an die Nase.
»Das habe ich dir nicht erzählt, Mary Yellan. O nein, noch sind mir ein bisschen Verstand und Schläue geblieben. Wenn du mehr wissen willst, kannst du deine Tante fragen. Sie wird dir eine schöne Geschichte auftischen. Ich habe ihr Geplapper heute Abend gehört; wie sie behauptet hat, dass es hier manchmal sehr gesellig zugeht und der Squire vor ihr den Hut zieht. Alles Lügen, nichts als Lügen. Ich erzähle dir das, denn du wirst es sowieso erfahren. Squire Bassat hat viel zu viel Angst, um seine Nase hier hereinzustecken. Wenn er mir auf der Landstraße begegnete, würde er das Kreuz schlagen und seinem Pferd die Sporen geben. Und der übrige kostbare Landadel ganz genauso. Die Kutschen halten hier nicht mehr, die Post ebenso wenig. Mir bereitet das keine Sorgen, ich habe Kundschaft genug. Je größer der Bogen ist, den der Landadel um mich schlägt, desto lieber ist es mir. Oh, hier wird durchaus getrunken, und zwar ziemlich viel. Die einen kommen am Samstagabend ins Jamaica, die anderen drehen dann den Türschlüssel um und stecken sich die Finger in die Ohren. In manchen Nächten sind sämtliche Hütten auf dem Moor dunkel und still, und die einzigen Lichter weit und breit sind die hell erleuchteten Fenster des Jamaica Inn. Der Gesang soll angeblich bis zu den Farmen unterhalb Roughtons zu hören sein. In diesen Nächten wirst du in der Bar arbeiten. Wenn es dir gefällt, dann siehst du, mit was für Menschen ich Umgang pflege.«
Mary saß mucksmäuschenstill da und hielt die Stuhlkanten umklammert. Sie wagte nicht, sich zu rühren, aus Angst, dass er in einem jähen Stimmungswechsel, wie sie ihn schon zuvor beobachtet hatte, aus dieser unvermittelten vertraulichen Offenheit wieder in rüde, brutale Grobheit fallen könnte.
»Sie haben allesamt Angst vor mir«, fuhr er fort, »die ganze verdammte Bande. Angst vor mir, der vor niemandem Angst hat. Ich sage dir, wenn ich eine Schule besucht hätte, wäre ich an der Seite von König George höchstpersönlich durch ganz England marschiert. Der Alkohol war mein Feind, der Alkohol und mein heißes Blut. Das ist unser aller Fluch, Mary. Es hat noch nie einen Merlyn gegeben, der friedlich in seinem Bett gestorben ist.
Mein Vater wurde in Exeter gehängt – er war mit jemandem in Streit geraten und hat ihn umgebracht. Meinem Großvater hat man wegen Diebstahls die Ohren abgeschnitten; er wurde als Sträfling in die Kolonien verschickt und starb in den Tropen, nachdem er durch einen Schlangenbiss den Verstand verloren hatte. Ich bin der älteste von drei Brüdern, alle im Schatten des Kilmar geboren, weit hinter dem Twelve Men's Moor. Um dort hinzugelangen, muss man über das East Moor bis nach Rushyford, dort sieht man eine große Granitklippe, die sich wie eine Teufelskralle in den Himmel reckt. Das ist der Kilmar. Wer in seinem Schatten geboren wird, fängt an zu trinken, so wie ich. Mein Bruder Matthew ertrank in der Trewartha Marsh. Wir hörten nichts mehr von ihm und dachten, er hätte als Matrose angeheuert; dann gab es im Sommer eine Dürre, sieben Monate lang keinen Regen, und plötzlich ragte Matthew aus dem Sumpf, die Hände über dem Kopf, und Brachvögel umflatterten ihn. Mein Bruder Jem, der Teufel soll ihn holen, war das Baby. Hing immer noch am Rockzipfel unserer Mutter, als Matt und ich schon erwachsen waren. Hab mich nie mit Jem verstanden. Der ist mir zu schlau, hat eine zu scharfe Zunge. Irgendwann werden sie den auch erwischen und hängen, genau wie meinen Vater.«
Er schwieg einen Augenblick und starrte in sein leeres Glas. Er nahm es in die Hand und stellte es wieder ab. »Nein«, sagte er, »ich habe genug gesagt. Heute Abend trinke ich nichts mehr. Geh nach oben, schlafen, Mary, bevor ich dir den Hals umdrehe. Hier ist deine Kerze. Dein Zimmer ist über der Veranda.«
Wortlos nahm Mary den Kerzenleuchter und wollte gerade an ihm vorbeigehen, als er sie an der Schulter packte und zu sich umdrehte.
»In manchen Nächten wirst du auf der Landstraße Räder rollen hören«, sagte er, »und diese Räder werden nicht vorbeifahren, sondern vor dem Jamaica Inn anhalten. Dann wirst du im Hof Schritte hören und Stimmen unter deinem Fenster. Wenn das der Fall ist, bleibst du in deinem Bett, Mary Yellan, und steckst den Kopf unter die Decke. Verstanden?«
»Ja, Onkel.«
»Sehr gut. Und jetzt fort mit dir, und wenn du mich je wieder etwas fragst, breche ich dir jeden einzelnen Knochen im Leib.«
Mary trat aus der Küche in den dunklen Durchgang, stieß gegen die Sitzbank im Vestibül, tastete sich weiter vor und versuchte, sich zu orientieren, indem sie sich wieder zur Treppe umdrehte. Ihr Onkel hatte gesagt, ihr Zimmer sei über der Veranda, und sie schlich über den unbeleuchteten, dunklen Flur an jeweils zwei Türen auf beiden Seiten vorbei – Gästezimmer, vermutete sie, die auf Reisende warteten, die inzwischen nicht mehr kamen und unter dem Dach des Jamaica Inn Schutz suchten –, und stolperte schließlich gegen eine weitere Tür, drehte den Knauf und erkannte im blakenden Kerzenschein, dass es sich um ihr Zimmer handelte, denn auf dem Fußboden stand ihr Koffer.
Die Wände waren rau und untapeziert, die Dielen kahl. Eine umgedrehte Kiste mit einem gesprungenen Spiegel darauf diente als Toilettentisch. Es gab weder Krug noch Waschschüssel, und sie nahm an, dass sie sich in der Küche waschen sollte. Das Bett quietschte, als sie sich dagegen lehnte, und die beiden fadenscheinigen Laken fühlten sich klamm an. Sie beschloss, sich nicht auszuziehen, sondern sich in ihren Reisekleidern hinzulegen, so staubig sie auch waren, und sich in ihren Umhang zu wickeln. Sie trat ans Fenster und blickte hinaus. Der Wind hatte nachgelassen, doch es regnete noch immer – ein scheußliches dünnes Nieseln, das an den Hauswänden herunterrann und den Schmutz auf der Fensterscheibe verschmierte.
Ein Geräusch drang vom entfernten Teil des Hofes zu ihr, ein merkwürdiges Stöhnen, wie von einem leidenden Tier. Es war zu dunkel, um etwas deutlich zu erkennen, doch sie konnte einen dunklen Umriss ausmachen, der sachte hin und her schwang. Nach den Geschichten, die Joss Merlyn ihr erzählt hatte, gaukelte ihre aufgeheizte Fantasie ihr für einen albtraumhaften Moment einen am Galgen hängenden Toten vor. Dann begriff sie, dass es sich um das Wirtshausschild handelte, das, weil sich niemand darum kümmerte, vermutlich nicht mehr ordentlich befestigt war und schon in der leichtesten Brise hin und her schwang. Nichts als ein armseliges, verwittertes Schild, das einmal stolzere Tage gesehen hatte, dessen weiße Buchstaben im Laufe der Zeit aber grau und unleserlich geworden waren und die Botschaft darauf Wind und Wetter ausgesetzt – Jamaica Inn. Mary schloss die Fensterläden und schlich zum Bett. Ihre Zähne klapperten, und ihre Hände und Füße waren taub vor Kälte. Lange Zeit kauerte sie auf dem Bett, ein Bild der Verzweiflung. Sie überlegte, ob sie wohl aus dem Haus fliehen und ins zwölf Meilen entfernte Bodmin zurückfinden könnte. Sie fragte sich, ob sie, von Müdigkeit übermannt, in einem Anfall von Erschöpfung am Straßenrand zusammenbrechen und an Ort und Stelle einschlafen würde, nur um, von der Morgendämmerung geweckt, die mächtige Gestalt Joss Merlyns über sich aufragen zu sehen.
Sie schloss die Augen, und sofort sah sie sein Gesicht vor sich, das sie anlächelte; dann verfinsterte sich dieses Lächeln, und sein böser Blick zerknitterte zu tausend Falten, während er vor Wut bebte; auch seinen dichten schwarzen Haarschopf sah sie vor sich, seine Hakennase und die langen, kräftigen Finger, in denen solch tödliche Anmut verborgen war.
Sie fühlte sich an diesem Ort gefangen wie ein Vogel im Netz, und sosehr sie sich auch bemühte, sie würde niemals entkommen. Wenn sie frei sein wollte, musste sie jetzt gehen, aus dem Fenster klettern und wie eine Verrückte auf der hellen Straße davonlaufen, die sich wie eine Schlange über das Moor wand. Morgen wäre es zu spät.
Sie wartete, bis sie auf der Treppe seine Schritte hörte. Er murmelte etwas vor sich hin, und zu ihrer Erleichterung wandte er sich auf dem Flur nach links und lief in eine andere Richtung. Weiter hinten fiel eine Tür ins Schloss, dann herrschte Stille. Sie entschied, nicht länger zu warten. Wenn sie auch nur eine Nacht unter diesem Dach verbrächte, würde ihr Mut sie verlassen, und sie wäre verloren. Verloren, verrückt und gebrochen wie ihre Tante Patience. Sie öffnete die Tür, stahl sich auf den Flur und von dort auf Zehenspitzen zur Treppe. Dort hielt sie inne und horchte. Sie hatte die Hand schon auf dem Geländer und den Fuß auf der obersten Treppenstufe, als sie von der anderen Flurseite her ein Geräusch wahrnahm. Jemand weinte. Jemand, der keuchend und schluchzend Luft holte und versuchte, dieses Geräusch in einem Kissen zu ersticken. Es war Tante Patience. Mary verharrte kurz, dann machte sie kehrt und ging wieder in ihr Zimmer, warf sich aufs Bett und schloss die Augen. Was immer die Zukunft ihr bringen und so groß ihre Angst sein mochte, sie würde das Jamaica Inn jetzt nicht verlassen. Sie musste bei Tante Patience bleiben. Sie wurde hier gebraucht. Vielleicht würde Tante Patience aus ihrer Anwesenheit ja Trost schöpfen, sie würden zu einem guten Einvernehmen finden, und irgendwie – müde, wie sie war, wusste sie noch nicht genau, wie – würde sie als Tante Patience' Beschützerin auftreten und sich zwischen sie und Joss Merlyn stellen. Siebzehn Jahre lang hatte ihre Mutter allein gelebt und gearbeitet und größere Mühsal ertragen, als Mary je kennenlernen würde. Sie wäre nicht wegen eines halb verrückten Mannes davongelaufen. Sie hätte sich nicht vor einem Haus gefürchtet, das von Bösem durchdrungen war, so isoliert es auch auf seinem windumtosten Hügel stehen mochte, ein einsamer Außenposten, der Mensch und Sturm trotzte. Marys Mutter hätte den Mut aufgebracht, gegen ihre Feinde zu kämpfen. Ja, und sie hätte sie schließlich besiegt. Sie durfte nicht aufgeben.
Und so lag Mary auf ihrem harten Bett, und ihre Gedanken rasten, während sie um Schlaf betete und jedes Geräusch wie ein weiterer Dolchstoß ihre Nerven traf – vom Scharren einer Maus in der Wand in ihrem Rücken bis zum Quietschen des Schilds im Hof. Sie zählte die Minuten und Stunden dieser endlosen Nacht, und als auf einem Feld hinter dem Haus der erste Hahnenschrei ertönte, hörte sie zu zählen auf, seufzte tief und schlief wie eine Tote.