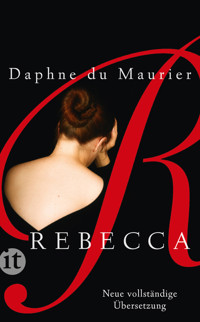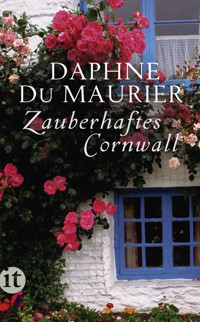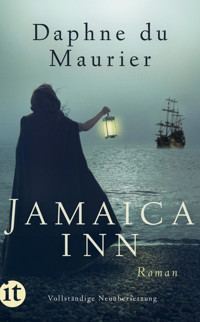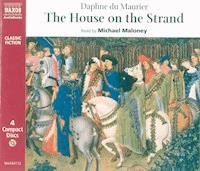11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Insel Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Klassiker psychologischer Spannung
Seit dem Tod seiner Eltern lebt Philipp bei seinem wohlhabenden Vetter Ambrose in Cornwall – bis der langjährige Junggeselle auf einer Florenzreise überraschend heiratet. In Briefen erzählt Ambrose Philipp von seinem Eheglück mit Rachel. Mit der Zeit jedoch werden die Briefe seltener, die Inhalte verwirrender. Eines Tages trifft ein beunruhigender Hilferuf aus Italien ein: Ambrose ist an einem rätselhaften Leiden erkrankt und fühlt sich von Rachel bedroht. Philipp reist alarmiert nach Florenz, doch er kommt zu spät: Ambrose ist tot, und von der jungen Witwe fehlt jede Spur ... bis Rachel vor Philipps Tür in Cornwall steht. Und sie ist ganz anders, als er erwartet hätte: humorvoll, intelligent und zurückhaltend. Mehr und mehr verfällt Philipp der schönen Frau, doch plötzlich erkrankt auch er …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 594
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Seit dem Tod seiner Eltern lebt Philip bei seinem wohlhabenden Vetter Ambrose in Cornwall – bis sich der langjährige Junggeselle auf einer Florenzreise verliebt und überraschend heiratet. In Briefen erzählt Ambrose Philip von seinem Eheglück mit Rachel. Er scheint wie besessen von ihr. Mit der Zeit jedoch werden die Briefe seltener und die Inhalte verwirrender. Eines Tages trifft ein beunruhigender Hilferuf aus Italien ein: Ambrose ist an einem rätselhaften Leiden erkrankt und fühlt sich von Rachel bedroht. Philip reist nach Florenz, doch er kommt zu spät: Ambrose ist tot, und von der jungen Witwe fehlt jede Spur …
Kaum zurück in Cornwall steht Rachel plötzlich vor Philips Tür. Und sie ist ganz anders, als er erwartet hätte: humorvoll, intelligent und zurückhaltend. Mehr und mehr verfällt Philip der schönen Frau, bis plötzlich auch er Symptome eines seltsamen Leidens zeigt …
Daphne du Maurier, geboren am 13. Mai 1907 in London, entstammt einer Künstlerfamilie. Sie wuchs in London und Paris auf und ließ sich im Alter von 19 Jahren in Cornwall nieder. Ihre schriftstellerische Tätigkeit begann sie 1928 mit Feuilletons und Kurzgeschichten. Sie veröffentlichte über 20 Romane, historische Biographien und Novellen-Sammlungen, die weltweit in Millionenauflagen erschienen. 1969 verlieh ihr die englische Königin den Titel »Dame«. Daphne du Maurier starb am 19. April 1989 in ihrem Haus Kilmarth in Cornwall.
Im insel taschenbuch liegt ebenfalls in Neuübersetzung vor: Rebecca (it 4434).
Christel Dormagen, geboren 1943 in Hamburg, hat Anglistik und Germanistik studiert und ist als Journalistin für Rundfunk und Printmedien und als Übersetzerin tätig. Sie lebt in Berlin.
Brigitte Heinrich, geboren am Bodensee, lebt nach Verlagstätigkeit in etlichen Städten und Häusern als Übersetzerin, Herausgeberin und Lektorin in Frankfurt am Main.
Daphne du Maurier
Meine Cousine Rachel
Roman
Aus dem Englischen von Brigitte Heinrich und Christel Dormagen
Die englische Originalausgabe erschien 1951 unter dem Titel My Cousin Rachel im Verlag Victor Gollancz Ltd., London
Umschlagfoto: J. A. Rausch, Trevillion Images, Brighton
Umschlag: Rothfos & Gabler, Hamburg
eBook Insel Verlag Berlin 2017
Der vorliegende Text folgt der 01. Auflage der Ausgabe des insel taschenbuchs 4496.
© Insel Verlag Berlin 2017
© Daphne du Maurier 1951
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr.
Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.
1
Früher wurden bei den Four Turnings Menschen gehenkt. Heute nicht mehr. Wenn heute ein Mörder für sein Verbrechen büßen muss, geschieht das nach einer fairen Verhandlung vor dem Schwurgericht oben in Bodmin. Das heißt, falls das Gesetz ihn verurteilt, bevor sein eigenes Gewissen ihn umbringt. So ist es besser. Wie ein chirurgischer Eingriff. Und die Leiche wird anständig beerdigt, wenn auch in einem namenlosen Grab. Als ich ein Kind war, war es noch anders. Ich kann mich erinnern, als kleiner Junge an der Stelle, wo die vier Straßen aufeinandertreffen, einen Mann in Ketten hängen gesehen zu haben. Gesicht und Körper waren zur Konservierung mit Teer geschwärzt. Er hing fünf Wochen dort, bevor sie ihn herunterschnitten. Ich sah ihn in der vierten Woche.
Er schwang zwischen Himmel und Erde an seinem Galgen oder, wie mein Cousin Ambrose es ausdrückte, zwischen Himmel und Hölle. In den Himmel würde er nicht mehr kommen, und die Hölle, durch die er gegangen war, würde ihm keine Lehre mehr sein. Ambrose stieß mit seinem Stock gegen die Leiche. Ich sehe noch vor mir, wie sie im Wind schwingt, wie eine Wetterfahne auf einer rostigen Achse, eine armselige Vogelscheuche, was einmal ein Mensch gewesen war. Der Regen hatte seine Hose zersetzt, womöglich auch seinen Körper, und Wollfetzen hingen von seinen aufgedunsenen Gliedmaßen herab wie durchweichtes Papier.
Es war Winter, und ein Spaßvogel hatte ihm als festliche Auszeichnung einen Stechpalmzweig in die zerrissene Weste gesteckt. Für mich mit meinen sieben Jahren war das irgendwie das größte Sakrileg, doch ich sagte nichts. Ambrose musste mich bewusst dorthin geführt haben, vielleicht als Mutprobe, um zu sehen, ob ich davonlaufen oder lachen oder weinen würde. Als mein Vormund, Vater, Bruder, Ratgeber, im Grunde der Mensch, der alles für mich war, prüfte er mich ständig. Wir gingen um den Galgen herum, wie ich mich erinnere, und Ambrose stieß und stupste die Leiche mit seinem Stock; dann ließ er von ihr ab, steckte sich eine Pfeife an und legte mir die Hand auf die Schulter.
»Sieh nur hin, Philip«, sagte er, »so enden wir schließlich alle. Manche auf dem Schlachtfeld, manche im Bett, jeder, wie es das Schicksal ihm bestimmt hat. Es gibt kein Entrinnen. Du kannst diese Lektion nicht früh genug lernen. Doch auf diese Weise stirbt ein Bösewicht. Eine Mahnung für dich und mich, ein rechtschaffenes Leben zu führen.« Wir standen nebeneinander und sahen der hin und her schwingenden Leiche zu, als vergnügten wir uns auf dem Jahrmarkt von Bodmin, und der Leichnam wäre der Hau-den-Lukas, auf den man schlägt, um eine Kokosnuss zu gewinnen. »Da siehst du, wohin ein unbedachter Gefühlsausbruch einen Mann führen kann«, sagte Ambrose. »Das ist Tom Jenkyn, ein ehrlicher, braver Mann, außer wenn er zu viel getrunken hatte. Es stimmt, seine Frau war ein zänkischer Drachen, aber das ist kein Grund, sie umzubringen. Wenn wir die Frauen wegen ihrer bösen Zungen umbringen wollten, wäre jeder Mann ein Mörder.«
Ich wünschte mir, er hätte den Mann nicht beim Namen genannt. Bis zu dem Moment war die Leiche ein totes Ding gewesen, ohne Identität. Jetzt würde sie, leblos und entsetzlich, meine Träume heimsuchen. Das wusste ich seit dem Moment, als mein Blick auf den Galgen gefallen war. Jetzt hatte sie eine Verbindung zur Wirklichkeit, zu dem Mann mit den wässrigen Augen, der auf der Hafenmole Hummer verkaufte. In den Sommermonaten hatte er, einen Korb neben sich, immer auf den Stufen gestanden und seine Hummer auf der Mole ausgesetzt, wo sie sich fantastische Rennen lieferten und die Kinder zum Lachen brachten. Es war noch gar nicht so lange her, dass ich ihn da gesehen hatte.
»Nun«, sagte Ambrose und betrachtete forschend mein Gesicht, »was hältst du von ihm?«
Ich zuckte die Schultern und trat gegen den Fuß des Galgens. Ambrose durfte keinesfalls merken, wie nahe es mir ging, wie elend ich mich fühlte, wie schockiert. Er würde mich verachten. Mit seinen siebenundzwanzig Jahren war Ambrose für mich der Gott aller Schöpfung, auf jeden Fall der Gott meiner kleinen Welt, und das einzige Ziel in meinem Leben bestand darin, ihm ähnlich zu sein.
»Tom schaute fröhlicher drein, als ich ihn das letzte Mal sah«, antwortete ich. »Jetzt könnte er nicht einmal mehr als Köder für seine eigenen Hummer dienen.«
Ambrose lachte und zog mich an den Ohren. »Das ist mein Junge«, sagte er. »Spricht wie ein wahrer Philosoph.« Und dann fügte er, plötzlich hellsichtig, hinzu: »Wenn dir übel ist, geh hinter die Hecke und übergib dich, und achte darauf, dass ich dich nicht sehe.«
Er kehrte dem Galgen und den vier Straßen den Rücken und ging den neuen Weg hinunter, den er damals gerade anlegen ließ; er führte durch den Wald und war als zweiter Kutschenweg zum Haus gedacht. Ich war froh, dass er ging, denn ich schaffte es nicht mehr rechtzeitig bis zur Hecke. Danach fühlte ich mich besser, auch wenn mir die Zähne klapperten und mir eiskalt war. Tom Jenkyn war jetzt wieder ein lebloses Ding, wie ein alter Sack, keine reale Person mehr. Er wurde sogar Zielscheibe eines Steins, den ich nach ihm warf. Höchst verwegen blieb ich stehen, um zu sehen, ob die Leiche sich bewegte. Doch nichts geschah. Der Stein traf mit einem dumpfen Plopp auf die durchnässten Kleider und fiel zu Boden. Beschämt rannte ich den neuen Weg hinunter und versuchte, Ambrose einzuholen.
Nun, all das war gut achtzehn Jahre her, und wenn ich mich nicht irre, habe ich seither selten daran gedacht. Bis jetzt. Seltsam, wie in Momenten großer Krisen die Gedanken in die Kindheit zurückfliegen. Aus irgendeinem Grund denke ich immerzu an den armen Tom, wie er dort in Ketten hing. Seine Geschichte habe ich nie erfahren, und nur wenige werden sich heute noch daran erinnern. Er habe seine Frau getötet, hatte Ambrose gesagt. Und das war alles. Sie sei ein Zankdrachen gewesen, doch das entschuldige keinen Mord. Zu sehr dem Alkohol zugeneigt, hatte er sie wahrscheinlich im Rausch getötet. Aber wie? Und mit welcher Waffe? Mit einem Messer, oder mit bloßen Händen? Vielleicht war Tom in jener Winternacht im Liebeswahn vom Wirtshaus am Kai nach Hause gestolpert. Es herrschte Flut, die Wellen spritzten gegen die Stufen, und der Vollmond schien aufs Wasser. Wer weiß schon, welche Fantasien, welche Eroberungsträume seinen unruhigen Geist umtrieben?
Vielleicht war er zu seinem Häuschen hinter der Kirche gestolpert, ein blasser, triefäugiger, nach Hummer stinkender Kerl, und seine Frau hatte ihn geschlagen, weil er mit nassen Füßen ins Haus getreten war. Da war sein Traum zerstoben, und er brachte sie um. Das hätte sehr wohl seine Geschichte sein können. Wenn es ein Leben nach dem Tod gibt, wie man uns lehrt, werde ich mich nach dem armen Tom umsehen und ihn befragen. Gemeinsam werden wir im Fegefeuer träumen. Doch er war ein Mann mittleren Alters, um die sechzig oder älter, und ich bin fünfundzwanzig. Unsere Träume würden nicht dieselben sein. Also kehre in den Schatten zurück, Tom, und lass mir einen Rest Frieden. Dieser Galgen ist seit langem verschwunden und du mit ihm. In meiner Unwissenheit habe ich einen Stein nach dir geworfen. Verzeih mir.
Es geht darum, dass das Leben ertragen und gelebt werden muss. Doch wie man es leben soll – das ist das Problem. Der Alltag bereitet keine Schwierigkeiten. Wie Ambrose werde ich Friedensrichter werden und eines Tages im Parlament sitzen. Man wird mich weiterhin so achten und ehren wie meine Familie vor mir. Ich werde das Land gut bestellen, für die Menschen sorgen. Niemand wird jemals ahnen, welch schwere Schuld ich auf meinen Schultern trage, noch wird irgendjemand erfahren, dass ich mir, von Schuldgefühlen geplagt, jeden Tag die eine Frage stelle, die ich nicht beantworten kann: War Rachel schuldig oder unschuldig? Vielleicht werde ich auch das im Fegefeuer in Erfahrung bringen.
Wie sanft und weich ihr Name klingt, wenn ich ihn flüstere. Er liegt heimtückisch und anhaltend auf der Zunge, fast wie Gift, was wirklich gut passt. Er gleitet von der Zunge auf die ausgedörrten Lippen, und von den Lippen zurück ins Herz. Und das Herz kontrolliert den Körper und auch den Geist. Werde ich eines Tages frei davon sein? In vierzig, fünfzig Jahren? Oder wird ein Teil meines Gehirns fahl und krank bleiben? Wird es irgendeiner winzigen Zelle in meinem Blutstrom nicht gelingen, mit den anderen zum Herzbrunnen zu fließen? Vielleicht werde ich mir, alles in allem, gar nicht mehr wünschen, frei zu sein. Noch kann ich das nicht sagen.
Ich halte noch immer das Haus in Ehren, wie Ambrose es sich von mir gewünscht hätte. Ich kann die Mauern neu verputzen, wo Feuchtigkeit eindringt, und alles gut instand halten. Weiterhin Bäume und Sträucher pflanzen, die kahlen Hügel aufforsten, wo der Wind von Osten hereinfegt. Wenn ich gehe, möchte ich etwas Schönes vererben, wenn auch nichts sonst. Doch ein einsamer Mann ist unnatürlich und hat etwas Ratloses. Und aus Ratlosigkeit entstehen Hirngespinste. Und aus Hirngespinsten Wahnsinn. Und so schwenke ich wieder zu Tom Jenkyn und seinen Ketten. Vielleicht hat auch er gelitten.
Ambrose lief damals, vor achtzehn Jahren, den Weg entlang und ich hinter ihm her. Gut möglich, dass er das abgewetzte Jackett angezogen hatte, das ich gerade trage. Das alte grüne Jagdjackett mit den Lederflecken auf den Ellbogen. Ich bin ihm so ähnlich geworden, dass ich sein Geist sein könnte. Meine Augen sind seine Augen, meine Gesichtszüge die seinen. Der Mann, der damals nach seinen Hunden pfiff und den vier Straßen und dem Galgen den Rücken zuwandte, könnte ich sein. Nun, das war es, was ich immer gewollt hatte. So zu sein wie er. Seine Größe wollte ich haben, seine Schultern, seine gebeugte Haltung, selbst die langen Arme und die ziemlich klobigen Hände; sein unvermitteltes Lächeln sollte meines sein, seine Scheu bei der ersten Begegnung mit Fremden, die Abneigung gegen jedes Getue, jede Förmlichkeit. Sein unkomplizierter Umgang mit denen, die ihm dienten und ihn liebten – wer ihn mir ebenfalls bescheinigt, schmeichelt mir. Und die Stärke, die sich als Illusion erwies, so dass uns die gleiche Katastrophe traf. In letzter Zeit frage ich mich, ob damals bei seinem Tod, als sein Verstand von Zweifeln und Angst gepeinigt war und er sich in der verdammten Villa, wo ich ihn nicht erreichen konnte, einsam und vergessen fühlte, seine Seele seinen Körper verließ und hierherkam und in meinen fuhr, ihn in Besitz nahm, so dass er in mir weiterlebte und seine Fehler wiederholte, ein zweites Mal von der Krankheit befallen wurde und ein zweites Mal zugrunde ging. So mochte es sein. Ich weiß nur, dass meine Ähnlichkeit mit ihm, die mich mit Stolz erfüllte, auch mein Verhängnis war. Sie führte zu meinem Untergang. Wäre ich anders gewesen, geschmeidig und gewandt, mit flinker Zunge und einem Sinn fürs Geschäft, dann wäre das vergangene Jahr nichts weiter gewesen als weitere zwölf Monate, die kamen und gingen. Ich würde mich munter und zufrieden der Zukunft widmen. Womöglich einer Ehe und einer jungen Familie.
Doch all das war ich nicht, und Ambrose auch nicht. Wir waren Träumer, alle beide, unpraktisch, scheu, den Kopf voll großartiger Theorien, die sich nie bewähren mussten, und wie alle Träumer, gingen wir schlafwandelnd durch die Welt. Trotz der Vorbehalte gegen unsere Mitmenschen sehnten wir uns nach Zuneigung; unsere Schüchternheit stand spontanen Regungen jedoch im Weg, solange nicht das Herz berührt war. Aber wenn das geschah, öffnete sich der Himmel, und beide fühlten wir uns, als hätten wir den ganzen Reichtum des Universums zu verschenken. Wir wären beide davongekommen, wenn wir anders gewesen wären. Rachel wäre zwar dennoch hergekommen, hätte ein, zwei Nächte hier verbracht, wäre dann aber ihrer Wege gegangen. Man hätte geschäftliche Dinge besprochen, eine Abfindung beschlossen, das Testament wäre von Anwälten ganz offiziell an einem Tisch verlesen worden, ich hätte ihr – die Angelegenheit mit einem Blick erfassend – eine lebenslängliche Rente ausgesetzt und wäre sie so losgeworden.
Es kam nicht so, weil ich wie Ambrose aussah. Es kam nicht so, weil ich wie Ambrose empfand. Als ich an jenem Abend zu ihrem Zimmer hinaufging und nach dem Klopfen wegen des niedrigen Türsturzes mit leicht gebeugtem Kopf unter der Tür stehen blieb und sie sich aus dem Sessel erhob, in dem sie am Fenster saß, und zu mir aufblickte, hätte ich an dem wissenden Aufleuchten ihrer Augen erkennen müssen, dass sie nicht mich sah, sondern Ambrose. Nicht Philip, sondern ein Phantom. Damals hätte sie gehen sollen. Hätte ihre Koffer packen und abreisen sollen. Dorthin zurück, wo sie hingehörte, zurück in die Villa mit den geschlossenen Fensterläden, zu den verstaubten Erinnerungen, dem terrassierten französischen Garten und dem rieselnden Brunnen in dem kleinen Hof. Hätte in ihr eigenes Land zurückkehren sollen, das im Hochsommer ausgedörrt im Hitzedunst lag und im Winter kahl unter einem kalten, klaren Himmel. Ein Instinkt hätte sie warnen sollen, dass ihr Bleiben Zerstörung bringen würde, nicht nur für das Phantom, das sie antraf, sondern am Ende auch für sie selbst.
Ich frage mich, ob sie, als sie mich dort stehen sah, schüchtern und unbeholfen, glühend vor Feindseligkeit wegen ihrer Anwesenheit und mir dennoch meiner Rolle als Gastgeber und Hausherr sehr bewusst, voller Wut über meine großen Füße, die langen Arme und Beine, eckig und schlaksig, ein ungezähmtes Fohlen – ob sie wohl plötzlich bei sich dachte: ›So muss Ambrose in seiner Jugend gewesen sein. Vor meiner Zeit. Ich kannte ihn noch nicht, als er so aussah‹ – und deshalb blieb?
Vielleicht war das der Grund, warum auch der Italiener Rainaldi mich bei der ersten kurzen Begegnung mit dem gleichen schockierten Blick des Wiedererkennens angesehen und kurz mit dem Füllhalter auf seinem Schreibtisch gespielt hatte, um sich zu fassen und dann mit neutralem Blick zu mir zu sagen: »Sie sind erst heute angekommen? Ihre Cousine Rachel hat Sie also noch nicht gesehen.« Offensichtlich hatte sein Instinkt also auch ihn gewarnt. Doch zu spät.
Man kann im Leben nicht umkehren. Es gibt kein Zurück. Keine zweite Chance. Ich kann, wie ich hier sitze, lebendig und in meinem eigenen Haus, das einmal ausgesprochene Wort oder die vollendete Tat nicht ungeschehen machen, genauso wenig wie der arme Tom Jenkyn an seinen Ketten.
Ebendas hat mein Pate Nick Kendall am Vorabend meines fünfundzwanzigsten Geburtstags auf seine schroffe, gradlinige Art zu mir gesagt – es ist erst wenige Monate her und doch, mein Gott, so lange schon –: »Es gibt Frauen, Philip, sehr wahrscheinlich gute Frauen, die ohne eigenes Verschulden Unglück bringen. Was sie auch anfassen, wird zur Tragödie. Ich weiß nicht, warum ich dir das sage, aber ich habe das Gefühl, dass ich es muss.« Anschließend beglaubigte er meine Unterschrift auf dem Dokument, das ich ihm vorgelegt hatte.
Nein, es gibt kein Zurück. Der junge Mann, der am Vorabend seines Geburtstags unter ihrem Fenster stand, der Junge, der am Abend ihrer Ankunft auf ihrer Türschwelle stand, ist nicht mehr, ebenso wie das Kind, das, um sich Mut zu machen, einen an einem Galgen hängenden Toten mit einem Stein bewarf. Tom Jenkyn, du Beispiel menschlichen Elends, unkenntlich und unbeweint, hast du mir vor all diesen Jahren mitleidig nachgeblickt, als ich durch den Wald in die Zukunft rannte?
Hätte ich noch einmal über die Schulter zurückgeblickt, dann hätte ich nicht dich in Ketten hängen sehen, sondern meine eigene schemenhafte Gestalt.
2
Ich hatte keinerlei Vorahnung, als wir am Abend, bevor Ambrose zu seiner letzten Reise aufbrach, beisammensaßen und plauderten. Kein ungutes Gefühl, dass wir uns nie wiedersehen würden. Es war der dritte Winter, den er auf Anweisung der Ärzte im Ausland verbrachte. Inzwischen hatte ich mich an seine Abwesenheit gewöhnt und auch daran, mich um den Besitz zu kümmern, während er fort war. Im ersten Winter hatte ich noch in Oxford studiert, weshalb sein Fortgehen für mich eigentlich nichts änderte, aber im zweiten Winter kehrte ich endgültig nach Hause zurück und blieb die ganze Zeit dort, was er auch von mir erwartete. Das gesellige Leben in Oxford vermisste ich nicht, ja, ich war sogar froh, es hinter mir zu lassen.
Ich hatte nie den Wunsch verspürt, irgendwo anders zu sein als zu Hause. Abgesehen von meiner Schulzeit in Harrow und danach dem Studium in Oxford habe ich nie woanders gelebt als in diesem Haus, in das ich, nach dem frühen Tod meiner Eltern, im Alter von achtzehn Monaten kam. Auf seine verschrobene, großzügige Art empfand Ambrose Mitleid für seinen kleinen verwaisten Cousin, und so übernahm er es, mich aufzuziehen, wie er es vielleicht mit einem Welpen oder einem jungen Kätzchen oder sonst irgendeinem schwachen, einsamen, schutzbedürftigen Wesen getan hätte.
Von Anfang an führten wir einen seltsamen Haushalt. Mein Kindermädchen schickte er zum Teufel, als ich drei Jahre alt war, weil sie mir den Hintern mit einer Haarbürste versohlt hatte. Ich selbst kann mich nicht an diesen Vorfall erinnern, aber er erzählte mir später davon.
»Ich war so abscheulich wütend«, sagte er zu mir, »als ich sah, dass diese Frau dich kleines Wesen wegen irgendeines harmlosen Vergehens mit ihren großen, groben Händen bearbeitete, dass sie einfach zu unbedarft war, um zu begreifen. Danach übernahm ich das Strafen stets selbst.«
Ich hatte nie Grund, das zu bedauern. Es hätte niemanden geben können, der anständiger, gerechter, liebenswürdiger und verständnisvoller war. Das Alphabet brachte er mir auf die denkbar einfachste Weise bei, indem er sich die Anfangsbuchstaben von Kraftausdrücken vornahm – sechsundzwanzig verschiedene zu finden war nicht ganz einfach, doch irgendwie gelang es ihm, und jedes Mal warnte er mich davor, diese Worte in Gesellschaft zu benutzen. Ein insgesamt durch und durch zuvorkommender Mensch, war er Frauen gegenüber jedoch schüchtern, ja, sogar misstrauisch, und behauptete, sie stifteten in einem Haushalt nur Unheil. Deshalb stellte er ausschließlich männliche Dienstboten ein; beaufsichtigt wurde der Tross vom alten Seecombe, der der Butler meines Onkels gewesen war.
Exzentrisch mochte Ambrose sein und unorthodox – der Südwesten des Landes ist seit jeher für seine kauzigen Charaktere bekannt –, doch trotz seiner eigentümlichen Ansichten über Frauen und die Aufzucht kleiner Jungen war er kein Spinner. Von den Nachbarn wurde er gemocht und respektiert, von seinen Pächtern geliebt. Er schoss und jagte im Winter, bevor er an Rheuma litt, fischte im Sommer von einem kleinen Segelboot aus, das in der Flussmündung ankerte, aß auswärts und lud Gäste ein, wenn er Lust dazu hatte, ging sonntags zweimal zum Gottesdienst, auch wenn er mir in der Kirchenbank der Familie einen genervten Blick zuwarf, sobald die Predigt zu lang wurde, und er versuchte, auch in mir eine Leidenschaft für das Anpflanzen seltener Sträucher zu wecken.
»Es ist eine Form von Erschaffen«, pflegte er zu sagen, »wie viele andere auch. Einige Menschen verschreiben sich der Fortpflanzung. Ich ziehe es vor, Dinge in der Erde wachsen zu lassen. Es strengt nicht so an, und das Ergebnis ist weitaus befriedigender.«
Das schockierte meinen Patenonkel, Nick Kendall, und Hubert Pascoe, den Pfarrer, sowie einige seiner Freunde, die ihn stets drängten, sich den Wonnen eines Heims zu widmen und eine Familie zu gründen, anstatt Rhododendren zu züchten.
»Ich habe ein Junges aufgezogen«, pflegte er zur Antwort zu geben und zog mich dabei an den Ohren, »und das hat mich zwanzig Jahre meines Lebens gekostet oder sie mir geschenkt, je nachdem, wie ich es betrachte. Und mit Philip habe ich darüber hinaus einen fix und fertigen Erben, weshalb keine Rede davon sein kann, dass ich meine Pflicht zu tun hätte. Er wird sie für mich erledigen, wenn seine Zeit gekommen ist. Und nun lehnen Sie sich in Ihren Sesseln zurück, und machen Sie es sich bequem, meine Herren. Und da keine Frau im Haus ist, können wir unsere Stiefel auf den Tisch legen und auf den Teppich spucken.«
Natürlich taten wir nichts dergleichen. Ambrose war absolut penibel, doch es bereitete ihm Vergnügen, solche Bemerkungen vor dem neuen Pfarrer zu machen, einem Pantoffelhelden, armer Kerl, mit einer ganzen Horde von Töchtern, und dann machte beim sonntäglichen Abendessen der Portwein die Runde, und Ambrose zwinkerte mir vom anderen Ende des Tisches aus zu.
Ich sehe ihn jetzt noch vor mir, wie er sich, halb gebeugt, halb in seinen Sessel gefläzt – ich habe diese Gewohnheit von ihm übernommen – vor stummem Lachen schüttelte, wenn der Pfarrer seinen schüchternen, wirkungslosen Protest einlegte, wie er intuitiv den Ton der Unterhaltung änderte, da er befürchtete, die Gefühle des Mannes verletzt zu haben, und zu Themen wechselte, die dem Pfarrer angenehm waren, und wirklich alles tat, damit der kleine Kerl sich wieder wohlfühlte. Ich begann, seine Qualitäten noch mehr zu schätzen, als ich nach Harrow kam. Die Ferien vergingen mir viel zu schnell, wenn ich seine Umgangsformen und seine Gesellschaft mit denen der Bengel verglich, die meine Schulkameraden waren, und auch der Lehrer, so steif und trocken und, für mein Gefühl, ohne jede menschliche Regung.
»Halb so schlimm«, sagte er immer und klopfte mir dabei auf die Schulter, wenn ich, kalkweiß im Gesicht und ein wenig weinerlich, wieder einmal aufbrach, um die Kutsche nach London zu erreichen. »Es ist einfach ein Ausbildungsprozess, ähnlich wie wenn man ein Pferd zureitet; das müssen wir durchstehen. Wenn deine Schulzeit erst hinter dir liegt, und das wird schneller der Fall sein, als du denkst, werde ich dich für immer hierherholen und persönlich ausbilden.«
»Ausbilden wofür?«, fragte ich.
»Nun, du bist doch mein Erbe, oder etwa nicht? Und das ist ein richtiger, eigenständiger Beruf.«
Und dann brach ich auf, mit Wellington, dem Kutscher, der mich nach Bodmin brachte, wo die Postkutsche nach London wartete. Ich drehte mich ein letztes Mal nach Ambrose um, der, das dicht gelockte Haar bereits ein wenig angegraut, die Augen verständnisvoll zusammengekniffen, auf seinen Stock gestützt, mit den Hunden an der Seite dort stand; und wenn er dann nach den Hunden pfiff und ins Haus zurückging, schluckte ich den Klumpen im Hals hinunter und spürte, wie die Wagenräder mich unausweichlich, unwiderruflich forttrugen, auf knirschendem Kies quer durch den Park, am Pförtnerhaus vorbei durch das weiße Tor, zu Schule und Getrenntsein.
Er hatte jedoch nicht mit seiner körperlichen Verfassung gerechnet, und als Schule und Universität hinter mir lagen, war es an ihm zu gehen.
»Sie erklären mir, wenn ich mich einen weiteren Winter täglich vollregnen lasse, werde ich meine Tage als Krüppel im Rollstuhl beschließen«, sagte er zu mir. »Ich muss fort und die Sonne aufsuchen. An den Küsten Spaniens oder in Ägypten, überall am Mittelmeer, wo es trocken und warm ist. Ich habe keine besondere Lust dazu, aber andererseits möchte ich mein Leben verdammt noch mal nicht als Krüppel beenden. Und einen Vorteil hat der Plan ja. Ich werde Pflanzen nach Hause bringen, die sonst niemand hat. Mal sehen, wie diese Racker in der kornischen Erde gedeihen.«
Der erste Winter kam und ging, ebenso der zweite. Ihm gefiel diese Art Leben, und ich glaube nicht, dass er einsam war. Er kehrte mit der Himmel weiß wie vielen Bäumen, Sträuchern und Blumen zurück – Pflanzen jeglicher Form und Farbe. Kamelien waren seine spezielle Leidenschaft. Nur für sie legten wir ein ganzes Feld an, und ob er einen grünen Daumen besaß oder über Zauberkräfte verfügte, weiß ich nicht, jedenfalls blühten sie gleich von Anfang an, und wir verloren keine Einzige von ihnen.
So vergingen die Monate bis zum dritten Winter. Dieses Mal hatte er sich für Italien entschieden. Er wollte sich einige Gärten in Florenz und Rom ansehen. In keiner der beiden Städte würde es im Winter warm sein, doch das beunruhigte ihn nicht. Jemand hatte ihm versichert, die Luft dort sei zwar kalt, aber trocken, und er müsse keinen Regen fürchten. An jenem Abend unterhielten wir uns lange. Er ging eigentlich nie früh zu Bett, und oft saßen wir bis ein oder zwei Uhr morgens zusammen in der Bibliothek, manchmal schweigend, manchmal plaudernd, beide die langen Beine vor dem Kamin ausgestreckt, die Hunde um unsere Füße gewickelt. Ich sagte schon, dass ich keine Vorahnung hatte, aber wenn ich jetzt zurückdenke, frage ich mich, ob es ihm nicht vielleicht anders erging. Er blickte mich immer wieder verwundert und irgendwie nachdenklich an, dann sah er von mir zu den getäfelten Wänden des Zimmers und den vertrauten Gemälden, dann wieder zum Feuer im Kamin und von dort zu den schlafenden Hunden.
»Ich wünschte, du kämst mit«, sagte er aus heiterem Himmel.
»Ich würde nicht lange zum Packen brauchen«, erwiderte ich.
Er schüttelte den Kopf und lächelte. »Nein, das war ein Scherz. Wir können nicht gleichzeitig monatelang fort sein. Du weißt, als Gutsbesitzer trägt man Verantwortung, auch wenn das nicht jeder so sieht wie ich.«
»Ich könnte mit dir nach Rom reisen«, sagte ich, ganz aufgeregt von der Idee. »Und wenn ich vom Wetter nicht zurückgehalten werde, könnte ich Weihnachten wieder zu Hause sein.«
»Nein«, sagte er nachdenklich, »nein, das war nur eine plötzliche Laune. Vergiss es wieder.«
»Dir geht es doch gut, oder?«, fragte ich. »Keinerlei Schmerzen?«
»Um Gottes willen, nein«, lachte er, »wofür hältst du mich, für einen Invaliden? Ich hatte schon seit Monaten keinen Rheumaanfall mehr. Das Dumme ist einfach, Philip, mein Junge, dass ich mich mit meinem Haus so närrisch anstelle. Wenn du erst einmal in meinem Alter bist, geht es dir vielleicht genauso.«
Er erhob sich aus seinem Sessel und ging zum Fenster. Er zog die schweren Vorhänge beiseite und starrte eine Weile hinaus aufs Gras. Es war ein ruhiger, stiller Abend. Die Dohlen hatten ihre Schlafplätze aufgesucht, und ausnahmsweise schwiegen sogar die Eulen.
»Ich bin froh, dass wir die Wege beseitigt haben und der Rasen jetzt direkt bis ans Haus heranreicht«, sagte er. »Es würde sogar noch besser aussehen, wenn das Gras auch den Hang hinauf wüchse, bis ganz nach hinten zur Ponyweide. Irgendwann musst du einmal das Unterholz roden, damit man einen freien Blick aufs Meer hat.«
»Was meinst du damit«, sagte ich, »ich soll das tun? Wieso nicht du?«
Er antwortete nicht sofort. »Einerlei«, sagte er schließlich, »ganz einerlei. Es kommt auf dasselbe heraus. Aber denk dran.«
Mein alter Retriever Don hob den Kopf und blickte zu ihm auf. Er hatte in der Halle die verschnürten Kisten gesehen und witterte den Aufbruch. Er rappelte sich mühsam auf und stellte sich mit hängendem Schwanz neben Ambrose. Ich rief ihn leise, doch er kam nicht. Ich klopfte im Kamin die Asche aus meiner Pfeife. Die Kirchturmuhr schlug zur vollen Stunde. Im Dienstbotentrakt hörte ich Seecombe den Küchenjungen ausschelten.
»Ambrose«, sagte ich, »Ambrose, lass mich mit dir kommen.«
»Sei kein verdammter Trottel, Philip, geh schlafen«, erwiderte er.
Das war alles. Wir sprachen nicht weiter über das Thema. Am nächsten Morgen gab er mir beim Frühstück die letzten Anweisungen für die Frühlingsbepflanzung und eine Liste von Dingen, die er vor seiner Rückkehr gern von mir erledigt sehen wollte. Er hatte sich plötzlich in den Kopf gesetzt, bei der östlichen Zufahrt zum Park, wo der Boden sumpfig war, einen kleinen Teich anzulegen, und der müsste ausgehoben und, bei einigermaßen passablem Wetter, in den Wintermonaten mit einem kleinen Wall versehen werden. Die Zeit zum Aufbruch kam nur zu schnell. Das Frühstück beendeten wir schon um sieben Uhr, weil er sich früh auf den Weg machen musste. Er würde die Nacht in Plymouth verbringen und morgens mit der Flut dort in See stechen. Das Schiff, ein Frachter, würde ihn nach Marseille bringen, und von dort aus würde er ganz gemächlich nach Italien weiterfahren; er liebte lange Seereisen. Es war ein rauer, feuchter Morgen. Wellington fuhr mit der Kutsche vor, und schon bald war sie hoch beladen mit Gepäck. Die Pferde waren unruhig und drängten zum Aufbruch. Ambrose kam zu mir und legte mir die Hand auf die Schulter. »Kümmere dich um alles«, sagte er, »enttäusch mich nicht.«
»Das war wirklich nicht nett von dir«, erwiderte ich. »Ich habe dich noch nie enttäuscht.«
»Du bist sehr jung«, sagte er. »Und ich lade dir eine Menge auf die Schultern, mag sein. Aber alles, was ich habe, gehört in jedem Fall dir, das weißt du.«
Hätte ich ihn in diesem Moment weiter bedrängt, dann hätte er mich, glaube ich, mitreisen lassen. Doch ich sagte nichts. Seecombe und ich halfen ihm mitsamt seinen Decken und Stöcken in die Kutsche, und er lächelte uns aus dem offenen Fenster zu.
»Nun denn, Wellington«, sagte er, »auf geht's.«
Und gerade als sie die Auffahrt entlang davonfuhren, begann es zu regnen.
Die Wochen vergingen kaum anders als in den letzten beiden Wintern. Ich vermisste ihn, wie ich es immer tat, doch ich hatte viel zu tun. Wenn ich Gesellschaft brauchte, setzte ich mich aufs Pferd und besuchte meinen Patenonkel Nick Kendall, dessen einzige Tochter Louise einige Jahre jünger war als ich und seit Kindertagen eine Spielgefährtin. Sie war ein guter Kumpel, überhaupt nicht launenhaft und durchaus hübsch. Ambrose pflegte gelegentlich zu scherzen, eines Tages werde sie mir eine gute Ehefrau sein, aber ich gestehe, dass ich sie nie unter diesem Gesichtspunkt gesehen habe.
Es war Mitte November, als sein erster Brief kam, vom selben Schiff, das ihn nach Marseille gebracht hatte, auf der Rückreise mitgenommen. Die Überfahrt sei ohne besondere Vorkommnisse gewesen, das Wetter gut, bis auf ein wenig Gerüttel in der Bucht von Biskaya. Er fühle sich wohl, sei guter Dinge und freue sich auf die Reise nach Italien. Er habe sich nicht der Postkutsche anvertrauen mögen, was in jedem Fall eine Fahrt nach Lyon bedeutet hätte, sondern Pferd und Wagen gemietet und beabsichtige, an der Küste entlang nach Italien zu reisen und dann weiter nach Florenz. Wellington schüttelte den Kopf, als er das hörte, und prophezeite einen Unfall. Er war der festen Überzeugung, dass kein Franzose fahren könne und alle Italiener Räuber seien. Ambrose überlebte jedoch, und der nächste Brief kam aus Florenz. Ich habe all seine Briefe aufbewahrt, und das Bündel liegt jetzt vor mir. Wie oft habe ich sie in den folgenden Monaten gelesen; sie waren abgegriffen und umgeknickt und wieder und wieder gelesen worden, als hätte allein der Druck meiner Hände mehr aus den Seiten herauspressen können, als die geschriebenen Worte von sich aus hergaben.
Und gegen Ende dieses ersten Briefs aus Florenz, wo er offenbar Weihnachten verbracht hatte, sprach er zum ersten Mal von Cousine Rachel.
»Ich habe die Bekanntschaft einer unserer Verwandten gemacht«, schrieb er. »Ich habe Dir doch gelegentlich von den Coryns erzählt, die früher ein Haus am Tamar hatten, das jetzt verkauft wurde und in andere Hände gelangt ist. Ein Coryn hat vor zwei Generationen eine Ashley geheiratet, wie Du unserem Familienstammbaum entnehmen kannst. Eine Nachfahrin dieses Zweigs, Tochter eines mittellosen Vaters und einer italienischen Mutter, wurde in Italien geboren und heiratete sehr früh einen italienischen Adligen namens Sangalletti, der dann offenbar halb angesäuselt in einem Duell das Zeitliche segnete und seiner Frau einen Berg Schulden und eine große, kahle Villa hinterließ. Keine Kinder. Die Contessa Sangalletti oder, wie sie unbedingt genannt werden möchte, meine Cousine Rachel, ist eine gescheite Frau, eine angenehme Gesellschafterin; sie hat es auf sich genommen, mir die Gärten von Florenz zu zeigen und später auch die in Rom, da wir beide uns zur selben Zeit dort aufhalten werden.«
Ich war froh, dass Ambrose jemanden gefunden hatte, eine Frau, die seine Leidenschaft für Gärten teilte. Da ich nichts über die Florentiner und die römische Gesellschaft wusste, hatte ich befürchtet, es lebten nur wenige Engländer dort, mit denen er hätte Bekanntschaft schließen können, und nun gab es wenigstens einen Menschen, der noch dazu aus Cornwall stammte, so dass auch das sie miteinander verband.
Der nächste Brief bestand fast ausschließlich aus einer Aufzählung von Gärten, die, obwohl zu dieser Jahreszeit nicht gerade in Bestform, auf Ambrose großen Eindruck gemacht zu haben schienen.
»Ich beginne, unsere Cousine Rachel allmählich wirklich zu schätzen«, schrieb Ambrose Anfang des Frühlings, »und wenn ich daran denke, was sie durch diesen Sangalletti erlitten haben muss, wird mir ganz elend. Diese Italiener sind einfach heimtückische Schurken, da gibt es nichts dran zu deuteln. Was das Verhalten und die Ansichten Deiner Cousine Rachel angeht, so ist sie ebenso englisch wie Du und ich und hätte gut noch gestern am Tamar leben können. Kann gar nicht genug bekommen von zu Hause und all dem, was ich zu erzählen habe. Sie ist äußerst intelligent, weiß aber, Gott sei Dank, wann sie den Mund zu halten hat. Nichts von dem für Frauen so typischen endlosen Geplapper. Unweit ihrer Villa hat sie mir in Fiesole eine hervorragende Wohnung besorgt, und sobald das Wetter etwas milder wird, werde ich einen Großteil meiner Zeit bei ihr verbringen, auf der Terrasse sitzen oder in dem Garten herumwerkeln, der für seine Gestaltung und seine Statuen offenbar berühmt ist; von Letzteren verstehe ich allerdings nicht besonders viel. Wovon sie lebt, ist mir nicht klar, aber ich vermute, dass sie sehr viele der Wertgegenstände aus der Villa verkaufen musste, um die Schulden ihres Mannes zu begleichen.«
Ich fragte meinen Paten Nick Kendall, ob er sich an die Coryns erinnern könne. Das tat er, und er hatte keine hohe Meinung von ihnen. »Sie waren ein nichtsnutziger Haufen, als ich klein war«, sagte er. »Verspielten Geld und Landbesitz, und jetzt ist das Haus am Tamar-Ufer nicht viel mehr als eine verfallene Farm. Ist schon vor vierzig Jahren eingestürzt. Der Vater dieser Frau muss Alexander Coryn gewesen sein. Ich glaube, er verschwand aufs Festland. Er war der zweite Sohn eines zweiten Sohns. Ich weiß aber nicht, was danach aus ihm geworden ist. Erwähnt Ambrose das Alter dieser Contessa?«
»Nein«, erwiderte ich, »er schrieb mir nur, sie habe sehr jung geheiratet, aber er hat nicht gesagt, wie lange das her ist. Ich vermute, sie ist mittleren Alters.«
»Sie muss sehr charmant sein, wenn sie Mr Ashley beeindrucken kann«, bemerkte Louise. »Ich habe noch nie gehört, dass er eine Frau bewundert.«
»Das ist wahrscheinlich das Geheimnis«, sagte ich. »Sie ist reizlos und unscheinbar, und er fühlt sich nicht verpflichtet, ihr Komplimente zu machen. Ich bin sehr froh darüber.«
Ein oder zwei Briefe folgten noch, hingeworfen, ohne große Neuigkeiten. Entweder kam er gerade von einem Essen mit unserer Cousine Rachel, oder er war auf dem Weg dorthin. Er erwähnte, es gebe leider nur wenige Menschen unter ihren Freunden in Florenz, die sie in ihren Angelegenheiten wirklich unparteiisch beraten könnten. Er selbst schmeichle sich, schrieb er, dass er dazu in der Lage sei. Und sie sei so ausgesprochen dankbar. Trotz ihrer vielen Interessen wirke sie merkwürdig einsam. Mit Sangalletti könne sie niemals irgendetwas verbunden haben; sie habe ihm bekannt, dass sie sich schon ihr Leben lang nach englischen Freunden verzehre. »Ich habe das Gefühl, dass mir etwas gelungen ist«, schrieb er, »abgesehen davon, dass ich Hunderte neuer Pflanzen nach Hause bringen werde.«
Danach kam lange Zeit nichts. Er hatte für seine Rückkehr kein Datum genannt, aber gewöhnlich kam er gegen Ende April zurück. Der Winter war uns diesmal lang erschienen, und der Frost, im Westteil unseres Landes selten hart, war unerwartet streng. Einige seiner jungen Kamelien hatten dadurch Schaden genommen, und ich hoffte, er würde nicht zu bald zurückkehren, um hier nicht noch auf starke Winde und strömenden Regen zu treffen.
Kurz nach Ostern kam sein Brief. »Lieber Junge«, schrieb er, »Du wirst Dich über mein Schweigen gewundert haben. Und ich hätte wahrhaftig nie gedacht, dass ich Dir eines Tages einen solchen Brief schreiben würde. Das Schicksal geht oft seltsame Wege. Du bist mir immer so nah gewesen, dass Du wahrscheinlich etwas von dem Aufruhr geahnt hast, der in den vergangenen Wochen in meinem Kopf getobt hat. Aufruhr ist das falsche Wort. Vielleicht sollte ich sagen: glückliche Verwirrung, die zur Gewissheit geworden ist. Ich habe keine schnelle Entscheidung getroffen. Wie Du weißt, bin ich zu sehr ein Gewohnheitsmensch, als dass ich mein Leben aus einer bloßen Laune heraus verändern würde. Doch seit einigen Wochen weiß ich, dass es der richtige Weg war. Ich habe etwas gefunden, das ich bis dahin noch nie gefunden und an dessen Existenz ich nicht geglaubt hatte. Selbst jetzt noch kann ich kaum fassen, dass es geschehen ist. In Gedanken war ich sehr oft bei Dir, aber irgendwie fühlte ich mich bis heute nicht gelassen und stabil genug, um zu schreiben. Du musst wissen, dass Deine Cousine Rachel und ich seit zwei Wochen verheiratet sind. Wir verbringen gerade in Neapel unsere Flitterwochen und wollen in Kürze nach Florenz zurückkehren. Weiter kann ich noch nicht denken. Wir haben keine Pläne gemacht, keiner von uns hat im Moment das Bedürfnis, über den Augenblick hinaus zu denken.
Eines nicht zu fernen Tages wirst Du, Philip, sie hoffentlich kennenlernen. Ich könnte Dir eine ausführliche, konkrete Beschreibung liefern, was Dich ermüden würde, könnte auch ihre Güte, ihre echte, liebevolle Zärtlichkeit erwähnen. Aber all das wirst Du dann selbst sehen. Wieso sie von allen Männern ausgerechnet mich gewählt hat, einen verkrusteten, zynischen Frauenhasser vor dem Herrn, kann ich nicht sagen. Sie neckt mich deswegen, und ich gebe mich geschlagen. Sich einer Frau wie ihr geschlagen zu geben, ist in gewisser Weise ein Sieg. Und ich könnte mich durchaus als Sieger bezeichnen, nicht als Besiegten, wenn das nicht eine so abscheulich eingebildete Äußerung wäre.
Erzähle allen diese Neuigkeit, überbringe ihnen meine herzlichen Grüße, und ihre ebenfalls, und vergiss nicht, Philip, mein lieber Junge, dass diese späte Heirat meine tiefe Zuneigung zu Dir um kein Jota vermindert, sie eher wachsen lassen wird, und nun, da ich mich für den glücklichsten Menschen halte, werde ich mich bemühen, mehr für Dich zu tun als jemals zuvor, und sie soll mir dabei helfen. Schreib bald, und wenn Du Dich dazu durchringen kannst, füg auch einen kleinen Willkommensgruß an Deine Cousine Rachel hinzu.
Immer Dein Dir ergebener Ambrose.«
Der Brief kam gegen halb sechs, kurz nachdem ich zu Abend gegessen hatte. Zum Glück war ich allein. Seecombe hatte den Postbeutel hereingeholt und mir hingelegt. Ich steckte den Brief in meine Tasche und wanderte über die Felder hinunter zum Meer. Seecombes Neffe, der am Strand in dem Mühlenhäuschen wohnte, grüßte mich. Seine Netze hingen über der Steinmauer und trockneten in der letzten Abendsonne. Er muss mich für ziemlich schroff gehalten haben, denn ich erwiderte seinen Gruß kaum. Ich kletterte über die Felsen auf eine schmale Landspitze, die in die kleine Bucht hineinragt, wo ich im Sommer immer badete. Ambrose ankerte dann jedes Mal etwa fünfzig Meter weiter draußen mit seinem Boot, und ich schwamm zu ihm hinaus. Ich setzte mich, holte den Brief aus der Tasche und las ihn ein zweites Mal. Wenn ich auch nur einen Funken Sympathie oder Freude, nur einen Hauch von Wärme für diese beiden empfunden hätte, die da unten in Neapel miteinander glücklich waren, so hätte das mein Gewissen beruhigt. Doch ich konnte meinem Herzen nicht das leiseste freundliche Gefühl abringen, selbst wenn mich das mit Scham und Zorn erfüllte. Ich saß da, ganz betäubt vor Kummer, und starrte auf das glatte, ruhige Meer. Ich war gerade dreiundzwanzig geworden, fühlte mich aber so einsam und verloren wie einst, als ich in der vierten Klasse in Harrow die Schulbank drückte: Niemand, der mich zum Freund haben wollte, und vor mir nichts als eine neue Welt voll befremdlicher Erfahrungen, die ich ablehnte.
3
Was mich, glaube ich, am meisten beschämte, war die Begeisterung seiner Freunde, ihre aufrichtige Freude, die ehrliche Anteilnahme an seinem Wohlergehen. Als eine Art Vermittler wurde ich mit Glückwünschen für Ambrose überschüttet und musste dazu immerfort lächeln und mit dem Kopf nicken und ihnen vorspielen, ich hätte schon die ganze Zeit gewusst, dass es dahin kommen würde. Ich kam mir vor wie ein Heuchler, wie ein Verräter. Ambrose hatte mich so entschieden erzogen, Falschheit zu hassen, bei Mensch und Tier, dass ich es als unerträglich empfand, mich plötzlich dabei zu ertappen, dass ich so tat, als wäre ich ein anderer.
»Das Beste, was passieren konnte.« Wie oft habe ich diese Worte gehört und ihnen ständig zustimmen müssen. Ich begann, meinen Nachbarn aus dem Weg zu gehen und mich in unserem eigenen Wald herumzudrücken, um nicht mit den neugierigen Gesichtern, den eifrigen Zungen konfrontiert zu werden. Sobald ich jedoch über die Felder oder in die Stadt ritt, gab es kein Entkommen mehr. Pächter oder Bekannte mussten mich nur von weitem erspähen, und schon war ich zu einem Gespräch verdammt. Mittelmäßiger Schauspieler, der ich war, zwang ich meinem Gesicht ein Lächeln ab und spürte, wie meine Haut sich in Protest zusammenzog; gleichzeitig sah ich mich verpflichtet, die Fragen mit einer Begeisterung zu beantworten, die ich hasste, jener Begeisterung, die die Welt bei der Erwähnung einer Heirat erwartet. »Wann werden sie denn nach Hause zurückkehren?« Darauf gab es keine Antwort. »Das weiß ich nicht. Ambrose hat es mir nicht gesagt.«
Es gab eine Menge Spekulationen über das Aussehen, das Alter, überhaupt das Auftreten der Braut, worauf ich jedes Mal antwortete: »Sie ist Witwe, und sie liebt Gärten ebenso wie er.«
Wie passend, nickten die Köpfe, könnte gar nicht besser sein, genau das Richtige für Ambrose. Und es folgten Heiterkeit und viel amüsierte Spöttelei, weil ein eingefleischter Junggeselle schließlich doch noch im Hafen der Ehe gelandet war. Die Gattin des Pfarrers, Mrs Pascoe, dieser Hausdrache, ritt auf dem Thema herum, als könne sie sich so für vergangene Beleidigungen des heiligen Ehestands rächen.
»Was für Veränderungen das mit sich bringen wird, Mr Ashley«, sagte sie bei jeder möglichen Gelegenheit. »Kein Alles-einfach-laufen-Lassen mehr in Ihrem Haushalt. Und das ist wahrhaftig nicht verkehrt. Endlich einmal hat die Dienerschaft eine gewisse Organisation zu lernen, und ich kann mir nicht vorstellen, dass das Seecombe besonders gefallen wird. Er hat die Dinge lange genug gehandhabt, wie es ihm passt.«
Damit hatte sie etwas Wahres gesagt. Ich glaube, Seecombe war mein einziger Verbündeter, aber ich achtete darauf, mich nicht mit ihm zu verbrüdern, und bremste ihn, wenn er versuchte, mich auszuhorchen.
»Ich weiß nicht, was ich sagen soll, Mr Philip«, murmelte er düster und resigniert. »Eine Frau im Haus wird alles umkrempeln, wir werden nicht wissen, wie uns geschieht. Erst kommt eins, dann das Nächste, und nichts wird der Dame gefallen, egal, was man macht. Ich glaube, es wird Zeit, dass ich mich zurückziehe und einem jüngeren Mann Platz mache. Vielleicht sollten Sie das erwähnen, wenn Sie Mr Ambrose schreiben.«
Ich erklärte ihm, er solle nicht albern sein, Ambrose und ich wären verloren ohne ihn, doch er schüttelte nur den Kopf, wanderte weiter mit Trauermiene durchs Haus und nahm jede Gelegenheit wahr, bittere Vermutungen über die Zukunft anzustellen: Mit Sicherheit würden die Essenszeiten verändert, die Möbel umgestellt und von morgens bis abends endloses Putzen angeordnet, ohne jede Pause für irgendwen, und, als endgültiger Schlag, würden selbst die armen Hunde abgeschafft. Bei dieser mit Grabesstimme vorgebrachten Prophezeiung regte sich endlich wieder mein fast verloren geglaubter Sinn für Humor, und zum ersten Mal nach Lektüre von Ambrose' Brief musste ich lachen.
Welch ein Bild Seecombe da ausmalte! Vor meinem inneren Auge erschien ein Regiment von Dienstmädchen mit Wischlappen, die das Haus von Spinnweben befreiten, und der alte Butler, wie gewöhnlich mit vorgeschobener Unterlippe, schaute mit versteinerter Miene missbilligend zu. Seine Trübsal amüsierte mich, doch als andere so ziemlich dasselbe voraussagten – selbst Louise Kendall, die, da sie mich kannte, schon aus Mitgefühl hätte den Mund halten müssen –, gingen mir diese Bemerkungen allmählich auf die Nerven.
»Gott sei Dank bekommst du dann in der Bibliothek neue Möbelbezüge«, sagte sie vergnügt. »Die alten sind schon grau und fadenscheinig; ich wette, das ist dir noch nie aufgefallen. Und Blumen im Haus, was für ein Fortschritt! Endlich kommt der Salon wieder richtig zur Geltung. Ich fand schon immer, dass es Verschwendung ist, ihn nicht zu benutzen. Mrs Ashley wird ihn bestimmt auch mit Büchern und Bildern aus ihrer italienischen Villa bestücken.«
Sie redete immerzu weiter, hakte eine ganze Liste von Verbesserungen ab, die sie offenbar im Kopf hatte, bis ich die Geduld verlor und grob dazwischenfuhr: »Hör um Himmels willen mit diesem Thema auf, Louise. Es reicht.«
Sie stutzte, sah mich an und bemerkte schlau: »Du bist doch nicht etwa eifersüchtig?«
»Idiot«, erwiderte ich.
Das war nicht nett, aber wir kannten einander so gut, dass sie für mich wie eine jüngere Schwester war und ich wenig Rücksicht auf sie nahm.
Danach sagte sie nichts mehr, und mir fiel auf, dass sie, wenn das leidige Thema wieder einmal in einer Unterhaltung auftauchte, von etwas anderem zu reden versuchte. Dafür war ich ihr dankbar und mochte sie nur umso mehr.
Es war ihr Vater, Nick Kendall, mein Patenonkel, der mir, natürlich ohne es zu wollen, den endgültigen Schlag versetzte, und zwar auf seine sehr direkte, unverblümte Art.
»Hast du denn schon Pläne für die Zukunft, Philip?«, fragte er eines Abends, als ich zum Essen zu ihnen hinübergeritten war.
»Pläne? Nein«, sagte ich, unsicher, was er meinte.
»Ist natürlich noch verfrüht«, meinte er, »und vermutlich kannst du auch erst planen, wenn Ambrose und seine Frau wieder zu Hause sind. Ich habe mich nur gefragt, ob du schon einmal daran gedacht hast, dich hier in der Gegend nach einem kleinen Haus umzuschauen.«
Ich begriff immer noch nicht. »Wieso sollte ich?«, fragte ich.
»Nun, die Verhältnisse haben sich doch ziemlich verändert«, erklärte er in sachlichem Ton. »Ambrose und seine Frau werden verständlicherweise zusammen sein wollen. Und falls es dann später eine Familie gibt, einen Sohn vielleicht, dann wird es für dich nicht mehr dasselbe sein. Ich bin sicher, Ambrose möchte nicht, dass du unter der veränderten Situation leidest, und er wird dir ein Haus nach deinen Wünschen kaufen. Natürlich ist es auch möglich, dass sie keine Kinder bekommen, aber es gibt keinen Grund, fest davon auszugehen. Vielleicht würdest du auch lieber bauen. Manchmal ist es befriedigender, sich sein Haus selbst zu bauen als eins zu übernehmen, das zum Verkauf steht.«
Er redete immer weiter, erwähnte Häuser im Umkreis von etwa zwanzig Meilen, die mich vielleicht interessieren könnten, und ich war froh, dass er offenbar auf all das Gesagte keine Antwort erwartete. Denn tatsächlich war mir für eine Antwort das Herz zu schwer. Was er vorschlug, war so neu und unerwartet, dass ich kaum vernünftig denken konnte und bald darauf mit einer Entschuldigung nach Hause aufbrach. Eifersucht, ja. Da hatte Louise vermutlich recht. Die Eifersucht eines Kindes, das plötzlich die einzige Person in seinem Leben mit einer Fremden teilen muss.
Ähnlich wie Seecombe hatte ich mir inzwischen ausgemalt, wie ich mich unter größten Anstrengungen mit den unangenehmen neuen Bedingungen arrangieren würde: immerzu bereit, die Pfeife auszumachen und aufzustehen, mühsam nach Gesprächsthemen zu suchen, mich eisern den Unbilden und der öden Langeweile weiblicher Gesellschaft anzupassen. Und, mein Gott, mit ansehen zu müssen, wie Ambrose sich zum Narren machte, bis ich vor Peinlichkeit gezwungen wäre, das Zimmer zu verlassen. Ich hatte bisher nie das Gefühl gehabt, ein Ausgestoßener zu sein, nicht länger erwünscht, aus dem Haus vertrieben und wie ein Dienstbote in Rente geschickt. Ein Kind würde kommen und Ambrose Vater nennen, so dass ich nicht länger gebraucht würde.
Hätte Mrs Pascoe mich auf diese Möglichkeit hingewiesen, dann hätte ich es als Boshaftigkeit abgetan und vergessen. Doch dass mein eigener Patenonkel so etwas ganz ruhig als Tatsache konstatierte, war etwas anderes. Ganz elend vor lauter Verunsicherung und Kummer, ritt ich nach Hause. Ich wusste nicht, was ich tun, wie ich mich verhalten sollte. Sollte ich Pläne machen, wie mein Pate geraten hatte? Mir ein neues Heim suchen? Meinen Auszug vorbereiten? Ich wollte nirgendwo anders leben, kein anderes Zuhause besitzen. Ambrose hatte mich einzig und allein für dieses Haus erzogen und ausgebildet. Es gehörte mir. Es gehörte ihm. Es gehörte uns beiden. Doch jetzt nicht mehr, alles hatte sich geändert. Ich weiß noch, wie ich nach meiner Rückkehr von den Kendalls durch das Haus wanderte und es mit ganz neuen Augen betrachtete; die Hunde, die meine Unruhe bemerkten, folgten mir und waren genauso beklommen wie ich. Mein altes Kinderzimmer, seit langem unbewohnt und inzwischen der Raum, in dem Seecombes Nichte einmal in der Woche Wäsche sortierte und flickte, erhielt eine neue Bedeutung. Ich sah es vor mir, frisch gestrichen, und mein kleiner Kricketschläger, der immer noch voller Spinnweben auf einem Regal zwischen einem Stapel staubiger Bücher lag, in den Müll geworfen. Bisher hatte ich diesen Raum vielleicht alle zwei Monate mit einem Hemd, das geflickt, oder einer Socke, die gestopft werden musste, betreten, mir aber nie Gedanken darüber gemacht, welche Erinnerungen er für mich barg. Jetzt wollte ich ihn wieder für mich haben, als Schutz vor der Welt da draußen. Doch stattdessen würde er zu einem vollkommen fremden Ort werden, stickig, mit dem Geruch nach kochender Milch und zum Trocknen aufgehängten Decken, genau wie die Wohnstuben in den Hütten mit vielen Kleinkindern, die ich so oft besuchte. Im Geiste sah ich wieder, wie sie quengelnd und kreischend über den Fußboden krochen, sich ständig den Kopf stießen oder die Ellbogen aufschrammten; oder, noch schlimmer, sich auf den Schoß hochhangeln wollten und das Gesicht wie Äffchen verzogen, wenn man es ihnen verwehrte. O Gott, stand all das auch Ambrose bevor?
Bis dahin hatte ich mir meine Cousine Rachel, wenn ich an sie dachte – was ich nur selten tat und den Namen, wie alle unangenehmen Dinge, auch gleich wieder verdrängte –, als eine Frau vorgestellt, die Mrs Pascoe ähnelte, nur noch schlimmer. Knochig, mit grobem Gesicht und, wie Seecombe prophezeit hatte, einem scharfen Auge für Staub; dazu ein viel zu lautes Lachen, wenn Gäste zum Essen geladen waren, was einen an Ambrose' Stelle zusammenzucken ließ. Jetzt nahm sie neue Formen an. Das eine Mal monströs, wie die arme Molly Bate in der West Lodge, dem westlichen Pförtnerhaus, die einen dazu zwang, aus schierem Zartgefühl die Augen abzuwenden, das andere Mal bleich und abgehärmt, in Schals gehüllt in einem Sessel sitzend, launenhaft wie eine Invalidin, während eine Krankenschwester im Hintergrund waltete und mit einem Löffel Arzneien zusammenrührte. Dann wiederum mittleren Alters und kräftig oder aber unsicher lächelnd und jünger als Louise – meine Cousine Rachel hatte ein Dutzend oder mehr Gesichter, eins hassenswerter als das andere. Ich sah, wie sie Ambrose zwang, auf alle viere zu gehen und, die Kinder rittlings auf dem Rücken, Bär zu spielen, was Ambrose, der all seine Würde verloren hatte, in demütiger Liebenswürdigkeit tat. Ein andermal sah ich sie, ein Band im Haar und in schönsten Musselin gekleidet, mit Schmollmund ihre Locken schütteln, eine einzige wogende Masse der Zuneigung, während Ambrose sie, in seinen Sessel zurückgelehnt, mit dem leeren Lächeln eines Idioten anblickte.
Als Mitte Mai der Brief kam, in dem stand, dass sie nun doch entschieden hätten, den Sommer über im Ausland zu bleiben, war meine Erleichterung so groß, dass ich laut hätte schreien können. Obwohl ich mich mehr denn je wie ein Verräter fühlte, konnte ich einfach nicht anders.
»Deine Cousine Rachel hat vor ihrer Reise nach England noch solch einen wüsten Haufen an Dingen zu regeln«, schrieb Ambrose, »dass wir, wenn auch bitter enttäuscht, wie Du Dir vorstellen kannst, beschlossen haben, unsere Rückkehr fürs Erste zu verschieben. Ich tue mein Bestes, aber das italienische Gesetz ist eine Sache und unseres eine andere, und es ist eine verteufelt verzwickte Aufgabe, beide unter einen Hut zu bringen. Ich scheine eine Menge Geld auszugeben, aber es ist für eine gute Sache, und es tut mir nicht leid. Wir sprechen oft von Dir, mein lieber Junge, und ich wünschte, Du könntest bei uns sein.« Und so weiter bis zu Fragen nach der Arbeit im Haus und dem Zustand des Gartens; und da er sie mit gewohnt leidenschaftlichem Interesse stellte, dachte ich, ich müsste verrückt sein, auch nur für einen Moment zu glauben, er könnte sich verändert haben.
In der Nachbarschaft war die Enttäuschung darüber, dass sie in diesem Sommer nicht da sein würden, natürlich groß.
»Mag ja sein«, sagte Mrs Pascoe mit bedeutungsvollem Lächeln, »dass Mrs Ashleys Gesundheit ihr das Reisen nicht erlaubt.«
»Dazu kann ich nichts sagen«, erwiderte ich. »In seinem Brief hat Ambrose erwähnt, dass sie eine Woche in Venedig verbracht haben und beide mit Rheuma zurückgekehrt seien.«
Sie machte ein langes Gesicht. »Rheuma? Seine Frau also auch?«, meinte sie. »Welch ausgesprochenes Pech.« Und schließlich nachdenklich: »Dann muss sie älter sein, als ich dachte.«
Stumpfsinnige Frau, deren Gedanken nur ein einziges Gleis kannten. Ich hatte schon mit zwei Jahren Rheuma in den Knien. Wachstumsschmerzen, sagten damals die Älteren. Bei Regenwetter bekomme ich manchmal noch immer einen Anfall. Dennoch gab es zwischen meinen und Mrs Pascoes Gedanken eine gewisse Ähnlichkeit. Und meine Cousine Rachel alterte um etwa zwanzig Jahre. Sie hatte jetzt wieder graue Haare, stützte sich sogar auf einen Stock, und wenn sie nicht gerade Rosen in diesem italienischen Garten pflanzte, den ich mir nicht vorstellen konnte, sah ich sie, von einem halben Dutzend italienisch plappernden Anwälten umgeben, an einem Tisch sitzen und mit dem Stock auf den Boden klopfen, während mein armer Ambrose geduldig daneben saß.
Warum kam er nicht nach Hause und überließ alles ihr?
Meine Lebensgeister erwachten allerdings wieder, als die unsicher lächelnde Braut einer alternden Matrone Platz gemacht hatte, die von Hexenschuss gepeinigt wurde, wenn er am meisten stört. Das Kinderzimmer verschwand, ich sah den Salon zum Boudoir einer Dame werden, unterteilt durch spanische Wände und mit einem Kamin, in dem selbst im Hochsommer ein gewaltiges Feuer brannte; und ich hörte eine Frau gereizt nach Seecombe rufen, es fehle Heizkohle, der Luftzug bringe sie um. Ich begann, bei meinen Ritten wieder zu singen, scheuchte die Hunde hinter jungen Kaninchen her, ging vor dem Frühstück schwimmen, segelte bei günstigem Wind mit Ambrose' kleinem Boot in der Flussmündung und neckte Louise mit der Londoner Mode, als sie die Saison dort verbringen wollte. Mit dreiundzwanzig braucht man wenig, um guter Dinge zu sein. Mein Heim war immer noch mein Heim. Niemand hatte es mir genommen.
Dann, im Winter, änderte sich der Ton seiner Briefe. Unmerklich zuerst, ich nahm es kaum wahr, doch beim Wiederlesen seiner Worte fiel mir in jedem Satz eine gewisse Anspannung auf, eine unausgesprochene Angst, die sich offenbar seiner bemächtigt hatte. Zum Teil handelte es sich um Heimweh, das erkannte ich wohl. Eine Sehnsucht nach seiner Heimat und seinem Haus, doch über alledem lag eine gewisse Einsamkeit, die mir bei einem Mann, der gerade einmal zehn Monate verheiratet war, seltsam vorkam. Er gestand, dass der Sommer und der Herbst sehr lang und sehr erschöpfend gewesen seien und der Winter ungewöhnlich früh eingesetzt habe. Obwohl die Villa in den Hügeln liege, fehle es an frischer Luft; er schrieb, er wandere ständig von Zimmer zu Zimmer, wie ein Hund vor dem Gewitter, nur komme kein Gewitter. Die Luft erneuere sich nicht; für einen heftigen Regenguss würde er seine Seele hergeben, auch wenn er davon krank würde. »Ich habe nie Kopfschmerzen gekannt«, schrieb er »doch jetzt habe ich dauernd welche. Manchmal bin ich fast blind vor Schmerz. Ich ertrage den Anblick der Sonne nicht mehr. Du fehlst mir mehr, als ich sagen kann. So viel zu bereden, das geht schlecht in einem Brief. Meine Frau ist heute in der Stadt, was mir die Gelegenheit zum Schreiben gibt.« Es war das erste Mal, dass er die Worte »meine Frau« benutzte. Bis dahin hatte er immer Rachel oder »Deine Cousine Rachel« geschrieben, und die Worte »meine Frau« wirkten auf mich förmlich und kalt.
In diesen Winterbriefen war keine Rede von einer Heimkehr, nur das ständige, leidenschaftliche Bedürfnis nach Neuigkeiten von zu Hause, und jede unbedeutende Kleinigkeit, die ich in meinen Briefen erwähnte, kommentierte er so, als gebe es für ihn nichts Interessanteres.
Zu Ostern und Pfingsten kam nichts, und ich begann mir Sorgen zu machen. Ich erzählte es meinem Patenonkel, und der meinte, sicherlich verzögere das Wetter die Post. Es heiße doch, auf dem Kontinent gebe es noch Schnee, und ich müsse mich bis Ende Mai gedulden, bis ich wieder aus Florenz hören würde. Ambrose war inzwischen über ein Jahr verheiratet und seit achtzehn Monaten fort von zu Hause. Meine anfängliche Erleichterung über seine Abwesenheit nach der Heirat wandelte sich in Angst, dass er vielleicht gar nicht mehr zurückkehrte. Schon dieser eine Sommer hatte offensichtlich seine Gesundheit angegriffen. Was würde erst ein weiterer mit ihm anstellen? Im Juli kam endlich ein Brief, kurz und unzusammenhängend, ganz und gar untypisch für ihn. Selbst seine Schrift, gewöhnlich so ordentlich, taumelte über die Seite, als habe er Schwierigkeiten, die Feder zu halten.
»Es steht nicht gut um mich«, schrieb er, »das wirst Du schon an meinem letzten Brief gemerkt haben. Besser, es nicht zu erwähnen. Sie beobachtet mich die ganze Zeit. Ich habe Dir mehrmals geschrieben, aber es gibt niemanden, dem ich trauen kann, und wenn ich nicht aus dem Haus kann, um meine Briefe selbst aufzugeben, erreichen sie Dich vielleicht gar nicht. Seit meiner Krankheit kann ich keine weiten Wege mehr zurücklegen. Was die Ärzte betrifft, so habe ich kein Vertrauen in irgendeinen von ihnen. Sie sind allesamt Lügner, die ganze Sippschaft. Der neue, von Rainaldi empfohlene, ist ein Halsabschneider, was auch kein Wunder ist bei der Herkunft. Aber sie haben irgendetwas Gefährliches mit mir vor, ich werde ihnen jedoch einen Strich durch die Rechnung machen.« Dann folgte eine Lücke, etwas war weggekratzt, das ich nicht entziffern konnte, und schließlich seine Unterschrift.
Ich ließ mein Pferd satteln und ritt hinüber zu meinem Paten, um ihm den Brief zu zeigen. Er war ebenso besorgt wie ich. »Klingt nach einem Nervenzusammenbruch«, sagte er sofort. »Das gefällt mir überhaupt nicht. Das ist kein Brief eines Menschen, der bei klarem Verstand ist. Ich hoffe zum Himmel …« Er unterbrach sich und presste die Lippen zusammen.
»Was hoffst du?«, fragte ich.
»Dein Onkel Philip, Ambrose' Vater, ist an einem Hirntumor gestorben. Das weißt du doch, oder?«, erwiderte er knapp.
Davon hatte ich noch nie gehört und sagte es ihm.
»Bevor du geboren wurdest natürlich«, erklärte er. »Darüber wurde in der Familie nie viel gesprochen. Ob diese Dinge erblich sind oder nicht, kann ich nicht sagen, die Ärzte wissen es auch nicht. Die medizinische Wissenschaft ist noch nicht so weit.« Er las den Brief erneut durch und setzte dazu extra seine Brille auf. »Es gibt natürlich noch eine andere Möglichkeit, eine äußerst unwahrscheinliche, die ich aber vorziehen würde«, sagte er.
»Und die wäre?«
»Dass Ambrose betrunken war, als er den Brief schrieb.«
Wäre er nicht über sechzig und mein Patenonkel, hätte ich ihn allein für diese Vermutung geschlagen.
»Ich habe Ambrose in meinem ganzen Leben niemals betrunken erlebt«, erklärte ich.