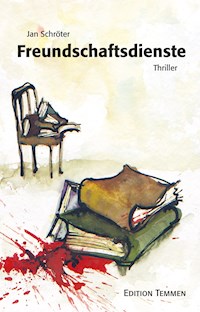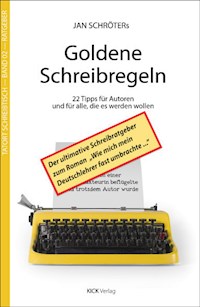
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kick-Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Tatort-Schreibtisch
- Sprache: Deutsch
Der erfolgreiche Roman- und Drehbuchautor Jan Schröter verrät in diesem höchst vergnüglichen Schreibratgeber 22 Regeln, die ihm auf dem Weg zum Autor geholfen haben. Das ist nicht nur für werdende Autoren interessant, sondern auch für alle, die mehr von der Welt erfahren möchten, in der sich Autoren bewegen. Denn Schröter gibt nicht nur Schreibtipps, sondern er ergänzt seine Ratschläge mit augenzwinkernden Berichten aus seinem Arbeitsleben. Absolut lesenswert! Zusätzlich zu den hier vorliegenden 22 Schreibregeln hat Jan Schröter einen autobiographischen Roman geschrieben, der seinen Schreibratgeber auf amüsante und kongeniale Weise ergänzt: "Wie mich mein Deutschlehrer fast umbrachte …" erzählt die skurile Geschichte des Autors Tom Schröder vom hormonverwirrten Teenager bis zum erfolgreichen Schriftsteller – Ähnlichkeiten mit wahren Begebenheiten sind nicht ausgeschlossen … Beide Bücher sind Teil der Ratgeber-Reihe "Tatort Schreibtisch" - Profis schreiben für Profis. ww.tatort-schreibtisch.de
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 143
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über den Autor:
Jan Schröter kennt die Höhen und die Tiefen des Autorendaseins schmerzlich genau. Er arbeitete als Journalist und Kolumnist, schrieb Reiseführer und Kurzgeschichten, massierte die Herzen der Zuschauer mit seinen Drehbüchern für den ZDF-Kultdampfer „Das Traumschiff“ und war jahrelang Stammautor der ARD-Serie „Großstadtrevier“. Bekannt geworden ist er durch seine absurd-komischen Krimis und Romane, in denen er augenzwinkernd und nicht ohne Mitgefühl seine Figuren ins Chaos stürzt.
Zusätzlich zu den hier vorliegenden 22 Schreibtipps hat Jan Schröter für den Kick Verlag einen Text geschrieben, der seinen Schreibratgeber auf amüsante und kongeniale Weise ergänzt: „Wie mich mein Deutschlehrer fast umbrachte …“ ist ein autobiographisch gefärbter Roman, der den Weg des Autors Tom Schröder vom hormonverwirrten Teenager zum erfolgreichen Schriftsteller beschreibt – Ähnlichkeiten mit wahren Begebenheiten sind nicht ausgeschlossen …
Mehr Informationen auf: www.tatort-schreibtisch.de
Jan Schröter
Goldene Schreibregeln
22 Tipps für Autorenund für alle, die es werden wollen
KICKVerlag
Ein paar Worte vorweg …
Vor einiger Zeit bat mich mein Verleger um einen kurzen Text darüber, wie ich ein Autor geworden bin. Er wusste damals bereits, dass ich diesbezüglich einige schillernde Geschichten zu bieten hatte. Und als ich meinen Text ablieferte, war uns beiden klar: Dies kann nur das erste Kapitel eines Romans sein.
Das wurde es dann auch. Der Roman „Wie mich mein Deutschlehrer fast umbrachte … ich als russischer Arzt praktizierte, das Liebesleben einer Chefsekretärin beflügelte und trotzdem Autor wurde“ verpackt persönliche Erfahrungen in eine fiktive Rahmenhandlung. Zur Auflockerung, als „Running Gag“ und um zwischendurch immer mal wieder den Bezug zum Schreiben herzustellen, verpasste ich jedem Kapitel mindestens eine besondere, schrifttypisch abgesetzte Textzeile. In diesen Zeilen formulierte ich Schreibregeln, 22 griffige Thesen aus der Praxis des Autorendaseins. Und als der Roman fertig war, meldete sich wieder mein Verleger.
„Diese Schreibregeln, die sind großartig! Damit musst du mir unbedingt noch ein Buch schreiben. Für unsere Berufskollegen und überhaupt für jeden, der sich für das Schreiben interessiert.“
Ich hasse die meisten pädagogischen Sachbücher. Und zwar aus Erfahrung, ich habe in grauer Vorzeit Erziehungswissenschaft studiert. Spätestens, wenn man konsterniert und allein vor einer voll aus dem Ruder gelaufenen Horde Achtklässler steht, wird einem bewusst, dass man 99 Prozent dieser Schlaubergerliteratur in die Tonne treten kann. Deshalb lautete meine Antwort:
„Die 22 Schreibregeln meine ich zwar durchaus ernst. Aber das ist weder in didaktisch durchdachter Reihenfolge sortiert, noch begründet es eine verbindliche Schreiblehre.“
„Schon klar“, antwortete mein Verleger, von meiner abwehrenden Haltung unbeeindruckt.
„Ich bin kein Literaturprofessor“, versuchte ich es noch einmal, „die Regeln decken sich mit meiner persönlichen Berufserfahrung, das ist alles. Ich möchte kein Schulbuch schreiben, sondern unterhaltsame Geschichten erzählen.“
„Mach das“, sprach mein Verleger gelassen. „Hauptsache, es geht dabei um die Schreibregeln. Ich bin mir sicher, du hast dazu etwas zu sagen.“
Und das haben Sie jetzt davon.
1 Jan Schrötersgoldene Regeln fürs gelungene Schreibwerk:
Recherchiere deine Geschichte – theoretisch ist okay, praktisch ist gefühlsechter.
Sie möchten einen Roman schreiben. Oder das Drehbuch für einen Film. Ein Gedicht, einen Songtext oder „nur“ eine Kurzgeschichte. Sie haben betörende Bilder im Kopf: Landschaften, Sonnenuntergänge, eine Traumfrau oder einen Traummann, Action, Romantik, Witz und Drama. Vielleicht gibt es sogar einen konkreten, realen Auslöser für Ihren Wunsch, etwas zu schreiben. Möglicherweise haben Sie selbst oder jemand aus Ihrem Bekanntenkreis etwas erlebt, und alle – Sie vor allem, vermutlich – kommentieren das spontan:
„Da könnte man ja glatt ein Buch draus machen!“
Könnte man. Meistens wird aber nichts daraus.
Und das, obwohl Sie sich doch sicher sind, dass diese Geschichte alles bietet, was einen Bestseller, Nummer-Eins-Hit oder Kinoknüller ausmacht.
Vielleicht versuchen Sie es sogar. Fahren den PC hoch, richten einen Ordner und eine Datei ein, schreiben ein paar Worte, Zeilen oder gar Seiten. Irgendwann, das ist so gut wie unausweichlich, kommt der gnadenlose Ernüchterungsmoment, in dem es nicht mehr vorangeht. Der Cursor nur noch blinkend an ein und derselben Stelle verharrt. Der Bildschirmschoner den Monitor kapert. Bis sich die ganze Kiste in den Stand-by-Modus verabschiedet und Sie resigniert die Segel streichen. Und alles bloß, weil Ihr Werk an einen Punkt gelangt ist, von dem Sie einfach nichts verstehen. Himmelherrgott, Sie sind Verwaltungsangestellte oder Ingenieur, dekorieren Schaufenster oder handeln mit Aktien – woher sollen Sie denn wissen, wie ein Streifenpolizist durch die Nacht kommt oder was eine Pathologin an ihrem Job liebt?
Sie wissen es nicht.
Sie wissen das, was Sie gelernt und vor allem das, was Sie selbst erlebt haben. Man kann selbstverständlich auch einen Roman übers eigene Leben schreiben, aber unser eigenes Leben bietet – Hand aufs Herz – meistens nicht den Stoff, der ein breites Publikum vom Hocker haut, und das ist ja vielleicht auch ganz gut so. Wer möchte schon in seinem wirklichen Dasein ein Kettensägenkiller sein oder ein Soziopath wie James Bond? Und selbst, wenn man aus der eigenen Lebenserfahrung tatsächlich einen Roman machen kann: Vielleicht möchte man noch einen zweiten veröffentlichen. Spätestens dann müsste man sich etwas ausdenken.
Über Fantasie zu verfügen, ist für Autoren äußerst hilfreich. Als Schreiber die Realität völlig zu ignorieren, stößt jedoch seitens der Leserschaft meist auf Unverständnis – es sei denn, Ihr geplantes Werk bewegt sich im Fantasy- oder Science-Fiction-Genre. Doch selbst hier müssen Sie die Geschichte mit glaubhaften Details füttern, welche die Lücke zwischen Gegenwart und Utopie nachvollziehbar schließen. Sonst können sich die Leser nicht in Ihre Fantasie hineindenken, bleiben kalt, werden Band 1 nicht weiterempfehlen und Band 2 sicher nicht vorbestellen.
Wenn es also in Ihrem Roman, Drehbuch, Gedicht, Songtext oder in Ihrer Kurzgeschichte Streifenpolizisten oder Pathologinnen gibt, die eine maßgebliche Rolle spielen – dann müssen Sie wissen, wie der Berufsalltag dieser Leute aussieht. Gleiches gilt für sachliche Inhalte: Spielen Sie mit der Relativitätstheorie oder der Funktionsweise eines Atomreaktors, sollten Sie sich gewisse Grundkenntnisse darüber aneignen. Bei Atomreaktoren und der Relativitätstheorie käme man möglicherweise mit einschlägiger Lektüre vom Kaliber „Kleine Gebrauchsanweisung für Reaktoren“ oder „Einstein für Anfänger“ über die Runden. Sachliche Inhalte lassen sich meist problemlos recherchieren, sofern man sie selbst versteht. Bei der Relativitätstheorie oder Atomreaktoren stoßen Physiklegastheniker wie ich allerdings schnell an persönliche Grenzen – aber hey, es gibt ja so viele andere interessante Geschichten auf dieser Welt. Streifenpolizisten oder Pathologinnen, zum Beispiel.
Problemlos recherchierbar ist auch die Kulisse eines Werks. Die sollte auf jeden Fall stimmen. Bloß nicht einen falsch benannten Bach durch Berlin fließen lassen oder in Paris die Straßenseiten verwechseln. Die Welt steckt voller selbsternannter Oberlehrer, die nur darauf warten, Autoren solche Stockfehler um die Ohren zu knallen – selbst, wenn das Werk ansonsten stilistisch nobelpreisverdächtig sein sollte. Fantasy- und SciFi-Autoren sind diesbezüglich fein raus, die erfinden sich einen Vampirwald oder den Todesstern – et voilà. Für alles andere bedient man sich aus eigenem Erfahrungsschatz (enorm praktisch und zeitsparend), im Internet und in Reisebüchern (günstig, hinterlässt aber seitens des Autors meist quälende Restzweifel, ob es dort wirklich so ist wie dargestellt) oder man fährt selbst dorthin, um sich vor Ort umzusehen (kostspielig, bereichert jedoch den eigenen Erfahrungsschatz – bei Wiederverwertung also enorm praktisch und zeitsparend).
Beschränken Sie sich bei der Darstellung der Kulisse nicht auf Fassaden oder das Wetter. Sex, zum Beispiel, bleibt in intensivster Erinnerung, wenn er nicht bloß den Körper befriedigt, sondern alle Sinne stimuliert und die Seele streichelt. Soll man Ihr Buch, Drehbuch oder Songtext ähnlich nachhaltig verinnerlichen, genügt es nicht, beispielsweise eine Fischkonservenfabrik nur in ihrer Architektur und in ihren technischen Abläufen zu beschreiben. Man muss den Fisch in Ihren Zeilen riechen können, Innereien aus den Buchstaben tropfen und klamme Kälte aus den Buchseiten aufsteigen sehen. Dann fühlt man die Fischkonservenfabrik. Ist nicht wie Sex, aber auch unvergesslich.
Um das zu beschreiben, sollten Sie vielleicht mal dort gewesen sein. Genau an diesem Punkt beginnt das Problem, das viele von uns blockiert und das möglicherweise auch bisher die Entstehung Ihres Bestseller-Romans behindert hat. Da die wenigsten von uns einen Fischkonservenfabrikbesitzer in der Verwandtschaft haben, müssten wir bei einem solchen Menschen vorstellig werden und darum bitten, mal den Betrieb besichtigen und mit den Mitarbeitern reden zu dürfen. Optimalerweise vielleicht sogar für ein paar Schichten mitzuarbeiten – Fische ausnehmen, filetieren und eindosen. Das trauen wir uns nicht. Denn unser Anliegen stieße zwangsläufig auf die Gegenfrage:
„Warum wollen Sie das?“
Und dann müssten wir uns erklären. Ich bin Autorin oder Autor. Ich möchte ein Buch, Drehbuch, einen Songtext oder eine Kurzgeschichte schreiben. Darin kommt eine Fischfabrik vor und jemand, der dort arbeitet. Und weil mir Fisch sonst bloß als Rollmops beim Katerfrühstück begegnet, muss ich dringend mehr darüber wissen.
Hört sich peinlich genug an, oder?
Müssen Sie jetzt auch noch zugeben, dass Sie sich zwar als Autorin oder Autor fühlen, aber bislang rein gar nichts veröffentlicht haben, weil die Fischkonservenfabriksaga Ihr erstes, großes Ding werden soll – dann ist es für die meisten von uns einfacher, den Traum vom Literaturerfolg, Filmpreis oder Chart-Hit umgehend zu begraben und lieber gar nicht erst in der Fischkonservenfabrik anzufragen.
Bitte nicht.
Versuchen Sie es. Mag sein, dass Sie bei der ersten Adresse abblitzen. Dann klappt es bei der zweiten, es gibt immer mehr als bloß eine Fischkonservenfabrik. Wahrscheinlicher ist jedoch, dass man Sie schon bei der ersten freundlich empfängt und Ihr Anliegen respektvoll behandelt. Wer sich ernsthaft für etwas interessiert – und das tun Sie, Sie möchten ja sogar ein Buch darüber schreiben! –, der wird in aller Regel von denjenigen, denen dieses Interesse gilt, gerne versorgt. Die Gefragten zeigen sich nicht selten sogar ausgesprochen geschmeichelt. Schließlich kommt es garantiert nicht oft vor, dass sich jemand für die Fabrikation von Fischkonserven begeistert und den dramaturgischen Aspekt dieser Tätigkeit würdigt. Das verleiht dem eigenen Beruf endlich die gebührende Bedeutung. Die Wahrscheinlichkeit, dass man Ihnen den roten Teppich ausrollt, ist wesentlich höher als eine barsche Abfuhr.
Natürlich ist es für jede Recherche komfortabel, wenn man als Autor bereits etabliert ist. Als ich Drehbücher für die TV-Serie „Großstadtrevier“ schrieb, gab es eine enge Zusammenarbeit zwischen der Produktionsfirma und der Polizei Hamburg. Stellte sich ein Drehbuchautor beim Schreiben die Frage, wie man eine Handschelle benutzt oder wie oft ein Beamter zum Schießtraining muss, ließ sich das sofort per Anruf klären. Wollte ich wissen, wie ein Streifenpolizist durch die Nacht kommt, durfte ich eine Reeperbahn-Nachtschicht im Polizeiwagen begleiten. Während meiner Mitarbeit an der Krankenhaus-TV-Saga „Alphateam“ beschäftigte die Produktionsfirma eigens einen Arzt, der uns Drehbuchautoren in medizinischen Details beriet.
Doch selbst Autoren-Novizen öffnen sich viele Recherchequellen. Die Polizei unterhält bundesweit Pressestellen, die auch Privatpersonen Rede und Antwort stehen. Auch Wirtschaftsunternehmen betreiben Öffentlichkeitsarbeit. Im Grunde möchte jeder, der etwas produziert oder eine Dienstleistung anbietet, auch darüber reden.
Man muss bloß fragen.
Jede Antwort erweitert den Horizont, jede Erfahrung vergrößert den Werkzeugschrank eines Autors. Nicht alles führt zwangsläufig zur Entstehung eines neuen Werks. Vielleicht spielt es erst viel später mal, in ganz anderen Zusammenhängen, eine Rolle. Auf jeden Fall begreift man durch Treffen mit Menschen, denen man ohne Recherche sicher niemals begegnet wäre, viele Dinge, über die man sich sonst vielleicht überhaupt keine Gedanken gemacht hätte.
Zum Beispiel, was eine Pathologin an ihrem Job liebt.
Als ich (vor sehr vielen Jahren …) einige wenige Semester Jura studierte, gab es für Interessierte im Rahmen eines Seminars eine Führung durchs Rechtsmedizinische Institut der Uniklinik. Ich war durchaus interessiert, während der Führung durchs Institut dann allerdings eher für eine hier arbeitende Pathologin – sehr jung, sehr hübsch, leider auch sehr verschlossen und unnahbar. Jahre später schrieb ich an einem Spielfilm-Drehbuch, in dem eine Pathologin eine Rolle spielen sollte. Meine Recherche führte mich wieder ins Rechtsmedizinische Institut, und als Gesprächspartnerin vermittelte man mir – ich hatte es natürlich gehofft – die gleiche Mitarbeiterin, die mir damals schon aufgefallen war: etwas älter, sehr hübsch, leider immer noch verschlossen und unnahbar. Okay, auf der Sachebene bekam ich von ihr die Informationen, die ich für meine Arbeit brauchte. Jedenfalls die allernötigsten. Aber keine Silbe mehr. Und schon gar keine Reaktion auf meine Bemühungen, den Frost zwischen uns wenigstens etwas aufzutauen. Endlich gab ich es auf. Nur eins wollte ich noch wissen:
„Was liebt eine Pathologin an ihrem Job?“
Sie setzte ihre Antwort mit der Schärfe eines Skalpells.
„Meine Patienten halten die Klappe.“
Aus dem Film ist übrigens auch nichts geworden.
2 Jan Schrötersgoldene Regeln fürs gelungene Schreibwerk:
Beachte die Rechtschreibung – sonst nimmt man weder Botschaft noch Autor für voll.
Stellen wir uns vor, Sie hätten nicht mehr alle Latten am Zaun. Angesichts Ihres eventuell gehegten Vorhabens, als Autorin oder Autor reich und berühmt zu werden oder wenigstens mit dem Schreiben den Lebensunterhalt verdienen zu wollen, könnten Ihre Mitmenschen durchaus zu so einem Urteil gelangen. Aber damit beschäftigen wir uns im Kapitel 16. Hier und jetzt ist es wörtlich gemeint: Stellen wir uns vor, Ihr Grundstück ist umzäunt. Und an dem Zaun sitzen ein paar Latten locker, einige fehlen sogar.
Sie vergeben den Reparaturauftrag an einen Handwerksprofi. Der Mann kommt, drückt einen Nagel an die erste, lose Zaunlatte. Dann nimmt er einen Hammer, umklammert dessen Kopf mit der Hand und drischt mit dem Stiel auf den Nagel ein. Der Nagel verbiegt sich, oder er springt weg. Oder der Mann kloppt sich auf die Finger. Jedenfalls funktioniert es nicht. Und mal ganz abgesehen davon, dass Ihr Zaun immer noch eine Ruine bleibt, halten Sie diesen Handwerker ab sofort nicht mehr für einen Profi. Denn auch für notorisch linkshändig veranlagte Do-it-yourself-Dilettanten ist es offensichtlich, dass der Typ keine Ahnung hat, weil er sein Werkzeug nicht beherrscht.
Das Werkzeug des Schreibers ist die Schrift. Die ist nach den Regeln der Rechtschreibung auszuführen. Und die sollte man beherrschen. Zumal, wenn man den Anspruch erhebt, als Profi zu gelten.
Ich bin tatsächlich schon sogenannten professionellen Schreibern begegnet (zum Glück nur wenigen), die ihre Texte ohne Rechtschreib-Endkontrolle veröffentlichen. „Rechtschreibung ist etwas für Erbsenzähler und Oberstudienräte“, behaupten diese Kandidaten gern, oder sie verweisen auf die Segnungen des Digitalzeitalters und ihr geniales Computer-Autokorrekturprogramm, das solche lästigen Dinge wie Rechtschreibung für sie regelt.
Autokorrekturprogramm, soso.
Googeln Sie mal. Man findet im Internet mehr Seiten mit den lustigsten Autokorrekturprogramm-Pannen als Chuck-Norris-Witze. Die Autokorrektur-Funktion kann Ihrem Werk ungeahnte Wendungen verleihen. Zum Beispiel, wenn aus der harmlosen Frage: „Kann man das ausschneiden?“ etwas wird wie: „Kann man das ausscheiden?“ Tüchtige Autokorrekturprogramme verwandeln ungefragt und möglicherweise unbemerkt „Seiten“ in „Sekten“, „Kleinigkeiten“ in „Kleinkinder“, „Duschgel“ zu „Durchfall“.
Und dann sind da noch die Satzzeichen. Wer glaubt, ein Komma sei doch bloß ein überflüssiger Strich im Strom der genialen Dichterworte – der irrt erheblich. Unter dem schönen Motto „Satzzeichen können Leben retten“ kursieren etliche Beispiele für die Bedeutung unscheinbarer Kommata. Die Aufforderung „Komm, wir essen, Opa!“ erfreut den hungrigen Senior – die kommareduzierte Variation „Komm, wir essen Opa!“ löst bei ihm eher den spontanen Fluchtreflex aus. Das Urteil „Hängen, nicht laufen lassen!“ ist tödlich für den Angeklagten – „Hängen nicht, laufen lassen!“ verschafft ihm dagegen die ersehnte Gnadenfrist. Und im Testament entscheidet möglicherweise ein schnödes Komma darüber, wer der lachende Erbe ist: „Peter erbt den Hof, nicht aber Rainer.“ – „Peter erbt den Hof nicht, aber Rainer.“ Jetzt wissen Sie auch, an welcher Stelle und mit welchem Federstrich Sie das Testament Ihres Erbonkels bearbeiten müssen, um an die Knete zu kommen – dann könnten Sie es sich endlich leisten, den Roman zu schreiben, von dem Sie immer geträumt haben.
Fehler sind immer peinlich für denjenigen, dem sie unterlaufen. Wenn Sie dem Handwerker zeigen, wie man den Hammer richtig herum hält, um den Nagel durch die havarierte Zaunlatte zu treiben, wird er sich vermutlich ein bisschen schämen. Aber solange Sie darüber Stillschweigen bewahren, ist es nicht ganz so schlimm. Schließlich hat ansonsten niemand die Dusseligkeit gesehen. Wer allerdings schreibt, um öffentliche Botschaften zu übermitteln, oder wer gar einen Roman verfasst, der hoffentlich in Höchstauflage Verbreitung findet, der kann nicht darauf bauen, dass eventuelle Fehler im Werk unbemerkt bleiben.
Wie kann man also als Autor solche Peinlichkeiten vermeiden?
Sich perfekt mit sämtlichen Rechtschreibregeln auszukennen, das wäre natürlich hilfreich. Das schaffen allerdings die Wenigsten. Wer als Autor einen soliden Verlag im Rücken hat, ist in der Regel mit einem funktionierenden Lektorat gesegnet und deshalb fein raus. Sollten Sie es mit einer Veröffentlichung als Selfpublisher versuchen, bewegen Sie zuvor bitte mindestens zwei rechtschreibkundige Menschen Ihres Vertrauens dazu, Ihr Werk Korrektur zu lesen. Unsere moderne, überwiegend digitalisierte Netzwerkwelt strotzt vor Sprachmüll, Satzzeichenignoranz und Rechtschreibschwäche. Bitte verschlimmern Sie den Status Quo nicht noch. Und erliegen Sie bitte nicht der Versuchung: „Hey, wenn sich die anderen nicht mehr um den dämlichen Rechtschreibquatsch kümmern, muss ich das doch nicht tun!“ Nach dieser Logik könnte jeder sein kaputtes Auto im Wald entsorgen. Und das machen Sie ja auch nicht. Hoffe ich doch.
Ein einziger Schreibfehler kann den Verursacher der Lächerlichkeit preisgeben, sein Werk diskreditieren und seine Absichten ins Leere laufen lassen. So wie damals …
Benni, Udo und ich waren jung. Sehr jung. Dreizehn Jahre, um genau zu sein. Und weitestgehend ahnungslos darüber, was die Liebe im Allgemeinen und die Damenwelt im Besonderen an Verlockungen zu bieten hat. Das bewahrte uns keineswegs vor Amors Pfeilspitzen. Speziell nicht, als nach Ostern die atemberaubend frühentwickelte Angelina in unsere Klasse kam. Vor allem Benni war auf der Stelle hin und weg.
„Männer, die ist sowas von rattenscharf …“
„Komm wieder runter. Los, wir gehen bolzen.“