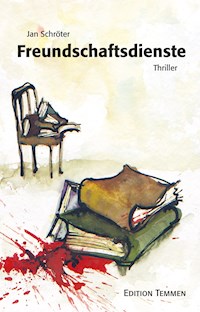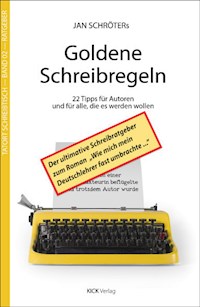6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Paul Cullmann ist jegliches Gefühl für die eigene Befindlichkeit abhanden gekommen. 20 Kilo Übergewicht. Ehe und Geschäft kaputt. Er fühlt sich als Treibgut im Strom des Lebens. Wo ist er bloß geblieben, der große Plan? Auf der Abifeier seines Sohnes beschließt er mit ein paar ehemaligen Klassenkameraden, die missglückte Abschlussfahrt – eine Kanutour auf der Weser – nachzuholen. Drei Frauen, drei Männer, drei Kanus. Eine Fahrt voller Unwägbarkeiten, Turbulenzen und persönlicher Erkenntnisse nimmt ihren Lauf
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 383
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Jan Schröter
Rettungsringe
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Paul Cullmann hat zwanzig Kilo Übergewicht und auch sonst etliche Probleme: Die Geschäfte laufen schlecht, sein Sohn zieht nach New York. Dafür trägt Paul plötzlich die Verantwortung für Pelle, den »hässlichsten Hund der Welt«. Wo ist er bloß geblieben, der große Plan vom Leben? Mit einigen ehemaligen Klassenkameraden beschließt Paul, ihre seinerzeit ausgefallene Schul-Abschlussfahrt nachzuholen: eine Kanutour auf der Weser. Eine Fahrt voller Unwägbarkeiten, Turbulenzen und persönlicher Erkenntnisse nimmt ihren Lauf …
Inhaltsübersicht
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
1
Durch die Gänge wummerten Beats, und vor dem Eingang zur Aula sprenkelte eine silberne Discokugel die Wände mit flirrenden Lichtern. Trotzdem Schule, dachte Paul Cullmann. Obgleich dies nicht die Schule war, die er früher besucht hatte, und obwohl seine Schulzeit schon ewig zurücklag, beschlich ihn umgehend das Gefühl, irgendetwas ungemein Wichtiges vergessen zu haben. Hausaufgaben oder die Mathe-Klausur. Ging wahrscheinlich jedem so, schätzte Paul, Schule blieb Schule. Da half auch keine Discokugel.
Die zum Festsaal umfunktionierte Aula präsentierte sich schon gut gefüllt mit Menschen. Auf den ersten Rundblick hin entdeckte Paul weder Lennart noch Daniela, also verkrümelte er sich an den Rand des Saals und behielt den Eingang im Auge. Immer noch strömten Gäste herein, Abiturienten und ihre Familien: Eltern, Großeltern, Geschwister. Die Heldinnen und Helden des Abends trennten sich schnell von ihrer jeweiligen Sippe und rotteten sich grüppchenweise auf der Tanzfläche zusammen, als stünden sie noch auf dem Pausenhof. Dabei entfachten sie jedes Mal aufs Neue einen Begeisterungstaumel, wenn wieder einer der Ihren in ungewohnter Abendgarderobe auftauchte. Auch Paul ließ dieses Schauspiel nicht unberührt. Da waren die schlaksigen Kerle, die sich in ihren nagelneuen Anzügen steif und ungelenk bewegten wie Roboter und dabei unablässig nervös am – vermutlich von Papa gebundenen – Krawattenknoten nestelten. Ihre weiblichen Pendants waren die Mädchen, die sich ihre Abendkleider wahrscheinlich schon eine Minute nach dem Anlegen am liebsten heruntergerissen und durch eine Reithose oder Jeans ersetzt hätten. Sie wirkten in diesen Kleidern genau so, wie sie es selbst empfanden: als Fremdkörper. Aber von diesen Mädchen gab es nicht viele. Die meisten ihrer Geschlechtsgenossinnen hatten die Metamorphose vom Schulmädel zur jungen Dame mühelos gemeistert. Perfekt gestylte Scarlett O’Haras, die sich in Putz und Robe auf dem Parkett bewegten, als hätten sie sich ein Schulleben lang bloß verstellt und nun endlich ihre wahre Bestimmung gefunden. Auch unter den Jungen gab es einige, die im Anzug eine souveräne Figur abgaben. Nicht sehr viele, aber immerhin. Auf diese Spezies schien der Nadelstreifen förmlich gewartet zu haben. Vermutlich würden sie ihn für den Rest ihres Daseins kaum noch ablegen.
»Sie sind soooo groß geworden, unsere Kleinen! Gestern noch soooo winzig. Konnten nichts alleine. Und jetzt das. Kaum zu fassen, was?«
Paul nickte gedankenverloren und sah erst dann zur Seite. Sein Blick versackte ungebremst im abgründigen Dekolleté einer wogenden Mutterbrust. Bevor sich Auge und Bewusstsein wieder mühsam schluchtaufwärts hangelten, verschüttete ihn bereits die nächste Wortlawine.
»Obwohl, so alles alleine, das können sie natürlich doch noch lange nicht. Sina, sag ich gestern zu meiner Tochter, was ist nun mit deinem Ballkleid? Stellen Sie sich vor, da hat das Kind bis dahin noch nicht mal daran gedacht, ein Kleid zu kaufen! Ich sag, das ist ein Ball. Ein Tanzfest. Der krönende Abschluss deiner Schulzeit. Du brauchst ein Kleid! Ich also mit meiner Tochter sofort los in die Stadt …«
Es war, als hätte man eine Endlostonspur gestartet.
»… nicht diese rosa Tüllgardine, sag ich zu der begriffsstutzigen Verkäuferin, mein einziges Kind soll ja nicht Karriere im Harem machen …«
Wo ist der Nothammer?, fragte sich Paul. Er kannte die Frau, obwohl ihm ihr Name nicht mehr einfiel. Ihre Tochter Sina war mit seinem Sohn Lennart zusammen im Kindergarten gewesen, vor einem gefühlten Jahrhundert. Damals hatte Sinas Mutter mit ihren Dauermonologen schon regelmäßig jeden Elternabend erheblicher überzogen als Gottschalk seine Sendezeiten bei »Wetten, dass«. Paul führte es im Nachhinein auf diese traumatische Früherfahrung zurück, dass er im weiteren Verlauf von Lennarts Schulzeit den Besuch von Elternabenden nur allzu gern Daniela überlassen hatte.
Aber jetzt war Daniela leider noch nicht da.
»… das Grüne passte nun mal kein Stück zu Sinas Teint, aber das Fliederfarbene, Flieder, sag ich, Flieder geht immer, nicht wahr, kennen Sie doch auch, den Spruch, Herr … Herr … sagen Sie mal …«
Sie wusste seinen Namen also auch nicht. Paul beschloss spontan, seine Anonymität zu wahren. »Holunder.« Wenn man schon beim Flieder war. »Fred Holunder.«
»Holunder? Sie kommen mir bekannt vor, aber bei Holunder klingelt es nicht bei mir. Was machen Sie denn so?«
»Ich restauriere.«
Sie kniff interessiert die Augen zusammen. »Alte Meister?«
»Alte Möbel.«
»Aus dem Museum?«
»Vom Sperrmüll.«
Ihr Interesse erlosch schlagartig. »Ihr Name klingt gar nicht polnisch.«
»Eingedeutscht. Eigentlich: Holunderoschinski. Aber Holunder spart Geld. Sonst bräuchte ich Visitenkarten zum Ausklappen.«
»Äh. Ja. Ach so.« Sie wusste nicht recht weiter, stocherte aber trotzdem weiter im Nebel. Notorisch neugierig. »Vielleicht kenne ich Ihr Kind? Es hat doch jetzt in Sinas Jahrgang Abitur gemacht. Sohn oder Tochter?«
»Tochter.«
Sinas Mutter ließ nicht locker. »Wie heißt sie denn?«
Paul zögerte keinen Moment. Diese Nervensäge verdiente es nicht anders. »Melinda Indira Elvis. Da ist sie ja endlich. Tschüs dann, ich muss zu ihr …«
Er ließ die verdutzte Frau stehen und strebte einem Grüppchen kichernder Ballprinzessinnen entgegen. Einer davon, einem ätherischen Geschöpf mit sorgfältig konstruierter Hochfrisur, tippte Paul im Vorbeigehen vertraulich auf die Schulter. »Entschuldigen Sie bitte – haben Sie Lennart Cullmann hier irgendwo gesehen?«
Sie schüttelte das Köpfchen – ausgesprochen bedächtig, damit ihr die Frisur nicht aus dem Leim ging.
»Danke, macht nichts. Ich finde ihn schon.«
Zu seinem vorigen Beobachtungsposten am Rande der Tanzfläche gab es kein Zurück. Dort stand Sinas Mutter, deren Blicke Paul immer noch verfolgten. Also entschied er sich für einen Abstecher zur Bar. Bis Lennart und Daniela hier aufkreuzten, würde er sich ein kühles Blondes gönnen. Dann hätte er etwas zu tun. Paul spürte wieder dieses Gefühl dumpfer Unruhe im Magen, das ihn bereits durch die ganze letzte Woche begleitete. Heute war es besonders schlimm gewesen. Heute ist ja auch der Tag X, dachte er. Lennarts allerletzte Schulveranstaltung. Nächste Woche wäre sein Junge schon weg. Sechs Monate Wirtschaftspraktikum. New York, Big Apple, USA. Sein Junge. Nicht daran denken, beschwor sich Paul. Er drängte sich energisch an den umlagerten Tresen.
»Ein Bier, bitte.«
»Schule ist anstrengend, was? Damals wie heute.« Vom Barhocker neben ihm grinste Paul ein bekanntes Gesicht entgegen: Sebastian Westhofen, sein einstiger Klassenkamerad.
»Heute ist schlimmer«, seufzte Paul.
»Wenn der offizielle Teil vorbei ist, wird’s bestimmt nett«, tröstete Sebastian.
Basti hatte drei oder vier Kinder, entsann sich Paul. Da wird man wahrscheinlich irgendwann gelassener. »Wenn du es sagst …«
Ein gestresster Barkeeper stellte das von Paul bestellte Bier vor Sebastian auf dem Tresen ab und hastete zum anderen Ende der Theke. Basti griff nach dem Glas und hielt es Paul entgegen. Dabei bebte seine Hand ein wenig, etwas Gerstensaft lief über den Rand und tropfte auf den Boden, bevor Paul das Getränk übernehmen konnte.
»Tut mir leid«, entschuldigte sich Basti.
»Bist wohl doch nicht so entspannt, wie du tust«, grinste Paul. Sebastian zuckte mit den Achseln. Er wirkte müde und abgekämpft. Vier Kinder, dachte Paul, da altert man rasant. Außerdem ist er zweiundfünfzig. Wie ich. O Mann.
»Irgendwas ist immer«, erwiderte Basti lapidar.
Sebastian, der Meister des Nichtsagens. Der ließ schon als Schüler nie viel von sich nach draußen, erinnerte sich Paul. Sebastian war irgendwie da, aber wie er wirklich tickte, wusste man nie so genau. Deshalb hatte Paul eher wenig mit Basti zu tun gehabt. Und jetzt konnte er auch nicht viel mit ihm anfangen. Paul überbrückte seine eigene Sprachlosigkeit mit einem zügigen Schluck aus dem Bierglas. Wenigstens entdeckte er dabei weiter hinten im Saal, am Rande der Tanzfläche, Daniela und Lennart.
»Ich zieh dann mal weiter.«
Sebastian grinste schief: »Ein Mann muss tun, was ein Mann tun muss.«
Klang nicht halb so cool wie bei John Wayne. War ja auch bloß Basti. Paul nickte ihm kurz zu und steuerte auf seinen Sohn und seine … tja, was eigentlich? – Ex-Frau, das hörte sich komplett bescheuert an. Schließlich war Daniela immer noch eine Frau, auch nach der Scheidung. »Seine« Frau war sie natürlich nicht mehr. Aber das war sie vorher auch nicht gewesen, jedenfalls nicht im wörtlichen Sinne, der ja ausgesprochen besitzergreifend daherkam. Daniela hatte immer sehr viel Wert auf Unabhängigkeit gelegt, auch während ihrer gemeinsamen Ehe. Die war nun bereits seit sechs Jahren geschieden. Und Paul wusste immer noch nicht, wie er sich gegenüber seiner – tja, was eigentlich? – positionieren sollte. Wohin für ihn die Reise mit Daniela gehen würde, die so viele gemeinsame Jahre und einen gemeinsamen Sohn umfasste. An dieser Ratlosigkeit hatte nicht einmal die Tatsache etwas geändert, dass Daniela längst wieder mit jemandem zusammen war. Jean-Luc, ein Franzose. Manager in der Systemgastronomie. Lebte in Lyon, was nur eine Wochenendbeziehung zuließ – für Daniela anscheinend genau das richtige Maß an verbindlicher Unverbindlichkeit. Seine – tja, was eigentlich? – blieb Paul ein Rätsel. Und solange man bei einem Rätsel nicht wusste, wie es sich auflöste, blieb die Spannung. Welche Paul immer in sich verspürte, wenn er Daniela sah. So wie jetzt.
Lennart hatte ihn entdeckt und winkte seinem Vater entgegen. »Na, Großer?«, grüßte Paul und bewunderte auch Lennarts Anzug gebührend. »Edel. Ganz groß. Perfektes Outfit für die Wall Street! Steht dir prima.« Und das war nicht gelogen, dachte Paul, überwältigt von einer Gefühlswelle aus Stolz, Staunen und Wehmut. Da stand Lennart: Rank und schlank überragte er Paul um eine halbe Haupteslänge. Die Schulterpolster seines Anzugjacketts hätte Lennie nicht benötigt, um athletisch zu wirken. Sein dunkles, gewelltes Haar war exakt so voll und dicht, wie es bei Paul ausgesehen hatte – damals, bevor es sehr viel dünner und nun überwiegend grau geworden war. Die wachen, strahlend blauen Augen hatte Lennart von seiner Mutter. So, fuhr es Paul durch den Sinn, sieht ein Held aus, der die Welt erobert. Und so stolzgeschwellt, wie Daniela gerade ihren Sohn musterte, schien sie Ähnliches zu denken.
Unter der vereinten elterlichen Großbeschau fühlte sich Lennart nun doch etwas unbehaglich. »Danke. Ich schau mal, wer schon alles da ist«, kündigte er an und verdrückte sich eilig ins Getümmel.
Daniela schmunzelte, als Paul ihrem Jungen regelrecht versonnen nachblickte. »Keine Sorge. Der macht seinen Weg.«
»Sicher. Gute Gene.«
»Genau. Meine.«
»Witzig.«
»Deine natürlich auch«, gab sich Daniela gnädig. War schließlich ein besonderer Abend.
»Den Anzug habt ihr gut ausgesucht«, gab Paul das Geschenk zurück, »passt wie angegossen.«
»Du könntest auch mal wieder einen neuen brauchen«, schwenkte Daniela wieder auf Konfrontationskurs ein. »Ich wette, du kriegst das Jackett nicht mehr zu, ohne dass dir der Knopf wegfliegt.«
»Krieg ich schon«, behauptete Paul fest. »Ich will bloß nicht.«
Daniela kicherte und knuffte ihn gegen die gut gepolsterten Rippen. »Zugenommen?«
»Wenn überhaupt: Kummerspeck!«
»Ach was. Andere Leute haben auch Probleme.«
Daniela wurde plötzlich ernst und atmete einmal tief ein und wieder aus. Ihr lag etwas auf der Seele, registrierte Paul sofort. Wenn er jemanden in- und auswendig kannte, dann seine – tja, was eigentlich?
»Du, zum Beispiel?«, erkundigte er sich aufmerksam. Ganz offensichtlich kämpfte Daniela mit einer Antwort. Interessant, fand Paul und verfiel umgehend einer ebenso schlüssigen wie verlockenden Erklärung: Bestimmt war es vorbei zwischen Daniela und Jean-Luc. An einem Abend wie diesem, der gewissermaßen den Schlusspunkt unters zwar schon vor Jahren ramponierte, aber immerhin doch noch irgendwie funktionstüchtige Familienleben setzte, kochte in ihr die Sehnsucht nach guten, alten Zeiten hoch. Sehnsucht nach ihm, hoffte Paul plötzlich in sicherer Zuversicht darüber, dass Daniela ihn gleich um einen kompletten Neustart anflehen würde. Und er, er würde sie in die Arme schließen und Ja sagen.
»Sie heißt nicht Melinda Elvira Elvis!«
Die Mutterbrust im abgründigen Dekolleté wogte diesmal vor blanker Empörung. Sinas Mutter baute sich neben Paul und Daniela auf, im Schlepp die ätherische Elfe, die immer noch dem Zusammenhalt ihrer Hochfrisur wesentlich mehr Aufmerksamkeit widmete als allem anderen.
»Sie heißt Désirée! Und sie ist auch nicht Ihre Tochter!«
»Sie erinnert sich nicht«, konterte Paul gelassen. »Wir haben sie gleich nach der Geburt zur Adoption freigegeben.«
»Hä?«, grunzte die Elfe nur und betastete beidhändig ihre hochtoupierte Sturmhaube.
»Dafür hat sie jetzt die Haare schön. Hätte sie mit mir als Vater nie geschafft«, legte Paul nach.
»Also ich geh jetzt«, verkündete die Elfe verständnislos und trippelte vorsichtigen Schrittes davon.
Sinas Mutter wandte sich Daniela zu, mit pistolengleich auf Paul gerichtetem Zeigefinger. »Nehmen Sie sich bloß vor Herrn Holunder in Acht, das ist ein ganz Durchgeknallter!«
Daniela bewegte keine Miene. »Zu spät. Wir waren schon verheiratet.«
»Unerhört so was!«
Sinas Mutter zog wutschnaubend von dannen und ließ damit offen, ob sich ihre Feststellung auf den Tatbestand der verflossenen Ehe oder auf Pauls albernes Täuschungsmanöver münzte. Daniela musterte ihren Ex-Gatten ausdruckslos.
»Herr Holunder?«
»Holunderoschinski. So viel Zeit muss sein.«
»Du hast wirklich einen ausgesprochen seltsamen Humor.«
»Immerhin habe ich welchen.«
Sie schüttelte resigniert den Kopf und ließ den Blick durch den Saal schweifen, in dem die Party allmählich Fahrt aufnahm. Paul spürte immer noch, dass Daniela etwas auf dem Herzen hatte.
»Du wolltest mir gerade etwas erzählen, bevor das rasende Muttertier hier aufkreuzte?«
Daniela nickte und wandte sich ihm zu, wieder etwas unsicher. »Wie geht’s dir so, Paul?«
Gleich, dachte er. Gleich setzen die Streicher ein, und Daniela dreht die Uhr zurück. Er zuckte verhalten mit den Achseln. »Lennie wird mir fehlen. Und, wie’s aussieht, werde ich meinen Laden zumachen müssen.«
»O nein. Tut mir leid, Paul.« Sie wirkte ehrlich betroffen.
»Es muss ja nicht immer alles so bleiben, wie es ist«, versuchte Paul ihr die verbale Brücke zum großen Wiedervereinigungsbekenntnis zu bauen. Schien zu klappen, Daniela nickte jedenfalls eifrig.
»Sehe ich genauso! Find ich gut, dass du auch bereit bist für Veränderungen, Paul. Weißt du, das hast du früher nicht so draufgehabt …«
»Früher war gestern.« Er winkte lässig ab. »Das Heute zählt. Sieh dich doch hier um …« Paul wies in den Saal. »Lauter junge Menschen auf dem Ritt ins Dasein. Wir haben ihnen lange genug die Steigbügel gehalten. Jetzt müssen wir uns mal wieder auf uns selbst besinnen, meinst du nicht auch?«
»Absolut richtig«, bekräftigte Daniela und strahlte ihn an. Hinreißend, fand Paul. Wo blieben die Streicher?
»Du bist ein guter Kerl, Paul. Auch, wenn ich eben über deinen Humor gemeckert habe …«
»Danke.« Streicher?
»Wenn Lennart nächste Woche nach New York fliegt, also nach seiner Abreise … Ich ziehe nach Lyon. Jean-Luc und ich – wir heiraten.«
Keine Streicher. Kesselpauke.
»Meinen Modeblog schreibe ich dann direkt aus Frankreich, ist irgendwie auch viel authentischer, findest du nicht? Ich kann dort sogar Reportagen für ein Lifestyle-Magazin machen …«
»Du ziehst also vor allem wegen der Arbeit dorthin, ach so.«
»Paul.« Sie musterte ihn betrübt. »Mach es nicht unnötig schwer. Früher war gestern. Hast du gerade erst gesagt.«
»Dann muss es ja stimmen.«
»Genau.« Sie stupste ihn wieder an, diesmal eher aufmunternd als neckisch. »Hey. Tanzen?«
Paul verzog das Gesicht. »Wir müssen uns wieder auf uns selbst besinnen – das hab ich doch auch gesagt.«
»Und?«
»Tanzen macht mich immer so besinnungslos.«
»Dann eben nicht. Ich mische mich jetzt unters Volk. Hier sind noch ein paar Leute, von denen ich mich verabschieden möchte.« Ihre Hand bewegte sich wieder auf ihn zu. Dann sank sie doch herab, bevor eine Berührung zustande kam. »Alles Gute, Paul.«
Damit ließ sie ihn stehen.
»Du mich auch, Daniela«, murmelte Paul leise. Um ihn herum schoben und drängten sich die Leute, doch er rührte sich nicht vom Fleck. Blieb einfach stehen, angewurzelt wie ein Baum. Wie irgendein seltsames Gewächs, das einfach da war und ansonsten nichts zu tun hatte mit allem, was die anderen Kreaturen um ihn herum so trieben. Solange er sich nicht bewegte, ginge ihn nichts davon an.
Diese Illusion währte nur so lange, bis ein unbeholfenes Tanzpaar zu den Klängen von Dancing Queen aus der Kurve getragen wurde und ihn unsanft anrempelte.
»’tschuldigung.« Lennart wirkte abwesend, als zählte er im Geiste immer noch seine Schritte.
»Tanzlegastheniker«, grummelte Paul und rieb sich die schmerzenden Rippen.
»Hab ich von dir«, grinste Lennart.
Leider wahr, dachte Paul und wandte sich Lennarts Tanzpartnerin zu: eine gut gebaute Blondine mit künftiger Tendenz zur Walküre. Ein funkelndes Lippenpiercing konterkarierte ihr hübsches Püppchengesicht beträchtlich, daran änderte auch das artig geschnittene, fliederfarbene Kleidchen wenig. Sie schien zu der Spezies Mädchen zu gehören, die sich in solchen Fummeln nicht wohlfühlte – jedenfalls zog sie ein Gesicht, als wäre sie viel lieber ganz woanders. Und in anderer Kleidung.
»Vielleicht sollten Sie die Führung übernehmen«, empfahl ihr Paul. »Lennie scheint damit überfordert.«
»Ich finde diese gestelzte Standardtanzerei sowieso völlig verlogen«, maulte das Mädchen. »Eigentlich gilt fürs Tanzen doch bloß, was George Bernard Shaw darüber gesagt hat!«
»Der hat einiges gesagt«, merkte Paul an, »zum Tanzen also auch?«
Das Mädchen nickte mürrisch. »Tanzen ist der vertikale Ausdruck eines horizontalen Bedürfnisses.«
»Allerhand.« Das musste Paul erst mal verdauen.
»Sina ist sehr für Klartext, Papa«, erklärte Lennart eifrig.
Paul dämmerte es, wen er da vor sich hatte. »Sina, aha. Sie … du warst mit Lennie zusammen im Kindergarten, nicht wahr?«
Sie rang sich nun doch ein kleines Lächeln ab. »Seitdem sind wir auch zusammen zur Schule gegangen. Immerhin ist heute Abschlussfeier.«
»Tanzt du gar nicht?«, erkundigte sich Lennart.
»Meine Mutter ist auch alleine hier«, insistierte Sina.
Die würde schreiend weglaufen, wenn ich sie zum Tanz aufforderte, stellte Paul sich vor. Zuvor allerdings würde er schreiend weglaufen. Eigentlich, erkannte Paul plötzlich glasklar, ist es genau das: Ich will nur noch weg von hier. Er schüttelte den Kopf. »Sei mir nicht böse, Junge – aber ich gehe gleich nach Hause. War alles ein bisschen viel bei mir in letzter Zeit. Lasst es noch ordentlich krachen hier. Okay?«
»Okay«, erwiderte Lennart unbesorgt. »Wir sehen uns ja noch die Tage.«
Paul klopfte seinem Sohn leicht auf die Schulter, nickte der fliederfarbenen Sina kurz zu und suchte das Weite, bevor Sinas Mutter möglicherweise Alarm auslöste, weil er sich ihrer Tochter näherte. Nach Daniela hielt er nicht mehr Ausschau, um sich von ihr zu verabschieden. Was das betraf, war zwischen ihnen nun offensichtlich alles gesagt.
An dieser Erkenntnis kaute Paul immer noch, als er das Schulgelände längst hinter sich gelassen hatte und durch die auch zu später Stunde noch belebten Straßen Hamburg-Eppendorfs ging. Es war Juni, aber die Nachtluft wehte mit kühler Brise und ließ ihn frösteln. Paul schloss sein Jackett und atmete tief durch.
Prompt flog der Knopf weg.
2
Paul bückte sich nicht einmal, sondern kickte den Knopf vor sich her, bis das Ding ins nächste Gully rollte. Wärmer wurde ihm davon nicht. Draußen der kalte Wind, in der Seele Eiszeit. Auf dem Ball hatte er es nicht mehr ausgehalten, aber nach Hause zog es ihn auch nicht. Mehr aus Ratlosigkeit als aus Überzeugung steuerte Paul eine Eckkneipe an und trat ein. Normalerweise, erkannte er sofort, würde er um so einen Laden einen großen Bogen machen: tabakgebeizte Uralt-Gardinen, stockfleckige Tische, eine Musiktruhe, aus der deutsche Schlager plärrten. Hinter der Theke eine Wirtin mit der Figur einer aus dem Leim gegangenen sowjetischen Kugelstoßerin, davor zwei gestählte Kampftrinker. Sie wirkten so fest mit ihren Barhockern verwachsen, als würden sie nach Kneipenschluss darauf nach Hause hoppeln müssen. Falls man in einer Kneipe wie dieser überhaupt jemals Feierabend machte. Blöde Idee, hier einzukehren, bereute Paul bereits seinen Entschluss und erwog, einfach auf den Hacken kehrtzumachen.
»Warst ja nicht lange auf dem Ball.«
Von seinem Tisch aus grinste ihn Sebastian Westhofen an, zum zweiten Mal an diesem Abend.
»Länger als du, wie’s scheint«, konterte Paul.
Sebastian zuckte wieder mit den Achseln und deutete auf Pauls Jackett. »Da fehlt ein Knopf.«
»Trägt man so«, behauptete Paul und ließ seinen Blick beredt durchs Lokal schweifen. »Deine Stammkneipe?«
Sebastian schüttelte den Kopf. »Spontanidee.«
»Wie bei mir«, gab Paul zu. Er sah auf die Gläser, die Basti vor sich stehen hatte: ein Pils, ein Korn. Altherrengedeck. »Hilft’s?«
»Ist einen Versuch wert. Du auch?«
Paul erwinkte sich die Aufmerksamkeit der sowjetischen Kugelstoßerin, zeigte auf Sebastians Getränke, danach auf sich. Die Wirtin nickte bestätigend, Paul ließ sich am Tisch nieder und blickte seinen ehemaligen Schulkameraden fragend an. »Keine Lust mehr gehabt, den großen Kindern zuzugucken?«
»Abiball hatte ich schon zweimal. Und einmal muss ich noch. Aber du hast doch bloß ein Kind – einen Sohn, richtig?«
»Ja, Lennart. Der bereitet gerade vertikal ein horizontales Bedürfnis vor. Dafür braucht er mich nicht.«
»Und was sagt deine Frau dazu, dass du einfach von der Fete abhaust?«
»Bin geschieden.«
»No woman, no cry.«
So konnte man es natürlich auch sehen, dachte Paul und langte nach dem Schnapsglas, das die Wirtin zusammen mit dem Bier vor ihn auf den Tisch abstellte. Basti erhob seinen Schnaps ebenfalls und kippte das Zeug hinunter.
»Noch einen?«, erkundigte sich die Wirtin.
»Warum nicht«, meinte Paul.
»Bin dabei«, schloss sich Basti an. Die Wirtin schlurfte von dannen.
»Und bei dir? Was sagt deine Frau dazu?«
»Melanie?« Sebastian spielte nachdenklich mit einem Bierdeckel, bis der ihm aus den Fingern rutschte und zu Boden segelte. Er ließ ihn dort liegen. »Die denkt sich nichts dabei. Sie weiß, dass ich momentan nicht so viel Trubel ertrage. Ich war gerade erst sechs Wochen zur Kur und habe noch Urlaub.«
»Bist du krank?«
»War einfach fällig«, äußerte sich Sebastian nur, kryptisch wie üblich.
Zur Kur, also wirklich, wunderte sich Paul. Wer machte denn so etwas? Großeltern fuhren zur Kur, Leute in meinem Alter doch nicht. Dabei fiel ihm sein eigentlich ja schon ziemlich erwachsener Sohn ein. Der wäre längst dazu in der Lage, ihn zum Großvater zu machen. Opa Paul. Im Geiste sah sich Paul mit einem Haufen plärrender Säuglinge auf dem Arm – alle in fliederfarbenen Stramplern. Hilfe. Themenwechsel.
»Du bist doch Beamter?«, erkundigte er sich vorsichtig. Das hatte er mal gehört. Und es passte zu Basti.
»Na und?«, ereiferte sich Sebastian. »Glaubst du, in einem Liegenschaftsamt gibt es keinen Stress?«
»Schon gut. Reden wir nicht drüber.« Bloß: Worüber dann, spekulierte Paul. Sein ehemaliger Mitschüler schien ebenfalls an akuter Konversationsverstopfung zu leiden – jedenfalls schwiegen sie sich an, bis die nächste Runde Bier und Korn an den Start gebracht wurde.
»Meine Tochter geht für ein Jahr als Au-pair nach Neuseeland«, erklärte Sebastian plötzlich. »Ihre beiden älteren Geschwister waren nach dem Abi auch lange weg. Flemming hat in Australien Schafe geschoren. Philip war mit einer Wohltätigkeitsorganisation auf Madagaskar, Brunnen bohren für die Landbevölkerung.«
»Lennart geht nach New York. Solche Sachen sind heutzutage üblich, wie es scheint.«
Sebastian schluckte seinen Schnaps und nickte grimmig – Letzteres offenbar nicht wegen der zweifelhaften Qualität des hier ausgeschenkten Fusels, denn er bestellte gleich die nächste Runde. Paul zog nach, damit kein Schnapsglasstau entstand.
»Brunnen bohren«, wiederholte Sebastian verächtlich, »die brauchten da eigentlich überhaupt keine, hat sich dann herausgestellt. Aber hört sich ja erst mal edel an, aus solchen Motiven zu reisen. Als würde man nicht einfach rumhängen, sondern mindestens die Welt retten! Früher sind wir irgendwie losgezogen, einfach zum Amüsieren, zack, fertig!«
»Früher haben wir sechs Wochen blaugemacht«, versetzte Paul augenzwinkernd, »heute gehen wir zur Kur.«
Sebastian sagte nichts, aber seine Hand, die nun das Bierglas zum Munde führte, zitterte leicht. Er schien die Bemerkung keineswegs witzig zu finden. Paul hatte plötzlich das Gefühl, etwas gutmachen zu müssen. Obwohl ihm nicht klar war, was eigentlich. »Heutzutage übertreiben doch alle«, meinte er schließlich. »Nimm zum Beispiel diese Abifeier. Große Gala, alle in feinstem Zwirn. Vorgestern schon stundenlange Feier anlässlich der Zeugnisvergabe. Jeder Schüler einzeln aufgerufen, Auftritt mit Wunschmusik und Händeschütteln auf der Bühne …«
»Und gefeiert haben die praktisch das ganze letzte Schuljahr«, erboste sich Sebastian. »Schon nach den letzten Sommerferien hatten sie ein Festkomitee, und dann gab’s fast jedes Wochenende eine Abiparty. Angeblich zum Geldsammeln für den großen Abschlussball. Bei uns war das deutlich schmuckloser, weißt du noch?«
O ja. Wusste er noch. Paul hatte heute selbst mehr als ein Mal daran gedacht. Seine Schule war damals erst ein paar Jahre zuvor gegründet worden, das durchweg junge Kollegium ungebrochen vom studentischen Geist der Achtundsechziger-Generation durchweht. Am letzten Schultag verteilte Direktor Dittmer die Abschlusszeugnisse während der großen Pause unter den in der Aula versammelten Abiturienten – das war’s dann gewesen. Seine Ansprache dabei hatte sich auf einen einzigen Satz beschränkt.
»Traut euch, anders zu sein«, sagte Sebastian, als hätte er Pauls Gedanken gelesen. »Genau das hat Dittmer damals gesagt, weißt du noch?«
»Ist uns gelungen«, behauptete Paul. »Wir fühlen uns doch ziemlich anders heute Abend, oder?«
»Warte ab, bis wir noch ein paar davon gekippt haben«, grinste Sebastian und hob sein Schnapsglas, »dann fühlst du dich wirklich anders!«
Paul hätte sich gerne anders gefühlt. Verdammter Schnaps. Nicht einmal der Kaffee kam gegen den üblen Geschmack an, der ihm von dem Billigfusel aus der Billigkneipe noch auf der Zunge lag. Vom leichten Sägen in sämtlichen Gehirnlappen mal ganz abgesehen. Eigentlich hatte er heute seine Wohnung aufräumen wollen – die sah ziemlich wüst aus, und der Dreckwäschekorb quoll auch schon über. Aber es ging ihm auch so schon mies genug, da musste es nicht auch noch Hausarbeit sein. Also schnappte er sich seine Jacke, verließ die Rumpelbude und ging zu seinem Laden. Der lag nur einen kurzen Fußweg entfernt.
Unterwegs versuchte er sich von den lästigen Fuselfolgen durch Schaufenstergucken abzulenken. Paul fand kaum eines, das ihn interessierte. Das Viertel machte sich: Trendboutiquen und gehobene Gastronomie verdrängten zunehmend die alten Läden und schmierigen Imbissbuden. In Würde bröckelnde Altbauten gab es kaum noch, die meisten Fassaden waren saniert oder neuen Häusern gewichen – merkwürdig einheitlich wirkenden Konstruktionen mit spiegelnden Glasfronten.
Vor dem Torweg zu seinem Hinterhofladen traf Paul auf Frau Böhnke und Pelle, den hässlichsten Hund der Welt. Es gab Promenadenmischungen, die von allen an ihnen beteiligten Rassen die putzigsten Merkmale vereinten und irre niedlich aussahen. Bei Pelle war leider alles schiefgelaufen. Die Proportionen stimmten hinten wie vorne nicht, ein Ohr hing durch, das Fell war großflächig nahezu kahl – bis auf gelegentliche Oasen, auf denen sich der Haarwuchs kringelte wie bei einem Angorakaninchen. Pelle sabberte chronisch und schielte erbärmlich. Gut, dass die Töle nicht sprechen kann, dachte Paul. Pelle würde zweifellos stottern. Sein Bellen hörte sich auch nicht normal an. Selbst wenn er jemanden freudig begrüßte, wie jetzt Paul, klang es wie eine kaputte Kirmeströte.
»Ist ja gut, Pelle!« Paul tätschelte den aufgeregt hüpfenden Hund und versuchte dabei Pelles Halsband zu erwischen, um die Sabberschnauze von seinen Hosenbeinen fernzuhalten. Der unterbelichtete Köter hielt das für ein ganz tolles Spiel und geriet vor Begeisterung schier aus dem Häuschen. Der Geifer flog in alle Richtungen, bis sich Paul ergab und gar nichts mehr machte. Zufrieden wischte Pelle seine Schnauze an Pauls Jeans ab und nahm zu seinen Füßen Platz.
»Er mag Sie, Herr Cullmann! Zu anderen Leuten ist er nie so«, behauptete Frau Böhnke.
Andere Leute machen ja auch vernünftigerweise einen großen Bogen um das hässliche Vieh, dachte Paul. Nur ich nicht, weil ich leider hier durch muss und die Böhnke mit ihrem Monsterhund genau im Weg steht. Doch dann rang er sich ein Lächeln und ein freundliches »Guten Morgen!« ab. Eigentlich fand er die alte Dame ganz nett. Frau Böhnke lebte seit Ewigkeiten in dem Haus, in dessen Hinterhof sich Pauls Werkstattladen befand. Hin und wieder hatte sie dort ein Möbelstück gekauft – einen Stuhl, eine kleine Kommode, ein Regal. Und Paul immer wieder damit verblüfft, dass sie alles ganz genau wissen wollte: Wie er an das Möbel geraten war, mit welchen Methoden er es aufgearbeitet hatte und wie es zu pflegen sei. Frau Böhnke gab sich nicht mit halbgaren Erklärungen zufrieden. Jetzt auch nicht, wie es schien. Sie dachte nicht daran, Paul den Weg freizugeben, sondern musterte ihn prüfend.
»Sie sahen auch schon mal besser aus.«
»Harte Zeiten.«
Sie lächelte milde. »Haben Sie schon die Kündigung für Ihren Laden gekriegt?«
Paul nickte. »Zum Quartalsende.«
»Ich ziehe im nächsten Monat um.«
Das verblüffte Paul. »Ihr Mietvertrag ist doch praktisch unkündbar, Frau Böhnke – das müssen Sie doch nicht …«
»Ich muss auch nicht, ich will!«, erklärte die alte Dame energisch. »Wissen Sie, wie lange ich hier wohne? Über siebzig Jahre! Damals war ich zwölf, als meine Familie hier einzog.«
»Na, eben! Das gibt man doch sicher nicht so leicht auf«, wunderte sich Paul. »Bleiben Sie wenigstens in der Gegend?«
»Wir ziehen ins Grüne, Pelle und ich«, strahlte Frau Böhnke. »In ein generationenübergreifendes Wohnprojekt!«
»Kennen Sie die Leute denn gut?«
»Seit Monaten. Wir haben uns über Facebook zusammengefunden.«
»Sie sind bei Facebook?«
»Sie nicht? Da ist doch jeder heutzutage.«
»Doch, natürlich«, entgegnete Paul halbherzig. Lennart hatte ihm den Account gerade erst letzte Woche eingerichtet – damit sie über einen Kommunikationskanal verfügten, wenn er erst in New York weilte, hatte Lennie gemeint und seinem Vater lang und breit den Umgang damit erklärt. Paul hatte ihm nicht besonders gut zugehört.
»Jedenfalls bin ich den neuen Hauseigentümern beinahe dankbar dafür, dass hier alles abgerissen wird«, erklärte Frau Böhnke. »Ich weiß nicht, ob ich sonst die Energie für so einen Schritt aufgebracht hätte. Irgendwann muss man mal was Neues anfangen! Sonst geht ja immer alles im alten Trott weiter.«
»Ist doch nicht das Schlechteste, jeden Tag das Gleiche«, murrte Paul.
Die Böhnke lachte ihm ins Gesicht. »Wollen Sie etwa jeden Morgen so mies aussehen wie jetzt?«
»Wieso, ich fühl mich wie das blühende Leben«, behauptete Paul.
»Wenn so das Leben aussieht, bin ich froh, dass meins bald vorbei ist«, kicherte die Alte. »Erholen Sie sich, Herr Cullmann. Ich muss jetzt mit meiner neuen WG chatten. Komm, Pelle.«
Der Hund erhob sich artig, trocknete zum Abschied noch einmal seine feuchte Schnauze an Pauls Hosenbein und folgte Frau Böhnke schweifwedelnd und mit weit heraushängender Zunge. Es sah aus, als würde er im nächsten Moment auf seinen eigenen Lappen latschen. Das seltsame Gespann verschwand im Hauseingang, und Paul ging endlich durch den Torweg.
Das Gebäude von »Cullmann Antik & Trödel« beherbergte ursprünglich mehrere Garagen, bis man die Trennwände entfernt und ein paar Fenster eingesetzt hatte. Werkstatt und Verkaufsraum gingen fließend ineinander über, was so viel bedeutete wie: Im Eingangsbereich aufgestellte Möbel waren fertig aufgearbeitet, dahinter reihten sich Einrichtungsgegenstände in unterschiedlichen Stadien des Verfalls. Das Durchqueren der Räumlichkeiten kam dem Erlebnis einer archäologischen Ausgrabung gleich, bei der man sich vom intakten Hier und Jetzt bis in historische Tiefen buddelte, wo alles nur noch aus kryptischem Schrott und Scherben bestand. Paul liebte es, diese alten Sachen zusammenzusetzen, ihrer ursprünglichen Funktion auf die Schliche zu kommen, ihnen zu neuem Glanz zu verhelfen. Wahrscheinlich täte er das auch, wenn ihm niemals jemand etwas davon abkaufen würde. Dass dies dennoch oft genug geschah, um finanziell über die Runden zu kommen, hatte ihn nie über berufliche Alternativen nachdenken lassen.
Daniela schon. Die hatte sich zu Beginn ihrer Ehe vorgestellt, dieser Trödelladen sei erst der Anfang. Sie sah Paul mehr als Künstler denn als Handwerker. Als jemanden, der aus Antiquitäten exklusive Designerstücke schuf, die sie dann als wohlhonorierte Innenarchitektin betuchten Schnöseln in die noblen Appartements stellem könnte. Das war an Pauls Unlust gescheitert, sich auf solche Projekte mit derartiger Klientel einzulassen. Eigentlich hatten seine Frau – Ex-Frau – und er schon früh recht unterschiedliche Vorstellungen vom Glück gepflegt, gestand sich Paul ein. Nun war Daniela für ihn endgültig Geschichte. Seine letzte Fluchtburg, dieser Trödelladen, demnächst leider auch. Was vielleicht sogar den existenzielleren Verlust darstellte. So preisgünstige Räume fände er bestimmt nicht wieder.
Und dann?
Paul nahm unentschlossen einen schartigen, hölzernen Hocker zur Hand. Ein Melkschemel, ursprünglich dreibeinig, mittlerweile eines Beines verlustig, vom Zahn der Zeit amputiert. Neben dem Schemel lag bereits die Prothese, von Paul gestern frisch gedrechselt und vorlackiert. Müsste nur noch eingesetzt werden, dachte Paul, aber weshalb die Mühe? Um zum Quartalsende wieder auf dem Sperrmüll zu landen, reichten die verbliebenen Beine allemal. Lustlos legte er den Schemel beiseite. Vielleicht sollte er es noch mal mit einem Kaffee probieren.
Die Kaffeemaschine stand ganz hinten in der kleinen Büro-Ecke. Paul benutzte sie weitaus häufiger als den betagten Computer oder das Telefon, die auch dort ihren Platz hatten. Während er mit dem Kaffeefilter hantierte, hörte er, wie jemand seinen Laden betrat.
»Hallo Papa.« Lennart steckte nun wieder in der Sorte Klamotten, in denen er für gewöhnlich herumlief: Jeans und T-Shirt. Obwohl sein Sohn ihm in dieser Kleidung viel vertrauter erschien als gestern im feinen Anzug, kam Lennart seinem Vater immer noch verblüffend erwachsen vor – als hätte sich dieser Wandel quasi über Nacht vollzogen. Vielleicht hatte die fliederfarbene Sina dabei ihre Hand im Spiel, überlegte Paul. Oder diese Entwicklung kam so langsam, dass sie an mir vorbeigelaufen ist. Er legte den Filter weg und umarmte seinen Sohn freudig. Lennart erwiderte die Geste merkwürdig steif.
»Du bist aber früh unterwegs«, wunderte sich Paul. »Und das nach einer rauschenden Ballnacht …?«
Lennart machte eine abwiegelnde Geste. »Ich hab noch so viel auf dem Zettel vor New York. Da bin ich lieber rechtzeitig nach Hause gegangen.«
»Da war deine Freundin sicher enttäuscht.«
»Sina? Das ist nicht meine … wir sind nur Schulkameraden. Außerdem steckt sie selbst im Abreisestress. Sie geht für ein Spanisch-Semester nach Madrid.«
»Ihr verstreut euch wirklich in alle Winde. Ist dir das nicht ein bisschen unheimlich?«
Lennart lächelte milde. »Wir sind doch alle gut vernetzt. Facebook, WhatsApp, Twitter und so.«
»Hätte mir nicht gereicht, mit ’nem Bildschirm zu knutschen«, wunderte sich Paul. »Aber ich finde es toll, wie du dich selbst um alles gekümmert hast, Lennie. Um dein Wirtschaftspraktikum und diese ganze New-York-Kiste. Wollte ich dir längst mal gesagt haben.«
»Danke.«
»So vernünftig wie du bin ich in deinem Alter bestimmt nicht gewesen. Dass du deine Zukunft selbst so zielstrebig in die Hand nimmst, erleichtert mich ziemlich. Jetzt, wo Mama auch noch weggeht … Macht dir das eigentlich gar nichts aus?«
Lennart zuckte abgeklärt mit den Achseln. »Wieso, wir sind doch alle erwachsen!«
Ihr vielleicht, dachte Paul. Bei sich selbst war er sich da langsam nicht mehr so sicher. »So muss man das wohl sehen. Trinkst du einen Kaffee mit? Ich wollte gerade welchen aufbrühen.«
»Nein, danke. Ehrlich gesagt hab ich nicht besonders viel Zeit«, wehrte Lennart ab. Er wirkte plötzlich etwas verlegen.
»Schon okay«, meinte Paul, »wir sehen uns ja noch, wenn ich dich zum Flughafen bringe. Oder vorher noch mal? Würde mich freuen.«
»Deshalb bin ich vorbeigekommen«, erwiderte Lennart. »Ich möchte dir eigentlich lieber jetzt schon auf Wiedersehen sagen.«
»Jetzt schon? Warum?«
»Auf dem Flughafen, das ist einfach bescheuert. Das ist halb unterwegs und halb noch zu Hause, keiner weiß, was man sagen soll, und irgendwie machen sich dann alle verrückt – das will ich nicht.«
Paul musste das erst mal verdauen. »Mama kommt auch nicht?«, fragte er schließlich.
Lennart schüttelte den Kopf. »Die fährt selbst am nächsten Tag nach Lyon und muss packen. Ist ihr ganz recht so. Für dich auch okay?«
»Muss ja«, brummte Paul. »Vorher noch mal treffen ist dann wohl auch nicht mehr drin?«
»Echt nicht, tut mir leid, Papa.«
»Okay, was ist schon ein halbes Jahr?« Paul riss sich zusammen. »Alles Gute, Großer. Schreib mir mal.«
»Warte nicht auf den Briefträger«, grinste Lennart. »Post war vorgestern. Guck bei Facebook nach. Du hast hoffentlich nicht vergessen, wie das geht?«
»Du glaubst wohl, meine Generation ritzt ihre Botschaften noch auf Steintafeln.«
»Deine Generation vielleicht nicht«, grinste Lennart. »Dir wäre das zuzutrauen.«
»Hau ab, du Klugscheißer. New York wartet.«
Ihre Umarmung fiel diesmal beiderseits etwas verkrampft aus. Dann war Lennie weg. Endgültig. Jedenfalls für sechs Monate. Und wer wüsste, was danach kam. Paul hatte plötzlich keine Lust mehr auf Kaffee. Keine Lust auf gar nichts. Er ließ sich auf den Bürostuhl am Schreibtisch sinken und starrte Löcher in die Luft. Sebastian fiel ihm ein, der offenbar momentan auch nicht viel mit sich selbst anfangen konnte. Genaueres hatte sein ehemaliger Mitschüler gestern während ihrer heftigen Bier-und-Korn-Therapie zwar nicht offenbart, aber die Aktion an sich sprach ja schon Bände. Sie hatten getrunken, sich angeschwiegen und zwischendurch von den gemeinsam erlebten alten Zeiten geredet – was sich, mangels späterer Berührungspunkte, auf ihre Schulzeit und die Aufzählung diverser Namen beschränkte. Weißt du noch, XY. Was macht der jetzt? Weiß ich auch nicht.
Ich mach auch nichts, dachte Paul. Bald jedenfalls nicht mehr, wenn ich mich nicht darum kümmere. Vielleicht sollte ich mein privates Netzwerk pflegen. Facebook, WhatsApp, Twitter. So löst man heutzutage Probleme.
Er schaltete den PC an und wartete ab, bis sich die Programme hochfuhren und der altersschwache Lüfter seine Arbeitsgeräusche von asthmatischem Pfeifen zu dezentem Röcheln abmilderte. Dann loggte er sich bei Facebook ein. Sieben Freunde, immerhin. Da fühlte man sich doch schon nicht mehr allein. Okay, fast alles Verwandte, aber die musste man auch erst mal haben. Da wäre Lennart. Und Daniela. Danielas Schwester und deren Mann. Plus deren drei Töchter. Also Schwägerin und Schwager und drei Nichten. Sind die eigentlich noch mit mir verwandt, nachdem ich von Daniela geschieden bin?, fragte sich Paul. Wenn nicht, gingen Ex-Schwägerinnen, Ex-Schwager und Ex-Nichten auf Facebook doch locker als Freunde durch. Mit denen hatte er zwar schon vor der Scheidung eher selten etwas zu tun gehabt, aber Karteileichen waren in sozialen Netzwerken schließlich obligat. Zwei Verwandte, fünf Freunde, bilanzierte Paul – gar nicht mal übel.
Plötzlich entdeckte er in der Statusleiste neben dem Symbol für Freundschaftsanfragen einen kleinen roten Punkt mit einer »1« darin. Wie’s aussah, wuchs sein Netzwerk rasant an. Neugierig setzte er den Cursor an die Stelle und klickte darauf.
3
Die Anfrage kam von Pelle, dem hässlichsten Hund der Welt.
Warum nicht. Paul bestätigte die Anfrage kurzentschlossen und klickte sich umgehend auf Pelles Seite. Haufenweise Fotos von Pelle in allen Lebenslagen. Pelle beim Fressen. Pelle beim Pennen. Pelle beim Pipi. Da der Köter diese Bilder kaum selbst von sich fabriziert haben konnte, steckte zweifellos Frau Böhnke dahinter. Wie es aussah, dokumentierte sie Pelles Alltag rund um die Uhr. Das fand Paul erschütternd genug, aber die Kommentare unter den Fotos ließen ihn erst recht am Geisteszustand der Menschheit verzweifeln. Unter einem Pelle-Porträt, auf dem der Hund derart grenzdebil in die Kamera linste, als würde er um den Gnadenschuss winseln, überschlugen sich die »Süüüüüüß!!!«- und »Soooo niedlich!!!«-Sprüche. Bei den anderen Fotos fielen die Kommentare ähnlich euphorisch aus. Und sie waren unfassbar zahlreich. Den Rest gab es Paul jedoch, als er die Anzahl der »Freunde« entdeckte, die auf Pelles Seite standen:
Exakt 2187.
Besäße er noch einen Glauben an irgendwas, wäre Paul spätestens jetzt vom selbigen abgefallen. So blieb ihm nichts anderes, als kopfschüttelnd den PC herunterzufahren. Vielleicht sollte er damit anfangen, seine Nase in anderer Leute Hosenbeinen zu schnäuzen. Anscheinend steigerte das die Beliebtheit immens. Möglicherweise aber nur, wenn man dabei gleichzeitig mit dem Schwanz wedeln konnte. Da musste Paul leider passen.
Ein Tag zum Wegschmeißen. Dabei könnte er sich doch ungebremst amüsieren. Sebastian Westhofen hatte das jedenfalls behauptet: »Deine Eltern sind tot, dein Kind ist groß, du bist ledig – du hast es geschafft!«
Paul wusste nicht mehr, wann er zuletzt derart aus vollem Halse gelacht hatte. Nach Sebastians Feststellung war es so weit gewesen. Irre komisch, dass der Schulfreund genau auf die Umstände neidisch war, unter denen Paul am meisten litt. Irre komisch allerdings nur unter akuter Zufuhr von Korn und Pils. Sieh mich an, Basti, dachte Paul, jetzt sitze ich hier – von jedem Amüsement weit entfernt und mit exakt 2180 Facebook-Freunden weniger ausgestattet als der hässlichste Hund der Welt.
Jemand öffnete die Ladentür und schloss sie hinter sich. Einen hoffnungsvollen Moment lang dachte Paul, es wäre Lennie, der nun doch noch Zeit für einen längeren Besuch bei ihm gefunden hätte.
»Hallo? Guten Tag!«
Sebastian. Zum dritten Mal innerhalb von vierundzwanzig Stunden. Eigentlich eine Überdosis Westhofen, fand Paul. Aber mit 2180 Facebook-Freunden weniger als Pelle durfte man nicht wählerisch sein. »Basti?«
Der einstige Mitschüler suchte sich einen Weg durch den Trödel. Auf Sebastians Gesicht zeichnete sich ein schiefes Grinsen ab, als er Paul entdeckte, der tatenlos in der Büro-Ecke an seinem Schreibtisch vor dem dunklen Monitor hockte. »Sieht ja nicht nach viel Arbeit aus …«
»Bier und Korn trinke ich jetzt trotzdem nicht, falls du so was vorschlagen willst«, baute Paul vor.
»Hör bloß auf«, wehrte Sebastian mit Grausen ab. »Das war eine Ausnahmesituation! Eine singuläre Entgleisung, okay?«
»Dann bin ich ja beruhigt. Kaffee? Ohne Schuss?«
»Kaffee ist okay. Etwas anderes geht heute eh nicht …«
Nun war es an Paul, sich zu einem schrägen Grinsen aufzuraffen. Während er mit Filter und Kanne hantierte, erkundigte er sich: »Hab ich gestern in der Kneipe etwas liegen lassen? Oder benötigst du ein Gebrauchtmöbel?«
»Weder, noch.«
»Die alten Zeiten hatten wir so ziemlich durchgehechelt, oder?«
»Deshalb möchte ich mich heute mit der Zukunft beschäftigen. Die hat allerdings auch mit der Vergangenheit zu tun«, erklärte Sebastian geheimnisvoll.
»Da bin ich aber gespannt«, behauptete Paul und verhehlte dabei kaum, dass so ziemlich das Gegenteil der Fall war.
Sebastian ließ sich nicht beirren. »Die Zukunft, das sind unsere Kinder. Sagt man ja immer. Unsere Kinder mit ihren glamourösen Plänen. Brunnen bohren auf Madagaskar, Au-pair in Neuseeland, Wirtschaftspraktikum in New York. Aber du und ich, wir haben auch eine Zukunft.«
»Ich mache mich nicht gut als Au-pair. Nicht mal in Neuseeland.«
»Wir mussten damals auf unsere große Abschlussfahrt verzichten, weißt du noch?«
Paul setzte die Kaffeemaschine in Betrieb, dann wandte er sich Sebastian zu. »Die Kanutour auf der Weser?«
»Die leider ausgefallen ist, weil der alte Bargfrede krank wurde«, nickte Sebastian.
»Ich dachte, du willst über die Zukunft reden.«
»Genau das«, grinste Sebastian, »mache ich gerade.«
Paul musterte sein Gegenüber scharf. »Kann es sein, dass dir ein wenig Restalkohol zu schaffen macht?«
»Durchaus«, gab Sebastian zu. »Aber das betrifft nur meinen Magen. Mein Kopf ist klar. Wir gehen auf Paddeltour.«
»Du und ich?« Paul starrte Basti an, als hätte der einen gemeinsamen Bankraub vorgeschlagen.
»Du und ich – und alle ehemaligen Mitschüler, die wir erreichen und dafür begeistern können!«
»Du spinnst«, entfuhr es Paul. Dann sah er, wie Sebastian beleidigt die Lippen zusammenkniff. Beinahe tat Paul seine harsche Reaktion leid. »Ich meine, nach all den Jahren … was bringt das?«
»Was das bringt?« Sebastians Blick wanderte über das angehäufte Ensemble von in sämtlichen Verfallsstadien befindlichen Mobiliars. In ihm schien es heftig zu arbeiten, es stand bloß noch nicht fest, was dabei herauskam. Paul ereilte ein Déjà-vu: Diese Miene hatte Basti auch in der Schule zur Schau getragen, wenn ein Lehrer diesen ansonsten eher stillen Vertreter zur konkreten Stellungnahme trieb. In seinen hellen, seltsamen farblosen Augen stand genau der gleiche Ausdruck wie damals, eine seltsame Mischung von Hilflosigkeit und Trotz. Für einen Moment vergaß Paul Sebastians schütter gewordene Haare, die Falten um Mund und Augen und die Brille, die Basti früher nicht gebraucht hatte. Für diesen Moment saßen sie wieder zusammen im Klassenzimmer. Und Paul hätte ihm gern die richtige Antwort zugeflüstert.
Leider kannte er sie selbst nicht.
»Gegenfrage«, äußerte sich Sebastian endlich und wies in den Laden. »Was bringt das hier?«
Paul zuckte mit den Achseln. »Ist mein Leben.«
»Demnächst fliegst du hier raus. Und hast nichts Neues in Sicht. Hast du mir gestern in der Kneipe erzählt.«
»Stimmt. Aber was hat das mit einer Kanutour auf der Weser zu tun?«
»Begreifst du das nicht?« Sebastian beugte sich beschwörend auf seinem Stuhl vor. »Es ist wie damals! Da war die Schulzeit fast vorbei. Und die meisten von uns wussten nicht genau, wie es mit ihnen weitergehen sollte. Du jedenfalls nicht. Und ich auch nicht …«
»Das war damals. Das ist vorbei.«
»Ist es nicht!« Sebastian sprang erregt auf und begann in dem schmalen Raum zwischen Schreibtisch und dem ersten Möbelstapel auf und ab zu wandern. »Wir sind … nie wirklich fertig geworden. Jeder für sich nicht, alle miteinander nicht – verstehst du, was ich meine?«
Paul schüttelte langsam den Kopf. Sebastian atmete tief durch, dann stoppte er seine Wanderung. Paul registrierte, dass es seinen Schulfreund vor Anspannung beinahe schüttelte. Sebastians Hände zuckten nervös.
»Erinnerst du dich wenigstens daran, wie sehr wir uns auf diese Abschlussfahrt gefreut hatten?«
Paul nickte bloß abwartend.
»Wäre unser Klassenlehrer nicht krank geworden … wenn wir losgefahren wären … hätte sich vielleicht manches verändert.«
»Zum Beispiel?«
»Vielleicht wären neue Freundschaften entstanden, prägend fürs ganze Leben. Wir hätten andere Ideen verfolgt, neue Pläne geschmiedet …«
»Haben wir aber nicht. Und die Uhr können wir auch nicht zurückdrehen.«
»Können wir nicht«, räumte Sebastian ein. »Wir könnten uns trotzdem versammeln, nachdem es uns in alle Winde zerstreut hat. Wer sich darauf einlässt, sitzt mit im Boot. Wir fahren eine Woche den Fluss hinunter. Und wer weiß, was dann passiert.«
»Was soll das ändern?«
Sebastian bedachte Paul mit einem Lächeln, in dem sich ein Hauch von Spott verbarg. »Stell dir vor, die Abschlussfahrt hätte stattgefunden. Du wärst in der letzten Nacht mit Ragna Meerbusch im Schlafsack gelandet, und ihr wärt auch nach der Tour zusammengeblieben. Hätte das dein Dasein verändert?«
O ja. Ragna Meerbusch. Paul schluckte, sagte jedoch nichts. Basti schien seine Gedanken auch so zu lesen, er grinste wissend und zog ein zusammengerolltes Heft aus seiner Jacke.
»Eine Woche, Paul. Um mehr geht es nicht. Was ist los mit dir? Coolman wäre sofort dabei gewesen.« Er ließ das Heft vor Paul auf die Schreibtischplatte fallen. »Sieh dir das einfach mal an. Ich komme morgen wieder, kurz vor Feierabend. Tschüs bis dahin.«
Damit wandte sich Sebastian ab und strebte zum Ausgang. Paul hörte die Tür schlagen, dann war er wieder allein. Coolman. Ein englischer Austauschlehrer hatte Pauls Nachnamen Cullmann immer so ausgesprochen. Zunächst aus Versehen, dann mit Absicht, weil er das enorm witzig fand und die Klasse dabei verlässlich kicherte. Ragna Meerbusch war die Erste gewesen, die Paul dann auch außerhalb der Englischstunden so nannte. Das fiel Paul jetzt wieder ein, und sogar Ragnas Erklärung dafür: Weil er selbst in brenzligen Situationen die Ruhe behielt und dabei aufreizend lässig wirkte. Wenn Ragna so etwas äußerte, wusste man nie genau, ob sie das ironisch meinte oder als Kompliment. Jedenfalls hatten ihn dann alle so genannt. Damals, in diesem letzten Schuljahr, als ihr Klassenlehrer Bargfrede wegen akuter Bandscheibenbeschwerden und anschließender OP die Abschlussfahrt absagen musste. Die Sebastian Westhofen nun nachzuholen gedachte. Was für eine Schnapsidee.
Vielleicht war Basti ja doch noch nicht ganz nüchtern, überlegte Paul. Anders konnte man kaum auf so etwas kommen. Er angelte sich das Heft vom Schreibtisch. Eine Abizeitung. Ihre