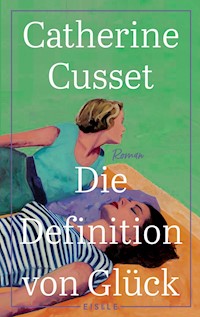12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Eisele eBooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Raffiniert erzählt Catherine Cusset ein Frauenleben als spannendes Puzzle.« Donna Jane Cook ist Professorin für französische Literatur an einer renommierten Universität an der amerikanischen Ostküste. Eines Tages wird ihr ein Päckchen ohne Absender zugestellt. Darin findet sie ein Manuskript vor, das – detailreich und mit größtem Wissen um ihr Innerstes – Janes gesamtes bisheriges Leben beschreibt. Vor allem scheint der unbekannte Biograf auch genau über ihre Liebesbeziehungen Bescheid zu wissen. Je weiter Jane liest, desto beunruhigter ist sie: Wer um Himmels willen hat einen solchen Zugriff auf ihr Leben? Mit jedem neuen Kapitel verdächtigt Jane eine andere Person aus ihrem Umfeld, der Verfasser zu sein. Doch dieser kommt ihr nicht nur im Manuskript, sondern auch im wahren Leben immer näher… Von der Autorin des Romans "Die Definition von Glück" Ausgezeichnet mit dem Grand Prix des Lectrices de Elle »Eine moderne Geschichte, die sowohl an Hitchcock als auch an de Beauvoir erinnert.« Le Figaro
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 496
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Das Buch
Jane Cook ist geschieden und lebt allein, als sie eines Tages ein Paket von einem anonymen Absender erhält. Darin befindet sich ein Manuskript, das detailliert von Janes Leben erzählt – von ihrem Alltag und ihren Freundschaften, ja sogar von ihrem Liebesleben. Beschämt und beunruhigt, wer sie wohl gut genug kannte, um ihre intime Geschichte zu schreiben, kann Jane nicht aufhören zu lesen. Und verdächtigt immer wieder neue Personen aus ihrem Umfeld, ohne zu ahnen, dass sie dem allwissenden Unbekannten näher ist, als sie denkt …
Die Autorin
CATHERINE CUSSET, 1963 in Paris geboren, studierte an der École Normale Supérieure. Von 1990 bis 2002 war sie Dozentin für Französische Literatur in Yale. Ihre Romane wurden in 18 Sprachen übersetzt und vielfach ausgezeichnet. Mit ihrem Mann und ihrer Tochter lebte sie in New York, bis sie vor Kurzem wieder in ihre Heimatstadt Paris zurückzog. Nach Die Definition von Glück ist Janes Roman das zweite Buch der Autorin im Eisele Verlag.
Catherine Cusset
Janes Roman
Roman
Aus dem Französischen von Annette Meyer-Prien
Besuchen Sie uns im Internet:
www.eisele-verlag.de
ISBN 978-3-96161-195-9
Die Originalausgabe »Le problème avec Jane« erschien 1999 bei Éditions Gallimard, Paris.
Taschenbuchausgabe
1. Auflage Juli 2024
© Éditions Gallimard, Paris, 1999
© 2024 der deutschsprachigen Ausgabe
Julia Eisele Verlags GmbH, München
© der deutschen Übersetzung 2002 by Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin
© der deutschen Übersetzung 2001 by Marion von Schröder Verlag, München
Erschienen im Marion von Schröder Verlag
Umschlaggestaltung: FAVORITBUERO, München
Umschlagillustration: © Lori Mehta
E-Book: LVD GmbH, Berlin
Alle Rechte vorbehalten.
Inhalt
Über das Buch / Über die Autorin
Titel
Impressum
Widmung
Das Paket
1. Ein Abendessen mit Bronzino
2. Wie es Erics Art war
3. Nicht einmal ein Kuss
4. Heilung
EMPFEHLUNGEN
Orientierungsmarken
Cover
Inhalt
Textbeginn
Für Vlad und Claire
Meinen Freunden Hilari, Meredith, Luciana und Per
Das Paket
Es gibt Tage, an denen man kein bisschen Schadenfreude empfindet, wenn man der miauend im Eingang sitzenden Nachbarskatze die Tür aufmacht und das verdutzte Tier im nächsten Moment von einem Regenguss durchtränkt wird.
Jane seufzte und ließ die Tür wieder ins Schloss fallen. Das Wetter machte auch nichts besser, und in einer Viertelstunde würde es noch schlimmer werden, wenn in ihrem Computer im Büro keine Nachricht von Alex war.
Die große graue Katze sah sie vorwurfsvoll an und miaute kläglich.
»Was ist? Bin ich vielleicht daran schuld?«
Am Boden, gleich neben dem per Hand beschrifteten Paket, das Jane gestern schon aufgefallen war, lag eine New York Times in der üblichen blauen Plastikhülle. Sie würde sie mitnehmen, wenn sie zurückkam, vorausgesetzt, sie war noch da. Man hatte ihr oft genug die Zeitung geklaut – bestimmt die Studenten aus dem Erdgeschoss –, und gerade damals, als sie von ihrer morgendlichen Nachrichtendosis abhängig war wie von einer Droge. Sie hatte deshalb sogar das Abonnement abbestellt.
Earl Grey maunzte jetzt vor der anderen Tür, der, die den kleinen Eingangsflur mit den Briefkästen vom Inneren des Hauses trennte. Sie steckte den Schlüssel wieder ins Schloss und stieß die schwere Tür für ihn auf. Er verschwand im Treppenhaus.
Jane hatte ebenso wenig Lust wie die Katze, sich in diesen Sturm hinauszustürzen, der ihr in weniger als einer Minute den Regenschirm umklappen würde. Für den Briefträger war es noch zu früh. Sie bückte sich, um den Namen des Nachbarn zu entziffern, der sein Paket liegen gelassen hatte, und machte große Augen, als sie merkte, dass es für sie selber war. Gestern war sie durch die Nachricht von Duportoys Tod zu verstört gewesen, um daran zu denken, sich den Namen anzusehen, zumal sie zu Hause sowieso nie Pakete bekam. Sie nahm es auf. Fest, rechteckig und eher schwer: bestimmt ein Buch. Ein Lächeln ließ ihr Gesicht aufleuchten. Alex musste sich einige Mühe gegeben haben, um ihre Adresse herauszubekommen. Nach dreizehn Tagen Schweigen schickte er ihr ein Geschenk anstelle einer E-Mail. Die Schrift auf dem Umschlag, so lebhaft und flüchtig, tanzend und ausgeglichen, passte zu Alex. Er benutzte einen Füllfederhalter und blaue Tinte, genau wie sie. Jetzt war sie schon sehr viel weniger trüber Stimmung.
Sie kämpfte mit dem wattierten Umschlag, der mit Klammern und Klebeband verschlossen war. Irgendein graubraunes Material quoll aus dem zerrissenen Papier hervor. Innen war wieder ein Umschlag, diesmal ein weißer: Das Buch war gut geschützt. Sie nahm einen Schnellhefter aus gelber Pappe heraus. Mit trockenem Geräusch fiel eine Diskette auf den Fliesenboden. Der Schnellhefter enthielt ein Manuskript in losen Blättern. Auf der ersten Seite las sie:
Janes Roman
Kein Autorenname. Auf der zweiten Seite ein Inhaltsverzeichnis:
1. Ein Abendessen mit Bronzino1
2. Wie es Erics Art war50
3. Nicht einmal ein Kuss153
4. Heilung260
Bronzino, Eric: die Männer in ihrer Vergangenheit. Sie musterte den braunen Umschlag: kein Absender. Das Paket war vor fünf Tagen in New York aufgegeben worden. Zu diesem Zeitpunkt war Alex in Frankreich, daran hätte sie denken müssen.
Sie überflog die ersten Seiten. Es ging um sie. Um sie und Bronzino. Vor neun Jahren. Da war jemand gut informiert. Das Manuskript war dreihundertundsechzig Seiten lang und endete mit dem Satz: »Unten fand sie das Paket mit dem Manuskript.« Jane zuckte zusammen und sah hoch. Hinter dem Türfenster war nichts zu sehen außer dem Regen und den Magnolienblüten, von denen das Wasser tropfte.
Sie würde später ins Büro gehen. Erst mal musste dieses Rätsel geklärt werden. Dieser seltsame Spaßvogel hatte sich genau den richtigen Tag ausgesucht: Als wenn der sintflutartige Regen, Duportoys Tod und Alex’ Schweigen, gerade jetzt, wo sie ihn so sehr brauchte, nicht schon genug gewesen wären. Sie hob die Diskette auf, öffnete zum zweiten Mal die Tür zwischen Eingang und Hausinnerem und stieg, immer zwei Stufen auf einmal nehmend, die Holztreppe hinauf, die trotz des Teppichbelags unter jedem Schritt knarzte. Als sie vor ihrer Wohnungstür angekommen war, berührte etwas sie am rechten Knöchel. Sie sprang mit einem Aufschrei zur Seite. Earl Grey glotzte sie mit großen Unschuldsaugen an. Sie lachte nervös und stampfte mit dem Fuß auf, um ihn zu verscheuchen. Als sie die Tür hinter sich zugemacht hatte, schob sie den Riegel vor, zog den Regenmantel aus, machte die Deckenbeleuchtung an – es war dunkel wie abends um sieben – und fing neben dem Tisch stehend zu lesen an.
Janes Roman
1. Ein Abendessen mit Bronzino
1Die Fenster des Provence lagen zu hoch, um hineinsehen zu können. Das beste Restaurant der Stadt. Freitag- und Samstagabend, wenn sie aus der Filmothek kam, sah Jane immer die eleganten Paare herauskommen Da hätte sie heute Abend gern gegessen. Heute Morgen am Telefon hätte sie es Bronzino beinahe vorgeschlagen, aber es war ein kleines bisschen zu schick für ein Dinner unter Kollegen, und finanziell gesehen konnte sie es sich gar nicht leisten. Also hatte sie das indische Restaurant in der University Street vorgeschlagen, das sie kannte, weil sie schon einmal allein dort gegessen hatte. Sie ging am Café Romulus vorbei. Ein kleiner Schwarzer mit Bart, den sie auch schon auf dem Campus betteln gesehen hatte, sprach sie an: »Haste mal zehn Cent?«
Sie blieb stehen, zufrieden mit sich, weil sie nicht rein aus Reflex nein gesagt hatte, und zog ihr Portemonnaie heraus.
»Eigentlich«, sprach der Kleine weiter, »werden hier nicht zehn Cent gebraucht, sondern ein Dollar.« Dann fügte er schnell hinzu: »Neunzig Cent hätten wir. Könnten Sie uns die vielleicht gegen einen Dollar tauschen?«
Ein massiger Schwarzer, der im Schatten eines Hauseingangs gestanden hatte, kam heran und hielt ihr mit einem Lächeln seinen großen Handteller voller Münzen hin. Ihm fehlten mehrere Vorderzähne. Jane holte einen Dollar heraus.
»Schon gut. Behalten Sie den Rest.«
»Danke!«
Sie machten keinen besonders überraschten Eindruck und verschwanden. Jane lachte. Sie konnte sich denken, dass es nicht der erste und auch nicht der letzte Dollar war, den sie heute Abend auf diese Weise verdient hatten.
Man durfte die Hoffnung nie aufgeben: Das Leben war ein ständiger Wechsel von Höhen und Tiefen, die sich am Ende irgendwann die Waage hielten. In Chicago hatte sie sechs Jahre lang Nudeln gegessen und sich mit anderen Studenten verrottete Wohnungen geteilt, die sich im Winter – und das waren sechs Monate pro Jahr – so schlecht beheizen ließen, dass sie mit Strümpfen und Wollmütze ins Bett gegangen war. Dann war das Licht am Ende des Tunnels erschienen, das unerwartete, völlig überraschende Angebot von der Devayne University, wo doch Jane auch nicht intelligenter war als jede andere und noch nicht einmal ihre Dissertation abgeschlossen hatte. Eine richtige Stelle mit richtigem Gehalt im besten Fachbereich für Französisch im ganzen Land, an der Ostküste, eineinhalb Stunden von New York entfernt – ein Traum, der Anfang eines glorreichen Lebens, das Glück. Sie hatte sich von ihrem Freund getrennt, den sie nie wirklich geliebt hatte, war nach Old Newport gezogen in eine elegante, gut geheizte Zweizimmerwohnung mit hohen Decken, Stuck, einem Kamin und wunderbarem Parkett aus breiten Ahornplanken, hatte sich einen herrlichen Teppich gekauft, ein richtiges Bett und ihr erstes Sofa und begonnen, an der Devayne zu unterrichten, wo sie nun die schlimmsten neun Monate ihres Lebens verbracht hatte. Mit jedem Tag noch ein bisschen einsamer und noch ein bisschen deprimierter.
Bis vor drei Tagen. Anscheinend gab es kein Absolutes im negativen Sinne. Je weiter man unten war, desto höher zog einen schon ein Nichts wieder nach oben. Die Dinner-Einladung eines bejahrten Kollegen hatte ausgereicht, sie wieder froh zu stimmen. Tatsächlich handelte es sich ja auch nicht um irgendeinen Kollegen. Ihre sämtlichen Kommilitonen an der Northwestern, und ganz besonders Josh, wären absolut sprachlos gewesen, wenn sie gewusst hätten, dass sie ganz allein mit Norman Bronzino essen ging.
Sie war vor der Perle von Bombay angekommen. Die gläserne Eingangstür warf ihr ihr Spiegelbild entgegen: Vom Halbrund ihres hochgeschlagenen Mantelkragens umgeben, mit der Wimperntusche, die ihre Augen größer wirken ließ, und dem rosa Lippenstift, hatte ihr von den braunen Haaren, die ihr dank Fönwelle bis auf die Schultern fielen, umrahmtes, herzförmiges Gesicht etwas Hübsches und Sanftes. Sie stieß die Tür auf. Ein indischer Kellner begrüßte sie mit einer Verbeugung.
»Ich bin hier mit jemandem verabredet.«
»Ein größerer Herr? Da hinten.«
Bronzino hatte sich die am weitesten von der verglasten Vorderfront entfernte Ecke in dem noch leeren Raum ausgesucht. Er erhob sich, als sie auf ihn zukam. Er war groß und dünn wie Janes Vater, wirkte aber jünger mit seinem schmalen Schnurrbart und den kurz geschnittenen hellbraunen Locken, die vielleicht gefärbt waren. Er trug wie immer ein perfekt gebügeltes Hemd, eine Fliege, ein Tweed-Jackett mit Wildlederflicken an den Ellbogen und Schuhe mit Kreppsohle. Der perfekte Landedelmann. Seine Hand war warm. Er hielt die von Jane eine Sekunde länger als nötig fest. Sie fragte schnell:
»Wartest du schon lange?«
»Ich bin gerade gekommen.«
Er half ihr aus dem Regenmantel und hielt ihn dem Kellner hin, der die Speisekarten brachte. Sie setzten sich. Er schlug vor, erst mal zu sehen, was es gab, und zog aus der Innentasche seines Jacketts eine rechteckige Lesebrille hervor, die ihn noch würdiger aussehen ließ.
Jane knurrte der Magen. Sie hatte den ganzen Nachmittag damit verbracht, ihre Wohnung zu putzen, und seit dem Morgen nichts mehr gegessen. Der Kellner verteilte den Inhalt einer großen Kanne mit Eiswürfeln und Wasser in ihren Gläsern. Sie trank ein paar Schlucke. Ein heftiger Schmerz durchzuckte ihren Leib. Sie stellte das Glas hin, verschränkte die Beine und starrte auf die Karte, ohne etwas zu lesen. Dann ein plötzlicher Krampf, dass sie beinahe aufgeschrien hätte. Das war nicht der Hunger. Sie setzte sich zurecht und schlug die Beine andersherum übereinander. Sie war blass, furchtbar angespannt. Bronzino war in seine Lektüre vertieft und hatte nichts bemerkt. Er faltete die Karte zusammen, nahm die Brille ab und lächelte sie an. Der Kellner kam an ihren Tisch. Jane nahm das erste Gericht auf der Seite, das auch das billigste war, nicht einmal sieben Dollar. Sie hatte zwar vierzig Dollar bei sich, wollte aber lieber nicht mehr als zehn ausgeben.
»Möchtest du keine Vorspeise?«
»Danke, ich habe nicht so viel Hunger.«
Er bestellte gemischte Vorspeisen und Scampi Tandoori, das teuerste Gericht auf der Karte. Ein Mann wie er achtete natürlich nicht auf den Preis, ein Privileg des Alters und des Ruhms. Es wäre schön, wenn man eines Tages leben könnte, ohne ständig zu rechnen – oder wenigstens ein bisschen großzügiger. Vielleicht in zehn Jahren, wenn sie die Schulden, die sie während ihrer Studienjahre aufgenommen hatte, zurückgezahlt haben würde.
»Hast du etwas dagegen, wenn wir Weißwein trinken? Das wäre mir lieber, damit er zu den Meeresfrüchten passt.« »Für mich bitte nur Wasser, danke.«
Mit ihrem leeren Magen wäre sie von dem Wein sofort betrunken gewesen. Bronzino bestellte ein Glas Chardonnay. Der Kellner entfernte sich.
»Hübsche Kette«, sagte Bronzino.
»Danke. Sie ist aus Israel.«
»Ach ja? Bist du schon mal dort gewesen?«
»Nein. Ich habe sie geschenkt bekommen.«
Sie errötete. Er lächelte.
»Also, wie läuft dein erstes Jahr hier bei uns?«
»Wirklich gut. Es macht Freude, derart intelligente Studenten zu unterrichten. Und die Bibliothek ist wunderbar. Ich habe eine Erstausgabe von Madame Bovary gefunden und durfte sie für ein Jahr ausleihen.«
»Wir sind verwöhnt, das stimmt.«
Jetzt ertönte ein lautes Magengrummeln, das Bronzinos Ohren nicht entgehen konnte. Jane hatte furchtbare Bauchschmerzen. Sie musterte ihre Finger.
»Ich sollte mir die Hände waschen. Ich war in der Bibliothek, und auf den Büchern ist immer so viel Staub …«
»Ich glaube, es ist hinten rechts.«
Sie ging gemessenen Schrittes weg, aber kaum hatte sie die Toiletten erreicht, rannte sie los, um sich einzuschließen. Ihr verflüssigtes Inneres entleerte sich geräuschvoll. Sie verkrampfte sich bei dem entsetzlichen Gedanken, man könnte sie vielleicht hören. Sie zog die Spülung. Der Anfall war noch nicht vorüber. Jemand kam herein und ging in die Nachbarkabine. Viertel nach sechs. Langsam fing er wahrscheinlich an, auf die Uhr zu sehen. Auf dieses Abendessen hatte sie seit drei Tagen gewartet – seit neun Monaten. Sie ging zum ersten Mal aus, seit sie in Old Newport wohnte.
Das war es, was sie hier am meisten überrascht hatte: das fehlende gesellschaftliche Leben. Mittags aß man eine Kleinigkeit mit den Kollegen, aber man dinierte nicht miteinander, aus Zeitmangel oder um in einer konkurrenzorientierten Umgebung wie Devayne die Privatsphäre zu wahren. Im November hatte Jane ihre Kollegin Carrie eingeladen, die neu war und allein, weil ihr Mann noch in Kalifornien studierte. Carrie hatte begeistert angenommen, und Jane fing schon an, das Leben wieder in rosigeren Farben zu sehen, da sagte Carrie in der allerletzten Minute mit wortreichen Entschuldigungen und ohne einen neuen Termin vorzuschlagen ab und ließ Jane mit ihrem Kalb mit Karotten und ihrem Tiramisu, das für zehn gereicht hätte, in einem Tal der Hoffnungslosigkeit sitzen. Da verbrachte man doch besser seine Abende allein und arbeitete. Dann konnte wenigstens nichts Unvorhergesehenes passieren. Sie konnte nicht einmal ihre Freunde in Chicago anrufen, schließlich wäre es unverschämt gewesen, sich zu beklagen, wo sie immer noch keine Arbeit hatten. Selbst mit Allison war es schwierig, und Allison war immerhin ihre beste Freundin. Aber Allison und John fingen mit dreißig mit Jura an, nachdem sie in Geisteswissenschaften promoviert hatten, nur um sicherzugehen, dass sie eine Stelle finden würden und in derselben Stadt leben konnten. In Wahrheit waren sie alle deprimiert. Eine Generationsfrage? Und Flaubert war schuld? Janes Vater hatte recht: Literatur zu unterrichten hieß, in Schönheit zu sterben. Selbst Bronzino war im Grunde ein Dinosaurier. Dieser Gedanke entlockte ihr ein Lächeln, das sofort von einem heftigen Schmerz weggewischt wurde.
Die andere Frau wusch sich die Hände. Endlich ging sie. Jane hatte solche Schmerzen, dass sie meinte, ohnmächtig zu werden. Der Schweiß stand ihr auf Stirn und Oberlippe, und ihre Hände waren klitschnass. Sie überließ sich dem Schmerz und hielt sich wimmernd den Bauch. Danach fühlte sie sich besser. Sie tastete mit der Hand in dem metallenen Papierhalter. Leer.
Ihr stiegen die Tränen in die Augen. Sie kämpfte sie wieder hinunter wegen der Wimperntusche und durchwühlte ihre Taschen. Die elegante Hose kam direkt aus der Reinigung. Nichts. Nicht das kleinste Papiertaschentuch in der Handtasche, und dabei hatte sie sonst immer ein Paket davon mit. Nur diese blöde Whiskeyflasche, die sie auf dem Herweg gekauft hatte für den Fall, dass Bronzino nachher noch auf ein Glas mit zu ihr kommen würde.
Nachdem die Frau sich die Hände unter einem Heißluftapparat getrocknet hatte, schien die Situation aussichtslos. Jane machte ihre Tür einen Spaltbreit auf, warf einen Blick nach draußen und stieß einen Erleichterungsschrei aus, als sie über dem Waschbecken einen Metallkasten mit Papiertüchern sah. Der Geschäftsführer des Restaurants stieg wieder in ihrer Achtung.
Inzwischen waren ein paar Tische am Fenster besetzt. Sie war zwanzig Minuten weg gewesen. Bronzino hatte seine Vorspeise bereits bekommen. Er war diskret genug, nicht zu fragen, ob alles in Ordnung war.
»Es ist köstlich. Möchtest du probieren?«
»Nein, danke. Ich habe keinen Hunger.«
Sein Blick war ihr unangenehm.
»Wie alt bist du?«
»Achtundzwanzig. Demnächst neunundzwanzig.«
»So jung! Deine Studenten müssen allesamt in dich verliebt sein.«
Sie lachte übertrieben und beglückwünschte sich innerlich, dass sie den Hosenanzug ausgesucht hatte und nicht das figurbetonte schwarze Kleid. Bronzino sprach weiter:
»Ich bin überzeugt, dass es keine Pädagogik ohne Erotik gibt. So wie es in den USA zurzeit aussieht, darf man es ja nicht laut sagen, aber es scheint mir doch so, als würde man nur von Professoren etwas lernen, in die man verliebt ist.«
Sie dachte an den blonden Studenten, der sie drei Stunden pro Woche im Seminar mit großen Bambiaugen anstarrte: Er war tatsächlich ihr bester Schüler. Dann erinnerte sie sich an früher.
»Als ich fünfzehn war, war ich in meine Französisch-Lehrerin verliebt. Auf dem College habe ich Französisch belegt.«
»Ist etwas passiert?«
»Etwas passiert?«
»Mit deiner Lehrerin.«
»O nein. Sie war verheiratet, Mutter von zwei Kindern.«
»Keine Simone de Beauvoir.«
Er lächelte. Sie hatte ihn immer als so kalt und distanziert empfunden, dass sie dem Gerücht, demzufolge er vor einigen Jahren von einer Studentin der sexuellen Belästigung beschuldigt worden sein sollte, nie die geringste Bedeutung beigemessen hatte. Jetzt war sie sich nicht mehr so sicher.
»Und wie läuft es so mit den Kollegen?«, fragte er in ernsterem Ton, während er ein Stück klein geschnittenes Gemüse in Blätterteig zum Munde führte. Er schluckte elegant unauffällig und sprach niemals mit vollem Mund.
»Sehr gut. Sie sind alle sehr nett. Natürlich auch sehr beschäftigt. Ist ja ganz normal in Devayne.«
»Das ist leider wahr. Da will ich zum Beispiel schon seit Monaten mit dir Mittag essen, und nun haben wir schon April. Das Jahr läuft nur so davon – besonders das zweite Halbjahr.«
Der Kellner kam, um Bronzinos leeren Teller abzutragen, und brachte das Hauptgericht. Das war auch Zeit: Jane war schon fast schwindelig vor Hunger. Bronzino bestellte noch ein Glas Wein und machte sich an seine Scampi. Sie nahm einen großen Bissen Hühnchen und verzog das Gesicht. Die Sauce war viel zu scharf gewürzt. Sie konnte nur den Reis essen. Bronzino fragte:
»Hast du eine anständige Wohnung gefunden?«
»Ja. Ich hatte Glück. Gleich das erste Apartment, das ich mir im Juli angesehen habe. In einem alten Haus. Es ist sehr schön.«
Sie beschrieb voller Enthusiasmus einige architektonische Details und ihre Ahorndielen.
»Eine gute Wohngegend?«
»An der Linden Street, fünf Minuten vom Campus.«
»Um so besser. Du weißt, was letzten Donnerstag passiert ist?«
»Ja. Völlig verrückt.« Die Mutter eines Studenten war beim Durchqueren des Central Square, der Grünanlage im Zentrum von Old Newport, plötzlich mitten in eine Schießerei geraten und hatte einen Schuss in den Oberschenkel abbekommen, und das nachmittags um vier.
»Ich hoffe, du bist vorsichtig, Jane.«
»Ich habe sechs Jahre lang mitten in Chicago gelebt, und mir ist nie etwas passiert. Nicht einmal mein Portemonnaie haben sie mir geklaut. Ich habe noch nie eine Waffe gesehen, außer im Film.«
»Vielleicht, aber ich mache keine Witze. Letztes Jahr ist auf dem Campus ein Student ermordet worden. Es wäre besser, wenn du abends nicht alleine ausgingest. Hast du ein Auto?«
»Nein. Ich fahre nicht gern. Das ist schade, vor allem, weil ich das Meer so liebe, und um dorthin zu kommen, braucht man ein Auto.«
Er hob den Kopf.
»Ja. Und die Küste ist wirklich schön. Eine halbe Stunde entfernt gibt es auch einen sehr schönen Nationalpark. Dahin müsste man dich mal mitnehmen.«
War das eine Aufforderung? Sie nahm ihr Wasserglas. Im selben Moment kam Bronzinos Hand zu seinem Weinglas vor und streifte die ihre. Er hatte eine glatte, vollkommen haarlose Haut von fast obszöner Blässe, lange Finger und einen schmalen Ehering am Ringfinger. Er bestellte das dritte Glas. Eine Flasche wäre günstiger gewesen.
»Willst du immer noch nichts trinken?«
»Nein, danke.«
Sie spürte, wie es unter Bronzinos Blick in ihren Wangen und den Lippen pochte, und senkte die Augen.
»Sag mir eins: Warum Flaubert?«
Erleichtert nahm sie den Kopf wieder hoch.
»Wegen meines Vaters.«
»Deines Vaters? Ist er Literaturwissenschaftler?«
»Nein, Zahnarzt. Er hat nie verstanden, was man mit Literatur wollen kann. Er war fuchsteufelswild, als ich mich für Literaturwissenschaften eingetragen habe. Er wollte, dass ich Jura studiere.«
» Ja, und?
»Ich habe ihn immer enttäuscht. Er hatte sich einen Jungen gewünscht, mit dem er sonntags Baseball spielen konnte. Er hat sogar versucht, es mir beizubringen. Ich habe nicht einen Ball gefangen. Er brüllte mich an, weil ich die Augen zumachte, sobald der Ball auf mich zukam. Und je mehr er brüllte, desto mehr schloss ich die Augen.«
Bronzino, der zweifellos so manchen Sonntag beim Baseball-Spielen mit seinen Kindern verbracht hatte, nickte lächelnd. Während ihres Aufenthalts in Paris im dritten Jahr an der Uni, fuhr Jane fort, war ihr klar geworden, dass sie die grünen Vororte, wo sie aufgewachsen war und sich zu Tode gelangweilt hatte, hasste. Deshalb Flaubert, wegen seines ironischen Blicks auf die langweilige, scheinheilige und bürgermuffige Provinz. Monsieur Homais, das war ihr Vater. Norman lachte.
»Es ist nicht leicht, Vater zu sein: Kinder sind gnadenlos. Woran arbeitest du genau?«
»Am ›energischen Stil‹ von Flaubert, seiner männlichen Auffassung – sie malte Gänsefüßchen in die Luft – vom Stil als Unterdrücker des Schwachen, Sentimentalen, in gewisser Weise des Femininen.«
»Interessant. Ich persönlich mag Madame Bovary nicht besonders. Man merkt doch jedem einzelnen Satz an, wie Flaubert sich im Zaum hält, findest du nicht? Vielleicht ist das Problem gerade, dass er sich vor der Frau in sich fürchtet.«
Jane, die Madame Bovary abgöttisch liebte, suchte noch nach einer schlauen Antwort, als Norman einen Blick auf die Uhr warf.
»Darüber diskutieren wir beim nächsten Mal. Ich muss los.«
»Natürlich! Ich bin fertig.«
Die zwei Stunden waren vergangen wie fünf Minuten. Sie hatte keine Bauchschmerzen mehr. Er gab ihr ein gutes Gefühl. Sie hatte gar nicht auf die Themen zurückgreifen müssen, die sie sich in petto gehalten hatte, und war nicht einmal dazu gekommen, ihm zu sagen, wie sehr sie sein Buch Sehnsucht und Spannung bewunderte.
Bronzino drehte sich zum Gastraum hin um und machte dem Kellner ein Zeichen, die Rechnung zu bringen. Der Raum hatte sich gefüllt, ohne dass sie etwas davon bemerkt hatte. »Nur für fünf Minuten«, würde er sagen, wenn er den Wagen vor ihrem Haus parkte. Sie hätte einen besseren Whiskey nehmen sollen, Chivas oder einen Glenlivet. Achtung: Er war verheiratet und ihr in der Hierarchie voraus. Zum Glück hatte sie sich noch nie von älteren Männern angezogen gefühlt.
Er beobachtete etwas auf der anderen Seite des Raumes. Jane wandte den Kopf und sah eine junge Frau mit langem Haar in venezianischem Blond und einem herrlichen Profil. Norman kommentierte mit Kennerstimme:
»Hübsches Stück.«
Sie nickte ein wenig schockiert.
»Mindestens hundert Jahre alt«, sprach er weiter.
Jane sah noch einmal auf die andere Seite des Raumes. An der Wand direkt hinter der Frau hing ein Teppich in dunklen Rottönen. Er gab dem Raum diese intime Wärme, die Jane so gefallen hatte, als sie allein hier gegessen hatte. Sie fragte erregt:
»Magst du Teppiche?«
»Sehr.«
»Im September habe ich mir einen kaukasischen Kelim aus dem neunzehnten Jahrhundert in wunderbar harmonischen, warmen Tönen gekauft, alles Naturfarben. Ich hatte keinen Cent, es war völlig verrückt, aber ich konnte einfach nicht widerstehen. Ich brauche ihn nur anzusehen, um mich zu entspannen.«
»Das überrascht mich nicht. Du weißt ja, dass Freuds Behandlungszimmer voller Perserteppiche war.«
Der dickliche Kellner legte die schwarzlederne Mappe mit der Rechnung darin vor ihn hin. Norman schlug sie auf und nahm den Zettel, noch bevor Jane nach ihrer Tasche greifen konnte.
»Ich habe einen kanadischen Kollegen«, sprach er weiter, während er in der Innentasche seiner Jacke nach seiner Brille suchte, »der ein solcher Teppichnarr ist, dass er auf Teppichen schläft, isst und arbeitet. Er ist natürlich unverheiratet.«
»Warum?«
»Sobald sich eine Frau bei ihm einnistet, will sie spätestens nach einer Woche einen Tisch oder ein Bett einführen.«
Jane lachte. Er setzte seine Brille auf und murmelte Zahlen vor sich hin.
»Einundvierzig Dollar und zehn Cent, dazu gebe ich fünfzehn Prozent Trinkgeld, das wären sechs Dollar fünfzig, sagen wir sieben …«
Jane war es peinlich, wie er das laut vor sich hin rechnete. Sollte sie protestieren und darauf bestehen, ihren bescheidenen Anteil selber zu zahlen? War es diskreter, zu schweigen? Das hier war ein Arbeitsessen, und die Rechnung würde bestimmt auf seiner Spesenabrechnung auftauchen. Sie zögerte noch, als Bronzino sie ansah und sagte:
»Achtundvierzig. Das ist einfach: vierundzwanzig für jeden.«
Jane lief rot an. Sie beugte sich vor und nahm ihre Handtasche hoch. Sie nahm ihre zwei Zwanziger heraus und hielt sie Bronzino hin, ohne ihn anzusehen.
»Gib mir zwanzig, das reicht auch. Geht es dir gut?«
»Ja, warum?«
Sie zwang sich zu einem Lächeln.
»Du bist ganz rot. Es war gut, aber ein wenig schwer. Die frische Luft wird uns guttun.«
Der Kellner stellte zwei kleine Teller vor sie hin. Bronzino zog die Augenbrauen hoch.
»Wir haben kein Dessert bestellt.«
»Eine Aufmerksamkeit des Küchenchefs. Zum Probieren. Sehr gut.«
Jane betrachtete die kleine, milchige Kugel, die in Honig schwamm.
»Sehr freundlich«, sagte Bronzino, »aber ich habe auch keinen Hunger mehr.«
Sie zog ihren Regenmantel an, während er das Wechselgeld zählte. Draußen hielt er ihr die Hand hin.
»Es war nett. Das machen wir mal wieder. Soll ich dich irgendwo absetzen? Ich sag’s aber gleich, mein Auto steht weit weg.«
»Nein, schon in Ordnung. Ich gehe in die Bibliothek.«
Er drängte nicht weiter. Jane blieb reglos auf dem Gehweg stehen und sah ihm nach, wie er sich mit großen Schritten entfernte. Sie fröstelte. Die Luft hatte aufgefrischt. Viertel nach acht. Den ganzen Abend noch vor sich und ungefähr so viel Lust, nach Hause zu gehen und ihr Seminar vorzubereiten, wie ein Dutzend von diesen cremigen Kugeln in Honig zu schlucken. Zwischen den in ihren Ledersesseln in der Bibliothek vor sich hin dämmernden Studenten oder den bebrillten Vereinsamten, die sich ins Café Romulus flüchteten, um dem Alleinsein zu entkommen, würde sie nur noch einsamer sein. Langsam ging sie am Central Square entlang, auf der Campusseite, die besser beleuchtet war als die am Park.
»Haste mal ’n paar Cent?«
Die raue Stimme direkt an ihrem Ohr ließ sie einen Satz zur Seite machen. Unter der schwarzen Sweatshirt-Kapuze war das Gesicht des Penners im Dunkeln kaum zu sehen.
»Ich habe kein Kleingeld.«
Sie ging vom Gehweg hinunter und auf der Fahrbahn weiter.
»Trotzdem gute Nacht! Und immer gesund bleiben!«
Ein lautes Hupen zog ihr förmlich die Beine weg. Das Auto schlingerte weiter, und der Fahrer beschimpfte sie durchs offene Fenster. Mit ihrem grauen Regenmantel war sie so unsichtbar wie der Penner. Ihre Beine zitterten immer noch, als sie den Gehweg auf der anderen Seite erreichte. Zwischen den Bäumen des Parks zeichneten sich verdächtige Schatten ab. Sie fing an zu laufen. Ein großer Tropfen landete auf ihrer Nase. Dann noch einer und noch einer und bald ganz viele. Sie hatte ihren Schirm in der Perle von Bombay vergessen. Zu spät, um noch mal umzudrehen. Ein neuer Schirm.
Jane war perplex. Selbst wenn ein Unbekannter an jenem Abend Fotos gemacht hätte, hätten sie bestimmt nicht denselben Effekt erzielt. Dieser Text war ein Schlag in die Magengrube. Noch neun Jahre später erinnerte sie sich daran, wie sie nach Hause gekommen war, tropfnass und noch viel deprimierter. Als wäre es gestern gewesen.
Was für ein hinreißendes Bild von ihr! Wimmernd und sich den Bauch haltend auf einer Klobrille, beseligt nickend zu jedem Wort, das Bronzino von sich gab, unablässig mit den Preisen beschäftigt! Der Autor dieses Manuskripts schrieb ihr offenbar einen ungelösten Ödipuskomplex zu und eine Sexualität, die in der Analphase stecken geblieben war.
Natürlich Bronzino. Niemand konnte besser wissen als er, was sich an jenem Abend zugetragen hatte. Er brauchte nicht hexen zu können, um sich vorzustellen, was Jane passiert war, als sie zu Beginn des Abendessens beinahe eine halbe Stunde verschwunden war. Und auch nicht, um zu erraten, warum sie so rot geworden war, als er sie die Hälfte von seinen Scampi Tandoori bezahlen ließ. Diese Knickerigkeit war typisch für Bronzino – und für die meisten Universitätsmenschen.
Deshalb hatte er sie also gestern in sein Büro bestellt. Er wollte wissen, ob sie sein Manuskript bekommen hatte. Er war ihr seltsam vorgekommen, bewegter und warmherziger, als er sich ihr gegenüber in acht Jahren gezeigt hatte. Der Grund war gar nicht die schreckliche Neuigkeit, die er ihr mitgeteilt hatte, sondern das Paket, das zu Hause auf sie wartete.
Sie stand auf und wählte die Nummer seines Büros. Ein Anrufbeantworter. Die Sekretärin war wahrscheinlich zur Mittagspause gegangen. Auf jeden Fall war es wohl besser, zur Universität zu fahren, um Bronzino persönlich gegenüberzutreten: Sein Gesicht würde verraten, was seine Stimme am Telefon verbergen könnte.
Sie sah aus dem Fenster. Der Himmel war noch schwärzer und der Regen dichter geworden. Sie würde ein wenig später gehen.
2Das Schwimmen hatte sie hungrig gemacht. Sie hatte sich etwas schön Gesundes zum Abendessen gekocht. In ihrem gemütlichen Hausmantel aus Samt saß sie auf ihrem beigeweiß gestreiften, nach anderthalb Jahren Benutzung immer noch sauberen Sofa und las mal wieder Rot und Schwarz, das immer noch so gut war wie in ihrer Erinnerung. Das Telefon klingelte. Sie warf einen Blick auf den vergoldeten Wecker auf dem Kaminsims: Mitternacht. Josh wartete immer, bis es in Chicago elf war, um den billigsten Tarif auszunutzen. Sie stützte den Ellbogen auf die Sofalehne und hob ab.
»Hallo?«
»Ich bin’s.«
Sie hatte gewusst, dass er irgendwann anrufen würde.
»Kann ich jetzt mit dir sprechen?«
Seine Stimme klang ernst und dramatisch. Sie konnte sich schon denken, was er sagen würde. Sie kannte es bereits auswendig.
»Ja. Was ist?«
»Ich habe jemanden kennengelernt.« Er machte eine Pause. »Es war mir wichtig, es dir zu sagen. Ich möchte ehrlich mit dir sein.«
Es tat trotzdem weh. Aber sie war eher irritiert als verletzt.
»Wer ist es?«
»Eine meiner früheren Studentinnen. Du kennst sie nicht. Ich bin ihr bei einer Vernissage vor drei Wochen über den Weg gelaufen, gleich nach unserem ersten Telefongespräch.«
»Das läuft schon seit drei Wochen?«
»Ja. Wir haben noch an dem Abend, an dem wir uns begegnet sind, miteinander geschlafen.«
Jane konnte es sich unschwer vorstellen: ein dickes Mädchen mit Krisselhaaren in einem billigen Sackkleid made in India, mit billigem Silbergebamsel, Wollstrümpfen und Birkenstock-Sandalen. Josh fuhr mit kummervoller Stimme fort:
»Ich habe nicht gedacht, dass es länger dauern würde. Ich habe nur mit ihr geschlafen, weil ich die negative Energie nach unserem Gespräch loswerden musste. Ich habe nicht einen Augenblick lang daran gedacht, dass es etwas Ernstes werden könnte. Aber jetzt bin ich dabei, mich mit ihr innerlich zu verbinden.«
Er glaubte in seiner nervtötenden Naivität tatsächlich, dass es irgendjemanden interessierte, was in seiner Seele oder sonstwo in seinem Inneren vor sich ging.
»Ja, und? Was willst du jetzt machen?«
»Ich weiß nicht. Ich nehme an, das hängt von dir ab.«
»Von mir?«
»Ich liebe dich, das weißt du genau. Wenn es zwischen uns läuft, lasse ich Stephanie fallen.«
Der Name ließ plötzlich ein ganz anderes Bild in ihr aufsteigen: ein blondes Mädchen mit Zöpfen, klein und zierlich, das bei jedem Wort von Josh vor sich hin gluckste. War es möglich, dass er diese Geschichte nur erfunden hatte, um Jane dazu zu bringen, zu ihm zu fahren? Dafür war seine melodramatische Stimme zu echt. Sie sagte kühl:
»Ehrlich gesagt gefällt mir dieses ›wenn‹ nicht besonders. Das riecht nach Erpressung. Hör zu, es ist schon halb eins, ich bin fix und fertig, und morgen muss ich unterrichten. Ich wollte gerade ins Bett gehen, als du angerufen hast. Wir sprechen noch mal darüber, wenn wir ausgeruhter sind.«
Sie war sehr ruhig, nachdem sie aufgelegt hatte. Da war Josh also eine kleine Studentin in die Arme gefallen: Nichts, was einem Kopfschmerzen bereiten musste.
Josh hatte sie nur ein einziges Mal überrascht: Als er vor fast einem Jahr in Old Newport angekommen war. Als sie ihn nach dem Essen mit Bronzino abends noch angerufen hatte, war es ihr nur mit großer Mühe gelungen, ihn zu einem Besuch zu überreden. Sie hatte seit neun Monaten nicht mehr mit ihm gesprochen und war ziemlich brutal mit ihm umgegangen, als sie Chicago verlassen hatte. Aber Josh hatte nachgegeben, ganz wie erwartet. Sie hatte mit ihm gebrochen, für ihn ließen sich daraus Rechte ableiten. Also hatte er zwei Wochen später an ihrer Tür geklingelt, und dann war die große Überraschung gekommen. Er war nicht größer als vorher, er hatte immer noch dieselbe unbändige Mähne, er trug immer noch dieselbe unförmige, schwarze Jacke und dasselbe alte T-Shirt mit dem Aufdruck vom Hard Rock Café. Aber sie hatte vergessen, was ein vertrautes Gesicht bedeutet. Drei Stunden später, nach dem Abendesssen, war sie noch überraschter.
»Was ist mit dir los, Jane?«
»Wie meinst du das?«
»Du redest von nichts anderem als Devayne, Bronzino, von deiner Habilschrift und deinen Veröffentlichungen. Ist das alles in deinem Leben?«
Eigentlich wollte sie ihm antworten, dass sie bestimmt ein ausgefüllteres Leben hatte als ein verkrachter Student, aber stattdessen war sie in Tränen ausgebrochen.
Er hatte auf dem Sofa im Wohnzimmer übernachtet. Am Morgen wollte er an den Strand. Der gute Josh, so naiv: In Old Newport selbst grenzte nur ein Industriegebiet ans Meer. Die Strände waren kilometerweit entfernt, ohne Auto nicht zu erreichen. Zwei Stunden später waren sie am Strand, im Woodmont Park. Eine halbe Stunde Busfahrt von Old Newports Innenstadt und fünfundsiebzig Cent pro Ticket. Der graue Sand sah aus wie Staub, und es gab keine Wellen wegen des Golfs von Long Island. Aber es war immerhin das Meer: eine endlose blaue Weite, die in der Sonne glitzerte.
Nun war Josh mit reden an der Reihe. Er hatte sich bei Jane für ihre harten Worte vor ihrer Abfahrt aus Chicago im letzten Juli bedankt. Er hatte das gebraucht, dass ihm mal jemand die Meinung sagt. Drei Monate lang hatte er wie ein Irrer gearbeitet, morgens als Forschungsassistent, nachmittags als Korrektor für Klausuren und abends als Pizzaausträger. Er hatte seine Doktorarbeit nicht angerührt und sich nicht nach einer Stelle umgesehen. Im November war er nach Osteuropa gefahren. In Berlin, wo er genau in der Nacht des Mauerfalls gelandet war, tanzten und sangen Hunderttausende von Menschen in den Straßen und auf der Mauer. Jane, die schon immer Wert auf Genauigkeit gelegt hatte, lächelte über seine kleinen Übertreibungen, aber sie war beeindruckt und ließ sich von seinem Enthusiasmus mitreißen. »Das ist Geschichte, Jane. Groß geschrieben.« Etwas, das er eines Tages seinen Enkelkindern erzählen würde.
Auf jeden Fall vergnüglicher als ihr Leben in Devayne. Sie stellte sich die Orte mit den ganzen exotischen Namen vor. Er erzählte voller Empörung von Rumänien, an Europas Grenze zum Orient, das mehr als vierzig Jahre lang von einem verrückten Tyrannen regiert worden war. Um einen Palast zu seinem Ruhm und eine Prachtstraße zu bauen, die auf diesen Palast zuführte, hatte der größenwahnsinnige Despot mitten im Herzen der Hauptstadt Bukarest drei Stadtteile mit orthodoxen Kirchen, die wahre Kleinodien gewesen waren, und Häusern aus dem siebzehnten und achtzehnten Jahrhundert dem Erdboden gleich machen lassen. Man brauchte eine Stunde, um den gigantischen Palast zu Fuß zu umrunden. Innen war alles aus Gold und Marmor. Elena Ceaucescu, die Frau des Tyrannen, war von einer derartigen Ignoranz, dass sie selbst die Stuckarbeiten aus Marmor haben wollte. »Wieso? Woraus sind sie denn sonst?« Josh war in Gelächter ausgebrochen: »Machst du Witze? Aus Stuck natürlich!« Die Menschen in Bukarest verabscheuten den Palast. Josh hatte ihn gar nicht mal so hässlich gefunden – aber das konnte man nicht sagen, ohne die Rumänen zu beleidigen.
»Dieser Typ, Ceaucescu, das ist König Ubu. Nur dass es eben keine Literatur ist. Tausende von Menschen haben ihr Leben verloren. Die Revolutionäre haben ihn und seine Frau im Dezember festgenommen und nach einem Eilverfahren alle beide an die Wand gestellt.«
Sie liefen barfuß über den Sand und tauchten ab und zu die Zehen ins eisige Wasser. Er erzählte ihr von einer Rumänin, Dora.
»Warst du in sie verliebt?«
»Nein, aber sexuell war es überwältigend. Die Frauen im Osten kennen da ein paar Kunststücke!«
»Zum Beispiel?«
Er lachte.
»Ich lag auf dem Rücken, sie setzte sich rittlings auf mich, direkt über meine Eichel, und dann ließ sie sie in Höchstgeschwindigkeit rein und raus gleiten. Zum Dahinschmelzen vor Wonne.«
Jane errötete. Sie hatte auch Lust auf eine lange Reise, ein Abenteuer auf dem Balkan, während dort die Revolution tobte. Der kalte Sand zwischen den Zehen und unter den Fußsohlen fühlte sich angenehm an. Erst mal musste ihre Dissertation fertig sein.
»Du wärst begeistert von Prag, die Stadt ist voll von Barockpalästen und gepflasterten Gässchen. Weißt du, was ›danke‹ auf Tschechisch heißt? Franzosen hören das wahrscheinlich nicht so gern. Eigentlich heißt es ›dekuju‹, aber ausgesprochen wird es wie ›tes couilles‹, »und dann denken sie natürlich, man will irgendwas Abfälliges über ihre Eier sagen.«
Als die Sonne unterging, hatten sie sich geküsst. Sie hatten den Sonntag in Manhattan verbracht, waren zusammen mit Tausenden New Yorkern, die den ersten Frühlingssonntag genießen wollten, im Central Park spazieren gegangen, hatten sich eine Ausstellung im Museum of Modern Art angesehen und waren dann die Fifth Avenue hinunter bis Greenwich Village gegangen, wo Jane Josh zum Essen bei einem Chinesen auf der Sixth Avenue eingeladen hatte. Auf der Rückfahrt im Zug waren sie vor Müdigkeit eingeschlafen. Als sie am Montag erwachte, war Josh schon fort. Sie war bester Laune: ihr schönstes Wochenende seit einem Jahr, und sie war nicht mehr allein.
Im Juni war Josh mit seinen Büchern und dem Computer nach Old Newport zurückgekommen. Sie hatten den Sommer damit verbracht, an ihren Dissertationen zu arbeiten. Wenn es sehr heiß war, fuhren sie mit dem Bus an den Strand.
Sie brauchte keinen Sex nach einem langen, erfüllten Tag. Sie war wie Proust der Meinung, dass ein Glas frischer Orangensaft – oder eine Stunde Schwimmen im Meer – bei Hitze sehr viel erstrebenswerter war als ein schweißgebadeter fremder Körper. Aber sie konnte nicht jedes Mal nein sagen. Sie bat ihn, ihren Bauch und die Hüften nicht zu berühren und auch nicht an ihren Brüsten zu saugen oder zu lutschen. Nach Joshs Interpretation war diese Überempfindlichkeit ein Zeichen für eine Sinnlichkeit, die sich eines Tages entfalten würde, vielleicht mit fünfunddreißig, wenn Frauen auf ihrem sexuellen Höhepunkt waren. »Mit fünfunddreißig, ja? »
Mitte Juli hatte er mit einem Roman angefangen. Daran dachte er schon seit Langem. Jetzt hatte er endlich den Einstieg gefunden.
»Worum geht es?«
»Eine Liebesgeschichte.
»Zwischen einem Studenten, der an seiner Doktorarbeit sitzt, und einer Dozentin von Devayne?«
»Weißt du, es geht immer alles auf die Realität zurück. Ein anderer Schauplatz, eine transponierte Handlung, das ist alles. Natürlich bin ich durch unsere Geschichte inspiriert, aber das ist nicht das Eigentliche, nicht das Fleisch. Um einen Roman zu schreiben, braucht man erst einmal ein Knochengerüst, eine Idee als Grundstruktur der Geschichte. Ich hab eine.«
»Und die wäre?«
»Hybris.«
»Häh? »
»So haben die Griechen übertriebenes Selbstvertrauen oder Stolz genannt, die am Ende immer von den Rachegöttinnen bestraft werden, den furchtbaren Erynnien.«
»Danke, ich weiß schon. Und?«
»Man kann niemals auf den Gipfel des Glücks gelangen, ohne irgendwann auf die Nase zu fallen. Garantiert. Das ist fast schon ein mathematisches Gesetz. Ich nenne es das Gesetz der Bescheidenheit. Ist dir das nie aufgefallen? Jedesmal, wenn man zu enthusiastisch ist und glaubt, man hätte alles begriffen, kommt garantiert ein Misserfolg hinterher. Der Held in meinem Roman ist ein Enthusiast, der erst mal Schritt für Schritt Bescheidenheit lernen muss.«
Wenn man dieses Gesetz auf seinen Roman anwandte, war seine eigene Begeisterung schon mal eine Garantie für den Misserfolg. Jane sagte nichts. Er verschob mal wieder den Abgabetermin seiner Doktorarbeit und entzog sich seinen Pflichten: Er hätte besser daran getan, seine Dissertation über das Göttliche zu beenden und sich irgendwo eine Stelle zu suchen. Das war nicht Janes Problem. Er ging ihr auf die Nerven. Er nahm unweigerlich die falsche Schale für sein Müsli und das Brotmesser zum Pampelmusenschneiden. Es lenkte sie ab, wenn er durch ihr Zimmer ging, nur um sich in der Küche ein Glas Wasser zu holen, wenn sie gerade arbeitete. Er pfiff beim Duschen vor sich hin, und er hatte sogar Janes Handtuch benutzt! Aber am schlimmsten war, als er sich vorgenommen hatte, sie zu psychoanalysieren.
»Dein Problem ist, dass du deinen Körper nicht magst. Du weigerst dich, eine Frau zu sein, deshalb hattest du auch noch nie einen Orgasmus. Du kannst dich nicht fallen lassen.«
»So ein Blödsinn. Nur nicht während der Penetration, das ist alles.«
»Aber da ist es doch am besten! Du weißt nicht, was du versäumst. Meiner Meinung nach liegt das ganz bestimmt an deinem Vater.«
»Soso.«
»Du hast mir selber gesagt, dass er sich einen Sohn gewünscht hatte. Auf jeden Fall sollte jeder zum Psychiater gehen, der so einen Vater hat wie deinen. Jeder.«
»Ich mache dich darauf aufmerksam, dass dieser eine Vater wie meiner dich in ein gutes Restaurant eingeladen hat, und du hast ihn bezahlen lassen. Ich finde dich nicht eben berufen, ihn zu beleidigen.«
Gegen Ende des Sommers juckte es sie an jeder Stelle, wo er sie berührte. Sie wollte ihn auch nicht auf den Mund küssen. Das einzig Erträgliche waren seine Finger auf ihrer Klitoris. Sie schloss die Augen und vergaß Josh. Die wenigen Male, bei denen es ihr gelang, sich genügend zu entspannen und zum Orgasmus zu kommen, erlaubte sie ihm, in ihr zu ejakulieren. Danach. Er war so aufgeregt, dass er keine Minute dazu brauchte. Das war zu ertragen.
In der Nacht vor Joshs Abreise weinte sie. Sie hatte ihn versprechen lassen, dass er sie nie verlassen würde. Sie hatten ein ernstes Gespräch über ihre Beziehung geführt. Es war Liebe, sonst wären sie schließlich nicht sechs Jahre nach ihrer ersten Begegnung und nachdem sie sich schon einmal getrennt hatten, immer noch zusammen. Diese simple Logik beruhigte sie. Josh hatte recht: Sie kritisierte an ihm herum, weil sie sich selbst nicht akzeptieren konnte – wegen ihres Vaters. Josh hatte Jane gesagt, dass sie der Lust zu viel Bedeutung beimaß. Es gab Tage, da hatte man welche, und an anderen nicht, das war nicht das Wichtigste in einer Liebesbeziehung. Die Einschränkungen, mit denen sie ihre sexuelle Verbindung belegte, frustrierten ihn zwar, aber er konnte damit leben. Es gab keine andere Frau, mit der er lieber geschlafen hätte, nicht einmal Dora, die Rumänin. Das Wichtigste war, dass Jane ihm so viel mentalen Freiraum ließ: Mit ihr konnte er seinen Roman schreiben, also konnte er sein Leben mit ihr verbringen. Er wünschte sich nur eins: dass sie sich nicht immer so verkrampfte.
»So bin ich nun mal. Ich kann nichts dafür.«
»Ich weiß. Das ist kein Vorwurf.«
Das war vor fast sieben Monaten gewesen. Seitdem hatten sie sich nur ein Mal gesehen, zu Weihnachten in Chicago. Die Universität hatte Jane, die in ihrer Eigenschaft als Mitglied der Einstellungskommission mit fünfundzwanzig Kandidaten für den Lehrbereich Gegenwartsliteratur sprechen musste, Ticket und Hotel bezahlt. Sie hatte fünf Tage lang eingeschlossen in einem Zimmer im Marriott verbracht. Josh hatte endlos viel Zeit. Er war nur zu einem einzigen Vorstellungsgespräch für eine Stelle in einem kleinen College in Kansas gebeten worden, und er war sich auch schon sicher, dass er sie nicht bekommen würde. Das war jetzt das dritte Mal, dass er sein Glück herausforderte. Dabei hatte sich sein Lebenslauf inzwischen mit seinen Reisen nach Osteuropa gefüllt, die ihn als viel interessanter hervorstechen ließen als diese ganzen Doktoranden, die nie aus ihren Kämmerlein herausgekommen waren. Jane wusste, wo das Problem war: So ging es mit einer Mappe, die schon zu viel herumgereicht worden war. Schon nach kurzer Zeit wusste jeder, dass es sich da um jemanden handelte, den keine Universität einstellen wollte. So war das mit der Begierde: Er wurde nur immer noch weniger begehrenswert. Josh war wütend: Jane hätte ihm schließlich ein Vorstellungsgespräch für Devayne verschaffen können. Sie hatte ihm geantwortet, er solle erst mal seine Doktorarbeit zu Ende schreiben. In der heutigen Zeit war das entscheidend. Nach fünf Tagen angespannter Stimmung, immer kurz vor der Explosion, hatte Josh schließlich zugegeben, dass er eine Blockade hatte. Er ging inzwischen ein Mal die Woche zum Psychiater. Jane hatte eingelenkt. Wie lief es mit seinem Roman? Er hatte ihn zur Seite gelegt. Am letzten Tag waren sie bei erstaunlich schönem Wetter am See spazieren gegangen. Überall schmolz das Eis, und das Wasser hatte eine lichte, blaugrüne Farbe. In der darauf folgenden Nacht hatten sie miteinander geschlafen und sich vorgenommen, sich in den Osterferien wieder zu sehen. Josh würde nach Old Newport kommen.
Ende Februar, drei Wochen davor, hatte er sie angerufen. Man hatte ihm eine Schwangerschaftsvertretung in einem Verlag angeboten. Konnte Jane ihn wohl während der Märzferien in Chicago besuchen?
So war es nicht geplant gewesen. Sie hatte keine Lust auf Joshs Wohnung und seine Mitbewohner. Sie schob Arbeit vor.
»Gib dir einen Schubs. Sei nicht so egoistisch.«
»Ich, egoistisch? Wer ist denn letztes Mal nach Chicago gekommen? Ich kann nicht in einer Tour Flugtickets kaufen. So reich bin ich nicht.«
»Weihnachten hat doch dein Fachbereich bezahlt! Und du bekommst ein Gehalt, ich nicht. Ich bin letztes Jahr zweimal gekommen.«
»Ja, aber mit Reisegutscheinen von American Express: neunundneunzig Dollar hin und zurück. Ich bin aber keine Studentin mehr. Ich muss über dreihundert Dollar bezahlen.«
»Du bist ja so geizig!
»Geizig! Darf ich mal fragen, wer in Chicago die Restaurants bezahlt hat? Du hast den ganzen Sommer bei mir verbracht. Habe ich dich auch nur ein einziges Mal gebeten, dich an den Einkäufen oder irgendwelchen anderen Kosten zu beteiligen?«
»Du weißt doch genau, dass ich pleite bin! Darum brauche ich ja auch diesen Job in dem Verlag!«
»In Ordnung. Dann behaupte aber nicht, ich sei geizig.«
Ihr letztes Gespräch vor dem von heute Abend. Und das von heute war nicht eben erfreulicher. Ein Erpressungsversuch mit einer Zwanzigjährigen. Das Problem war nicht dieses Mädchen. Und auch nicht, wer was bezahlt hatte.
Das Berufsleben veränderte. Das war sogar der ethymologische Sinn des Wortes ›erwachsen‹: jemand, der sich verändert hatte. Die Angst, die Jane jede Woche vor ihrem Doktorandenkolloquium erfasste, und dieser immer wiederkehrende Traum, in dem sie sich vor ihren Studenten wiederfand und nichts zu sagen hatte – Josh hätte das alles als infantil abgetan. Wirklich infantil war aber nur seine Idealvorstellung von absoluter Freiheit. Und zwar von vorne bis hinten in Großbuchstaben geschrieben.
Drei Tage später hatte Josh immer noch nicht wieder angerufen. Hatte sie ihn verärgert, als sie ihm gesagt hatte, sie würde jetzt schlafen gehen, als wäre ihr Joshs Untreue ganz egal? Wenn sie den ersten Schritt tat, würde er daraus schließen, dass sie von ihm abhängig war, und das wollte er ja wohl beweisen, indem er sie eifersüchtig machte. Josh war so didaktisch. In dieser Nacht schlief Jane schlecht. Als sie am nächsten Tag nach ihrem Kurs auf eine schnelle Pizza zu Bruno’s ging, sprach sie eine koreanische Studentin aus ihrem Doktorandenkolloquium an:
»Professor Cook! Wollen Sie sich zu uns setzen?«
Miran stellte ihr ihre Begleiterin vor, eine junge Frau mit einem sehr schönen Gesicht, die ebenso blond war wie die Asiatin brünett und ganz in Schwarz gekleidet, während Miran einen grellgelben Pullover trug. Man hätte sie für Dominos halten können. Kathryn Johns, angehende Doktorandin im Fachbereich, erzählte Jane bei der ersten Gelegenheit, wie unendlich sie es bedauere, nicht an ihrem Seminar über Flaubert teilnehmen zu können; sie hatte zur selben Zeit ein Seminar in Afrikanistik. Jane war nicht wohl bei ihrem höflichen Getue und dem kalten Lächeln.
»Ich bin sicher, dass Sie Flaubert längst gelesen haben.«
Die koreanische Studentin wandte sich Jane zu:
»Ich habe gerade zu Kathryn gesagt, dass ich mich noch nie so deprimiert gefühlt habe, wie seit ich hierhergekommen bin, um meine Doktorarbeit zu schreiben. An manchen Abenden bin ich stundenlang wie von Furcht gelähmt.«
»Mir geht es genauso!«, sprudelte Jane los. »Am schlimmsten ist es abends, wenn es dunkel wird. Morgens geht es normalerweise sehr viel besser. Vielleicht liegt es an Devayne? Und wie ist es bei Ihnen?«, fügte sie hinzu und wandte sich der Blonden zu, die den Kopf schüttelte.
»Das passiert mir nie. Seit ich verheiratet bin, war ich kein einziges Mal deprimiert.«
»Sie sind verheiratet! »
Jetzt erst sah Jane den schmalen Goldring am Finger der jungen Frau, die gepflegte Hände hatte mit perfekt oval geformten, weißen Fingernägeln.
»Und dabei lebt ihr Mann in Los Angeles«, sagte Miran. »Nicht gerade um die Ecke.«
»Und was macht er dort? »
»Er ist Filmregisseur«, antwortete Kathryn.
»Regisseur!«
In der Nacht konnte Jane nicht einschlafen. Wenn sie die Augen zumachte, sah sie Kathryn Johns mit ihrem langen Hals, ihren gleichmäßigen Gesichtszügen, ihrem straff zurückgebundenen, blassgoldenen Haar und dem herablassenden Lächeln. Schließlich stand sie auf. Im Wohnzimmer machte sie das Licht an und wählte Joshs Nummer. Zwei Uhr fünfzehn nachts. In Chicago war es erst Viertel nach eins, und Joshs Mitbewohner gingen nie vor eins ins Bett. Jemand nahm ab. Ein verschlafenes Grunzen am anderen Ende.
»Ich bin’s«, sagte Jane.
Josh murmelte:
»Was ist los?
»Ich wollte mit dir reden.«
»Nicht jetzt. Ich ruf dich morgen an.«
Er hatte leise gesprochen und aufgelegt, ohne ihre Antwort abzuwarten. Jane blieb lange auf ihrem Sofa sitzen, bevor ihr bewusst wurde, dass sie fror. Sie erhob sich und ging zum Fenster. Auf den Stufen vor dem Haus gegenüber, auf der anderen Straßenseite, saß ein Mann. Ein Chinese, noch jung, der aus einer in braunes Papier gewickelten Flasche trank und nur ein Hemd trug, obwohl es draußen ziemlich kalt war. Ein neuer Nachbar? Sie hatte ihn noch nie hier im Viertel gesehen. Er hatte ihr den Kopf zugewandt, und sie hatte das Gefühl, als lächelte er ihr zu. Bestimmt war ihr Fenster das einzig erleuchtete im ganzen Haustrakt, und er konnte sie durch die weißen Stores hindurch problemlos sehen. Sie trat zurück, machte das Licht aus und ging wieder ins Bett.
Es war schon halb fünf, als sie schließlich in Schlaf versank, und nicht einmal sieben, als sie die Augen wieder aufschlug. Um zehn Uhr dreißig wählte sie Joshs Nummer: keine Antwort. Sie wählte die Nummer des Verlags und dann seine Durchwahl. Josh nahm ab. Er schien nicht besonders erfreut, als er merkte, wer dran war. Vielleicht war er heute am Samstag extra ins Büro gegangen, um ihrem Anruf auszuweichen.
»Entschuldige, dass ich dich nicht zurückgerufen habe, aber ich habe furchtbar viel Arbeit.« In zögerlicherem Ton fügte er dann hinzu: »Jane, du kannst nicht mitten in der Nacht bei mir anrufen.«
»War Stephanie bei dir?«
»Ja. Ich habe ihr gesagt, es hätte sich jemand verwählt, aber sie ist nicht blöde. Wir haben die ganze Nacht diskutiert. Sie will, dass ich mich entscheide, und zwar ein für alle Mal. Sonst macht sie Schluss. Ich kann sie verstehen. Sie liebt mich, und sie hat Angst.«
Jane hätte am liebsten geheult. Stephanie war ihr ungefähr so wichtig wie eine alte Socke. Josh seufzte.
»Ich muss ihr heute Abend antworten.«
»Ich verstehe. Du musst also mit mir Schluss machen, und du hattest nicht mal so viel Mut, mich anzurufen, um es mir zu sagen.«
»Da ist jemand ins Büro gekommen. Ich rufe dich heute Abend wieder an.«
Er konnte sie doch nicht nach sechs Jahren wegen eines Mädchens verlassen, mit dem er gerade mal drei Wochen verbracht hatte. Dieses Kind hielt ihn wahrscheinlich mit ihren Tränen fest. Josh war gutmütig und schwach. Ein Mann mit geringem Selbstwertgefühl konnte sich leicht an eine Heulsuse binden. Am Abend würde Jane versprechen, nach Chicago zu kommen, sobald kein Unterricht mehr stattfand. Das wäre in weniger als einem Monat. Sie könnte ihn auch zu der geplanten Kreuzfahrt durch Frankreich im August einladen; sie durfte ja ihren Freund mitnehmen.
Sie saß mit einem Buch auf dem Schoß, von dem sie keine Zeile gelesen hatte, auf ihrem Sofa und kaute an den Fingernägeln, als sie um neun Uhr das lang erwartete Klingeln hochschrecken ließ.
»Ich bin’s. Tut mir leid wegen heute Morgen.«
Joshs Stimme klang entsetzlich traurig.
»Kein Problem. Soll ich dich zurückrufen?«
Sie meinte es gut, aber nun hörte es sich an, als wollte sie ihn darauf stoßen, dass sie Geld verdiente und er nicht. »Nein, schon gut.«
Sie fragte in gezwungen lockerem Ton:
»Und? Hast du gründlich nachgedacht?«
»Ich liebe dich.«
Sie hatte einen Kloß im Hals.
»Ich habe den ganzen Tag über uns nachgedacht. Ich entscheide mich für Stephanie.«
»Warum?«
Sie hatte fast geschrien.
»Weil du dich nicht entscheiden kannst, und ich nicht glaube, dass du es irgendwann tun wirst. Du weißt nicht, was du willst.«
»Aber ja doch, ich weiß genau, was ich will! Ich will mit dir zusammen sein. Ich habe heute auch nachgedacht, Josh.« Sie brachte die Worte »Ich liebe dich« einfach nicht heraus. Sie hätten falsch geklungen. »Du kannst mich nicht verlassen, du hast es mir versprochen. Wir lieben uns, das hast du selber gesagt. Du hast mir gesagt, es gäbe keine andere Frau, mit der du lieber ins Bett gehen würdest als mit mir, und dass du mit mir deinen Roman schreiben kannst.«
Josh antwortete nicht.
»Ich komme dieses Wochenende.«
»Nein, Jane. Versteh doch: Es ist vorbei.«
»Aber ich liebe dich doch!«
Sie hatte ihn nie so sehr geliebt wie in diesem Augenblick.
Als sie aufgelegt hatte, weinte sie, und weil sie in der Nacht zuvor so wenig geschlafen hatte, dämmerte sie schließlich vor Müdigkeit ein. Sie lief in den Straßen der Chicagoer Innenstadt hinter Bronzino her, ohne auch nur an den Ampeln haltzumachen, und wurde von zornigen Fahrern angehupt, als sie erwachte: das Telefon. Sie rannte ins Wohnzimmer.
»Habe ich dich geweckt?«
Josh. In ihrem halbwachen Zustand hatte sie mit Bronzinos Stimme gerechnet. Es brachte sie gegen Josh auf.
»Anzunehmen. Ich habe geträumt. Wie spät ist es?«
»Vier Uhr. Entschuldige. Ich kann nicht schlafen. Ich muss immerzu an dich denken. Ich liebe dich. Ich ertrage den Gedanken nicht, dass du unglücklich bist. Ich habe mir eine Lösung ausgedacht: Und wenn ich mich nun zwischen dir und Stephanie aufteilen würde, bis du glücklich bist? Oder willst du, dass ich mit ihr Schluss mache? Ich tu’s, wenn du es willst.«
Er wäre nie auf den Gedanken gekommen, dass sie eben von Bronzino geträumt hatte, und das, nachdem er gerade mit ihr Schluss gemacht hatte.
»Nein, Josh. Bleib du nur bei deiner Entscheidung von heute Nachmittag. Es ist richtig so. Du hattest recht, als du mir gesagt hast, du könntest nicht auf mich zählen, weil ich mich immer nicht entscheiden kann. Mach dir keine Sorgen um mich. Ich bin stärker, als du denkst.«
»Bist du sicher?«
Jetzt weinte er.
»Ja. Du solltest jetzt schlafen gehen.«
»Ich rufe dich morgen an, um zu hören, wie es dir geht.«
»Nein, Josh. Es ist vorbei. Ruf mich nicht mehr an.«
Sie legte auf und sah dann durch das Fenster hinter sich, weil sie sich beobachtet fühlte. Der Chinese saß wieder auf seiner Stufe und trank. Er zog eine Grimasse in ihre Richtung. Sie sah nach, ob alle Fenster gut verschlossen waren, und machte das Licht aus.
Im Bett ging sie in Gedanken noch mal das ganze Gespräch mit Josh durch. Es war also vorbei. Diesmal endgültig. Ein klarer Schnitt. Es tat nicht wirklich weh. Sie fühlte nichts außer einer unbestimmten Furcht, später aufzuwachen wie nach einer Narkose und festzustellen, dass man sie während des Schlafs verstümmelt hatte.
Jane lächelte. Nein, nicht Bronzino. Dies hier war eine kleinliche Rache, die Joshs Unterschrift trug. Sie hätte gleich an ihn denken sollen. Josh hatte literarische Ambitionen, er hatte Freud gelesen, und er war davon überzeugt, dass sie ihren Ödipuskomplex nicht überwunden hatte. Das erste Kapitel hatte er problemlos schreiben können, weil sie ihm von ihrem Abendessen mit Bronzino in allen Einzelheiten berichtet hatte.
Armer Josh, wenn das nun der Roman sein sollte, an dem er schon seit Jahren schrieb!
Er konnte nicht viel an Lebenserfahrung hinzugewonnen haben, wenn er eine Jugendbeziehung derart genau im Gedächtnis bewahrte, an die Jane sich so gut wie gar nicht mehr erinnerte. Wer sollte sich wohl seiner Meinung nach für die banale Liebesgeschichte zwischen einer Professorin und einem ewigen Doktoranden interessieren? Wenn er wenigstens noch ein bisschen Humor zeigte! Aber dafür nahm er sich viel zu ernst. Vielleicht spekulierte er auf einen Sensationserfolg wegen Bronzino. Aber wer war schon Bronzino in der großen weiten Welt?
Sie nahm den braunen Umschlag vom Tisch. Die Schrift sah nicht aus wie die von Josh, die Jane als breit und schnörkelig in Erinnerung hatte. Er musste jemand anders gebeten haben, die Adresse zu schreiben.
Das Paket war in New York aufgegeben worden. Sie erhob sich und ging mit zwei Schritten zum Tisch mit dem Telefon, links neben dem Herd. Dann tippte sie die Nummer der Auskunft für Manhattan ein.
»Joshua Levine«, sagte Jane.
Es folgte eine Minute Stille, während die Angestellte am anderen Ende auf ihrer Computertastatur herumklapperte.
»Ich habe fünf Joshua Levines und sechs J. Levines. Wissen Sie die Adresse?«
»Nein.«
»Soll ich Ihnen alle Nummern geben?«
»Nein. Vielen Dank.«
Jane blieb reglos neben dem aufgelegten Telefon stehen. Sie war nicht einmal sicher, dass Josh überhaupt in New York lebte. Und wenn ja, dann vielleicht in Brooklyn oder in Queens, das war billiger als Manhattan. Oder er wohnte zur Untermiete oder mit anderen zusammen, und in dem Fall wäre sein Name gar nicht registriert. Sie musste einen schnelleren Weg finden, seine Nummer zu bekommen. Über Allison? Josh und sie waren während ihrer Studienzeit in Chicago gut befreundet gewesen. Vielleicht hatten sie immer noch Kontakt.
Zehn vor zwei hier: zehn vor elf in Seattle. Sie nahm den weißen Hörer wieder ab und suchte in ihrem Adressbuch nach Allisons Büronummer. Über den Anrufbeantworter ertönte Allisons geschäftsmäßige Stimme: »Ich spreche gerade oder ich bin nicht da. Hinterlassen Sie bitte eine Nachricht nach dem Piepton, und ich rufe so bald wie möglich zurück.«
»Hallo, hier ist Jane. Kannst du mich zurückrufen? Ich bin zu Hause. Danke.«
Bevor sie sich wieder hinsetzte, um weiterzulesen, warf sie einen Blick durch das Fenster neben dem Herd: immer noch der gleiche dichte Regen.
3Die Sonne schien so hell, als sie aus Macy’s herauskam, dass sie die Augen zusammenkneifen musste. An einem solchen Tag wäre sie besser im Woodmont Park Schwimmen gegangen. Zum Glück machte Macy’s Ende der Woche zu, vielleicht sogar schon morgen. Es gab nichts mehr zu kaufen. Seit die immer weiter sinkenden Räumungsverkaufspreise achtzig Prozent der vorher auch schon heruntergesetzten Preise erreicht hatten, ähnelte das Kaufhaus eher einer Militärkaserne im Kriegszustand. Die dritte, zweite und erste Etage waren eine nach der anderen geschlossen worden, und man hatte die Reste auf kaum der Hälfte der Gesamtfläche im Erdgeschoss zusammengetragen und mit einer kreischgelben Banderole abgegrenzt, wie sie die Polizei am Tatort verwendet.
Sie blieb an der Ampel stehen, bevor sie die Main Street überquerte und Bronzino von der anderen Seite auf der Government Street herankommen sah. Er ging schnell, den Blick zu Boden gerichtet, in Gedanken versunken. Er trug ein weißes Hemd mit hochgekrempelten Ärmeln und eine blaue Fliege, das zusammengelegte Jackett hing über seinem linken Unterarm. Jane lächelte. Sie hatte gewusst, dass sie irgendwann über ihn stolpern würde. Genau im richtigen Moment, wenn Macy’s zumachte und sich der ganze Sommer vor ihnen ausstreckte.