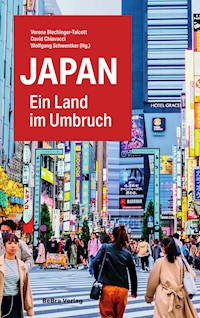
Japan E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BeBra Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Japan galt lange als Erfolgsmodell, das sich durch technischen Fortschritt, wirtschaftlichen Aufschwung und gesellschaftliche Stabilität auszeichnete. In den letzten dreißig Jahren hat dieses Bild allerdings tiefe Risse bekommen. Das vorliegende Buch beschreibt den gegenwärtigen Zustand Japans, das mit den Herausforderungen einer überalterten Gesellschaft, geopolitischen Konflikten und den Folgen der Atomkatastrophe von Fukushima zu kämpfen hat, das aber zugleich in vielen Bereichen immer noch weltweit Maßstäbe setzt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 412
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Verena Blechinger-TalcottDavid ChiavacciWolfgang Schwentker(Hg.)
JAPAN
Ein Land im Umbruch
BeBra Verlag
Bei der Nennung von Eigennamen folgen wir dem in Ostasien verbreiteten Brauch: Der Familienname geht dem persönlichen Namen voran. Bei Ortsnamen und Begriffen, die auch im Deutschen geläufig sind, wird auf die Längenzeichen über Vokalen verzichtet.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Alle Rechte vorbehalten.
Dieses Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen, Verfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung auf DVDs, CDROMs, CDs, Videos, in weiteren elektronischen Systemen sowie für Internet-Plattformen.
E-Book im be.bra verlag, 2022
© der Originalausgabe:
be.bra verlag GmbH
Berlin-Brandenburg, 2022
Asternplatz 3, 12203 Berlin
Lektorat: Gabriele Dietz, Berlin
Umschlaggestaltung: typegerecht berlin
(Foto: mauritius images / Axiom Photographic / Rick Senley)
ISBN 978-3-8393-0163-0 (epub)
ISBN 978-3-89809-208-1 (print)
www.bebraverlag.de
Inhalt
Japan – Ein Land im WandelVerena Blechinger-Talcott, David Chiavacci, Wolfgang Schwentker
I. Der nostalgische Blick
Zeitreise in die MultibürgergesellschaftExpedition in ein alterndes LandFlorian Coulmas
Die verschwundene StadtTokyo-Nostalgie in autobiografischen StadtbeschreibungenEvelyn Schulz
Japanische NachkriegszeitenAuseinandersetzungen um ein NarrativWolfgang Schwentker
Demokratie in der Krise? Japans politisches System nach dem Ende der NachkriegszeitVerena Blechinger-Talcott
Deutschland und JapanPartner mit unterschiedlichen InteressenFriederike Bosse
II. Aushandlungen
Die Fassade bröckeltJapans Weg zum EinwanderungslandRuth Achenbach
Japan nach dem Kapitalismus? Betrachtungen zu einer japanischen DebatteCarsten Herrmann-Pillath
Japan als Gesellschaft der KluftSoziale Teilhabe ohne Wachstum?David Chiavacci
Stagnierender WandelFamiliengesetze und GeschlechterordnungKaren A. Shire
Zwischen Tradition und ModerneAufwachsen in Japan in Zeiten von Krisen und GefährdungenGisela Trommsdorff
Armer Staat, reiches LandJapans StaatsverschuldungFranz Waldenberger
Neue Seidenstraße oder »Silk Subway« Die Herausforderung internationaler InfrastrukturinitiativenWerner Pascha
III. Erneuerungen
Das Ende der Harmonie? Gesellschaftlicher Wandel und die Reform des JustizsystemsMoritz Bälz
Diversität und PolitikGender, Sexualität und EthnizitätKibe Takashi
Machtverhältnisse im digitalen ZeitalterDie Mediennutzung japanischer FrauenHayashi Kaori
Alltag und ErinnerungDer Nordosten Japans nach der Dreifachkatastrophe von 2011Julia Gerster
Covid-Olympia 2020/2021Japans Wunsch nach NeuerfindungBarbara Holthus
Anhang
Die Autorinnen und Autoren
Dank
Bildnachweis
Japan – Ein Land im Wandel
Verena Blechinger-Talcott, David Chiavacci, Wolfgang Schwentker
Umbrüche im modernen Japan
Die moderne Entwicklung Japans zeichnet sich durch vier große Umbrüche aus. In seiner frühen Moderne war Japan während 250 Jahren ein nach außen abgeschirmtes Land unter der Führung des Tokugawa-Shōgunats. Mitte des 19. Jahrhunderts wurde es jedoch durch US-Commodore Matthew Perry und seine »Schwarzen Schiffe« zur Aufgabe dieser Selbstisolation und zur Unterzeichnung von ungleichen Verträgen gezwungen. Im Zuge dieses ersten Umbruchs formierte sich bald Widerstand gegen die Verträge, die als erster Schritt in Richtung Kolonialisierung Japans betrachtet wurden, und gegen das Shōgunat, das sie unterzeichnet hatte. Einer Koalition gelang es, die Tokugawa zu stürzen und 1868 die Meiji-Revolution einzuleiten. Die neuen Machthaber errichteten in wenigen Jahren einen zentralisierten Nationalstaat mit dem Tenno als legitimierende Institution im Zentrum und begannen eine rasante Industrialisierungs- und Modernisierungspolitik nach westlichem Vorbild. Zwar demokratisierte sich Japan zunehmend ab dem frühen 20. Jahrhundert nach innen, gleichzeitig etablierte es sich jedoch in Ostasien als imperiale Großmacht neben den westlichen Kolonialmächten.
Um 1930 erfolgte der zweite Umbruch. Aufgrund ökonomischer Probleme und sozialer Spannungen mischte sich das Militär zunehmend in die Politik ein und es wurde ein autoritäres Regime mit einer ultranationalistischen Ideologie errichtet. Japan trat aus dem Völkerbund aus, begann eine Bündnispolitik mit Nazi-Deutschland und dem faschistischen Italien und führte eine Reihe von brutalen Angriffskriegen gegen die westlichen Mächte mit dem Ziel, eine »Großostasiatische Wohlstandssphäre« unter japanischer Herrschaft zu errichten. Diese aggressive Expansionspolitik und militärischen Großmachtträume endeten jedoch 1945 in einer verheerenden Niederlage gegen die Alliierten unter US-amerikanischer Führung, nachdem es am 6. und 9. August 1945 zum Abwurf zweier Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki gekommen war.
Den dritten Umbruch stellten die umfassenden Reformen während der US-Besatzungszeit bis 1952 dar, die eine Neuordnung und Neuerfindung des modernen Japans auslösten. Wie ein Phoenix aus der Asche vollzog das kriegszerstörte Japan wieder einen rasanten ökonomischen Aufstieg und zeichnete sich in den Folgejahrzehnten durch wirtschaftliche Prosperität, politische und soziale Stabilität sowie einen ausgeprägten Zukunftsoptimismus aus, der mit einem hohen Maß an technologischer Innovation einherging. Dies endete jedoch abrupt mit dem Platzen der Spekulationsblasen (1990/91), dem Kobe-Erdbeben (Januar 1995) und dem Giftgasanschlag der Aum-Sekte auf die U-Bahn von Tokyo (März 1995).
Die 1990er Jahre läuteten die vierte Umbruchsphase Japans ein und werden heute als »verlorenes Jahrzehnt« bezeichnet; manche Ökonomen sprechen mit Blick auf die Stagnation der 2000er Jahre sogar von zwei »verlorenen Jahrzehnten«. In der Tat kam es zu einem merklichen Einbruch des wirtschaftlichen Wachstums und in der Folge zur Entstehung prekärer Arbeits- und Lebensverhältnisse. Das Bild einer harmonischen Mittelstandsgesellschaft hatte tiefe Risse bekommen. Demographisch hat das vormals junge Japan einen einmalig rasanten Alterungsprozess durchlaufen und ist die heute älteste Gesellschaft der Welt. Eine nationalistische Geschichtspolitik und ungelöste Territorialkonflikte führen Japan bis heute immer wieder in Auseinandersetzungen mit Korea und China. China hat Japan darüber hinaus wirtschaftlich und militärisch überholt, und zum Schrecken Japans ist der südkoreanische Durchschnittslohn heute höher als derjenige Japans. Verschärfend hinzu kommen Probleme, die sich aus der Atomkatastrophe von Fukushima im Jahre 2011 ergeben haben und das Land noch über Jahre hinweg beschäftigen werden.
Diese Tendenzen markieren zwar die Bruchlinien zur Wachstumsphase vor 1990, aber es wäre indes zu einseitig, wollte man die Entwicklungen der letzten 30 Jahre und die gegenwärtige Lage Japans nur unter dem Aspekt des Niedergangs beschreiben. Wirtschaftlich hat sich das Land in Sektoren der Hochtechnologie eine Monopolstellung gesichert und mit den sogenannten »Abenomics« fiskal- und geldpolitisches Neuland betreten – mit Nachahmungseffekten in Europa und in den USA. Trotz der demographischen Transformation funktionieren die Sozialversicherungssysteme weiterhin und sind an die neuen Altersstrukturen angepasst worden. Politisch verfügt das Land nach wie vor über eine stabile demokratische Ordnung, obgleich konservative Kräfte eine Revision der Verfassung anstreben, um den veränderten internationalen Herausforderungen, insbesondere mit Blick auf Nordkorea und die Herausforderung durch China, begegnen zu können. Im Bereich der »Softpower« – unter anderem im Design, in der Architektur, in der Esskultur oder im Animationsfilm – hat sich Japan auf den globalen Märkten fest etabliert.
Die Themen des Buches
Das Ziel des vorliegenden Bandes ist es, mit einer Reihe von Essays von führenden Spezialisten zu den wichtigen Themen dieser vierten, gegenwärtigen Umbruchsphase des modernen Japan einer interessierten Leserschaft vertiefte Analysen und Einsichten in das Land der aufgehenden Sonne zu eröffnen. Inhaltlich ist das Buch in drei Teile untergliedert. Der erste trägt die Überschrift »Der nostalgische Blick«. Dieser richtet sich nicht auf die japanische Moderne als ein Gegenmodell zum vormodernen oder traditionellen Japan, sondern fasst die Moderne, insbesondere die der Nachkriegszeit, selbst als ein Stück lebendiger Tradition. Nirgendwo kommt dieses ambivalente Verhältnis zwischen Tradition und Erinnerung auf der einen Seite und dem fortwährenden Willen zur Erneuerung besser zum Ausdruck als in Tokyo, dem politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Zentrum Japans. Die japanische Hauptstadt ist mehr noch als die anderen urbanen Zentren ein Laboratorium der Moderne, das sich niemals ganz von den Vorgaben der Vergangenheit löst. Die Bewohner der Stadt begegnen dem gelegentlich mit einem emotiven Affekt, der im Zuge eines beschleunigten Wandels den Verlust einer tradierten Lebenswelt sogleich beklagt als auch diesen im Blick auf das Neue kompensiert. In der Literatur kommen diese Ambivalenzen deutlicher zum Ausdruck als in der Politik; hier richtet sich der »nostalgische Blick« eher auf eine Zeit, in der die Vorherrschaft der konservativen Liberal-Demokratischen Partei noch ungebrochen, die politische Opposition zwar nur einen eingeschränkten Handlungsspielraum hatte, aber noch funktionstüchtig war und die Friedens- und Verfassungspolitik noch nicht hinterfragt wurde. Eine feste Konstante auch über den Umbruch von 1989/90 hinweg sind die in der Regel guten und freundschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und Japan, auch wenn auf japanischer Seite gelegentlich beklagt wird, wie stark sich die Bundesrepublik Deutschland in der Ära Merkel in ihrer Asienpolitik aufgrund wirtschaftlicher Interessen auf die Volksrepublik China ausgerichtet hat.
Florian Coulmas, Senior Professor für japanische Gesellschaft und Soziolinguistik an der Universität Duisburg-Essen, nimmt seine Leser mit auf eine Zeitreise in die Vergangenheit und in die Zukunft. Die Wendemarken seines Beitrags sind die Olympischen Spiele in Tokyo: die ausgefallenen 1940, die auf dem Gipfel des Wachstums ausgerichteten von 1964 und die im Zeichen der Pandemie stehenden von 2020/21. Diese Zeitmarken dienen Coulmas für eine kritische, dichotomische Beschreibung der sozialen Entwicklung in Japan. Zur Sprache kommen dabei die beschleunigte Urbanisierung und die Entvölkerung des ländlichen Raums, technologische Innovation in den urbanen Zentren und der Rückbau von Infrastruktur an der Peripherie, die Auflösung einer vermeintlich homogenen Mittelstandsgesellschaft und die Konfrontation mit sozialer Ungleichheit, ablesbar an Altersarmut und Versorgungsengpässen im Pflegebereich, die nicht, wie das im Westen verbreitete Klischee suggeriert, von Robotern kompensiert werden können. Japan befinde sich angesichts des Zwangs, mehr Immigration zuzulassen, auf dem Weg zu einer »Multibürger-Gesellschaft« (tamin shakai), ohne dass klar sei, wie diese in der Zukunft aussehen werde.
Die Literaturwissenschaftlerin Evelyn Schulz widmet sich in ihrem Aufsatz dem Genre der autobiografischen Stadtbeschreibungen und wählt dafür als Beispiel die Werke des Schriftstellers und Filmkritikers Kobayashi Nobuhiko (Jg. 1932). Die von persönlichen Beobachtungen und Erinnerungen geprägten Beschreibungen meist kleinräumiger Stadtviertel haben in Japan eine lange Tradition. In ihnen werden in einer Art von nostalgischem Rückblick Erfahrungen aus der Kindheit und Jugend wieder in Erinnerung gerufen. Gleichzeitig gehen damit Beschreibungen der zum Teil radikalen Veränderungen in Städtebau und Architektur einher. Tokyo ist als ein Laboratorium von urbaner Modernität dafür ein besonders eindrückliches Beispiel. Kobayashi nimmt seine Leser auf Spaziergänge durch verschiedene Stadtviertel mit, in denen das alte und neue Tokyo, wie Schulz betont, zu einem »mit allen Sinnen erfahrbaren Raum« wird. Die Reihe autobiografischer Beschreibungen seiner Stadt setzt bei Kobayashi in den 1960er Jahren ein und reicht bis in die Gegenwart. Thematisiert werden von Schulz im Rahmen ihrer Deutung der literarischen Spaziergänge die Ungleichzeitigkeiten, die der Fortschritt auch in Japan mit sich bringt: Die Dynamik des Wandels wird in der subjektiven Wahrnehmung des Schriftstellers kontrastiert mit den Schattenseiten eines beschleunigten Wachstums.
Der Historiker Wolfgang Schwentker zeichnet in seinem Beitrag die Kontroversen über die Fragen nach, wann die Nachkriegszeit in Japan zu einem Ende gekommen ist und wie sie, je nachdem wie man die erste Frage beantworten will, zu strukturieren ist. Einvernehmliche Antworten oder gar einen Konsens gibt es bei diesem Themenkomplex nicht. Das lassen schon die verschiedenen Bedeutungsvarianten des Begriffs »Nachkriegszeit« nicht zu. Die Diskussionen über das Ende und den Charakter der Nachkriegszeit beschränken sich keineswegs nur auf die Geschichtswissenschaft: Sie werden auch in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft geführt. Während man für die Wirtschaft schon Mitte der 1950er Jahre das Ende der Nachkriegszeit ausrief, tat man sich damit in der Politik schwerer. Einer »Schlussabrechnung« (Nakasone Yasuhiro) mit der Nachkriegszeit, mit der man in den 1980er Jahren geschichtspolitisch auch die Kriegszeit hinter sich lassen wollte, steht das Interesse der asiatischen Nachbarn, namentlich Chinas und Koreas, entgegen, Japans dauerhafte Verantwortung für den Krieg einzufordern. Das Thema bleibt Schwentker zufolge aktuell, auch wenn sich in den japanischen Kultur- und Sozialwissenschaften langsam eine Übereinkunft herauszuschälen beginnt, die Nachkriegszeit – nicht zuletzt dann, wenn man sie mit der Herausbildung einer saturierten Mittelstandsgesellschaft in Verbindung bringt – mit den Wendejahren 1989/90 (dem Tod Hirohitos und dem Zusammenbruch der bubble economy) enden zu lassen.
Die Politikwissenschaftlerin und Japanologin Verena Blechinger-Talcott fragt in ihrem Essay nach dem Zustand der Demokratie in Japan. Ausländische Beobachter nehmen die Tatsache, dass die Liberal-Demokratische Partei Japan seit 1955 bis auf kurze Ausnahmen nahezu ununterbrochen regiert, oft zum Anlass, danach zu fragen, wie offen und wettbewerbsorientiert die demokratischen Institutionen in Japan wirklich sind. Dagegen sehen japanische Stimmen angesichts jüngster Reformen, etwa im Bereich der Sicherheitspolitik, den Grundkonsens der japanischen Nachkriegsdemokratie, die pazifistische Ausrichtung des Staates, in Gefahr und befürchten eine Einschränkung der Meinungsfreiheit in einem zunehmend polarisierten politischen Klima. Blechinger-Talcott arbeitet die wichtigsten Charakteristika und zentralen Meilensteine für das politische System Japans heraus. Sie zeigt, dass Japan als eine lebendige Demokratie betrachtet werden kann, die unter den Bürgern großen Rückhalt genießt. Dennoch deutet sich in einigen Bereichen, etwa bei der Repräsentation von Frauen oder jüngeren Menschen, eine wachsende Kluft zwischen den Bürgern und den Politikern in Parlament und Regierung an.
Der persönliche Blick auf die jüngere Vergangenheit ist kennzeichnend für den Essay von Friederike Bosse über die Japanisch-Deutschen Beziehungen, die sie in verschiedenen Funktionen in Wirtschaft und Wissenschaft, namentlich als langjährige Leiterin des Japanisch-Deutschen Zentrums Berlin, begleitet und geprägt hat. Als im Jahre 2021 Deutschland und Japan den 160. Jahrestag der diplomatischen und wirtschaftlichen Beziehungen feiern wollten, was wegen der Corona-Pandemie nur sehr eingeschränkt möglich war, blickte Bosse auf ihre 40 Jahre währende Beschäftigung mit Japan zurück. Die Autorin betont, dass die Beziehungen seit den 1980er Jahren von einer Vielzahl von deutschen und japanischen Akteuren geprägt waren: Geschäftsleuten, Wissenschaftlern, Diplomaten und Touristen. Ihr Blick auf das jeweils andere Land war unterschiedlich, da von spezifischen Interessen bestimmt. Aus deutscher Sicht dominierte laut Bosse in den 1980er Jahren ein exotisches Bild von Japan als wirtschaftlicher Supermacht, welches nach der Wende und dem Ende des Ost-West-Konflikts sukzessive von einem veränderten Blick bestimmt wurde. Der Aufstieg Chinas führte insbesondere in der Geschäftswelt zu einer Verschiebung der Perspektiven, wenn es um Engagements in Asien ging. Auch auf dem Feld der Politik und Geschichte – etwa im Festhalten Japans an der Atomenergie oder in der Frage der Vergangenheitsbewältigung – gehen die Interessen Deutschlands und Japans auseinander. Gleichwohl bleiben sie, so beobachtet Bosse, von einem partnerschaftlichen Wertekonsens geprägt.
Thema der Beiträge im zweiten Teil des Buchs sind »Aushandlungen«: Nach dem Zusammenbruch der sogenannten bubble economy, dem Erdbeben von Kōbe und dem Giftgasanschlag von Mitgliedern der Aum-Sekte auf die U-Bahn von Tokyo sind die alten Selbstverständlichkeiten dahin. Der bis dahin vorherrschende Glaube an Fortschritt und Wachstum löste sich in den frühen 1990er Jahren auf. Dies war keine neue Entwicklung, sondern lediglich der spektakuläre Höhepunkt eines längeren Transformationsprozesses, der die japanische Gesellschaft bereits in den 1980er Jahren erfasst hatte. Vor dem Hintergrund eines demographischen Strukturwandels, der von niedrigen Geburtenraten und einer Überalterung der Gesellschaft gekennzeichnet ist, war es erforderlich, soziale Ordnungsvorstellungen und individuelle Chancen der Lebensführung neu auszuhandeln. Die neuen Herausforderungen für Kinder und Jugendliche, die überkommenen Geschlechterbeziehungen, soziale Ungleichheiten, wirtschaftliche Stagnation und der Aufstieg Chinas, das Japan vom zweiten Platz der größten Volkswirtschaften verdrängte – das alles waren Elemente eines umfassenden Umbruchs, auf den Staat, Wirtschaft und Gesellschaft zu reagieren hatten.
Ruth Achenbach analysiert in ihrem Essay die Diskrepanz zwischen der offiziellen Rhetorik, dass Japan kein Einwanderungsland sei, und realer Politik und Entwicklung, laut welcher Japan seit Jahrzehnten bereits ein reales Immigrationsland ist und aufgrund der alternden und schrumpfenden Bevölkerung zunehmend abhängig von ausländischen Arbeitskräften wird. Die Autorin zeigt auf, dass die Fassade von Japan als einem Nichtimmigrationsland in der Politik und im Selbstverständnis bröckelt. Sie argumentiert jedoch auch, dass diese zunehmend offene und aktive Anwerbungspolitik von ausländischen Arbeitskräften nicht oder zumindest noch nicht mit einer adäquaten Integrationspo-litik und Anerkennung der Bedeutung der ausländischen Einwohner einhergeht. Dies zeigt sich gerade auch in den restriktiven Maßnahmen gegenüber ausländischen Einwohnern während der Covid-19-Pandemie.
Die neue Wahrnehmung von sozialer Ungleichheit und Integration werden im Essay von David Chiavacci erörtert. Lange galt in Japan ein Selbstbild einer generellen Mittelschichtsgesellschaft mit einer ausgeprägten Egalität sowohl in den Lebenschancen durch ein vorbildlich meritokratisches Bildungssystem als auch in der Verteilung von Einkommen und Vermögen. Seit dem Jahrtausendwechsel aber hat sich ein ganz neues Narrativ von Japan als einer Gesellschaft der Kluft etabliert, in welchem ein Auseinanderdriften der Gesellschaft und das Anwachsen von Armut konstatiert werden. Die Analyse von David Chiavacci zeigt, dass diese Transformation in der Selbstwahrnehmung nicht durch ein Öffnen der sozialen Schere per se, sondern durch das abrupte Ende der Kaufkraftzunahme und Abschwächung der sozialen Aufwärtsmobilität bedingt ist.
Im Essay des Volkswirts Carsten Herrmann-Pillath geht es um eine Grundfrage der japanischen Wirtschaft, Politik und Gesellschaft: Wie soll die Zukunft der japanischen Wirtschaft gestaltet werden? Diese Frage ist in einer Zeit, in der neoliberale Politik, wie sie zum Beispiel auch die »Abenomics«, die Wirtschaftspolitik unter der Regierung von Premierminister Abe Shinzō, maßgeblich geprägt hat, zunehmend umstritten ist und weltweit über eine Neuausrichtung (oder das Ende) des Kapitalismus diskutiert wird, von hoher Bedeutung. Dies gilt insbesondere für Japan, wo wirtschaftlicher Erfolg und Wachstum auch als Kernziel der Politik verstanden werden. Herrmann-Pillath stellt in seinem Beitrag verschiedene japanische Denkansätze vor, wie eine nicht an Wachstum orientierte, eine ethischere Form des Kapitalismus oder gar eine nicht-kapitalistische Marktwirtschaft der Zukunft aussehen könnte. Er zeigt, dass die Diskussionen zu diesem Thema in Japan, gerade unter dem Einfluss des Systemkonflikts mit der Volksrepublik China, schon recht weit vorangeschritten sind und wichtige Impulse für andere westliche Staaten bieten können.
Karen A. Shire diskutiert in ihrem Essay die Gründe für den schleppenden Abbau von Genderungleichheit in Japan. Auch heute noch ist Japan berüchtigt dafür, in den internationalen Rankings bezüglich Genderegalität nur eine sehr tief angesiedelte Position, weit hinter westlichen Industrieländern, zu erreichen. Karen A. Shire zeigt anhand eines Einzelbeispiels auf, was die strukturelle Benachteiligung in Beruf und Karriere konkret für Frauen in Japan bedeutet, und beschreibt den konservativen Modernisierungsprozess in Japan (und anderen Ländern), durch den bestimmte Positionen für Frauen in der Familie festgeschrieben wurden. Die damit verbundenen Gendernormen wirken bis in die gegenwärtige japanische Gesellschaft nach, wodurch sich in Japan sozialer Wandel trotz aller politischen Reformen und Maßnahmen in diesem Bereich noch nicht wirklich realisieren ließ.
In ihrem Beitrag stellt Gisela Trommsdorff die Frage, was es bedeutet, heute in Japan aufzuwachsen. Wie viele westliche Gesellschaften zeichnet sich das Land gegenwärtig durch tiefgreifenden Wandel, Krisen und Katastrophen aus. Hierdurch ergeben sich für Kinder und Jugendliche besondere Herausforderungen, indem sie mit diesen Gefahren und Unsicherheiten umzugehen und zu leben lernen müssen. Laut der Analyse von Gisela Trommsdorff ist hierbei in Japan das Aufwachsen in sozialer Verbundenheit zentral, dessen wichtigste Bestandteile diskutiert werden. Damit legt die Autorin eine weitaus differenziertere und komplexere Analyse gegenüber den überholten Modellen von Japan als kollektivistische Gesellschaft vor.
Der Ökonom FranzWaldenberger widmet sich in seinem Essay der japanischen Staatsverschuldung. Seit vielen Jahren ist Japan das am höchsten verschuldete Land der OECD. 2021 betrug die japanische Staatsverschuldung 242 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Dennoch ist die Zinsbelastung, die aus diesen Schulden resultiert, vergleichsweise gering. Ebenso verwundert die hohe Staatsverschuldung vor dem Hintergrund, dass Japan, gemessen am Auslandsvermögen, das reichste OECD-Land ist. Waldenberger stellt eine differenzierte Analyse der Ursachen für die hohe Schuldenlast wie auch der zu erwartenden Folgen für die japanische Volkswirtschaft vor. Seine Ergebnisse zeigen, dass übliche Erklärungsansätze, etwa ein zu großer und kostenträchtiger öffentlicher Sektor, für Japan nicht zum Tragen kommen. Zentrale Aspekte sind hier vielmehr mehrfache Konjunkturpakete zur Behebung früherer Wirtschaftskrisen und die Folgen des demographischen Wandels. Eine akute Bedrohung für die japanische Volkswirtschaft kann Waldenberger in der hohen Staatsverschuldung nicht erkennen, da die japanischen Staatsschulden nahezu ausschließlich durch in Yen notierte Inlandsanleihen finanziert werden und ein hoher Druck der – wenigen – Gläubiger nicht zu erwarten ist.
Der Essay des Ökonomen Werner Pascha greift das Konkurrenzverhältnis zwischen Japan und der sich zur Weltmacht aufschwingenden Volksrepublik China auf. Konkret geht es in dem Beitrag um große Infrastrukturprojekte, die durch die chinesische Initiative zur Errichtung einer »Neuen Seidenstraße« in den letzten Jahren eine hohe öffentliche Sichtbarkeit erfahren haben. Pascha betrachtet im Kontrast zu den chinesischen Initiativen japanische Infrastrukturprojekte, die an die erfolgreiche, seit dem 19. Jahrhundert verfolgte Modernisierungsstrategie Japans anknüpfen und seit langem ein wichtiger Teil der japanischen Außenwirtschafts- und Entwicklungspolitik sind. Er zeichnet die Entwicklung japanischer Infrastrukturinitiativen seit den 1980er Jahren nach und macht deutlich, dass viele der von China vorangetriebenen Initiativen in Japan vorgedacht und entwickelt worden sind. Japans Aktivitäten, die seit 2013 zunehmend unter dem Einfluss der wachsenden Konkurrenz zu China stehen, zeichnen sich dadurch aus, in enger Abstimmung mit den Partnerländern zu arbeiten, anstatt durch Infrastrukturinitiativen einen eigenen regionalen oder globalen Führungsanspruch nach außen zu tragen. Ebenso sei ein besonderer Fokus auf die Qualität der Projekte gerichtet. Für Deutschland und auch die EU liegt es vor dem Hintergrund der wachsenden Rivalität mit China nahe, genauer auf Japan zu schauen und Kooperationen ins Auge zu fassen.
Wie Japan die neuen Herausforderungen angenommen hat und welche Aufgaben sich dem Land in Zukunft stellen werden, davon handeln die Beiträge im dritten Teil dieses Buches unter der Überschrift »Erneuerungen«. Einige Probleme scheinen besonders drängend. Dazu gehört zweifellos die Bewältigung der nuklearen Katastrophe von Fukushima, aber auch der Wiederaufbau der durch das Erdbeben und den Tsunami zerstörten Küstenregionen. Der Rückgang der Bevölkerungszahlen verlangt soziale Strukturreformen und eine neue Sicht auf die Immigration von Arbeitskräften. Bislang hat sich Japan gesträubt, einen Bewusstseinswandel einzuleiten, der die Akzeptanz für die Eingliederung ausländischer Arbeitnehmer erhöht. Ohne eine solchen werden sich die Aufgaben, die sich insbesondere im Pflegebereich und in der Industrie stellen, aber nicht bewältigen lassen. Problematisch geworden ist auch die Rolle der Medien in der japanischen Gesellschaft. Wie viele Länder weltweit erlebt auch Japan hier einen Strukturwandel als Folge technologischer Transformationsprozesse. Die Bedeutung der Printmedien hat abgenommen. Noch problematischer sind die Eingrenzungen der Pressefreiheit durch die Verabschiedung neuer Sicherheitsgesetze. All diesen Fragen wird sich Japan in den folgenden Jahren zuwenden müssen – mit einer skeptisch-kritischen Grundhaltung, nicht aber mit Pessimismus. Die Ausrichtung der Olympischen Sommerspiele in Tokyo 2021 trotz aller Widrigkeiten, die der Pandemie geschuldet waren, war auch ein positives, in die Zukunft weisendes Signal. Die zahlreichen Umbrüche in der Moderne haben immer wieder gezeigt, dass Japan besonders dann neue Energien freisetzen kann, wenn es vor großen Herausforderungen steht.
Im Essay von Moritz Bälz werden die große Justizreform der letzten Jahre und ihre Auswirkungen auf die Streitbeilegung diskutiert. Diese Reform ist von besonderer Bedeutung angesichts der ausgeprägten Tendenz in Japan, Streitigkeiten eher nicht vor Gericht auszutragen, sondern über andere, außergerichtliche Verfahren zu lösen. Diese Besonderheit wurde mit kulturellen, institutionellen und politischen Faktoren erklärt, wobei gerade das Bild von Japan als harmonische Gesellschaft auch im Westen als kulturelles Erklärungsmuster stark rezipiert wurde. Die Analyse von Moritz Bälz zeigt, dass im Zuge der Reform die Anzahl von Anwälten in Japan signifikant erhöht wurde und damit der Zugang zu Rechtsspezialisten für die Bevölkerung vereinfacht wurde. Dies hat zwar bisher nicht zu einer massiven Zunahme an Rechtsstreitigkeiten geführt, jedoch muss hierzu die mittelfristige Entwicklung abgewartet werden, um die gesellschaftlichen Folgen umfassend einschätzen zu können.
Der Politikwissenschaftler KibeTakashi fragt in seinem Beitrag danach, ob die japanische Gesellschaft wirklich so homogen ist, wie sie in der öffentlichen Diskussion immer wieder beschrieben wird. Er greift drei Themenfelder auf, in denen die öffentliche und politische Debatte sich in den letzten Jahren mit Diversität beschäftigt hat: Geschlecht, Sexualität und Ethnizität. In Fallstudien zur Frage der Führung getrennter Ehenamen, zur gleichgeschlechtlichen Ehe, zur Frage einer weiblichen Thronfolge im japanischen Kaiserhaus und zur Integration von Zuwanderern arbeitet Kibe heraus, dass sich die japanische Gesellschaft zum Beispiel in Umfragen sehr offen für Diversität zeigt und auch unterschiedliche Lebensstile zu tolerieren bereit ist. Dem steht jedoch eine von einer konservativen Ideologie geprägte Politik gegenüber, die sich in den letzten Jahren zunehmend von der Grundhaltung der Mehrheit der Gesellschaft entfernt hat. Gerade für politische Neueinsteiger zahlt es sich im Hinblick auf Karrierechancen dabei aus, deutlich konservative Positionen zu vertreten.
Die Medienwissenschaftlerin HayashiKaori wendet sich in ihrem Essay der Frage zu, in welchem Verhältnis die Auswahl und Nutzung von Medien von Frauen zu den Geschlechter- und Machtverhältnissen in der Familie stehen. Dabei stellt sie die Ergebnisse einer umfangreichen Interviewstudie mit Japanerinnen und Japanern aller Alters- und Berufsgruppen zum Umgang mit Medien im Haushalt vor. Sie zeigt auf, dass die Mediennutzung von Frauen, ganz egal, ob es sich um die Zeitung, das Fernseh- oder Radiogerät handelt, stark von Zugeständnissen innerhalb der Familie geprägt wird. Frauen stellen entweder ihre eigenen Bedürfnisse zugunsten der Kinder hintan oder werden durch ihre Männer in der Wahl und beim Zugang zu Medien eingeschränkt. Die neuen digitalen Medien scheinen auf den ersten Blick mehr Gestaltungsfreiheit und Selbstbestimmung für die Frauen zu bringen, aber der von den Machtverhältnissen innerhalb der Familie geprägte Rahmen setzt sich auch im Umgang mit digitalen Medien weiter fort.
Die Japanologin und Sozialanthropologin Julia Gerster hielt sich in Japan auf, als am 11. März 2011 das große Erdbeben, der Tsunami und die atomare Katastrophe in Fukushima über Nordostjapan hereinbrachen. Seitdem hat sie diese Erfahrung nicht mehr losgelassen. In ihren Forschungen geht sie unter anderem der Frage nach, wie die Katastrophe in Japan bewältigt und insbesondere in den betroffenen Regionen Nordostjapans erinnert wird. Als Folge der Dreifachkatastrophe verloren etwa 16 000 Menschen ihr Leben; über 2 000 Bewohner der Region werden bis heute vermisst. Die Wohngebiete und Straßen um das Atomkraftwerk Fukushima Dai’ichi bleiben noch für lange Zeit gesperrt. Mehr als zehn Jahre nach der Katastrophe stehen neben dem Wiederaufbau und dem Katastrophenschutz auch Fragen der Erinnerung in der Diskussion. An vielen Orten sind Mahnmale und Museen entstanden; die Erfahrungen der Betroffenen werden mithilfe von Fotografien, Videos oder Relikten heute an Besucher weitergegeben. Gerster führt ihre Leser unter anderem durch das im September 2020 in Futaba (Präfektur Fukushima) eröffnete Museum und zeigt, wie unterschiedlich und interessengeleitet die Erinnerungen an das Erlebte präsentiert werden. Denn an den Erinnerungsorten geht es nicht nur um das Gedenken an die Opfer, sondern auch um die Aufarbeitung von Fehlern und Lehren für die Zukunft.
Barbara Holthus thematisiert in ihrem Essay die Sommerolympiade in Tokyo 2020/21 und stellt dar, wie die Regierung die Spiele für eine Neuerfindung Japans zu instrumentalisieren versuchte. Wie die Olympischen Spiele 1964 in Tokyo, welche die Wiedereingliederung eines friedliebenden Japans nach seinen aggressiven Expansionskriegen in die internationale Gemeinschaft symbolisierten und Japan als Wirtschafts- und Hochtechnologiestandort zelebrierten, sollte das neuerliche Olympia in Tokyo das Bild eines diverseren und nachhaltigeren Japans entwerfen, das die Dreifachkatastrophe von 2011 überwunden hat. Nicht allein wegen der Covid-19-Pandemie und der damit verbundenen Verschiebung und späteren Durchführung ohne ausländische Gäste konnten diese hochgesteckten Ziele lauf der Analyse von Barbara Holthus jedoch nicht realisiert werden.
Die Vielzahl und Unterschiedlichkeit der in diesem Band versammelten Beiträge spiegelt eine differenzierte Wahrnehmung Japans – eines Landes, das sich allen Umbrüchen und Einschnitten zum Trotz immer wieder neu erfunden hat und erfindet.
I. DER NOSTALGISCHE BLICK
Zeitreise in die Multibürgergesellschaft
Expedition in ein alterndes Land
Florian Coulmas
Seit H. G. Wells »The Time Machine« wissen wir, wie Zeitmaschinen aussehen – sie haben einen Sitz auf einer Art Schlitten für einen Passagier, dahinter eine konkave Scheibe mit eingraviertem Kompass, einige Rollen und Hebel, um das Ganze in Bewegung zu setzen –, und seither wissen wir auch, dass man mit Zeitmaschinen eigentlich nur in die Zukunft reist, denn an der Vergangenheit, da sind sich die Experten einig, lässt sich aus logischen Gründen nichts mehr ändern, obwohl das unter Umständen ganz segensreich wäre.
Stellen wir uns zum Beispiel vor, die Tokyoter und Tokyoterinnen, die sich heute für den Erhalt des Artikels 9 der japanischen Verfassung von 1946 einsetzen, der Japan in aller Deutlichkeit zum Pazifismus verpflichtet, dass eben diese Tokyoter nur ein Menschenleben zurück in der Zeit reisten, um dafür zu sorgen, dass die japanische Regierung ihren Ehrgeiz, in der Welt etwas zu bedeuten, auf die Olympischen Spiele 1940 konzentrierte, statt China mit Krieg zu überziehen. Die Welt sähe heute ganz anders aus. Tatsächlich war es ja ein großer Fortschritt für Japans internationales Renommee, als Tokyo 1936 den Zuschlag für Olympia 1940 bekam. Zum ersten Mal sollten die Spiele in Asien stattfinden mit Japan als »Leitgans«, der die übrigen Länder der Region beim Flug in die Zukunft in V-Formation folgen würden. So sahen es manche Japan schon damals. Allein was früher geschah, lässt sich auch von Zeitreisenden nicht mehr ungeschehen machen. Die Olympiade von 1940 fiel aus, denn die japanische Führung blies sie 1938 ab. Sie hatte Besseres zu tun (für die, die das besser fanden). Einen Moment lang sah es so aus, als würden die Spiele nach Helsinki verlegt, aber angesichts der Verheerungen des Zweiten Weltkrieges fanden sie nicht statt.
Stellen wir uns stattdessen vor, ein zeitreisender Tokyoter hätte sich 1940 (oder 1938) in die Zukunft aufgemacht, um sich seine Heimatstadt unter der Fünf-Ringe-Fahne anzusehen, die da irgendwann einmal flattern würde. Oder stellen wir uns jemanden vor, der sich das vorstellte.
Abgesagt: Die Olympischen Spiele 1940
Tokyo im demographischen Wandel
Die Vergangenheit kann man nicht ändern, und sich die Zukunft auszumalen, ist äußerst schwierig, da wir in unserer Phantasie durch die Beschränktheit geprägt sind, in die wir hineinwachsen. Hätte sich der oder die Zeitreisende beziehungsweise Visionärin von 1940 zum Beispiel einen konbini – von englisch convenience store abgeleitete Bezeichnung für kleine Allzweckgeschäfte ohne Ladenschlusszeiten – vorstellen können? Oder hätte er oder sie sich vorstellen können, dass die Bevölkerung von Tokyo/Yokohama schon fünf Jahre später um drei Millionen geschrumpft sein würde, nur, weil die Regierung das internationale Standing Japans statt auf dem Sportplatz auf dem Schlachtfeld zu verbessern suchte?
1940
12.7 Millionen
1945
9.3 Millionen
1964
21.0 Millionen
2020
38.0 Millionen
Bevölkerungswachstum in der Metropolregion Tokyo
Und weiter, dass die Urbanisierung so rapide voranschreiten würde, dass sich die Bevölkerung im Großraum Tokyo bis zur Olympiade 1964 wieder verdoppelt und zu der von 2020 mehr als verdreifacht haben würde? Das lag durchaus jenseits der Vorstellungskraft selbst weitsichtiger Zeitreisender, ganz zu schweigen von gegenwartsfixierten Politikern, die es 1948 für geboten hielten, Abtreibung zu legalisieren, um des den Staat in vieler Hinsicht überfordernden Nachkriegsbabybooms Herr zu werden. Noch viel weniger hätten sie sich vorstellen können, dass es zum Zeitpunkt der 2020-Olympiade in ihrem Land Geisterstädte geben würde, dass sich die wenigen verbliebenen Bürgerinnen und Bürger abgelegener Dörfer nach Einbruch der Dunkelheit nicht mehr auf die Straße trauten, weil sie fürchten mussten, einem Bären zu begegnen, und dass die Natur hier und dort begann, sich zurückzuholen, was menschliche Besiedlung ihr einst genommen hatte.
Oder Schulen. In jedes Dorf gehört eine Schule, zumindest eine Grundschule. Das war immer so. Immer – zumindest die zwei Generationen, die die Erinnerung zurückreicht. Zu Beginn der 2010er Jahre sah sich das Erziehungsministerium jedoch gedrängt, das »Gemeinschaftsprojekt verlassene Schulen« auszurufen. »Verbindet euch mit der Zukunft!«, verkündet ein lächelnder Knirps auf der Homepage des Ministeriums, um der Kampagne ein freundliches Gesicht zu geben. Der Landbevölkerung ist dabei allerdings nicht recht zum Lachen zumute, und wie sie sich unter diesen Umständen mit der Zukunft verbinden soll, wird immer unklarer. Allein 2012 wurden im ganzen Land über 600 öffentliche Schulen geschlossen, was für die betroffenen Gemeinden nicht nur bedeutet, dass ihre Kinder einen längeren Schulweg haben, sondern auch, dass sie eine wichtige Plattform des gesellschaftlichen Lebens verlieren. Das Leben auf dem Dorf wird immer unattraktiver und die Überalterung der ländlichen Regionen schreitet voran. In den 1960er Jahren lebten 63 Prozent der japanischen Bevölkerung in Städten. Inzwischen sind es 92 Prozent, und die wenigen Menschen, die noch auf dem Land leben, sind uralt.
Schweiz
BRD
Japan
Nanmoku, Präfektur Gunma
42,4
45,9
46,7
65,5
Medianalter[1] in Nanmoku im Vergleich
Das rührt nicht nur daher, dass die Menschen immer länger leben, was ja zweifellos willkommen ist und von einem erfolgreichen Gesellschaftsmodell zeugt. Hinzu kommt, dass das Landleben vielen keine Zukunftsperspektive mehr bietet und sie deshalb in die Stadt ziehen. Wer 1964 bei der ersten Olympiade auf den Gedanken gekommen wäre, das 100 Kilometer nordwestlich von Tokyo gelegene Dorf Nanmoku zu besuchen, hätte dort noch um die 10 000 Einwohner angetroffen. Bei der zweiten Olympiade 2021 war die Dorfbevölkerung auf ein Fünftel zurückgegangen, während das Medianalter auf 65,5 Jahre angestiegen war – fast zwanzig Jahre älter als das der Gesamtbevölkerung Japans.
Dadurch entsteht ein Teufelskreis, den zu durchbrechen immer schwieriger wird. Das Steueraufkommen einer Gemeinde mit einem Medianalter über 65 strebt gegen null, wenn es nicht schon negativ ist. Unter den dadurch unvermeidlich werdenden Einschränkungen der öffentlichen Ausgaben leidet die Infrastruktur, was noch mehr Menschen dazu bewegt, vom Land in die Stadt zu ziehen, und so weiter. Seit Anfang der 2000er Jahre sind in Japan ungefähr 40 Eisenbahnlinien stillgelegt worden und auf jährlich Hunderten von Kilometern wird der Busverkehr eingestellt.
Welcher Zeitreisende hätte das bei den ersten Olympischen Spielen 1964 kommen sehen, als der erste Hochgeschwindigkeitszug der Welt pünktlich zur Eröffnung am 1. Oktober in Rekordgeschwindigkeit die 500 Kilometer von Tokyo nach Osaka zurücklegte und ganz Japan auf den Weg nach »Number One« mitnahm, wie es im Titel eines viel beachteten Buchs von Ezra F. Vogel hieß, das eineinhalb Jahrzehnte später erschien, als das Land auf dem Höhepunkt seines sagenhaften Aufstiegs war.
»Bullet Train«: Der Shinkansen, erster Hochgeschwindigkeitszug der Welt, legte 1964 seine erste Fahrt von Tokyo nach Osaka zurück.
Der Shinkansen symbolisierte lange den scheinbar unaufhaltsamen Fortschritt, immer schneller und komfortabler und dabei sicherer als alle anderen Eisenbahnlinien rund um den Globus. Von den ersten 514 Kilometer entlang der pazifischen Küste wurde das Streckennetz auf inzwischen 2 764 Kilometer ausgedehnt und die Spitzengeschwindigkeit von damals unglaublichen 200 Kilometer pro Stunde auf über 320 Kilometer pro Stunde erhöht. Alle wollten mit dem Shinkansen fahren, dem Stolz der Nation, und das durchaus zu Recht. Für die Dorfbewohner, die nur noch einen Bus am Vormittag und einen am Nachmittag für die Fahrt in die Kreisstadt haben, sind die technischen Höchstleistungen freilich von begrenztem Interesse.
Die 100-Millionen-Mittelschichtsgesellschaft
Entwicklung hat auch Verlierer. Über sie wird heute viel gesprochen, aber die Zeitreisenden haben gewöhnlich kein Auge für sie. Im Vordergrund stehen die Besonderen, die Lichtgestalten, oder die, die uns bedrohen, nicht die, die hinten runterfallen. Zeitreisende begegnen Tetsuwan Atomu (Astroboy), E. T., Superman und IMO Aliens, aber keiner von ihnen hat, als ersterer 1954 das Licht der Welt erblickte, daran gedacht, dass die lange verschmähten Aliens 2020 in Japan händeringend gesucht werden würden, dass man ihnen ihr Studium bezahlen würde, wenn sie nur danach in Japan blieben, damit man die geschätzten sechs Millionen alten Demenzpatienten nicht allein ihrem Schicksal überlassen muss. Dass zum Zeitpunkt der zweiten Tokyoter Olympiade jährlich rund 15 000 von ihnen bei der Polizei als vermisst gemeldet würden, wer hätte sich das zum Zeitpunkt der ersten vorstellen können, als Japan jung, voller Energie und davon überzeugt war, dass das Wachstum niemals aufhören würde, ohne auch nur einen Gedanken darauf zu verwenden, dass Wirtschaftswachstum ohne Bevölkerungswachstum schwierig, wenn nicht unmöglich ist?
Zur Überraschung vieler pendelte sich die Bevölkerung Japans nicht auf einem stabilen Niveau ein, sondern ging recht plötzlich von Wachstum zu Schrumpfung über. 1964 war die Hundertmillionenmarke gerade überschritten, Tendenz die nächsten vier Jahrzehnte weiter steigend. Wer nicht genau hinguckte, bemerkte nicht, dass die Bevölkerung schon bald nicht mehr dank des Geburtenüberschusses wuchs, sondern nur noch, weil die Menschen ihr Ableben immer weiter hinausschoben. Als Asō Tarō Finanzminister war (2012 bis 2021), verstand er, was das für die Renten bedeuten würde, und mahnte zur Eile, was aber durchaus nicht bei all seinen Mitbürgerinnen – und sie sind es, die an der Spitze der Alterspyramide stehen – auf Verständnis stieß. Sollte Asō, inzwischen 82 und nicht mehr im Kabinett, seine Meinung in diesem Punkt geändert haben, hat er das jedenfalls nicht öffentlich bekannt gemacht.
Vielmehr verkörpert Asō eine Transformation der japanischen Gesellschaft, die von den Zeitreisenden übersehen wurde. 100 Millionen war für ein paar Jahrzehnte eine magische Zahl (sie wuchs dann noch auf 126 Millionen an), indem sie, verbunden mit zweistelligen Wachstumsraten der Wirtschaft, Anlass dazu bot, von der 100-Millionen-Mittelschichtgesellschaft zu reden, einer Ideologie, die sich angesichts von Vollbeschäftigung und Jahr für Jahr steigenden Löhnen viele Menschen zu eigen machten. Gleichheit hieß das Gebot der Stunde, das die verkündeten, die daran glaubten, und die, die es opportun fanden, daran zu glauben. Die 100 Millionen Mittelschichtler waren 100 Millionen reinrassige Japaner und Japanerinnen, ein Glaubenssatz, mit dem noch Mitte der 1980er Jahre Premier Nakasone Yasuhiro Japans wirtschaftlichen Erfolg erklärte. Schon bald jedoch schrumpften die Wachstumsraten auf einstellige und gelegentlich selbst negative Zahlen zusammen. 1991 mit dem Platzen der Spekulationsblase begann, was im Rückblick zunächst die »verlorene Dekade« genannt wurde, der dann eine zweite folgte und, wie manche meinen, eine dritte der Stagflation. Wie auch immer das die Wirtschaftsweisen rechnen, es wurde schwierig und ist inzwischen unmöglich, über die sozialen Unterschiede hinwegzusehen, die die japanische Gesellschaft kennzeichnen. Asō Tarō ist reich, fröhlich und gesund und hatte immer einen guten Job. Für viele seiner Altersgenossen gilt das nicht. Der Anstieg der sogenannten »silbernen Kriminalität«, der der Betagten nämlich, und die Beschäftigung von Altenpflegern in Gefängnissen markieren auf bedrückende Weise den Abstand zwischen 1964 und 2020/21, zwischen der Mittelschichtgesellschaft und der Differenzgesellschaft.
Differenz (kakusa), das klingt sehr negativ und konnte der herrschenden Elite nicht wirklich gefallen. Um die Probleme der sich öffnenden sozialen Schere erträglich zu machen, musste sich die herrschende männliche Elite von der Homogenität verabschieden. Zunächst sollten mit den Worten von Abe Shinzō – Premierminister bis 2020 – »die Frauen glänzen«. Dass dieses Begehren weniger Vorstellungen von Gerechtigkeit und gleichem Lohn für gleiche Arbeit geschuldet war als der bitteren Einsicht, dass die Arbeitsbevölkerung im Zuge der Alterung beständig schrumpft, wurde dabei nicht unbedingt thematisiert. Die Lohndifferenz zwischen den Geschlechtern verringert sich nur langsam, wie auch der Arbeitskräftemangel; denn die weibliche Arbeitsmarktbeteiligung ist trotz geringerer Löhne schon lange relativ hoch.
Wer kann außer den Frauen Abhilfe schaffen? Das ist wieder eine Frage für die Zeitreisenden von 1940 oder 1964. Hätte ihre Phantasie so weit gereicht, in einem »Verrückten Hotel« (hen na hoteru) abzusteigen, in dem am Empfang die Gäste von Robotern begrüßt werden? Der technische Fortschritt ist ja typischerweise etwas für Zeitreisende. Etwas, das es schon gibt, nur ein bisschen weitergedacht: U-Boote, die die Welt umrunden, ohne aufzutauchen, autonome Staubsauger, Taxis, die durch Häuserschluchten fliegen. Aber hätten sie sich den Helden Ishiguro Hiroshi ausdenken können, der als Direktor des Robotiklabors der Universität Osaka 2019 anlässlich eines Vortrags in der Päpstlichen Akademie für das Leben (Pro Vita) in Rom erklärte, in Japan bräuchte man Roboter, weil Ausländer dort nicht überleben könnten? Vielleicht wäre das doch etwas viel verlangt gewesen, obschon Ishiguros Vision von der Zukunft der Menschheit durchaus das Zeug zu einer veritablen Zeitreise hätte. Denn in tausend oder zehntausend Jahren – er will sich da nicht so genau festlegen – werden sich Menschen angepasst haben und von Robotern ununterscheidbar sein. Das erklärte er jedenfalls dem Publikum in Rom. Ob aus Zynismus oder Überzeugung, ist nicht ganz einfach auszumachen.
Wie dem auch sei, Ishiguro bedient das im Westen durchaus geläufige Klischee, dass in Japan alles von der Industrieproduktion bis zur Altenpflege von Robotern gehandhabt wird. Gewiss ist er nicht der Einzige, dessen Ansichten von den eigenen Notwendigkeiten bestimmt sind. Roboterforschung will gefördert und vor allem finanziert werden, und um das zu gewährleisten, darf der Roboterforscher keine Gelegenheit auslassen, andere von ihrer Unverzichtbarkeit zu überzeugen. Die Kardinäle in Rom (deren Neugier man nur loben kann) waren in dieser Hinsicht nicht wirklich die richtigen Ansprechpartner, aber für einen, der das heute unverzichtbare Geschäft der Selbstvermarktung so gut versteht wie Ishiguro, auch nicht auszulassen. Mit seinem Roboterzwilling glaubt er, den Weg in die Zukunft zu weisen und der Branche, wenn nicht der Welt voraus zu sein. Gleichzeitig ist er aber – so widersprüchlich können Menschen eben sein – in der vorigen Welt zurückgeblieben, in der ideologischen Welt der japanischen Homogenität.
Zusammen mit oder etwas später als die Mittelschichtgesellschaft ist auch der »einrassige Nationalstaat« (tan’itsu minzoku kokka), den es erst seit Ende des Pazifischen Krieges gab, mehr oder minder ad acta gelegt worden – notgedrungen. Mit der Differenzgesellschaft ist ein neues Zeitalter angebrochen. Das ist Ishiguro entgangen, und 1964 hätte das auch kaum jemand vorausgesehen. Eine bahnbrechende Entdeckung hat das ermöglicht, die ihren Niederschlag mittlerweile in jeder Universität gefunden hat, die etwas auf sich hält, in Japan wie auch in der Bundesrepublik Deutschland und anderen sogenannten hochentwickelten Industrienationen. Die Entdeckung heißt diversity, mit dem englischsprachigen Terminus technicus, weil in der japanischen und in der deutschen Sprache ein geeignetes Wort offenkundig fehlt. Die bahnbrechende Einsicht ist, dass, ebenso wie es Spaghetti, Dampfnudeln, Soba, Udon, Biangbiang, Kritharki und Space Ram (dazu siehe unten) gibt, auch menschliche Wesen in mancherlei Form auftreten. Dafür, dass diese Vielfalt ihnen nicht zum Nachteil wird, gibt es jetzt Diversity-Tage, Diversity-Förderungszentren, Diversity-Prorektorinnen usw. an den Universitäten. Wenn man zur Kenntnis nimmt, dass weiblichen Prüflingen an japanischen medizinischen Hochschulen bis in unsere Tage ihre dank Fleiß oder höherer Intelligenz – man weiß es nicht genau – besseren Testergebnisse gekürzt wurden, um den Jungs auch eine Chance zu geben und zu verhindern, dass Krankenhäuser wegen massenhaft synchronisierten Mutterschaftsurlaubs arbeitsunfähig werden, wenn man das zur Kenntnis nimmt, kann man leicht Verständnis dafür aufbringen, dass dagegen etwas unternommen werden muss. Die Frage ist: was.
Diversity und Gleichbehandlung
Schreit ein solches Vorgehen, wie es die angesehenste medizinische Hochschule Japans (Tōkyō ika daigaku) praktiziert hat, nicht nach Gleichbehandlung mehr als nach diversity? Wer das denkt, vergisst möglicherweise, dass Gleichheit – Monotonie, Homogenität, ethnische Einheitlichkeit und Konformismus – in Japan aus der Mode gekommen ist, und wenn hier Mode steht, dann durchaus mit Absicht. Zwar gehorcht die Mode dem Profitstreben der Branche; die kann den Konsum aber nicht völlig willkürlich nach eigenem Gutdünken anheizen. Das Straßenbild, das Tokyo heute den Zeitreisenden von 1940 und 1964 bietet, hätte sie nicht nur in Erstaunen versetzt, sondern mit Fug und Recht davon überzeugt, dass sie sich in einer anderen Stadt befinden. Die Vergangenheit ist ein fremdes Land, wie man so sagt. Und da brauchen wir gar nicht über Architektur, das Nahverkehrssystem oder die Gastronomie zu reden. Die roten, blauen, blonden und grünen Haare, die Ringelchen in Ohren und Nasen, die vielen genderneutral gekleideten Jugendlichen, die Buntheit in den einst von grauen Anzügen mit Brille bevölkerten U-Bahnen und die fast fashion, die im Halb- oder Vierteljahresrhythmus Neues verlangt; all dies hätte den Horizont der Zeitreisenden gesprengt.
Die neue Vielfalt haben sich freilich nicht primär die Modeschöpfer ausgedacht. Die großen Namen, die jeder kennt, sind schon lange Weltspitze. Aber die Mode ist Teil des gesellschaftlichen Wandels. Die Zeichen stehen auf mehr Vielfalt. Die einst so gern zitierte Spruchweisheit von dem herausstehenden Nagel, der eingeschlagen wird, hört man in letzter Zeit nicht mehr so oft. Dass ein Altenpfleger ein makelloses Führungszeugnis hat, fließend japanisch spricht, Prüfungen bestanden hat, die manchen japanischen Oberschulabsolventen überfordern, am besten so aussieht wie Japaner und, wenn er eine Frau ist, keine Brille trägt: die Besetzung vakanter Stellen im Pflegesektor an solche Bedingungen zu knüpfen, ist nicht länger praktikabel. Die japanische Regierung drückt und windet sich noch immer – ähnlich wie die deutsche vor zwei oder drei Jahrzehnten –, das Wort »Immigration« in den Mund zu nehmen und eine realistische Immigrationsgesetzgebung in Angriff zu nehmen. Lange wird sie das nicht mehr können, auch wenn sie ihre Hoffnung auf Ishiguros Roboter setzt.
Diversity heißt der erste Schritt. Gleichheit zu betonen und ihren universellen Wert, der in der Erklärung der Menschenrechte kodifiziert ist, erschiene in Japan, wo so lange Gleichheit und Homogenität hochgehalten wurden, möglicherweise als Rückschritt. Diversity hingegen klingt so, als wäre es etwas völlig Neues, als hätte es Schwarze und Weiße, Braune und Gelbe, Dicke und Dünne, Krumme und Grade, Hübsche und Hässliche, Alte und Junge, Gesunde und Kranke, Gläubige und Ungläubige usw. nicht schon immer gegeben. An sich ist das Prinzip, dass Menschen nicht wegen irgendwelcher Äußerlichkeiten diskriminiert werden sollen, nicht schwer zu verstehen, und alle, die das einmal von passiver Seite aus erfahren haben, werden dem zustimmen. Die Neigung, den eigenen Stamm nicht nur von anderen abzugrenzen, sondern auch über sie zu stellen, hat das freilich nicht, oder, wenn wir optimistisch sein wollen, kaum gemindert.
Gendervielfalt und fast fashion: Junges Paar in Tokyo
Wenn nun aber Hoteliers nicht alle ihre Zimmer verkaufen können, weil es an Personal fehlt; wenn Pflegerinnen und Pfleger endlose Überstunden machen müssen, um die Versorgung in Krankenhäusern und Altenheimen nicht zusammenbrechen zu lassen; wenn das Durchschnittsalter der Bauern über 60 ist und sie nicht mehr wissen, wie sie ihre Felder bestellen und abernten sollen; wenn sich große Bauvorhaben wegen Arbeitskräftemangel verzögern; wenn der Arbeitsmarkt in all diesen Sparten leergefegt ist und von den nachwachsenden einheimischen Generationen nicht aufgefüllt werden wird – dann muss man in den Apfel der diversity beißen, sauer, wie er der Regierung auch erscheinen mag. Als diese Zeilen geschrieben wurden, verkündete Ex-Premier Abe, Japan bezöge »seine Energie aus diversity« – womit er wieder einmal seine Fähigkeit unter Beweis stellte, auf einen Zug aufzuspringen, den niemand aufhalten kann. Als Ausdruck von Philanthropie sollte man das nicht missverstehen. Homogenität ist gut, wenn es opportun ist, und Heterogenität auch.
In der Presse ist das Thema allgegenwärtig. Eine der größten Tageszeitungen, die eher progressive Asahi Shinbun, schreibt über die 1,46 Millionen ausländischen Arbeitnehmer, die 2,73 Millionen ansässigen Ausländer, die über 9 000 spurlos verschwundenen Praktikantinnen und Praktikanten, die 20 000 ausländischen Schulkinder, die durch das Netz der Schulpflicht fallen, und führt in diesem Zusammenhang einen Begriff in die Debatte ein, den es bisher nicht gab. Tamin shakai hieß es in der Schlagzeile der diesem Komplex gewidmeten Seite am 19.11.2019. Taminzoku shakai gab es bisher: die multiethnische Gesellschaft, und das war nicht die japanische. Was aber unter tamin shakai zu verstehen ist, bleibt den Lesern überlassen. »Multi-Bürger-Gesellschaft« hieße das wörtlich, so etwas Ähnliches also wie diversity, vielleicht.
Vielfalt kennzeichnet jedenfalls Tokyo heute mehr denn je. Groß ist die Stadt schon lange, bereits im 18. Jahrhundert hatte sie mehr als eine Million Einwohner. Da Japan der Kolonialisierung entging, den Verkehr mit westlichen Mächten und Missionaren ab dem 17. Jahrhundert stark einschränkte und vom Festland getrennt ist, war die Bevölkerung jedoch, verglichen mit anderen Städten dieser Größenordnung, immer relativ einheitlich und verkörperte das Körnchen Wahrheit, das der Ideologie der japanischen Homogenität und Besonderheit innewohnte.
Wenn die Bevölkerung Japans, wie die Experten vom Staatlichen Institut für Bevölkerung und Soziale Wohlfahrt schätzen, bis Mitte des Jahrhunderts bei weiter fortschreitender Alterung um mehr als 20 Millionen abnehmen wird, ist nicht ersichtlich, wie der Lebensstandard ohne Zuwanderung erhalten bleiben kann, auch wenn Rationalisierung, Automatisierung und Robotisierung weitergehen.
Erfindungen und technologische Neuerungen sind für Zeitreisende eine Herausforderung; haben wir doch so oft erfahren, dass Innovationen völlig unerwartete Begleiterscheinungen haben und neue Anwendungen nach sich ziehen. Ratlos hätten die Zeitreisenden von damals zum Beispiel vor den Regalen gestanden, die es heute in jedem konbini – geschätzte 10 000 im Großraum Tokyo allein – gibt. Das Trocknen von Lebensmitteln ist eine der ältesten Konservierungsmethoden überhaupt. 1940, ja auch noch 1964 dachte niemand daran, dass eine neue Anwendung derselben die japanischen Essgewohnheiten nur einige Jahre später von Grund auf umwälzen würde. 1971 brachte ihr Erfinder Andō Momofuku die ersten Cup Noodle auf den Markt. 2005 nahm der Astronaut Noguchi Sōichi auf seinem Trip mit der Space Shuttle »Discovery« eine Portion (genannt space ram) mit ins All. Für die Industrie war das ein willkommener Werbegag, aber die Japanerinnen und Japaner hatten bereits vorher anlässlich einer Umfrage entschieden, dass Instant-Nudeln die bedeutendste japanische Erfindung des zwanzigsten Jahrhunderts waren. 5,5 Milliarden Portionen jährlich ist gegenwärtig der Umsatz allein in Japan. Mehrere Cup-Noodle-Museen, in Yokohama und Osaka und anderswo, zeugen von der Wertschätzung, derer sich diese Schnellgerichte erfreuen. Nicht allein der niedrige Preis, auch der geringe Zeitaufwand für Zubereitung und Verzehr machen sie so beliebt, was wiederum die Zeitreisenden überrascht hätte. Tokyo ist heute eine schnelle Stadt, viel schneller als 1940 oder 1964. Rationalisierung und Vereinfachung haben nicht zu mehr Gelassenheit geführt, im Gegenteil.
Die nicht vorausgesehenen Folgen technologischer Entwicklungen sind sprichwörtlich. Die Nudeln illustrieren das. Gleichzeitig zeigt ihr Aufstieg zum beliebtesten Super-Fast-Food, dass soziale Entwicklungen ebenso schwer zu antizipieren sind. Demographische Veränderungen erklären nicht alles, schon weil sie endemisch von dem Henne-oder-Ei-Problem durchdrungen sind. (Bevölkerungswachstum dank ökonomischen Wachstums oder umgekehrt, oder beides einander bedingend?) Aber sie machen vieles verständlich.
Wäre Zeitreisenden von dazumal die Möglichkeit gewährt worden, zur Vorbereitung ihrer Expedition ins alternde Japan ein Interview in der Zukunft zu führen, wären sie gut beraten gewesen, nach einem Demographen eher als nach einem Robotikspezialisten zu fragen; denn nur Ersterer hätte ihnen vielleicht das Stichwort »Multibürgergesellschaft« genannt. Auch das hätten sie freilich nicht antizipiert.
Anmerkungen
Eine gekürzte Version dieses Essays erschien im Juli 2021 unter dem Titel »Zeitreise in die Multibürgergesellschaft: Tokyo von einer Olympiade zur anderen« im Merkur 866, S. 88–94.
1 Mittelwert, der dasjenige Alter angibt, das die Gesamtbevölkerung in zwei gleich große Hälften teilt: 50 Prozent sind jünger, 50 Prozent älter als das Medianalter.
Die verschwundene Stadt
Tokyo-Nostalgie in autobiografischen Stadtbeschreibungen
Evelyn Schulz
Tokyo wird wie keine andere Stadt Japans mit permanentem Wandel, Wachstum und Entgrenzung in Verbindung gebracht. Die moderne Geschichte Tokyos ist von zahlreichen Zäsuren gekennzeichnet, die Transformationen beschleunigten und tiefe Spuren in der Stadtlandschaft hinterließen. Die bekanntesten Ereignisse, die sich nachhaltig auf Modernisierungs- und Globalisierungsprozesse auswirkten, sind neben der Meiji-Restauration im Jahr 1868 das große Kantō-Erdbeben vom 1. September 1923, die großflächige Zerstörung Tokyos im Verlauf der Kriegsjahre 1944 und 1945 und der nachfolgende Wiederaufbau und das enorme Wachstum in der Nachkriegszeit, die Bauprojekte im Vorfeld der Olympischen Spiele von 1964, der Bauboom der 1980er und 1990er Jahre und schließlich die sozialen Verschiebungen und Verwerfungen, die unter dem Schlagwort der »Differenzgesellschaft« (kakusa shakai) ab den 1990er Jahren die unerfüllten Hoffnungen und Versprechungen der japanischen Moderne in den Fokus rückten. Diese Ereignisse lösten intensive Debatten über die Zukunft aus, die meist von einer Phase kritischer Reflexion begleitet wurden, in der Verbindungen zur Vergangenheit gesucht, Traditionen rekonstruiert beziehungsweise neu konstruiert und damit Bedeutungen neu zugeschrieben wurden. Tokyos wechselhafte Geschichte hat wesentlich dazu beigetragen, dass im Laufe der Zeit eine unüberschaubare Fülle an Texten unterschiedlicher Genres – Romane, Erzählungen, historische Darstellungen, topografische Essays, Kriminalliteratur, Lyrik, Schlager – entstanden ist, die diesen Ereignissen und ihren Folgen für die Stadt nachspüren. Hinzu kommen unzählige Werke der visuellen Kultur: Filme, Gemälde, Farbholzschnitte und Manga.





























