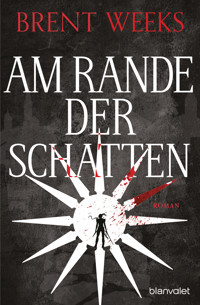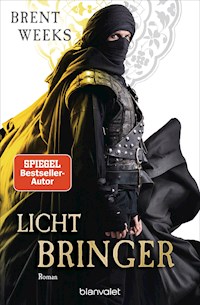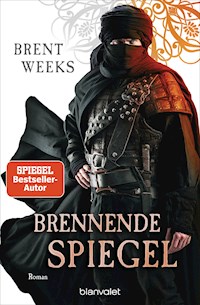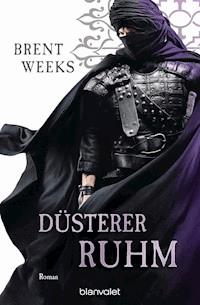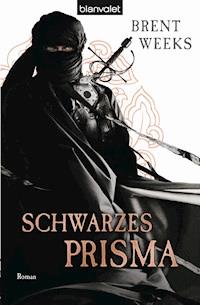12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Schatten-Trilogie (Night Angel)
- Sprache: Deutsch
Der fulminante Abschluss der spannenden Assassinen-Trilogie
Kylar Stern war der wahrscheinlich beste Assassine der Welt – bis er dem Töten für immer abschwor. Doch nun werden seine besonderen Talente wieder benötigt. Denn Kylars Heimat steht unter Belagerung, und die Hoffnung seiner Freunde ruht auf ihm genauso schwer wie das Vertrauen seines Königs. Ihm allein kann es jetzt noch gelingen, das Reich zu retten. Doch Kylars Plan ist selbstmörderisch und nahezu unmöglich durchzuführen – die Ermordung eines Gottes!
Alle Bände der Schatten-Trilogie
Band 1 - Der Weg in die Schatten
Band 2 - Am Rande der Schatten
Band 3 - Jenseits der Schatten
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 922
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Author
Brent Weeks wurde in Montana geboren und wuchs auch dort auf. Seine ersten Geschichten schrieb er auf Papierservietten und Stundenplänen. Doch tausende Manuskriptseiten später konnte er endlich seinen Brotjob kündigen und sich ganz darauf konzentrieren, was er wirklich machen wollte: Schreiben. Seither wurde er mehrfach für sein Werk ausgezeichnet und ist ein fester Bestandteil der »New York Times«- und der SPIEGEL-Bestsellerliste. Brent Weeks lebt heute mit seiner Frau und seinen Töchtern in Oregon
Buch
Kylar Stern war der wahrscheinlich beste Assassine der Welt — bis er dem Töten für immer abschwor. Doch nun werden seine besonderen Talente wieder benötigt. Denn Kylars Heimat steht unter Belagerung, und die Hoffnung seiner Freunde ruht auf ihm genauso schwer wie das Vertrauen seines Königs. Ihm allein kann es jetzt noch gelingen, das Reich zu retten. Doch Kylars Plan ist selbstmörderisch und nahezu unmöglich durchzuführen — die Ermordung eines Gottes!
Die Schatten-Trilogie von Brent Weeks: Der Weg in die SchattenAm Rande der SchattenJenseits der Schatten
Die Abenteuer von Kylar Stern gehen weiter in der Nachtengel-Saga: DNachtengel – NemesisNachtengel – Gemini
Brent Weeks
Jenseits der Schatten
Roman
Deutsch von Hans Link
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »The Night Angel Trilogy III. Beyond the Shadows« bei Orbit, Hachette Book Group USA, Inc., New York.
Copyright © der Originalausgabe 2008 by Brent Weeks
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30827 Garbsen.
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2010 by Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Kartenillustration: Jürgen Speh
Redaktion: Alexander Groß
Lektorat: Urban Hofstetter
Herstellung: Sabine Müller
Satz: Vornehm Mediengestaltung GmbH, München
Covergestaltung: bürosüd
ISBN 978-3-641-05242-3V010
www.blanvalet.de
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Kapitel 61
Kapitel 62
Kapitel 63
Kapitel 64
Kapitel 65
Kapitel 66
Kapitel 67
Kapitel 68
Kapitel 69
Kapitel 70
Kapitel 71
Kapitel 72
Kapitel 73
Kapitel 74
Kapitel 75
Kapitel 76
Kapitel 77
Kapitel 78
Kapitel 79
Kapitel 80
Kapitel 81
Kapitel 82
Kapitel 83
Kapitel 84
Kapitel 85
Kapitel 86
Kapitel 87
Kapitel 88
Kapitel 89
Kapitel 90
Kapitel 91
Kapitel 92
Kapitel 93
Kapitel 94
Kapitel 95
Kapitel 96
Kapitel 97
Kapitel 98
Kapitel 99
Epilog
Für Kristi, aus den üblichen Gründen, und für meinen Dad, weil du Klasse hast und echt bist und Kinder großgezogen hast, die auch mal: »Piep!« sagen - wenn auch nur sehr leise.
1
Logan Gyre saß im blutigen Schlamm des Schlachtfeldes bei Pavvils Hain, als Terah Graesin zu ihm kam. Es war kaum eine Stunde her, dass sie die Khalidori vernichtend geschlagen hatten, als der monströse Ferali, der geschaffen worden war, um die cenarische Armee zu verschlingen, sich stattdessen gegen seine khalidorischen Meister gewandt hatte. Logan hatte die Dinge befohlen, die ihm am dringlichsten erschienen waren, und dann all seine Leute entlassen, damit sie an den Feiern teilnehmen konnten, die im Lager der Cenarier abgehalten wurden.
Terah Graesin kam allein. Logan saß auf einem niedrigen Felsen, ohne den Schmutz ringsum zu beachten. Das feine Tuch seiner Kleider war so mit Blut und Schlimmerem besudelt, dass sie ohnehin nicht mehr brauchbar sein würden. Terahs Gewand dagegen war bis auf den unteren Saum makellos. Sie trug zwar hohe Schuhe, aber sie waren nicht hoch genug, um sie vor dem dicken Matsch zu schützen. Als sie Logan erreichte, blieb sie vor ihm stehen. Er erhob sich nicht.
Sie tat so, als bemerke sie es nicht. Er tat so, als bemerke er nicht, dass ihre Leibwache – die nicht vom Blut der Schlacht besudelt war – keine hundert Schritt entfernt hinter Bäumen versteckt Aufstellung genommen hatte. Es konnte nur einen Grund geben, weshalb Terah Graesin gekommen war: Sie fragte sich, ob sie noch Königin war.
Wenn Logan nicht so vollkommen erschöpft gewesen wäre, hätte ihn das Ganze erheitert. Terah war allein zu ihm gegangen, um Verwundbarkeit oder Furchtlosigkeit zu demonstrieren. »Ihr wart heute ein Held«, sagte Terah. »Ihr habt der Kreatur des Gottkönigs Einhalt geboten. Man sagt, Ihr hättet sie getötet.«
Logan schüttelte den Kopf. Er hatte auf den Ferali eingestochen, und der Gottkönig hatte die Kreatur daraufhin verlassen, aber andere hatten ihm ernstere Wunden zugefügt als er. Irgendetwas anderes hatte den Gottkönig aufgehalten, nicht er, Logan.
»Ihr habt ihr befohlen, unsere Feinde zu vernichten, und sie hat es getan. Ihr habt Cenaria gerettet.«
Logan zuckte die Achseln. Das schien alles schon lange her zu sein.
»Ich nehme an, die Frage ist«, fuhr Terah Graesin fort, »habt Ihr Cenaria für Euch selbst gerettet oder für uns alle?«
Logan spuckte ihr vor die Füße. »Verschont mich mit diesem Mist, Terah. Ihr denkt, Ihr könnt mit mir spielen? Ihr habt nichts anzubieten, nichts, mit dem Ihr drohen könnt. Wenn Ihr eine Frage an mich habt, dann zeigt wenigstens so viel Respekt und fragt einfach.«
Terahs Rücken versteifte sich, sie hob das Kinn, und eine ihrer Hände zuckte, aber dann hielt sie inne.
Das Zucken der Hand war Logan nicht entgangen. Wäre es, wenn sie die Hand gehoben hätte, für ihre Männer das Zeichen gewesen anzugreifen? Logan blickte an ihr vorbei in den Wald am Rand des Schlachtfeldes, aber das Erste, was er sah, waren nicht ihre Leute. Er sah seine eigenen. Agons Hunde – darunter zwei der erstaunlich begabten Bogenschützen, die Agon mit ymmurischen Bögen ausgerüstet und zu Hexenjägern gemacht hatte – hatten heimlich hinter Terahs Leibwachen Position bezogen. Beide Hexenjäger hatten Pfeile an die Sehnen gelegt, aber ihre Bögen noch nicht gespannt. Beide Männer hatten offensichtlich darauf geachtet, sich so hinzustellen, dass Logan sie gut sehen konnte; von den übrigen Hunden war indessen keiner klar zu erkennen.
Einer der Jäger blickte abwechselnd zu Logan und einem Ziel im Wald. Logan folgte seinem Blick und entdeckte einen verborgenen Bogenschützen Terahs, der mit seinem Pfeil auf ihn zielte und auf Terahs Signal wartete. Der andere Hexenjäger hatte den Blick auf Terah Graesins Rücken gerichtet. Sie beide warteten auf ein Signal von Logan. Logan hätte wissen müssen, dass seine auf der Straße groß gewordenen Gefolgsleute ihn nicht allein lassen würden, wenn Terah Graesin in der Nähe war.
Er blickte Terah an. Sie war schlank, schön, mit herrischen grünen Augen, die Logan an die Augen seiner Mutter erinnerten. Terah glaubte, dass Logan nichts von ihren Leuten im Wald wusste. Sie dachte, dass Logan nicht wusste, dass sie am längeren Hebel saß. »Ihr habt mir heute Morgen unter nicht gerade idealen Umständen Gefolgschaft geschworen«, sagte Terah. »Habt Ihr vor, Euren Schwur zu halten, oder beabsichtigt Ihr, Euch selbst zum König zu machen?«
Sie brachte es offenbar nicht fertig, ihn direkt zu fragen. Es war ihr nicht gegeben, nicht einmal jetzt, da sie glaubte, Logan völlig in der Hand zu haben. Sie würde keine gute Königin sein.
Logan dachte, er hätte seine Entscheidung bereits getroffen, aber jetzt zögerte er. Er dachte daran, wie es gewesen war, im Loch machtlos zu sein, wie es sich angefühlt hatte, machtlos zu sein, als Jenine, seine frisch angetraute Frau, ermordet worden war. Dann rief er sich ins Gedächtnis, wie verstörend wunderbar es sich angefühlt hatte, Kylar zu befehlen, Gorkhy zu töten, und den Befehl dann befolgt zu sehen. Er fragte sich, ob es das gleiche Vergnügen sein würde, Terah Graesin sterben zu sehen. Mit einem Nicken in Richtung seiner Hexenjäger würde er es herausfinden können. Er würde sich nie wieder machtlos fühlen.
Sein Vater hatte einmal zu ihm gesagt: »Ein Eid ist das Maß des Mannes, der ihn ablegt.« Logan hatte gesehen, was passierte, wenn er das tat, was recht war, ganz gleich, wie dumm es ihm zur Zeit der Tat erschienen war. Das war es, was die Locher hinter ihn gebracht hatte. Das war es, was sein Leben gerettet hatte, als er im Fieber lag und kaum noch bei Bewusstsein gewesen war. Das war es, was Lilly – die Frau, aus der die Khalidori den Ferali gemacht hatten – dazu bewogen hatte, sich gegen die Khalidori zu wenden. Letzten Endes hatte es zur Rettung von ganz Cenaria geführt, dass Logan stets das getan hatte, was er für recht hielt. Und sein Vater, Regnus Gyre, hatte getreu seinen Eiden gelebt, eine jämmerliche Ehe und den jämmerlichen Dienst an einem armseligen, bösartigen König durchgestanden. Er hatte Tag für Tag die Zähne zusammengebissen und nachts gut schlafen können. Logan wusste nicht, ob er aus gleichem Holz geschnitzt war wie sein Vater. Aber er konnte es einfach nicht tun.
Also zögerte er. Wenn sie die Hand hob, um ihren Männern den Befehl zum Angriff zu geben, hätte sie die Übereinkunft zwischen dem Fürsten und seinem Gefolgsmann gebrochen. Wenn sie diese Übereinkunft brach, würde er frei sein.
»Unsere Soldaten haben mich zum König erklärt«, sagte Logan mit unbewegter Stimme. Verlier die Fassung, Terah. Befiehl den Angriff. Befiehl deinen eigenen Tod.
Terahs Augen blitzten, aber ihre Stimme blieb ruhig, und ihre Hand bewegte sich nicht. »In der Hitze des Gefechts sagen Männer vieles. Ich bin bereit, diese Unbedachtheit zu vergeben.«
Ist es das, wofür Kylar mich gerettet hat?
Nein. Aber ich bin der Mann, der ich bin. Ich bin der Sohn meines Vaters.
Logan stand so langsam auf, dass er den Bogenschützen beider Seiten keinen Anlass zur Beunruhigung gab, kniete dann langsam nieder und berührte Terah Graesins Fuß.
In der gleichen Nacht griff eine Bande von Khalidori das cenarische Lager an und brachte Dutzende der von den Feiern noch betrunkenen cenarischen Soldaten um, bevor sie wieder in der Dunkelheit verschwanden. Am Morgen befahl Terah Graesin Logan Gyre, mit tausend Mann die Verfolgung aufzunehmen.
2
Die Wache war ein kampferprobter Sa’ceurai, ein Schwertfürst, der sechzehn Männer getötet und sich ihre Stirnlocken in sein feuerrotes Haar gebunden hatte. Seine Augen suchten rastlos die Dunkelheit ab, wo der Forst und der Eichenhain aneinandergrenzten, und wenn er sich umdrehte, schirmte er den Blick ab gegen die niedrigen Flammen der Feuer, die seine Kameraden wärmten, um seine Nachtsicht nicht zu schwächen. Trotz des kalten Windes, der durchs Lager strich und die hohen Eichen ächzen ließ, trug er keinen Helm, der sein Gehör beeinträchtigt hätte. Dennoch hatte er keine Chance, den Blutjungen aufzuhalten.
Den ehemaligen Blutjungen, dachte Kylar, während er einhändig auf einem dicken Eichenast balancierte. Wäre er immer noch ein gedungener Mörder gewesen, hätte er die Wache ohne viel Federlesens umgebracht. Aber Kylar war jetzt etwas anderes, er war der Nachtengel – unsterblich, unsichtbar und fast unbesiegbar -, und er brachte den Tod nur denjenigen, die ihn verdienten.
Diese Schwertkämpfer aus dem Land, dessen Name selbst »das Schwert« bedeutete, Ceura, waren die besten Soldaten, die Kylar je gesehen hatte. Sie hatten ihr Lager mit einer Effizienz aufgeschlagen, die einen jahrelangen Aufenthalt im Feld verriet. Sie rodeten Buschwerk, das die Annäherung eines Feindes hätte verbergen können, schirmten ihre kleinen Feuer ab, um sie weniger sichtbar zu machen, und hatten ihre Zelte so aufgestellt, dass ihre Pferde und ihre Führer geschützt waren. Jedes Feuer wärmte zehn Männer, von denen jeder seine Zuständigkeit genau kannte. Sie bewegten sich im Wald wie Ameisen, und wenn sie ihre Aufgabe erfüllt hatten, entfernte sich keiner von ihnen weiter als bis zum nächsten Feuer. Sie spielten, aber sie tranken nicht, und ihre Stimmen blieben gedämpft. Der einzige Schwachpunkt, der die Effizienz der Ceuraner beeinträchtigte, schien von ihren Rüstungen herzurühren. Eine ceuranische Rüstung aus Bambus und Lack konnte ein Mann sich selbst anlegen. Das jedoch war bei den khalidorischen Rüstungen, die sie vor einer Woche bei Pavvils Hain gestohlen hatten, nicht möglich. Sie bestanden aus Schuppenpanzern, kombiniert mit Ketten- und sogar Plattenpanzern, und die Ceuraner konnten nicht entscheiden, ob es nötig war, in Rüstung zu schlafen, oder ob die Männer sich gegenseitig beim Ablegen der Rüstungen als Knappen dienen sollten.
Als es jeder Einheit erlaubt wurde, selbst zu entscheiden, wie sie das Problem lösen wollten, damit keine Zeit verschwendet wurde, die Vorgesetzten damit zu belästigen, wusste Kylar, dass das Schicksal seines Freundes, Logan Gyre, besiegelt war. Der Kriegsführer, Lantano Garuwashi, hatte die ceuranische Ordnungsliebe mit Eigenverantwortung vermählt. Dieser Umstand war der Grund, warum Garuwashi niemals eine Schlacht verloren hatte. Es war der Grund, warum er sterben musste.
Also bewegte sich Kylar durch die Bäume wie der Atem eines rachsüchtigen Gottes und ließ die Zweige nur rascheln, wenn sie im Abendwind ohnehin geraschelt hätten. Die Eichen wuchsen in gradlinigen Reihen, die nur unterbrochen waren, wo jüngere Bäume zwischen den breiten Schultern älterer emporgesprossen und inzwischen selbst zu alten Bäumen herangewachsen waren. Kylar kletterte auf einem Ast so weit nach außen, wie es ging, und erspähte Lantano Garuwashi durch die vom Wind bewegten Zweige. Schwach beleuchtet von den niedrigen Flammen seines Feuers berührte er das Schwert auf seinem Schoß mit erkennbarer Freude. Wenn Kylar die nächste Eiche erreichte, konnte er nur ein paar Schritte von seiner Leiche entfernt hinunterklettern.
Kann ich mein Ziel immer noch eine »Leiche« nennen, obwohl ich kein Blutjunge mehr bin? Aber es war unmöglich, sich Garuwashi als »Ziel« vorzustellen. Kylar hörte immer noch die Stimme seines Meisters Durzo Blint: »Meuchelmörder«, hatte er gehöhnt, »haben Ziele, weil Meuchelmörder manchmal ihr Ziel verfehlen.«
Kylar schätzte die Entfernung zum nächsten Ast ein, der sein Gewicht tragen würde. Acht Schritte. Das war kein allzu weiter Sprung. Die Schwierigkeit lag darin, auf einem Ast zu landen und seine Bewegung geräuschlos mit nur einem Arm abzufangen. Falls Kylar nicht sprang, würde er zwischen zwei Feuern hindurchschleichen müssen, wo ab und zu auch ein Ceuraner hin und her ging, und die Erde war bedeckt mit welkem Laub. Er würde springen, beschloss er, wenn die nächste Brise wehte.
»Es steht ein seltsamer Glanz in Euren Augen«, sagte Lantano Garuwashi. Er war groß für einen Ceuraner, schlank und doch so muskulös wie ein Tiger. Streifen seines eigenen Haars, das in der gleichen Farbe brannte wie das flackernde Feuer, waren zwischen den sechzig Stirnlocken aller Haarfarben erkennbar, die er getöteten Gegnern abgeschnitten hatte.
»Ich habe das Feuer immer geliebt. Ich möchte mich daran erinnern, wenn ich sterbe.«
Kylar bewegte sich ein wenig, um den Sprecher sehen zu können. Es war Feir Cousat, ein blonder Berg von einem Mann, so breit wie hoch. Kylar war einmal mit ihm zusammengetroffen. Feir verstand sich nicht nur auf den Umgang mit dem Schwert, er war außerdem ein Magus. Kylar konnte von Glück reden, dass der Mann mit dem Rücken zu ihm saß.
Vor einer Woche, nachdem der khalidorische Gottkönig Garoth Ursuul ihn getötet hatte, hatte Kylar einen Handel mit dem gelbäugigen Wesen geschlossen, das der Wolf genannt wurde. In seinem merkwürdigen Zwischenreich zwischen Leben und Tod hatte der Wolf versprochen, Kylar seinen rechten Arm zurückzugeben und ihn schnell genug wieder zum Leben zu erwecken, wenn Kylar als Gegenleistung Lantano Garuwashis Schwert stahl. Was so einfach erschienen war – wer kann schon einen Unsichtbaren davon abhalten, etwas zu stehlen? -, wurde nun von Sekunde zu Sekunde schwieriger. Wer kann einen unsichtbaren Mann aufhalten? Ein Magus, der unsichtbare Männer sehen kann.
»Ihr glaubt also wirklich, dass der Dunkle Jäger in diesen Wäldern haust?«, fragte Garuwashi.
»Zieht Euer Schwert ein Stück heraus, Kriegsführer«, antwortete Feir. Garuwashi entblößte die Klinge des Schwertes eine Handbreit. Die Klinge sah aus wie ein mit Feuer erfüllter Kristall und gab strahlendes Licht ab. »Die Klinge leuchtet, um vor Gefahr oder Magie zu warnen. Der Dunkle Jäger ist beides.«
So wie ich, dachte Kylar.
»Ist er in der Nähe?«, fragte Garuwashi. Er richtete sich auf wie ein sprungbereiter Tiger.
»Ich habe Euch ja gesagt, dass es vielleicht unseren Tod bedeutet und nicht ihren, wenn wir der cenarischen Armee hier auflauern«, erklärte Feir. Dann wandte er den Blick zurück aufs Feuer.
Eine Woche lang, seit der Schlacht bei Pavvils Hain, hatte Garuwashi Logan und dessen Männer nach Osten gelockt. Da die Ceuraner sich in khalidorische Rüstungen gehüllt hatten, glaubte Logan, er verfolge die Reste des geschlagenen khalidorischen Heeres. Kylar wusste immer noch nicht, warum Lantano Garuwashi Logan hierhergeführt hatte.
Aber er wusste auch nicht, warum die schwarze Metallkugel, die als Ka’kari bezeichnet wurde, beschlossen hatte, ihm zu dienen, oder warum sie ihn vom Tod zurückholte oder warum er die Flecken auf der Seele eines Mannes sah, die nach Tod verlangten, oder warum die Sonne aufging oder wie sie am Himmel hängen konnte, ohne herunterzufallen.
»Ihr habt gesagt, wir seien sicher, solange wir nicht in den Wald des Jägers gehen«, sagte Garuwashi.
»Ich sagte ›vermutlich sicher‹«, erwiderte Feir. »Der Jäger spürt und hasst Magie. Und die besitzt das Schwert im Übermaß.«
Garuwashi machte eine wegwerfende Handbewegung, als verscheuche er eine Fliege. »Wir sind nicht in den Wald des Jägers gegangen – und wenn die Cenarier gegen uns kämpfen wollen, müssen sie es tun«, sagte er.
Kylar stockte er Atem, als er den Plan endlich begriff. Die Wälder nördlich, südlich und westlich des Iaosischen Forstes waren dicht und beinahe undurchdringlich. Logan hatte nur eine einzige Möglichkeit, seine zahlenmäßige Überlegenheit zu nutzen: Er musste von Osten kommen, wo die gigantischen Mammutbäume des Forstes – auch Ezras Wald oder der Wald des Dunklen Jägers genannt – einem Heer genug Raum für Manöver ließen. Aber es hieß, dass eine jahrhundertealte Kreatur alles tötete, was diesen Wald betrat. Gelehrte Männer hatten solchen Aberglauben verhöhnt, aber Kylar hatte die Bauern von Torras Bend kennengelernt … Logan würde direkt in die Falle laufen.
Der Wind frischte wieder auf und ließ die Äste knarren. Kylar sprang. Mit seiner Magie konnte er die Entfernung leicht überwinden. Aber er war mit zu viel Kraft gesprungen, zu weit, und drohte, an dem Ast, auf dem er gelandet war, abzurutschen. Kleine schwarze Krallen bohrten sich an seinen Knien durch seine Kleidung, ebenso an seinem linken Unterarm und selbst an seinen Rippen. Einen Moment lang waren diese Krallen wie flüssiges Metall und zerrissen seine Kleidung weniger, als dass sie sie absorbierten und sich außerhalb seiner Kleider wieder verfestigten. Kylars Bewegung wurde fast schlagartig aufgehalten.
Nachdem er sich wieder auf den Ast gezogen hatte, schmolzen die Krallen zurück in seine Haut. Kylar zitterte, und nicht nur, weil er beinahe gefallen wäre. Zu was werde ich? Mit jedem Tod, den er brachte, und jedem Tod, den er erlitt, wurde er stärker. Das beängstigte ihn außerordentlich. Was wird es mich kosten? Es muss einen Preis geben.
Mit zusammengebissenen Zähnen kletterte Kylar kopfunter den Baum hinab, ließ die Krallen dort aus seiner Haut wachsen, wo sie nötig waren, und sich in die Baumrinde bohren. Als er die Erde erreichte, floss der schwarze Ka’kari ihm aus allen Poren und umschloss ihn wie eine zweite Haut. Er umfing sein Gesicht, seinen Körper, seine Kleider und sein Schwert und begann Licht zu verzehren. Unsichtbar bewegte Kylar sich weiter.
»Ich habe davon geträumt, in einem kleinen Ort wie Torras Bend zu leben«, sagte Feir, dessen Rücken jetzt breit wie der eines Ochsen vor Kylar aufragte. »Mir eine Schmiede am Fluss zu bauen, ein Wasserrad einzurichten, das die Blasebälge antreibt, bis meine Söhne alt genug sind, um mir zu helfen. Ein Prophet hat mir gesagt, dass es so kommen könnte.«
»Genug von Euren Träumen«, schnitt Garuwashi ihm das Wort ab und stand auf. »Meine Hauptarmee sollte es jetzt fast über die Berge geschafft haben. Ihr und ich müssen gehen.«
Hauptarmee? Der letzte Stein fand seinen Platz. Darum also hatten die Sa’ceurai sich als Khalidori verkleidet. Garuwashi hatte die besten Männer von Cenarias Truppen weit nach Osten gelockt, während seine Hauptarmee sich im Westen sammelte. Nachdem die Khalidori bei Pavvils Hain geschlagen waren, würden die cenarischen Bauern, die man zum Heerdienst einberufen hatte, inzwischen wieder auf dem Rückweg zu ihren Höfen sein. In wenigen Tagen würden ein paar hundert cenarische Burgwachen es mit der gesamten ceuranischen Armee zu tun bekommen.
»Gehen? Heute Nacht?«, fragte Feir überrascht.
»Jetzt«, sagte Garuwashi grinsend – direkt vor Kylar. Dieser erstarrte, aber er bemerkte in den grünen Augen des Kriegsführers nichts, was darauf schließen ließ, dass er ihn gesehen hatte. Doch er sah etwas Schlimmeres.
In Garuwashis Augen stand zweiundachtzigfacher Tod. Zweiundachtzig! Und nicht einer davon ein Mord. Lantano Garuwashi zu töten würde keine Gerechtigkeit sein; es würde Mord sein. Kylar fluchte laut.
Lantano Garuwashi sprang auf die Füße, die Scheide flog vom Schwert, das wie eine Flamme aussah, bereit zu kämpfen und schon in der richtigen Haltung. Feir, der Berg von einem Mann, war nur einen Sekundenbruchteil langsamer. Er war auf den Füßen und hatte nackten Stahl in Händen, schneller, als Kylar es bei einem so großen Mann für möglich gehalten hätte. Als er Kylar erblickte, weiteten sich seine Augen.
Kylar brüllte vor Enttäuschung und ließ blaue Flammen über seine vom Ka’kari bedeckte Haut und seine Gesichtsmaske schlagen. Er hörte einen Schritt, als eine von Garuwashis Leibwachen ihn von hinten angriff. Kylars Magie erwachte; er machte einen Salto rückwärts und stieß dem Mann seine Füße gegen die Schultern. Der Sa’ceurai wurde zu Boden geschleudert, und Kylar flog in blaue Flammen gehüllt durch die Luft.
Bevor er den Ast erreichte, ließ er die Flammen erlöschen und wurde unsichtbar. Einhändig sprang er von Ast zu Ast, ohne sich auch nur um Verstohlenheit zu bemühen. Wenn er heute Nacht nichts unternahm, würde Logan sterben – und mit ihm seine kleine Armee treu ergebener Männer.
»War das der Jäger?«, fragte Garuwashi.
»Schlimmer«, sagte Feir, der bleich geworden war. »Das war der Nachtengel, wahrscheinlich der einzige Mann auf der Welt, den Ihr fürchten müsst.«
Lantano Garuwashis Augen wurden hell von einem Feuer, das eines mit Gewissheit sagte: Für ihn war »Mann, den Ihr fürchten müsst« gleichbedeutend mit »würdiger Gegner«.
»In welche Richtung ist er gegangen?«, fragte Garuwashi.
3
Als Elene auf ihrem müden Pferd vollkommen erschöpft den kleinen Gasthof in Torras Bend erreichte, schwang sich dort gerade eine atemberaubend schöne junge Frau mit langem, rotem Haar, das sie zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden hatte, und einem funkelnden Ring in ihrem linken Ohr auf einen stichelhaarigen Hengst. Der Stallknecht konnte den Blick nicht von der Schönheit abwenden, während sie nach Norden davonritt.
Elene ritt den Mann fast über den Haufen, bevor er sich zu ihr umdrehte. Er blinzelte dümmlich. »He, Eure Freundin ist gerade auf und davon«, sagte er und deutete auf den in der Ferne verschwindenden Rotschopf.
»Wovon sprichst du?« Elene war so müde, dass sie kaum einen klaren Gedanken fassen konnte. Sie war zwei Tage lang zu Fuß unterwegs gewesen, bevor eines der Pferde sie gefunden hatte. Und sie wusste auch nicht, was aus den anderen Gefangenen der Khalidori oder dem Ymmuri geworden war, der sie gerettet hatte.
»Ihr könntet sie immer noch einholen«, sagte der Stallknecht.
Elene hatte die junge Frau gut genug gesehen, um zu wissen, dass sie ihr niemals zuvor begegnet war. Sie schüttelte den Kopf. Sie musste in Torras Bend Vorräte kaufen, bevor sie nach Cenaria aufbrach. Außerdem war es bereits fast dunkel, und nach den Tagen, in denen ihre khalidorischen Entführer sie vor sich hergetrieben hatten, brauchte Elene dringend eine Nacht in einem Bett und eine Möglichkeit, sich zu waschen. »Das glaube ich nicht«, sagte sie.
Sie ging hinein, ließ sich von der Frau des gerade abwesenden Wirts ein Zimmer geben, zahlte ihr dafür eine großzügige Summe Silber, die sie in den Satteltaschen ihres Pferdes gefunden hatte, wusch sich und ihre verschmutzten Kleider und schlief danach sofort ein.
Vor dem Morgengrauen zog sie widerwillig ihr immer noch feuchtes Kleid an und ging hinunter.
Der Wirt, ein schmaler junger Mann, brachte ein Tablett voller gewaschener Krüge von draußen herein und stellte sie auf den Kopf, damit sie trockneten, bevor er Feierabend machte und endlich zu Bett ging. Er nickte Elene freundlich zu und beachtete sie kaum. »Meine Frau wird in einer halben Stunde das Frühstück fertig haben, und falls – oh, Hölle.« Er sah sie noch einmal an und nahm sie jetzt zum ersten Mal richtig wahr. »Maira hat mir nicht gesagt …« Er rieb sich die Hände an seiner Schürze ab – offenbar gewohnheitsmäßig, denn seine Hände waren gar nicht nass – und ging hinüber zu einem Tisch, der bedeckt war mit Krimskrams, Notizen und Kassenbüchern.
Er zog eine Notiz hervor und reichte sie Elene mit einer Geste der Entschuldigung. »Ich habe Euch gestern Abend nicht gesehen, sonst hätte ich es Euch gleich gegeben.« Elenes Name und eine Beschreibung, wie sie aussah, waren außen auf die Nachricht geschrieben. Sie faltete das Blatt auseinander, und ein kleineres, zerknittertes Blatt fiel heraus. Es war in Kylars Handschrift beschrieben. Und mit dem Datum des Tages versehen, an dem er Caernarvon verlassen hatte. Ihre Kehle schnürte sich zusammen.
»Elene«, las sie, »es tut mir leid. Ich habe es versucht. Ich schwöre, ich habe es versucht. Einige Dinge sind mehr wert als mein Glück. Einige Dinge kann nur ich tun. Verkaufe diese Ringe an Master Bourary und zieh mit der Familie in einen besseren Stadtteil. Ich werde dich immer lieben.«
Kylar liebte sie noch. Er liebte sie. Sie hatte es immer geglaubt, aber es war etwas anderes, es von ihm selbst in seiner krakeligen Handschrift zu lesen. Ihre Tränen begannen zu fließen, in Strömen. Es kümmerte sie nicht, dass der beunruhigte Wirt den Mund öffnete und wieder schloss, unsicher, was er mit einer weinenden Frau in seinem Gasthaus anfangen sollte.
Elene hatte sich geweigert, sich zu ändern, und das hatte sie alles gekostet, aber der Gott gab ihr eine zweite Chance. Sie würde Kylar zeigen, wie stark und tief die Liebe einer Frau sein konnte. Es würde nicht leicht werden, aber er war der Mann, den sie liebte. Er war es. Sie liebte ihn, und so einfach war das.
Es dauerte einige Minuten, bevor sie die andere Nachricht las, die eine ihr unbekannte Frauenhand geschrieben hatte.
»Ich heiße Vi«, hieß in der Nachricht. »Ich bin der Blutjunge, der Jarl getötet und Uly entführt hat. Kylar hat Euch verlassen, um Logan zu retten und den Gottkönig zu töten. Der Mann, den ihr liebt, hat Cenaria gerettet. Ich hoffe, Ihr seid stolz auf ihn. Für den Fall, dass Ihr nach Cenaria geht, habe ich Momma K angewiesen, Euch vollen Zugang zu meinem Vermögen zu gewähren. Nehmt Euch, was Ihr wollt. Und falls Ihr ein anderes Ziel habt, Uly wird an der Chantry sein, so wie ich, und ich denke, dass Kylar ebenfalls bald dorthin kommen wird. Es gibt … noch mehr, aber ich ertrage es nicht, es niederzuschreiben. Ich musste etwas Furchtbares tun, damit wir den Sieg erringen konnten. Worte können das, was ich getan habe, nicht ungeschehen machen. Es tut mir so furchtbar leid. Ich wünschte, dass ich es wiedergutmachen könnte, aber das kann ich nicht. Wenn Ihr kommt, könnt Ihr jede Art von Vergeltung üben, die Ihr wünscht, selbst wenn es mein Leben kostet. – Vi Sovari«
Die Haare in Elenes Nacken hatten sich aufgestellt. Was konnte das für ein Mensch sein, der für sich in Anspruch nahm, ein solcher Feind und ein solcher Freund zu sein? Wo waren Elenes Hochzeitsohrringe? »Es gibt noch mehr«? Was bedeutete das? Vi hatte etwas Furchtbares getan?
Das bleierne Gewicht der Intuition machte sich in Elenes Magen bemerkbar. Die Frau, die sie gestern hatte davonreiten sehen, hatte einen Ohrring getragen; es war vermutlich nicht … es war doch sicherlich nicht …
»Oh mein Gott«, sagte Elene. Sie rannte zu ihrem Pferd.
Der Traum war jede Nacht etwas anders. Logan stand auf dem runden Podest und sah die schöne, armselige Terah Graesin an. Sie würde über ein ganzes Heer von Leichen gehen – oder einen Mann heiraten, den sie verachtete -, um das Ziel ihres Ehrgeizes zu erreichen. Wie es an jenem Tag gewesen war, so verweigerte Logans Herz sich ihm auch im Traum. Sein Vater hatte eine Frau geheiratet, die all sein Glück vergiftet hatte. Logan konnte es nicht tun.
Wie er es an jenem Tag gemacht hatte, fragte Logan sie, ob sie ihm Gefolgschaft leisten würde, und das runde Podest erinnerte ihn an das Loch, in dem er während der khalidorischen Besatzungszeit verrottet war. Terah lehnte ab. Aber statt sich seinerseits ihr zu unterwerfen, so dass ihrer beider Armeen sich am Vorabend der Schlacht nicht entzweiten, sagte Logan in seinem Traum: »Dann verurteile ich Euch zum Tod wegen Hochverrats.«
Sein Schwert sang. Terah trat stolpernd zurück, aber zu langsam. Die Klinge trennte ihren Hals zur Hälfte durch.
Logan fing sie auf, und plötzlich war sie zu einer anderen Frau geworden, an einem anderen Ort. Aus Jenines durchschnittener Kehle ergoss sich Blut über ihr weißes Nachthemd und seine bloße Brust. Die Khalidori, die in sein Hochzeitsgemach eingedrungen waren, lachten.
Logan schlug um sich und erwachte. Er lag im Dunkeln und brauchte einen Moment, um sich zu orientieren. Seine Jenine war tot. Terah Graesin war Königin. Logan hatte ihr Gefolgschaft geschworen. Logan Gyre hatte einen Eid geleistet, ein Wort gegeben, das für seine Wahrhaftigkeit stand. Wenn seine Königin ihm also befahl, die letzten verbliebenen Khalidori auszurotten, dann gehorchte er. Er würde sich immer glücklich schätzen, Khalidori zu töten.
Als er sich im Dunkeln des Lagerzelts aufrichtete, sah Logan den Hauptmann seiner Leibwache, Kaldrosa Wyn. Während der Besatzung waren die Bordelle von Momma K in der Stadt zu den sichersten Plätzen für Frauen geworden. Momma K hatte nur die schönsten und exotischsten genommen. Sie hatten die Khalidori den ersten Blutzoll des Krieges entrichten lassen, in einer Nacht, da man sie in der ganzen Stadt in Hinterhalte gelockt hatte, einer Nacht, die jetzt Nocta Hemata, die Nacht des Blutes, genannt wurde. Logan hatte diese Frauen öffentlich geehrt, und sie waren zu seinen treuen Anhängerinnen geworden. Diejenigen von ihnen, die kämpfen konnten, hatten gekämpft und waren gestorben – um ihn zu retten. Nach der Schlacht bei Pavvils Hain hatte Logan alle Überlebenden des Strumpfbandordens außer Kaldrosa Wyn entlassen. Ihr Mann war einer der zehn Hexerjäger, und die beiden waren unzertrennlich. Also konnte sie ihm geradeso gut weiter dienen.
Kaldrosa trug ihr Strumpfband am linken Arm. Es war aus dem Stoff einer mit Magie belegten khalidorischen Kriegsfahne genäht und schimmerte selbst in der Dunkelheit. Sie war natürlich ebenfalls eine Schönheit mit olivfarbener sethischer Haut, einem kehligen Lachen und hundert Geschichten, von denen einige, wie sie behauptete, wahr waren. Ihr Kettenpanzer passte ihr nicht richtig, und sie trug einen Waffenrock mit dem weißen Gyre-Falken, dessen Schwingen über einen schwarzen Kreis hinausragten. »Es ist Zeit«, sagte sie.
General Agon Brant steckte den Kopf durch die Zeltlasche und trat dann ein. Er ging immer noch an zwei Krücken. »Die Späher sind zurückgekehrt. Unsere Elitetruppe von Khalidori denkt, sie hätte einen Hinterhalt gelegt. Wenn wir von Norden, Süden oder Westen kommen, müssen wir uns vorher durch dichten Wald schlagen. Der einzige bequeme Weg führt durch den Wald des Jägers. Falls es ihn wirklich gibt, wird er uns vernichten. Wenn ich es mit nur hundert Mann mit einem Gegner zu tun hätte, der vierzehn Mal so viele Leute hat wie ich, könnte ich es vermutlich nicht besser eingerichtet haben.«
Wenn sich diese Situation vor einem Monat ergeben hätte, hätte Logan nicht gezögert. Er hätte seine Armee durch den lichten Wald des Jägers geführt und nichts auf die Legenden gegeben. Aber bei Pavvils Hain hatten sie eine Legende lebendig werden sehen – und sie hatte Tausende verschlungen. Der Ferali hatte Logans Überzeugung, dass er den Unterschied zwischen Aberglauben und Realität kenne, erschüttert. »Sie sind Khalidori. Warum haben sie nicht den Weg nach Norden zu Quorigs Pass eingeschlagen?«
Agon zuckte die Achseln. Dieses Problem beschäftigte sie schon seit einer Woche. Die Einheit, die sie verfolgten, war nicht annähernd so nachlässig wie die Khalidori, die sie bis dahin kennengelernt hatten. Und selbst auf der Flucht vor Logans Truppen hatten sie geplündert und immer wieder angegriffen. Cenaria hatte hundert Männer verloren. Die Khalidori nicht einen einzigen. Die beste Erklärung, die Agon dazu einfiel, war, dass es sich um eine Eliteeinheit irgendeines khalidorischen Stammes handeln musste, dem die Cenarier bisher nicht begegnet waren. Auch Logan stand vor einem Rätsel. Wenn er es nicht löste, würden seine Leute sterben. »Ihr wollt sie immer noch von allen Seiten angreifen?«, fragte Agon.
Das Problem schien Logan voller Hohn anzustarren. Die Antwort fiel ihm schwer. »Ja.«
»Und Ihr besteht weiter darauf, die Reiterei selbst durch den Wald zu führen?«
Logan nickte. Wenn er Männer bitten würde, dem Tod durch irgendein Monster ins Auge zu sehen, würde er selbst es ebenfalls tun.
»Das ist sehr … mutig«, sagte Agon. Er hatte lange genug gedient, um ganze Bände von Vorwürfen in einem Kompliment zu verstecken.
»Genug«, erwiderte Logan und nahm seinen Helm von Kaldrosa entgegen. »Lasst uns ein paar Khalidori töten.«
4
Vürdmeister Neph Dada überließ sich einem tiefen, rasselnden, ungesunden Husten. Dann räusperte er sich lautstark und spie sich das Ergebnis seines Hustens in die Hand. Er drehte die Hand nach unten und sah zu, wie der Schleim in den Schmutz tropfte, bevor er sich den anderen Vürdmeistern zuwandte, die sich um das niedergebrannte Feuer geschart hatten. Abgesehen von dem jungen Borsini, der unablässig blinzelte, ließen sie mit keinem Zeichen erkennen, dass er sie anwiderte. Ein Mann lebte nicht lange genug, um allein aufgrund seiner magischen Stärke Vürdmeister zu werden.
Auf der Erde waren schwach leuchtende Figuren in militärischen Formationen ausgebreitet. »Dies ist nur eine grobe Schätzung der Positionen der Armeen«, sagte Neph. »Logan Gyres Kräfte sind die roten, ungefähr vierzehnhundert Mann westlich vom Wald des Dunklen Jägers auf cenarischem Gebiet. Vielleicht zweihundert Ceuraner, die vorgeben, Khalidori zu sein, sind die blauen und befinden sich direkt am Rand des Waldes. Weiter im Süden in Weiß stehen fünftausend unserer geliebten Feinde, der Lae’knaught. Wir Khalidori haben nicht mehr direkt gegen die Lae’knaught gekämpft, seit ihr alle noch an der Brust hingt, so dass ich euch erinnern darf, dass sie jegliche Magie hassen, aber wir diejenigen sind, die zu vernichten sie geschaffen wurden. Fünftausend von ihnen sind mehr als genug, um das zu vollenden, was die Cenarier in der Schlacht bei Pavvils Hain begonnen haben; wir müssen also Vorsicht walten lassen.«
In einer schnellen Folge von Einzelheiten erklärte Neph, was er über die Aufstellung all dieser Truppen wusste; da, wo es ihm wichtig erschien, erfand er zusätzliche Einzelheiten und sprach stets über die Köpfe der anderen Vürdmeister hinweg, als erwarte er, dass sie die Feinheiten der Feldherrnkunst beherrschten, die sie nie erlernt hatten. Wann immer ein Gottkönig starb, gab es Massaker. Zuerst wandten sich seine Thronerben gegeneinander. Dann sammelten die Überlebenden dieser Kämpfe Meister und Vürdmeister um sich und gingen erneut aufeinander los, bis schließlich nur noch ein einziger Ursuul übrig blieb. Wenn niemand schnell die Vorherrschaft gewann, würde der Aderlass auch die Meister treffen. Neph hatte nicht vor, das zuzulassen.
Also hatte Neph, sobald er sich sicher war, dass Gottkönig Garoth Ursuul tot war, Tenser Ursuul ausfindig gemacht, einen der Thronerben des Gottkönigs, und den Jungen dazu überredet, Khali zu beherbergen. Tenser glaubte, dass es Macht bedeute, die Gottheit zu beherbergen. Das würde es auch – für Neph. Für Tenser bedeutete es Katatonie und Wahnsinn. Als Nächstes hatte Neph eine einfache Nachricht an die Vürdmeister in allen Winkeln des khalidorischen Reiches gerichtet: »Helft mir, Khali heimzubringen.«
Diesem religiösen Aufruf zu folgen, bot jedem Vürdmeister, der sein Leben nicht wegwerfen wollte, um irgendeinem missratenen Kind Ursuuls zu helfen, eine legitime Ausflucht. Und wenn Neph diese ersten Vürdmeister, die von ihren Posten in der Nähe herbeigeeilt waren, zähmen konnte, dann würden auch die Vürdmeister aus entlegeneren Gegenden des Reiches auf seine Linie einschwenken, sobald sie eintrafen. Wenn es eines gab, wofür die Gottkönige gut waren, dann dazu, ihren Untergebenen Gehorsam einzupflanzen.
»Der Wald des Dunklen Jägers liegt zwischen uns«, erklärte Neph den Vürdmeistern und Khalis Leibwache, zusammen nicht mehr als fünfzig Männer, »und all diesen Armeen. Ich persönlich habe miterlebt, dass über hundert Männer – Meister und andere – in den Wald geschickt wurden. Niemand von ihnen ist je wieder herausgekommen. Niemals. Wenn es nur um die Sicherheit Khalis ginge, würde ich euch nicht darauf aufmerksam machen.«
Neph hustete wieder, seine Lunge stand in Flammen, aber das Husten war dennoch wohlberechnet. Diejenigen, die ihr Knie nicht vor einem jungen Mann beugen würden, würden es vielleicht dennoch zufrieden sein, sich einem alten Mann zu unterwerfen, dessen Kräfte schwanden. Er spuckte aus. »Die Ceuraner haben das Schwert der Macht, Curoch. Genau dort«, sagte Neph und deutete dorthin, wo er seinen Schleim hatte fallen lassen, an den Rand des Waldes des Dunklen Jägers.
»Hat das Schwert die Form von Ceur’caelestos angenommen, der Klinge des Himmels der Ceuraner?«, fragte Vürdmeister Borsini. Er war der junge Mann, der ständig blinzelte und eine ebenso grotesk lange Nase hatte wie riesige Ohren. Er hatte den Blick in die Ferne gerichtet. Neph gefiel die Frage nicht. Hatte Borsini gelauscht, als ihm der Späher berichtet hatte?
Borsinis Vir, das Maß der Gnade der Göttin und seiner magischen Macht, füllten seine Arme wie die Stängel von hundert dornigen Rosen. Nur Nephs Vir füllten seine Haut noch mehr aus, wellten sich wie lebendige Tätowierungen in lodricarischen Wirbeln und färbten ihn von der Stirn bis zu den Fingernägeln fast schwarz. Aber trotz seiner Intelligenz und Macht gehörte Borsini erst zur elften Shu’ra. Neph, Taru, Orad und Raalst gehörten zur zwölften Shu’ra, dem höchsten Rang unterhalb des Gottkönigs selbst.
»Curoch nimmt jede Gestalt an, die ihm beliebt«, erklärte Neph. »Der Punkt ist, falls Curoch in den Wald des Jägers gelangt, wird es nie wieder herauskommen. Wir haben eine schwache Chance, einen Preis zu erringen, nach dem es uns von alters her gelüstet.«
»Aber hier stehen drei Heere«, wandte Vürdmeister Tarus ein. »Alle sind uns zahlenmäßig weit überlegen, und jedes von ihnen würde uns gern vernichten.«
»Der Versuch, das Schwert zu erringen, wird mit großer Wahrscheinlichkeit zum Tod führen, aber ich darf euch in Erinnerung rufen«, sagte Neph, »dass wir uns dafür werden verantworten müssen, wenn wir es nicht versucht haben. Daher werde ich gehen. Ich bin alt, ich habe nur noch wenige Jahre zu erwarten, so dass mein Tod das Reich das Geringste kosten wird.« Natürlich würde sich, wenn er Curoch in Händen hielt und seine magische Macht auf das Hundertfache vergrößert sein würde, alles ändern, und sie alle wussten es.
Vürdmeister Tarus war der Erste, der Einwände erhob. »Wer hat Euch damit betraut -«
»Khali hat es«, unterbrach ihn der junge Borsini, bevor Neph dazu Gelegenheit hatte. Verflucht! »Khali hat mir eine Vision zukommen lassen«, fuhr Borsini fort. »Deswegen habe ich gefragt, wie die Ceuraner das Schwert nennen. Khali sagte mir, dass ich Ceur’caelestos holen solle. Ich bin der Jüngste von uns, der, auf den am ehesten verzichtet werden kann, und der Schnellste. Vürdmeister Dada, sie sagte, sie werde an diesem Morgen zu Euch sprechen. Ihr sollt ihr Wort am Bett des Prinzen erwarten. Allein.«
Der Junge war ein Genius. Borsini wollte seine Chance auf das Schwert, und er hatte Neph vor allen anderen den Wind aus den Segeln genommen. Neph würde bei Khali und dem katatonischen Prinzen sein, und wenn er aus dessen Zelt wieder herauskam, dann mit »einem Wort von der Gottheit«. In Wahrheit hatte Neph gar nicht vorgehabt, dem Schwert nachzujagen. Aber die einzige Möglichkeit sicherzugehen, dass die anderen ihn zum Bleiben zwangen, war sein Versuch zu gehen. Borsinis Blick traf den von Neph. Er schien sagen zu wollen: Wenn ich das Schwert hole, dienst du mir, verstanden?
»Gesegnet sei ihr Name«, sagte Neph. Die anderen fielen ein. Sie verstanden nicht ganz, was gerade passiert war. Das würden sie jedoch, wenn die Zeit gekommen war. Neph sagte: »Ihr solltet mein Pferd nehmen; es ist schneller als Eures.« Und er hatte dessen Mähne mit einem kleinen Zauber versehen. Wenn die Sonne aufging – ungefähr zu der Zeit, da ein Reiter den südlichen Rand des Waldes erreicht haben würde – würde der Zauber aktiv werden und vor Magie pulsieren – Magie, die den Dunklen Jäger herbeirufen würde. Borsini würde den Mittag nicht mehr erleben.
»Ich danke Euch, aber ich komme furchtbar schlecht mit einem neuen Pferd zurecht. Ich werde mein eigenes nehmen«, erwiderte Borsini und ließ seine Stimme gleichmütig klingen. Seine gewaltigen Ohren wackelten, und er zupfte nervös an seiner riesigen Nase. Er vermutete eine Falle und wusste, dass er sie vermieden hatte, aber er wollte Neph denken lassen, das sei reines Glück gewesen.
Neph blinzelte, als sei er enttäuscht, und zuckte dann mit den Schultern, als gäbe er sich damit zufrieden und wolle andeuten, dass es ihm gleichgültig sei.
Das war es auch. Er hatte jedes einzelne Pferd im Lager mit diesem Zauber versehen.
5
Kylar hatte noch nie einen Krieg ausgelöst.
Um sich dem lae’knaughtischen Lager zu nähern, brauchte er nichts von der Vorsicht, die er hatte walten lassen müssen, um sich an die Ceuraner anzuschleichen. Er ging einfach unsichtbar an den Wachen in ihren schwarzen, mit goldenen Sonnen verzierten Wappenröcken vorbei: Die Sonne stand als Symbol für das reine Licht der Vernunft, die die Dunkelheit des Aberglaubens durchdrang. Kylar grinste. Die Lae’knaught würden den Nachtengel lieben.
Das Lager war riesig. Es beherbergte eine ganze Legion von fünftausend Soldaten, darunter tausend der berühmten lae’knaughtischen Lanzenreiter. Als eine nur auf ihre Ideologie gegründete Gesellschaft behaupteten die Lae’knaught, keinerlei Anspruch auf Land zu erheben. In Wirklichkeit hielten sie allerdings seit achtzehn Jahren den Osten Cenarias besetzt. Kylar vermutete, dass diese Legion hierhergeschickt worden war, um die Macht der Lae’knaught zu zeigen und die Khalidori davon abzuhalten, weiter nach Osten vorzudringen. Vielleicht war sie aber auch nur zufällig hier.
Das spielte ohnehin keine Rolle. Die Lae’knaught waren Rabauken. Wenn es auch nur einen Funken Wahrhaftigkeit in ihrem Anspruch gegeben hätte, gegen die schwarze Magie zu kämpfen, hätten sie Cenaria zu Hilfe kommen müssen, als die Khalidori ihre Invasion begannen. Stattdessen hatten sie gewartet, bis ihre Zeit gekommen war, hatten hier und dort »Hexer« und »Hexen« verbrannt und unter den cenarischen Flüchtlingen ihre Ideologie verbreitet. Vermutlich hofften sie, zu Hilfe eilen zu können, wenn Cenarias Macht erst ausgelöscht war und sie sich noch mehr Land für ihre Mühe nehmen konnten.
Ohne irgendeinen seiner Nachbarn herausgefordert zu haben, war Cenaria von Osten her von den Lae’knaught, von Norden her von Khalidor und jetzt von Süden von Ceura angegriffen worden. Es wurde Zeit, dass einige dieser hungrigen Schwerter aufeinandertrafen.
Eine rauchende schwarze Klinge glitt aus Kylars linker Hand. Er ließ sie erglühen, hüllte sie in blaue Flammen, blieb aber selbst unsichtbar. Zwei Soldaten, die miteinander plauderten, statt Patrouille zu gehen, versteiften sich bei diesem Anblick. Der erste war relativ unschuldig. In den Augen des anderen sah Kylar, dass der Mann einen Müller der Hexerei bezichtigt hatte, weil er dessen Frau begehrte.
»Mörder«, sagte Kylar. Er führte einen Hieb mit dem Ka’kari-Schwert. Die Klinge schnitt weniger, als dass sie verzehrte. Es war kaum Widerstand zu spüren, als die Klinge durch das Nasal, die Nase, das Kinn, den Wappenrock, den Gammbeson und den Bauch des Mannes fuhr. Der Mann blickte an sich herab, berührte dann sein zweigeteiltes Gesicht, aus dem das Blut strömte. Er schrie, und seine Eingeweide ergossen sich aus seinem Bauch.
Die andere Wache rannte schreiend davon.
Kylar lief los und ließ sich von Illusionen umspielen. Wie durch Rauch sah man funkelnd irisierende, schwarze metallische Haut aufglänzen, die Bögen einer übertrieben starken Muskulatur, ein Gesicht wie das Strafgericht selbst, mit markanten Augenbrauen, gerunzelter Stirn, hohen Wangenknochen, einem kleinen Mund und pechschwarzen, glänzenden, pupillenlosen Augen, aus denen blaue Flammen schossen. Er lief an einem Haufen hagerer, cenarischer Rekruten vorbei, deren Augen sich bei seinem Anblick weiteten und die die Waffen in ihren Händen vergaßen. In ihren Augen las er keine Verbrechen. Diese Männer waren der lae’knaughtischen Legion beigetreten, weil sie keine andere Möglichkeit sahen, nicht zu verhungern.
Die nächste Gruppe hatte an Hunderten von Mordbrennereien und Schlimmerem teilgenommen. »Vergewaltiger!«, rief Kylar. Er schnitt dem Mann mit dem Ka’kari-Schwert durch die Lenden. Es würde ein furchtbarer Tod sein. Drei weitere Männer starben, bevor ihn irgendjemand angriff. Er tanzte an einem Speer vorbei und schlug dessen Spitze ab, bevor er weiter zu den mitten im Lager aufgebauten Zelten der Offiziere rannte.
Schließlich blies eine Trompete ein Alarmsignal. Kylar setzte seinen Weg durch die Zeltreihen fort, wurde manchmal unsichtbar, trat aber jedes Mal in Erscheinung, bevor er tötete. Er schnitt einige der Pferde los, um Verwirrung zu stiften, aber nicht viele. Er wollte, dass diese Armee zu einer schnellen Reaktion in der Lage blieb.
Binnen Minuten herrschte im gesamten Lager ein riesiger Tumult. Ein Pferdegespann, an dem noch der Pfosten hing, an dem es festgemacht worden war, ging durch, der Pfosten schwang vor und zurück, schlug in Zelte ein und riss sie weg. Männer schrien alle möglichen Obszönitäten, riefen etwas von einem Geist, einem Dämon, einem Phantasma. Einige griffen in der Dunkelheit und dem Chaos einander an. Ein Zelt ging in Flammen auf. Wo immer ein Offizier erschien, Befehle brüllte und Ordnung zu schaffen versuchte, tötete Kylar. Schließlich fand er, wonach er gesucht hatte.
Ein älterer Mann stürmte aus einem der größten Zelte des Lagers hervor. Er setzte sich einen großen Helm auf den Kopf, das Symbol eines lae’knaughtischen Lordleutnants, eines Generals. »Formiert euch! Igel!«, rief er. »Ihr Dummköpfe, ihr werdet betrogen! Formation Igel, verflucht!«
In dem wüsten Durcheinander und da seine Stimme durch den großen Helm gedämpft war, hörten anfangs nur wenige auf ihn, aber ein Trompeter blies das Signal für die Formation wieder und wieder. Kylar sah, dass die ersten Männer sich zu lockeren Kreisen zusammenfanden, jeweils zehn Mann mit dem Rücken zueinander, die Lanzen nach außen gerichtet.
»Ihr kämpft nur gegen euch selbst. Es ist eine Täuschung. Denkt an eure Rüstung!« Der Lordleutnant meinte damit die Rüstung des Unglaubens. Die Lae’knaught glaubten, dass Aberglaube nur dann eine Wirkung entfalten könne, wenn man an ihn glaubte.
Kylar sprang hoch in die Luft und ließ sich sichtbar werden, während er vor dem Lordleutnant wieder zu Boden sank. Er landete auf einem Knie, die linke Hand am Boden, die auch das Schwert hielt, den Kopf gesenkt. Obwohl im weiteren Umkreis der Lärm ungezügelt weiterging, verstummten die Männer in der Nähe vor Staunen. »Lordleutnant«, sagte der Nachtengel, »für Euch habe ich eine Nachricht.« Er erhob sich.
»Es ist nichts als eine Erscheinung«, tat der Lordleutnant kund. »Sammelt euch! Adler drei!« Der Trompeter blies die Signale, und die Soldaten begannen, auf ihre Positionen zu eilen.
Über hundert Mann hatten sich inzwischen auf dem freien Feld vor dem Zelt des Lordleutnants versammelt und bildeten einen großen Kreis um ihn, die Speere jetzt einwärts gerichtet. Der Nachtengel ließ ein Brüllen vernehmen und blaue Flammen aus Mund und Augen schlagen. Auch in das Schwert flossen jetzt die Flammen. Er peitschte die Klinge in so schnellen Kreisen durch die Luft, dass sie zu langen Lichtschweifen verschwamm. Dann schob er sie mit einem weiteren Lichtausbruch in ihre Scheide zurück und überließ es den Soldaten, mit den Nachbildern dieser Vorführung fertig zu werden.
»Ihr lae’knaughtischen Dummköpfe«, sagte der Nachtengel. »Dieses Land gehört jetzt Khalidor. Flieht oder lasst euch abschlachten. Flieht oder stellt euch eurem Strafgericht.« Indem er sich als Khalidori ausgab, hoffte Kylar, jedwede Vergeltung auf die als Khalidori verkleideten Ceuraner zu lenken, die Logan und seine Männer in eine Falle zu locken versuchten.
Der Lordleutnant blinzelte. Dann rief er: »Täuschungen haben keine Macht über uns! Denkt an eure Rüstung, Männer!«
Kylar ließ die Flammen schwächer werden, als sei der Nachtengel nicht in der Lage, ohne den Glauben der Lae’knaught an das, was sie sahen, seine Gestalt beizubehalten. Er schien immer weiter zu verschwinden, bis nur noch sein Schwert sichtbar war, das sich langsam bewegte.
»Es kann uns nichts anhaben«, erklärte der Lordleutnant seinen Hunderten von Soldaten, die sich inzwischen am Rand des Platzes versammelt hatten. »Das Licht ist unser! Wir fürchten die Dunkelheit nicht.«
»Ich richte Euch!«, sagte der Nachtengel. »Ich finde Fehl an Euch!« Er verblasste völlig, verschwand und sah die Erleichterung in den Augen der Männer ringsum; einige Männer und Frauen grinsten sogar und schüttelten sich im Gefühl des Sieges die Hände.
Der Lordleutnant ließ sich von seinem Adjutanten sein Pferd bringen und Zügel und Lanze übergeben. Er saß auf, ganz nach der Manier eines Mannes, der wusste, dass er jetzt Befehle erteilen, die Kontrolle wiederherstellen und die Männer dazu bringen musste, etwas zu tun, damit sie nicht nachdachten, damit sie nicht in Panik gerieten. Kylar wartete, bis der Lordleutnant den Mund öffnete, und brüllte dann so laut, dass er die Stimme des Mannes übertönte.
»Mörder!« Die Wölbungen des Bizeps und knotiger Schultermuskeln sowie glühende Augen waren alles, was von ihm erschien, gefolgt vom Zischen einer Flamme, als das kreisende Schwert wieder sichtbar wurde. Ein Soldat fiel zu Boden. Als der Kopf von seinem Körper fortrollte, war der Nachtengel bereits an anderer Stelle.
Niemand bewegte sich. Es durfte nicht sein. Eine Erscheinung war das Resultat einer Massenhysterie. Sie hatte keinen Körper.
»Sklavenhändler.« Diesmal erschien das Schwert erst, als es aus dem Rücken des Soldaten wieder hervortrat. Der Mann wurde von dem Schwert hochgehoben und der Länge nach in ein Gusseisenbecken mit glühenden Kohlen geworfen. Er bäumte sich auf, krümmte sich, sein Fleisch brutzelte auf den Kohlen, aber er rollte nicht weg.
»Folterer!« Die ersten Soldaten mit schwächerem Magen übergaben sich.
»Unrein! Unrein!«, schrie der Nachtengel, dessen ganze Gestalt jetzt glühte. Er teilte zur Linken und zur Rechten Tod aus.
»Tötet es!«, schrie der Lordleutnant.
In blaue Flammen gehüllt, die in langen Fahnen knisternd hinter ihm herzogen, war Kylar bereits aus dem großen Kreis herausgesprungen. Sichtbar und brennend lief er direkt nach Norden, als ob er zurück zum Lager der »Khalidori« wollte. Die Männer sprangen ihm aus dem Weg. Dann ließ Kylar die Flammen erlöschen, wurde unsichtbar und kam zurück, um zu sehen, ob sein Köder geschluckt worden war.
»Formiert euch!«, brüllte der Lordleutnant mit vor Zorn purpurfarbenem Gesicht. »Wir marschieren zum Wald! Es wird Zeit, dass wir einige dieser Hexer töten, Männer! Vorwärts!«
6
»Eunuchen nach links«, sagte Rugger, der khalidorische Wachmann. Er war so muskulös, dass er einem Sack voller Nüsse ähnelte, aber den bemerkenswertesten Knoten, eine Art Grützbeutel, trug er auf der Stirn. »He, Halbmann! Damit bist du gemeint!«
Dorian schlurfte zur linken Reihe hinüber und löste den Blick von der Wache. Er kannte den Mann: ein Bastard, den irgendein Sklavenmädchen einem von Dorians älteren Brüdern geworfen hatte. Die Edelinge, die thronwerten Söhne des Gottkönigs, hatten Rugger unbarmherzig gequält. Dorians Lehrer, Neph Dada, hatte sie darin ermutigt. Es gab nur eine Einschränkung: Sie durften keinen Sklaven so sehr verletzen, dass er seine Pflicht nicht mehr erfüllen konnte. Ruggers Grützbeutel auf der Stirn war das Werk des kleinen Dorian gewesen.
»Was starrst du so? Gibt es etwas Besonderes zu sehen?«, verlangte Rugger zu wissen und stach Dorian ein wenig mit seinem Speer.
Dorian blickte entschlossen zu Boden und schüttelte den Kopf. Er hatte seine äußere Erscheinung so sehr verändert, wie er es wagen konnte, bevor er sich in der Zitadelle um Arbeit bewarb. Er durfte die Illusion nicht zu weit treiben, denn dann würde er regelmäßig geschlagen werden. Ganz gleich, ob Wache, Adliger oder Edeling, sie alle würden es merken, wenn ihr Schlag nicht den gewohnten Widerstand fand oder wenn Dorian sich nicht entsprechend der Schwere der Züchtigung krümmte. Er hatte auch mit einer Änderung des Gleichgewichts seiner Körpersäfte experimentiert, um das Wachstum seiner Körper- und Gesichtsbehaarung zu unterbinden, aber die Ergebnisse waren schrecklich gewesen. Beim bloßen Gedanken daran fuhr er sich mit der Hand über die Brust – die jetzt dankenswerterweise wieder männliche Proportionen aufwies.
Stattdessen hatte er dann so lange geübt, bis er seinen Körper mit Hilfe von Feuer und Luft von allen Haaren befreien konnte. Bei der Geschwindigkeit, mit der sein Barthaar wuchs, würde er diesen Zauber zweimal pro Tag anwenden müssen. Zum Leben eines Sklaven gehörte nur wenig Privatsphäre, daher war es wesentlich, dass er sich dieser Aufgabe schnell entledigen konnte. Glücklicherweise wurden Sklaven aber auch kaum wahrgenommen – solange sie nicht selbst die Aufmerksamkeit auf sich zogen, indem sie eine Wache anstarrten, als sei sie ein Weltwunder.
Geh gebeugt oder stirb, Dorian. Rugger stach ihn noch einmal, aber Dorian ließ keine Reaktion erkennen, so dass Rugger schließlich seinen Weg die Reihe entlang fortsetzte, um andere zu peinigen.
Sie standen, zweihundert Männer und Frauen, am Westtor des Brückenturms. Der Winter rückte näher, und selbst diejenigen, die gute Ernten gehabt hatten, waren von den Armeen des Gottkönigs an den Bettelstab gebracht worden. Für das einfache Volk spielte es kaum eine Rolle, ob eine durchziehende Armee feindlich oder freundlich war. Bei beiden lief es darauf hinaus, dass sie sich nahmen, was sie wollten, und jeden umbrachten, der sie daran zu hindern versuchte. Nachdem der Gottkönig die Zitadelle weitgehend geleert hatte, um Armeen sowohl nach Süden – nach Cenaria – als auch nach Norden – in den Frost – zu senden, würde der Winter besonders hart sein. Die Leute, die in einer Reihe dastanden, hofften allesamt, sich in die Sklaverei verkaufen zu können, bevor sich die Reihen der Hilfesuchenden mit dem Wintereinbruch vervielfachten.
Es war eine klare, eisige Nacht in der Stadt Khaliras; erst in zwei Stunden würde der Tag dämmern. Dorian hatte ganz vergessen, wie herrlich der Anblick des nördlichen Sternenhimmels war. In der Stadt brannten nur wenige Lichter – Öl war kostbar -, so dass die Sterne ihren prächtigen Glanz umso besser zeigen konnten.
Ohne es zu wollen, empfand Dorian so etwas wie Stolz, als er über die Stadt blickte, die seine hätte sein können. Khaliras zog sich in einem gewaltigen Ring um den Abgrund, der den Sklavenberg umgab. Aufeinanderfolgende Generationen von Gottkönigen aus dem Geschlecht der Ursuuls hatten die Stadt mit halbkreisförmigen Mauern befestigt – um ihre Sklaven, Handwerker und Händler zu schützen -, bis all diese Halbkreise aus verschiedenen Steinen schließlich einen Ring um die ganze Stadt gebildet hatten.
Es gab nur eine Erhebung, einen schmalen granitenen Grat, den sich die Hauptstraße in Serpentinen hinaufwand, die dazu berechnet waren, den Einsatz von Belagerungsmaschinen zu erschweren. Oben auf diesem Grat thronte der Torturm wie eine Kröte auf ihrem Baumstumpf. Und unmittelbar hinter den rostigen, eisernen Zähnen des Fallgitters des Turmtors lag Dorians erste große Herausforderung.
»Ihr vier, marsch«, sagte Rugger.
Dorian war der dritte von vier Eunuchen, die allesamt zitterten, während sie die letzten Schritte gingen. Die Lichtbrücke war eines der Weltwunder, und auf all seinen Reisen hatte Dorian keine Magie gesehen, die der dieser Brücke gleichgekommen wäre. Ohne Brückenbögen, ohne Pfeiler hing die Brücke wie der Aufhängefaden für ein Spinnennetz über dem Abgrund und überspannte eine Entfernung von vierhundert Schritt zwischen dem Torturm und der Zitadelle des Sklavenbergs.
Bei seiner letzten Überquerung der Lichtbrücke hatte Dorian nur Augen für die Brillanz dieser Magie gehabt, die unter seinen Füßen sprühte und federte und bei jedem Schritt in tausenden Farben funkelte. Jetzt sah er nichts als die Bausteine, in denen die Magie verankert war. Das gelbliche Material, aus dem die Lichtbrücke bestand, war kein Stein, es war kein Metall oder Holz; sie bestand vielmehr aus einem Pfad menschlicher Schädel, einem Pfad, der breit genug war, dass auf ihm drei Pferde nebeneinandergehen konnten. Neue Schädel waren hinzugefügt worden, wo sich im Laufe des Jahres Löcher gebildet hatten. Jeder Vürdmeister, wie die Meister der Vir genannten wurden, nachdem sie in die zehnte Shu’ra gelangten, konnte die ganze Brücke mit einem einzigen Wort zerstören. Dorian selbst kannte den Spruch, was immer ihm das jetzt nützen mochte. Was ihm im Moment zu schaffen machte und einen Knoten in seine Eingeweide zu binden schien, war allerdings die Tatsache, dass die Magie der Lichtbrücke jeden Magus – der sich nur seiner magischen Begabung bediente – in die Tiefe werfen würde. Die Meister und Vürdmeister dagegen, die ihre Magie aus den abscheulichen Vir bezogen, konnten sie ungehindert passieren.
Als vermutlich einzige Person in Midcyru, die sowohl als Meister als auch als Magus ausgebildet war, glaubte Dorian, eine bessere Chance zu haben, es über die Brücke zu schaffen, als jeder andere Magus. Er hatte sich am letzten Abend neue Schuhe gekauft und eine Bleiplatte in die Sohlen geschoben. Er vermutete, dass er damit alle Spuren südlicher Magie, die ihm noch anhaften mochten, für die Magie der Brücke unkenntlich gemacht hatte. Unglücklicherweise gab es nur eine einzige Möglichkeit herauszufinden, ob er damit richtig lag.
Mit Herzklopfen folgte Dorian den Eunuchen auf die Lichtbrücke. Bei seinem ersten Schritt flackerte die Brücke in einem unheimlichen Grün, und Dorian spürte ein Kribbeln an den Füßen, als die Vir um seine Schuhe herumgriffen. Einen Augenblick später hatte beides aufgehört, ohne dass es jemand bemerkt hatte. Dorian hatte es geschafft. Die Lichtbrücke spürte, dass er die magische Begabung eines südlichen Magiers besaß, aber Dorians Vorfahren waren klug genug gewesen zu wissen, dass nicht jede magisch begabte Person auch ein Magus war. Die folgenden Schritte Dorians – er schlurfte wie die anderen ängstlichen Eunuchen – schienen Funken aus der Magie zu schlagen, während die Totenschädel, über die sie hinwegschritten, sie hasserfüllt aus leeren Augenhöhlen anstarrten. Aber sie gaben nicht nach, und sie ließen ihn nicht in die Tiefe fallen.
Wenn Dorian noch einigen Stolz empfunden hatte angesichts des Zauberwerks der Lichtbrücke, dann empfand er beim Anblick des Sklavenbergs nur Furcht. Er war in den Eingeweiden dieses verfluchten Felsens geboren worden, hatte in seinen Kerkern geschmachtet, hatte in seinen Gruben gekämpft, in seinen Schlafgemächern, Küchen und Hallen gemordet.
In diesem Berg würde Dorian seine Vürd finden, sein Schicksal, das, was ihm gegeben war, seine Vollendung. Er würde auch die Frau finden, die er zu seiner Gemahlin machen würde. Und, so fürchtete er, er würde herausfinden, warum er seine Gabe der Prophezeiung weggeworfen hatte. Was war so furchtbar, dass er deren bloße Voraussicht unerträglich gefunden hatte?
Der Sklavenberg war eine künstliche Anlage: eine gewaltige vierseitige, schwarze Pyramide, die doppelt so hoch war, als ihre Basis in der Breite maß, und sich tief in die Erde hinein fortsetzte. Von der Lichtbrücke aus blickte Dorian hinab auf die Wolken, die tief unter ihm verdeckten, was immer dort liegen mochte. Dreißig Generationen von Sklaven, sowohl Khalidori als auch Kriegsgefangene, waren in diese Tiefe geschickt worden und hatten dort gegraben, bis sie in den übelriechenden Miasmen ihren letzten Atemzug getan hatten und ihre Knochen sich mit dem Erz des Berges vermählten.
Die Pyramide war von oben nach unten zwischen zwei gegenüberliegenden Kanten glatt abgehauen worden, so dass die stehen gebliebene Hälfte einen großen dreiseitigen Dolch von einem Berg ergab, vor dessen Grund sich eine ebene Fläche befand. Auf dieser Fläche hatte einst die abgetragene Hälfte der Pyramide gestanden, und jetzt erhob sich darauf die Zitadelle. Sie wurde durch den riesigen Berg hinter ihr weit überragt, aber je näher man ihr kam, desto deutlicher wurde, dass auch sie eine ganze Stadt für sich war. Auf ihrem Gelände befanden sich Kasernen für zehntausend Soldaten, große Lagergebäude, gewaltige Brunnen, Trainingsgründe für Männer, Pferde und Wölfe, Waffenkammern, ein Dutzend Schmieden, Küchen, Ställe, Scheunen, Pferche für Vieh, Holzlager und Raum genug für all die Arbeiter, Geräte und Materialien, die zwanzigtausend Menschen benötigten, um ein Jahr unter Belagerung standzuhalten. Allerdings wurde die Zitadelle noch in den Schatten gestellt durch das Schloss, das der Sklavenberg in Wahrheit war. Denn der Berg war ausgehöhlt und gefüllt mit Hallen, großen Sälen, Gemächern und Kerkern, Durchgängen und anderen Quartieren, die sich bis weit in die Tiefe erstreckten.
Seit Jahrzehnten waren weder die Zitadelle noch der Berg selbst voll besetzt gewesen, und jetzt, da die Armeen Khalidors im Norden und im Süden standen, war es dort noch ruhiger als gewöhnlich. Nur wenige waren in Khaliras verblieben, lediglich eine Stammbesatzung von Soldaten, weniger als die Hälfte der Meister, über die das Königreich verfügte, gerade genug Beamte, um die reduzierten Aktivitäten des Reichs in Gang zu halten, die Edelinge, die Ehefrauen und Konkubinen des Gottkönigs und deren Hüter.